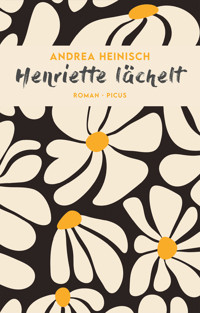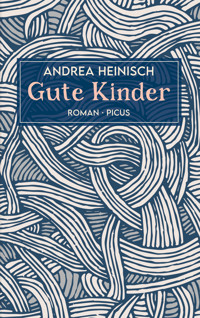
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Inge ihre Wohnung in Brand setzt, muss ihre Tochter Helene reagieren und quartiert sie in einem Pflegeheim ein. Weder Helene noch Inge selbst wissen allerdings, was eigentlich los ist: Wird die Mutter dement oder ist es bloß Widerstand gegen die Zumutungen des Lebens? Ihr Pfleger Manfred, den alle nur Manni nennen, ein Zivildiener, schreibt ihre Erinnerungen ordentlich in ein Heft: Inge erinnert sich an ihre Arbeit im Import-Export, an ihren Vorgesetzten, der ihr eine Zeit lang mehr war als nur Chef. Sie erinnert sich an ihre Kinder: die Tochter, die sie in einer Tour anlügt, und an ihren Sohn, der alles wieder gutmachen kann. Und Manni löst noch etwas aus: ein schwebendes Gefühl des Verliebtseins, von dem Inge nie gedacht hätte, dass sie ihm noch einmal begegnen würde. Und auch Manni ist gern bei Inge, so gern, dass er sogar nach dem Ende seines Zivildiensts regelmäßig zu Besuch kommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Copyright © 2024 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © Juliia Tochilina/iStockphoto
ISBN 978-3-7117-2150-1
eISBN 978-3-7117-5518-6
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
ANDREA HEINISCH
Gute Kinder
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Die Stille sitzt in jedem Handgriff. Wartet am Ende jedes Augenblicks, holt mich hinterrücks ein, wenn ich in ein Zimmer gehe. Wartet dort auf mich. Sperrt mir die Türen vor der Nase zu, biegt sich weg unter meinem Atem. Hält mich gefangen ohne Aussicht auf Besserung. Gut so. Nichts ist schlimmer als die Aussicht auf Besserung. Nichts ist grausamer als die Hoffnung. Ich habe meine Wohnung angezündet, damit sich das mit der Hoffnung ein für alle Mal erledigt.
Sie denken, dass es ein Versehen war. Weil ich vergesslich bin. Weil ich die Pfanne mit dem heißen Fett auf dem offenen Herd stehen hatte und dann einfach aus der Küche gegangen bin. Da war es dann endlich zu spät für alles, was es auch vorher schon war, aber das weiß niemand. Nur ich und deshalb habe ich es auch nicht gerochen, als das Fett // brandig stinkend // Feuer fing. Ich habe nur etwas gehört. Jemand hat sich in meinem Wohnzimmer zu schaffen gemacht, er hat sich wie Herbert angehört. Erkannt habe ich ihn an seinem Husten und dann hat es geläutet. Vielleicht war das mit dem Läuten aber auch später. Ja, ich weiß, dass ich vergesslich geworden bin, und ich weiß, was das bedeutet. Ich bin niemandem böse.
Tatsache ist: Ich habe verloren, obwohl ich nicht mitgespielt habe, deshalb habe ich meine Wohnung abgefackelt und jetzt bin ich dort, wo man das Vorher an der Tür abgibt wie altes Gewand, das einem beim besten Willen nicht mehr passt und nie wieder passen wird. Ich bin dort, wo es nur noch das Nachher gibt. So ist das jetzt.
1
Der junge Mann, den sie mir zugeteilt haben, isst am liebsten Palatschinken, sagt er, aber er kann sie nicht zubereiten. Sicher ist er ein Zivildiener, zumindest schaut er so aus. Ich erkläre ihm, dass man da nur Ei, Milch, Mehl und eine Messerspitze Salz zusammenrühren muss. Ein Kinderspiel, sage ich, um ihm Mut zu machen. Ich habe das tausendmal hinter mir. Einkippen, warten, hochwerfen. Er schaut so skeptisch. Ganz sicher ist er ein Zivildiener, er ist so jung, kaum aus der Schule heraußen, das nutze ich aus, schaue ihm unschuldig wie der junge Frühling mit meinen alten Augen ins Gesicht, damit er Zutrauen fasst (Hab keine Angst, wir zwei schaffen das!), und er fällt drauf herein.
Er wird es schwer haben, das sehe ich jetzt schon. Vorausschauen geht noch, es ist nur die Vergangenheit, die tot ist wie ein Steinfeld, wie eine Geröllhalde soll sie tot und tot und noch einmal tot und vergessen sein und keiner schlägt Haken in den Grund, der doch sowieso immerzu rutscht. Was jeder weiß, nur mein kleiner Zivildiener nicht, denn der hat Herzen in den Augen. Solche, die sich nach innen bohren wie Spulwürmer. Oder eben: Haken. Nein, mein Schatz, du wirst es hier nicht lang machen. Wäre Helene jünger, würde ich sie ihm vorstellen. Sie würden zusammenpassen.
Wie mir das Kind, Helene, erzählt, dass sie eine Schlangenhaut gefunden und in eine Schachtel gesteckt hat. Sie wird die Haut in die Schule tragen, sagt sie. Sie wird nach Hause kommen, erinnere ich mich, und erzählen, dass alle in der Klasse die Schlangenhaut sehen wollten. Das war schön, wird sie sagen und ich werde am Herd stehen und in die Pfanne schauen, damit sie mein Gesicht nicht sehen kann. Sie ist so ein sensibles Kind. Weint sich schon wegen der kleinsten Ermahnung die Augen aus. Braucht viel Zuwendung. Dauernd muss man mit ihr reden, ihr gut zureden, ihr über den Kopf fahren und sagen: Es wird schon wieder. Ein anstrengendes Kind. Hat die Schlangenhaut in der Schule vergessen und dann behauptet, dass sie nie eine gehabt hat. Ich muss sie dazu bringen, dass sie das mit dem Lügen endlich aufgibt. Kein Wunder, dass niemand sie mag, wenn sie andauernd lügt.
Das ist Helene und nicht diese Person, die hoch wie ein Baum vor mir steht, auch wenn. Auch wenn es da eine Erinnerung gibt, ganz weit hinten liegt sie. Hinter den Augäpfeln regt sie sich und kratzt an der Netzhaut, als ob sie um Einlass betteln würde wie ein fremder Hund.
Nein, sage ich. Du bist nicht meins! und: Reiß dich doch zusammen, was ist mit deiner Würde! und: Wozu glaubst du, dass so eine Netzhaut da ist? Bleib, wo du bist.
Ja, wenn es Spuren, wenn es Elemente gäbe, die ich bergen könnte, aber da regt sich nichts, nur dieses stumme Kratzen. Es tut mir leid, Madame. Sie müssen schon von sich heraus wer sein, ich kann jetzt niemanden erkennen, ich muss erst Zeit gewinnen.
Die Frau, die immer wieder sagt: Ich bin’s, Helene, und jedes Mal redet sie noch lauter, als ob ich schwerhörig wäre, wie ein Nervenbündel, hochgebündelt wie Heu zum Trocknen, früher, steht sie vor mir. Ich lächle einfach weiter, obwohl mein Trommelfell direkt vibriert, so schrecklich laut ist ihre Stimme. Kann sie bitte jemand abdrehen. Ich lächle so nichtssagend, wie ich es nur kann.
Sie deutet auf die Kinder, die neben ihr stehen und mich anstarren wie ein Weltwunder. Wo kommen die vielen Kinder auf einmal her? War da zuvor nicht nur ein einziges Kind? Höchstens noch ein zweites, das sich vielleicht irgendwo versteckt und gewartet hat, dass man es sucht. Wie das Kinder so gern tun, meine Helene hat das bei jeder Gelegenheit gemacht. Meistens, nein, immer ist sie unter dem untersten Regalbrett, ganz hinten in der Besenkammer gehockt. Von oben bis unten war sie staubig, wenn sie hervorgekrochen ist. Ich hob sie in die Höhe und blies ihr den Staub aus den Haaren. Geweint hat sie, wenn ich sie zu früh, wenn ich sie zu spät, wenn ich sie nicht gefunden habe. Die Frau sagt ein paar Namen und redet dann irgendetwas vor sich hin, ich lächle nach wie vor unverbindlich, ohne Inhalt lächle ich, aber ich bleibe freundlich, obwohl es immer mehr Kinder sind, die um den Tisch laufen, die an der Balkontür stehen, die am Verschluss rütteln. Zwischen Bad und Zimmer laufen sie hin und her, johlend, vermehren sich aus dem Stand, wie Karnickel sind es mit jedem Mal Hinschauen mehr, ich versuche sie zu zählen, um wenigstens den Überblick zu behalten, aber diese Frau unterbricht mich andauernd, sie greift sogar ein paarmal nach meiner Hand – Darf man das überhaupt? –, so komme ich über zwei nicht hinaus. Ich höre auf zu lächeln. Besser, ich konzentriere mich. Ich setze erneut an: Eins, zwei …, da ruft sie so laut, dass es jeden Gedanken übertönt: Mama! Erkennst du mich nicht?
Jetzt aber. Jetzt aber verliere ich die Beherrschung. Ich lache schallend, ich kann gar nicht mehr aufhören. Mutter! Ich! Gute Frau, sage ich, als ich wieder sprechen kann. Um eine Tochter zu haben, müsste ich aber gut und gerne dreißig Jahre älter sein!
Damit habe ich sie erwischt. Entlarvt. Sie weiß das auch, ich sehe es an ihrem Blick. Als sie endlich mitsamt den Kindern Richtung Tür verschwindet, bin ich wieder ganz Contenance, bin ich von ausgesuchter Höflichkeit, wie ich es beim Import-Export gelernt habe. Es wird schon wieder, sage ich und: Ich wünsche Ihnen und Ihren entzückenden Kleinen noch einen schönen Tag. Ich weiß, dass sie jetzt quer über den Gang und in den anderen Trakt hinübergeht. Wo die schweren Fälle hingehören. Mir geht es noch gut. Nur die Unordnung im Kopf nimmt zu.
2
Ob ich geschrien habe? Ein Widerhall hängt mir im Ohr, aber ich weiß nicht, woher er kommt. Aus dem Bad? Vom Gang? Haben die Verrückten wieder einmal Ausgang? Ich habe Angst, dass sie mir ins Zimmer kommen. Vor diesen Verrückten habe ich die größte Angst, sie sind ja vollkommen unberechenbar. Kommen herein und greifen alle meine Sachen an. Schütten Eimer voll Wasser auf meinen Boden, lassen mich im aufsteigenden Nebel zurück (Schau selbst, wie du nach Hause kommst!), schieben meine Sachen herum, meine Schuhe, das Handy, meine Wäsche, meine Hefte, das Schreibzeug und immer wieder: mein Feuerzeug (Jetzt ist auch noch mein Feuerzeug verschwunden, ich brauche es doch für Herbert! Bringt es endlich zurück!), heben alles hoch, lassen es fallen, lassen es verschwinden. Vor meinen Augen. Vollkommen schamlos. Ohne jede Erziehung. Ich sollte aufstehen und meinen Schmuck in Sicherheit bringen. – Was für einen Schmuck? Ist er nicht zurückgeblieben, dem Feuer zum Opfer gefallen, hat es geheißen.
Die Füße sind angeschwollen wie die Beine auch – vom Knie abwärts ist alles pralles Rot. Erdbeerrot. Wenn ich aufstehe, zerplatzen die Füße. Feuerrot. Wenn ich sie auf den Boden setze, zerreißen sie wie Luftballons in tausend Fetzen und das mit einem Tusch, blutrot, dass die Bilder an der Wand zu fliehen beginnen, als ob jemand ein Erdbeben losgetreten hätte. Nicht wandern sie vielleicht von oben nach unten, nein, von links nach rechts und von rechts nach links wandern sie und die Stille, die sich, das Tageslicht scheuend, hinter die Bilder gequetscht hat, rutscht hervor. Sie fällt mir ins Zimmer und breitet sich aus. Dünn, so gut wie fast noch gar nicht da ist sie, wie der erste Herbstnebel ist sie. Ich mag das. So zart. So schön ist es anzusehen, wie die kleinen Tränen in ihm hängen. Unsichtbar wie alles, das einen Wert hat. Noch niemand hat diese so jungen Tränen geweint. (Erst wenn die Erde bebt von links nach rechts und von rechts nach links, dann weine ich um Helene. Was vorher war? Ich weiß es nicht.) Ich muss nur zugreifen, dann kann ich die Tränen pflücken und sie im Mund zerplatzen lassen wie Weintrauben, die ich an den Gaumen presse.
Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ich muss mit Herbert reden. Er muss etwas unternehmen. Es geht nicht an, dass sie so ekelhaft zu Helene sind. Sie kann doch nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Und ich bin doch den ganzen Tag im Büro. Wo ist Helene überhaupt? Warum besucht sie mich nicht? Seit ich umgezogen bin, war sie noch kein einziges Mal da. Sie sollte sich ein Beispiel an ihrem Bruder nehmen. Der kommt jeden Tag. Manchmal schreie ich vor Glück, wenn er bei der Tür hereinkommt, aber ich schreie nur in mich hinein. Niemand soll mich hören, die hängen einem hier sofort eine Diagnose an, nur weil man glücklich ist. Das vertragen die hier nicht. Das geht denen hier gegen den Strich. Da liegen dann gleich ein paar mehr Tabletten auf meinem Tisch. Manchmal tue ich ihnen den Gefallen und raste aus. Da nehme ich meine ganze Energie zusammen und fege mit einer schnellen Bewegung die Tabletten vom Tisch. Manchmal geht das Wasserglas mit, das gibt vielleicht einen Krach. Scherben bringen Glück. Ich schaue mich um. Nirgends Glassplitter. Keine Tabletten auf dem Boden. Die habe ich alle schon geschluckt. Das war ein Fehler. Ich muss mit Herbert reden, dass er mit dem Oberarzt redet. Bitte nur mit dem Oberarzt und nicht mit irgendeiner dieser Praktikantinnen, die sie mir als Ärztinnen unterschieben wollen. Junges, unerfahrenes Gemüse, besonders die eine. Das wird man mir doch wenigstens zubilligen. Wofür habe ich seit Jahrzehnten eine Privatversicherung. So kann das nicht weitergehen. Ich brauche meine Ruhe. Die müssen wenigstens dafür sorgen, dass die Verrückten in ihren Zimmern bleiben.
3
Es gibt gute und schlechte Tage. Heute ist ein guter Tag. Ich stehe auf, alles ist da und hat einen Namen. Auch ich.
Guten Morgen, Frau Heiligstetter, sagt der nette junge Mann, ein Zivildiener wahrscheinlich. Wie war die Nacht?
Und ich sage: Ganz wunderbar. Ich habe geschlafen wie in Abrahams Schoß.
Der junge Mann, Manfred heißt er, kennt Abrahams Schoß nicht. Er kennt viel nicht. Hoffentlich habe ich noch genug Zeit. Die guten Tage werden immer weniger, sie sind schon zu Stunden geschrumpft. Ich weiß das. Ich merke alles, auch wenn die Ärzte und Schwestern das nicht merken. Mir nichts anmerken zu lassen, ist das Letzte, das mir geblieben ist. Gott sei Dank ist das Handy auf einmal wieder da. Dafür hat Herbert gesorgt. Oder nein, es muss Lukas gewesen sein. Der Gute. Sicher zahlt er es. Er organisiert auch den Rest, ich kenne mich nicht mehr aus, geht ja alles nur noch elektronisch. Da kommen die Alten nicht mehr mit.
Die guten Tage sind am schwersten. Ich google am Handy, lese alles, was mir unterkommt, erschrecke. Google weiter, lese weiter, erschrecke wieder und so fort. Bis der Schreck mich ganz blöd macht im Hirn.
Frau Heiligstetter, sagt Manfred. Alles okay?
Sicher doch, sage ich und versuche, verwegen dreinzuschauen. Verwegen finde ich gut.
Gehen wir?
Nein, ich frage nicht, wohin wir jetzt gehen. Ich will es nicht vergessen haben. Ich gebe vor, mir den Knöchel verstaucht zu haben, damit der junge Mann mich stützen muss und keine weiteren Fragen stellt.
Es tut mir leid, sage ich.
Ist doch kein Problem, sagt er und bietet mir seinen Arm an, als ob er mich ausgesucht hätte. Wie in der Tanzschule. Freiwillig: Herrenwahl. Natürlich Elmayer wie die richtigen Wiener. Ich würde jetzt gern erröten. Schade, dass man das heutzutage nicht mehr macht.
Meine Freunde nennen mich Manni, sagt er.
Gut, sage ich, dann also Manni.
Er erinnert mich an Herbert, an den ganz, ganz jungen Herbert. Er hat dasselbe entwaffnende Lächeln. Da kann ich einfach nicht anders als mitzugehen, auch wenn ich mir sicher bin, dass sie ihn nur für mich abgestellt haben, weil man bei mir nicht mehr viel falsch machen kann. (Da ist alles lang vorbei, da ist alles längst gelaufen // viel ist da nicht mehr, viel hat sie nicht mehr, nur Zeit hat sie noch, aber davon mehr als genug // wo doch sonst nichts mehr ist // so reden sie, wenn sie Nachtdienst haben und wachen sollen über unseren Schlaf.)
Dieses Lächeln, entwaffnend, wie’s schon bei Herbert war, nur deshalb komme ich mit, obwohl ich das Mitgehen hasse, das sowieso und noch mehr, wenn es in den Speisesaal geht. Wie ein Gentleman ist er, eine sichere Hand hat er und ich bin so elegant. Ein elegantes Paar, wie vor meiner Zeit, wie auf einer Sommerfrischepostkarte auf der Kredenz der Mutter. Schritte wie früher. Als ob meine Beine für einen Moment vergessen hätten, wie alt sie sind, und auch die Hüfte, also ein Hüftschwung ist das wie damals. Ein Schwung und noch ein Schwung, ein kleiner Schritt mehr und ich tanze mit diesem Manni zu dem Tisch, an den er mich führt. Er rückt mir sogar den Sessel zurecht, ich bedanke mich, wie es sich gehört. Schön ist das, auch wenn das Ambiente hier im Speisesaal wie im ganzen restlichen Haus zu wünschen übrig lässt.
Ein wenig kräftigere Farben wären kein Fehler und die Vorhänge müssten gewaschen werden. Oder gleich weg damit. Ich würde gern in den Park hinausschauen können. Mir gegenüber sitzt ein Mann mit tausend Falten im Gesicht. Keine Ahnung, was der hier soll. Ich brauche doch meine Ruhe. Seine Hände zittern, trotzdem hat er ein Messer in der Hand und versucht, eine Semmel zu halbieren. Gleich wird er sich schneiden. Jemand muss ihm das Messer aus der Hand nehmen. Wo die Bedienung steckt? Gutes Personal zu kriegen, ja, das ist schwer. Aufmerksam müsste es sein. Sehen müsste man mich. Ich will bestellen. Dem alten Mann rinnt Spucke aus den Mundwinkeln. Ekelhaft. So einer gehört nicht an meinen Tisch. Alles, was recht ist. Nicht dass sie mir den noch ins Zimmer legen. Ich traue denen hier alles zu. Ich muss mit Lukas sprechen. Ich deute immer wieder in die Luft, ich rufe nach der Bedienung. Man wird doch wenigstens eine Bedienung erwarten dürfen für sein Geld! Da beugt sich Manni zu mir, redet auf mich ein, sagt, dass er nur schnell etwas regeln hat müssen. Für mich, eine Überraschung, ein kleiner Ausflug am Nachmittag. Er sagt, dass mein Zimmer immer nur für mich allein sein wird, dass er dafür sorgen wird, er lächelt. Ich glaube ihm, aber ich bleibe vorsichtig. Der alte Mann von gegenüber sei erst heute angekommen. Er brauche meine Unterstützung. Wie bitte? Er sei ein armer Kerl, habe gerade erst seine Frau verloren. Deshalb weint er die ganze Zeit.
Weinen? Aus dem Mund? Ich schweige. Die Semmel, die auf dem Teller vor mir liegt, breitet sich auf dem viel zu kleinen Teller aus. Das Messer hat gar keinen Platz. Es hängt über den Tellerrand, gleich wird es auf den Tisch fallen und das wird erst für Ärger sorgen. Sie werden wieder auf mich aufmerksam werden, herschießen werden sie auf mich wie der Teufel auf die arme Seele. Manni ist weg und ich traue mich nicht, das Messer anzugreifen. Messer, Schere, Feuer, Licht. Da muss man aufpassen, das darfst du nicht. Den Kakao werde ich verschütten, er ist viel zu heiß.
4
Meinen Herbert trage ich im Herzen. Das sowieso. Ich muss das nicht andauernd erwähnen, ich werde ihn nie vergessen. Niemals, auch wenn überall behauptet wird, dass man sich zuletzt an keinen mehr erinnern kann. Fast fünfundvierzig gemeinsame Jahre. Nie allein gewesen. Das kann niemand vergessen. Herbert habe ich in mir drin, ob ich will oder nicht. Ich habe Ja, ich will, gesagt und daran wird sich nie etwas ändern.
Ich weiß, dass er tot ist. Das ist normal, Manni, jeder stirbt einmal. Daran wirst du dich auch noch gewöhnen, nur jetzt bist du noch viel zu jung dafür. Du musst noch nicht an so was denken, so schwere Lektionen sind noch nichts für dich. Die kommen später. Lern erst einmal kochen, das reicht für den Anfang. Bist ein Hübscher, dich hätte ich auch genommen. Liebend gern, hätte ich gesagt und wäre dir ohne zu zögern auf die Tanzfläche gefolgt. Nein, schüchtern war ich nie. Schüchtern ist was für Verlierer. Doch, der Herbert war schon schüchtern, aber nur ganz am Anfang, weil als er Karriere gemacht hat, war das Schüchterne übers Jahr wie weggeblasen. Da war er ganz obenauf. Bis es bergab gegangen ist, und am Ende hat er gegen den Krebs verloren. Die Lunge war es.
Sei nicht traurig, Kind. So ist das nun einmal, aber wenn du einen im Herzen hast, kann dich der ganze Krebs kreuzweise. Schau, dass du eine findest, die wie ich ist. Die du dir ins Herz nehmen kannst. Bitte sehr, sagst du und rückst ihr den Sessel zurecht, wie du ihn mir zurechtrückst. Dann setzt sie sich nieder, schaut dich an mit ihren Augen und macht dir ihr Herz auf. Stumm wechselt ihr die Plätze: sie in dein, du in ihr Herz und dann verliert ihr euch nie mehr. Das geht, glaube mir, das geht über den Tod hinaus. Was aber mich angeht: Ich pfeif sowieso auf den Tod. Er kann mir nichts anhaben. Das macht mich stark, so überlebe ich alles. Frag meinen Herbert. Frag mich, ich werde dir auf alles eine Antwort geben, aber frag mich nur an den guten Tagen, wenn ich genug Worte habe.
Such dir aus, was du willst. Bau dir ein Haus oder eine Höhle oder sammle das alles in deinen Taschen für später, wenn die Zeit kommt. Wenn du Schutz brauchst vor dem ganzen anderen wie vor den Geräuschen der Motorsägen, wie sie ins Holz fahren zur Unzeit und schon sprichst du nie wieder. Kein einziges Wort. Nur noch haltloses Hin & Her, als ob du das Sprechen verlernt hättest. Was du hast oder nicht, wissen wirst du es nie.
An den guten Tagen, Manni, da weiß ich alles. Da weiß ich auch, dass ich zu lang geschwiegen habe, an den schlechten Tagen, das sollst du auch wissen, da weiß ich nicht einmal das. Da rinnt mir jeder Gedanke zwischen den Fingern durch wie Wasser, und Wasser, Manni, merk dir das, Wasser findet die kleinste Öffnung und es gibt immer eine. Früher oder später tut sie sich weiter und weiter auf und dir rinnt alles davon.
Nach dem Essen ist Betreuung angesagt. Ich hasse das. Seniorensport, Bewegung ist alles. Alles, was Flügel hat, fliegt, sagst du. Ein Vogel!, ruft Manni und hebt seine Arme in die Höhe. Die alten Knochen und Hirne beweglich halten und du hüpfst es vor, ich weiß, was du willst, Manni. Bist eh ein guter Bub, aber mir. Mir fliegt auch so schon alles davon.
Sei mir nicht bös, aber da mach ich nicht mit. Da hebe ich nicht einmal meine Augen, erst recht nicht die Arme, da kannst du dich noch so abmühen. Alles, was Flügel hat, fliegt! Der Vogel fliegt! Ich verstehe jedes Wort. Ich tue nur so, als ob es anders wäre. Das geht mir leicht von der Hand. Leichter als ein Vögelchen kann ich tun, als wüsste ich nichts mehr. Glaub mir, mein Vögelchen, mir ist es zugig genug. Ich muss mich konzentrieren, ich habe keine Kraft für kindische Spiele. Da hängen schon zu viele schwarze Löcher in mir, ein Tunnel neben dem anderen, endlos, und sie vermehren sich wie verrückt. Tauchen auf wie der schwarze Tod, breiten sich aus, brechen zusammen und nehmen alles mit. Schlucken alles mit sich, wenn sie gehn, nichts bleibt, keine Spur, nicht einmal eine Erinnerung, und bald bin ich das selbst und das ist das Schlimmste.
Sterben am lebendigen Leib. Ich weiß alles darüber. Ich habe mich informiert. Habe alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Ein Gedanke daran und mich überkommt das Vergessen wie eine Kapuze, die sie dem zum Tod Verurteilten über den Kopf ziehen. Du weißt, was dann kommt. Vielleicht noch letzte Worte, weil es jetzt eh schon egal ist. Zwei oder drei. Wenn die letzten Worte verschwunden sind, lass dir das gesagt sein, Manni, dann bin auch ich verschwunden. Deshalb, nur deshalb und weil ich dich lieb gewonnen habe, habe ich beschlossen, dir ein Gehäuse aus Worten zu bauen. Es wird stehen bleiben für dich, auch wenn ich es nicht mehr bewohne.
5
Ich mache mir Sorgen, Helene schaut so abgespannt aus. Wahrscheinlich hat sie deshalb vergessen anzuklopfen. Oder Alexander hat die Tür einfach aufgerissen. Er ist so ein begeistertes Kind. Kaum zu bremsen. Gut, dass wenigstens die Kleine nicht mitgekommen ist.
Schau, Oma, was ich gefunden habe!
O, das ist ja toll!, sage ich und nehme das Schneckenhaus mit spitzen Fingern entgegen. Ich betrachte es von allen Seiten und gebe es dem Buben wieder zurück. Helene hat sich niedergesetzt.
Müde?, frage ich. Sie antwortet mir nicht, sondern wühlt in ihrer Tasche herum. So nervös, das Kind. Endlich hat sie gefunden, wonach sie gesucht hat.
Hier, die Füllfeder, um die du mich gebeten hast.
Füllfeder?, denke ich. Was soll ich denn mit einer Füllfeder? Warum sollte ich sie um eine Füllfeder gebeten haben? Helene war immer schon eine Träumerin. Hat weiß Gott was alles dahererfunden. Schwer für jemanden wie mich. Ich will sie aber nicht enttäuschen. Sie kommt mir bedrückt vor.
Vielen Dank, das ist aber lieb von dir, dass du das nicht vergessen hast, sage ich.
Sie schaut sich um.
Eigentlich hast du es hier eh schön, sagt sie.
Ich beklage mich ja nicht, sage ich.
Oma, kann ich Saft?
Ich verdrehe die Augen, da sagt Helene: Wie sagt man da?
Bitte, sagt der Bub.
An besten gehen wir gleich ins Café hinunter, sage ich, und dann erinnere ich mich wieder: Und das Heft? Hast du mir auch ein Heft mitgebracht?
Das hat Helene natürlich vergessen. Aber immerhin. Eine Füllfeder habe ich, und um das Heft werde ich Lukas bitten. Der kommt im Gegensatz zu ihr ja jeden Tag. Ich werde ihn heute wegen dem Heft fragen, da kann er es mir morgen gleich mitbringen.
Deine Mutter hat einmal eine Schlangenhaut gefunden, erzähle ich dem Buben im Lift.
Echt?, fragt er und schaut Helene ungläubig an. Er ist beeindruckt.
Echt, sagen Helene und ich gleichzeitig.
Ich kann Manfred nirgends entdecken, wahrscheinlich hat er heute frei. Schade, ich hätte ihm die beiden vorstellen können.
Suchst du was?, fragt Helene. Musst du nicht, ich habe schon beim Hereingehen bestellt. Eine Melange für dich, ist’s eh recht?
Ich nicke und schaue zur Seite, damit sie mein aufgebrachtes Gesicht nicht sieht. Wie kommt sie dazu, einfach für mich zu bestellen? Und warum können wir nicht warten, bis die Kellnerin an den Tisch kommt. Alles der Reihe nach, wie es sich gehört. Nicht immer alles so durcheinander.
Eins nach dem anderen, sage ich.
Ja, Mama, sagt sie. Du hast recht. Tut mir leid.
Der Ton. Ich hasse diesen Ton. Als ob man mit mir wie mit einer Idiotin reden müsste, nur weil ich jetzt in diesem Heim lebe. Weil ich alt bin. Zu alt für diese Welt, denke ich. Nein, sage ich zu mir. Nein. Ich bin noch lang nicht so alt, wie alle tun. Nein, sage ich noch einmal. Sonst nichts.
Bekomme ich ein Aquarium?, fragt der Bub.
Vielleicht, sagt Helene.
Ich will aber sicher eines, sagt Alexander.
Nerv mich nicht, sagt Helene.
Seit wann kämmst du dir die Haare zurück?, frage ich. Schaut streng aus.