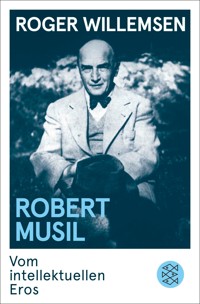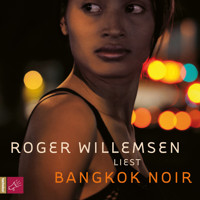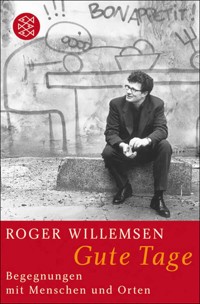
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Roger Willemsen hatte das Glück, einigen großen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte an einem Wendepunkt ihres Lebens zu begegnen und manchmal Tage, sogar Wochen mit ihnen zu verbringen, bisweilen an erstaunlichen Orten. In den literarischen Porträts, die nach diesen Begegnungen entstanden sind, ist die Sicht auf jene »überlebensgroßen« Menschen immer persönlich, zuweilen intim, manchmal sogar innig, und schließlich schält sich aus der Summe der Beobachtungen, Gespräche und Gedanken fast ein Gesamtbild vom Menschen – seinen Möglichkeiten und Grenzen. Die hier beschriebenen Persönlichkeiten – Popstars und Politiker, Wissenschaftler, Schauspieler und andere – vereint, dass sie das Menschenmögliche neu gefasst und ihre Rolle in der Öffentlichkeit einzigartig interpretiert haben. Willemsens Porträts wiederum verbindet die Gabe ihres Autors, tiefer zu sehen und Erkenntnisse zu fördern, die oft genug selbst seine Gesprächspartner überraschen. In Arafats Badezimmer – In einem Kloster mit dem Dalai Lama – In der Badewanne von John le Carré – Mit John Malkovich auf der Burg des Marquis de Sade – In den Gemächern Margaret Thatchers – Auf der Verbannungsinsel von Mikis Theodorakis – Im Dschungel unterwegs mit einem Orang-Utan – In der Harald Schmidt Show – Mit einem japanischen Konzernchef in der Geisha Bar – In Vivienne Westwoods Werkstatt – Auf der Suche nach Jean Seberg in Paris – Sinead O'Connor mit Elbblick – Mit Tina Turner an der Côte d'Azur – In einem Boot mit Michel Piccoli – Bei Jane Birkin daheim – In der Bar von Henry Millers letzter Frau – Mittagessen mit einem »Kannibalen« – Am Sterbebett von Timothy Leary – Im Gespräch mit zwei Kosmonauten im Weltraum – Vor einem »Monster« in der Berliner Charité.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roger Willemsen
Gute Tage
Begegnungen mit Menschen und Orten
Über dieses Buch
Roger Willemsen hatte das Glück, einigen großen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte an einem Wendepunkt ihres Lebens zu begegnen und manchmal Tage, sogar Wochen mit ihnen zu verbringen, bisweilen an erstaunlichen Orten.In den literarischen Porträts, die nach diesen Begegnungen entstanden sind, ist die Sicht auf jene »überlebensgroßen« Menschen immer persönlich, zuweilen intim, manchmal sogar innig, und schließlich schält sich aus der Summe der Beobachtungen, Gespräche und Gedanken fast ein Gesamtbild vom Menschen – seinen Möglichkeiten und Grenzen.Die hier beschriebenen Persönlichkeiten – Popstars und Politiker, Wissenschaftler, Schauspieler und andere – vereint, dass sie das Menschenmögliche neu gefasst und ihre Rolle in der Öffentlichkeit einzigartig interpretiert haben. Willemsens Porträts wiederum verbindet die Gabe ihres Autors, tiefer zu sehen und Erkenntnisse zu fördern, die oft genug selbst seine Gesprächspartner überraschen.In Arafats Badezimmer – In einem Kloster mit dem Dalai Lama – In der Badewanne von John le Carré – Mit John Malkovich auf der Burg des Marquis de Sade – In den Gemächern Margaret Thatchers – Auf der Verbannungsinsel von Mikis Theodorakis – Im Dschungel unterwegs mit einem Orang-Utan – In der Harald Schmidt Show – Mit einem japanischen Konzernchef in der Geisha Bar – In Vivienne Westwoods Werkstatt – Auf der Suche nach Jean Seberg in Paris – Sinead O’Connor mit Elbblick – Mit Tina Turner an der Côte d’Azur – In einem Boot mit Michel Piccoli – Bei Jane Birkin daheim – In der Bar von Henry Millers letzter Frau – Mittagessen mit einem »Kannibalen« – Am Sterbebett von Timothy Leary – Im Gespräch mit zwei Kosmonauten im Weltraum – Vor einem »Monster« in der Berliner Charité.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Roger Willemsen war Publizist, Moderator, Literaturwissenschaftler und stand mit zahlreichen Soloprogrammen auf der Bühne. Für sein Schaffen wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Am 15. August 2025 wäre er siebzig Jahre alt geworden.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2004 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
ISBN 978-3-10-402549-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Flussfahrt mit Orang-Utan
Der Unberechenbare
Die einsame Lady
»Express Yourself!«
Der Bel Ami der Barrikaden
Der ewige Palästinenser
King Leary´s Winterschlaf
Außer Atem, außer sich
Die Insel der schwarzen Skorpione
Die Untragbare
Papa Popstar und der Krieg
Die blaue Blume der Spione
»Fucking Je t’aime!«
Vom Menschen essen
Der Spaßdienstverweigerer
»This is a Rebel Song«
Die Hausfrau als Megastar
Der Mönch als Global Player
Lady im Werden
Diesseits von Nirwana
»Froschkopf«
Unter Hostessen
Einzelgänger des Weltraums
Editorische Notiz
Vorwort
Die Opernsängerin, die in der Limousine durch Europa fährt, ihre New Yorker Agentin anruft und bittet, sie möge den Fahrer anweisen, die Klimaanlage zu drosseln.
Die kleine Auktionsgehilfin, die an die Westküste Irlands fährt, ein Streichholz an ihre Kleider hält und sich aus Liebeskummer verbrennt.
Der Mann, der sich im Postamt die Benutzung eines Briefumschlags erklären lässt.
Der Business-Class-Reisende, der den Tod einer Passagierin in der Economy Class mit dem Satz kommentiert: »So brauchen wir wenigstens keine Warteschleife zu fliegen.«
Der Folterer, der so lange foltert, bis die Schreie des Opfers den Hahn zum Krähen bringen.
Der Tuareg auf dem Weg zu seinen Frauen in der Oase, der auf die Frage: »Und womit beschäftigen Sie sich an den Abenden?«, erwidert: »Wir erzählen uns Geschichten.«
Sie alle sind am Rande der Geschichten aufgetaucht, die in diesem Buch erzählt werden. Aber ich habe verpasst, sie zu ragen, wer sie sind, wer sie waren, und wie sie den Punkt erreichten, an dem sie so handeln, reagieren, zurechtkommen konnten.
Aus manchen Menschen in verwandten Situationen werden berühmte, exemplarische Menschen, Richtbilder. Aus anderen werden Unbekannte, die nie das Licht der Öffentlichkeit streift. Wenn man wissen will, wie die Berühmten das wurden, was sie wurden, ist ihre öffentliche nicht unbedingt ihre interessantere Seite.
Fesselnder erschien mir also die Berufung oder Obsession, die die Menschen in diesem Buch verbindet, der persönliche Extremismus, der sie eint: die Zwangsvorstellung, etwas nicht für die Öffentlichkeit sein zu müssen, sondern für sich oder ihre Wirkung in der Welt. Auf der nicht öffentlichen Seite unterscheiden sie sich von allen, denen ein bloßer Effekt flüchtige Aufmerksamkeit sichert. Das bedeutet auch: Die hier Porträtierten werden weniger um ihres Ranges willen, als um ihres Weges dorthin beobachtet.
Alle haben sich an extreme Punkte bewegt, haben in extremen Zuständen gelebt oder tun es noch. Sie alle sind auf ihrem Feld zu Repräsentanten extremer Entwicklungslinien geworden. Schauspieler, Musiker, Wirtschaftsführer, Kriminelle, Autoren, religiöse und politische Führer, Staatsfeinde, Entertainer, Modedesigner, Popstars, Kosmonauten, Mönche, Provokateure, Forscher eint hier ihr Ringen um das »Menschenmögliche«, und die meisten von ihnen haben dabei eine Idee von Freiheit, von Unabhängigkeit und Radikalität vertreten, die sie eigentlich zu Außenseitern hätte machen sollen. Manchmal sind sie das sogar geblieben, trotz ihres Ruhms.
Jedenfalls wurden sie auf ihre Weise zu exemplarisch Lebenden, die es wert sind, dass man sie hört, auch wenn man sich nicht primär für ihr Werk interessiert. Denn sie teilen nicht sich allein mit. Und da das Menschenmögliche hier manchmal von seinen Rändern aus gedacht wird, findet auch der »monströse« Fötus seinen Platz, der japanische »Kannibale«, der Menschenaffe.
Einige der Personen in diesem Band waren schon im Gefängnis, andere haben Gewalt ausgeübt oder erlitten. Einige haben Macht genossen, andere Macht nur ertragen. Manche von ihnen glauben, andere lästern, dritte glauben lästernd. Einige waren gezeichnet von der Liebe, andere vom Rausch, wieder andere vom Verlust oder vom Sterben. Triumphe, Siege in jeder Größenordnung zogen vorbei und Niederlagen nicht minder. Wem es nicht reicht, ein Werk zu hinterlassen, wer zwischen Geburts- und Sterbedatum auch ein Eigenleben hinkriegen will, vollendet sich im Scheitern.
Etwas Ansteckendes geht von solchen Individuen aus, von ihrem Arbeiten, ihrem Wahrnehmen und Ausdrücken, ihren abweichenden Standpunkten und Anstrengungen, sich in der Gegenwart zu behaupten und eine Wirkung zu hinterlassen, statt bloß einen Effekt.
In der Begegnung mit solchen »Menschenmöglichen« (oder solchen, die zumindest mir so erscheinen) habe ich erlebt, was »Gute Tage« sind, auch wenn es sich manchmal um Menschen handelte, die um ihre »Guten Tage« rangen oder sie vermeintlich hinter sich hatten. Immer befanden wir uns dabei auf Reisen, und oft haben Städte und Landschaften mitgesprochen.
Es gibt Orte, die Erinnerung herstellen, und es gibt Nicht-Orte, die nichts als Vergessen produzieren. Wir sehen der Wucherung solcher Nicht-Orte zu, die wenig mehr sind als Aufbewahrungsorte für Menschen, Zwischenlager, Transithallen. Zum Reisenden gehört, dass er immer auf dem Weg ist, dass er alles in Bewegung und schließlich in Erfahrung verwandelt.
Entsprechend haben sich die hier Porträtierten erfahrbar gemacht auch in der Wechselwirkung mit ihren Räumen, in Melbourne und Kyoto, auf den Straßen von Paris und Los Angeles, an den Küsten von Cornwall und Ikaria, in den Häusern von Kinshasa und Tunis, dem Dschungel Borneos, dem indischen Hochland, einem Kastell in Südfrankreich, einer Bar in Tokio und sogar dem All.
Stanley Kubricks Epos »2001 – Odyssee im Weltraum« beginnt mit dem Menschenaffen und seinem Knochenwerkzeug, das, in den Himmel geworfen, als Raumschiff weiterfliegt. Dies hier ist eine andere Reise, aber wenigstens beginnt auch sie mit einem Orang-Utan und endet mit zwei Kosmonauten.
Flussfahrt mit Orang-Utan
Biruté Galdikas im Dschungel Borneos
Nur Überfliegen reicht nicht.
Zurück bleiben die Industrien von Balikpapan, die Werften der großen Ölstadt an der Ostküste, die Rauchfahnen über den Schloten, die im tropischen Dunst rasch rostenden Installationen der Raffinerien.
Die Straßen enden in Flüssen, und die Flüsse wieder in Flüssen. Sie bestimmen das unregelmäßige Muster aus den Reststücken eines sechzig Millionen Jahre alten Urwalds und den frei gerodeten Flächen, auf denen die neuen Siedler ihre bunt gestrichenen Baracken abgestellt haben. Abseits erkennt man noch die Haufendörfer der Alteingesessenen, vereinzelt ein paar traditionelle Langhäuser, und über allem lasten die Rauchwolken schwelender und offener Feuer.
Früher drangen holländische Kolonialbeamte, philippinische Seeräuber und Missionare, chinesische und malaysische Kaufleute von den Flussmündungen aus in dieses Dickicht, den zweitgrößten Dschungel der Welt. Heute kommen selten Weiße nach Zentralkalimantan oder Borneo, aber im Hafen der südlichen Metropole Banjarmasin und auf dem Flughafen von Palangkaraya, der Hauptstadt von Zentralkalimantan, landen Javanesen, Balinesen, Maduresen in Klein- und Großfamilien, Tausende jeden Monat.
Schon seit Jahrhunderten ballt sich die Bevölkerung Indonesiens auf Java, der Insel mit dem fruchtbarsten Boden und folgerichtig mit der dichtesten Besiedlung der Welt. Zwei Drittel aller Indonesier leben auf Java, der vorgelagerten Insel Madura und der benachbarten Insel Bali. Die Bevölkerungsdichte auf der größten dieser drei Inseln ist mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.
Schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts begannen die holländischen Kolonialherren mit der Umsiedlung der Javanesen auf die wildere Insel Sumatra. Etwa zweihunderttausend Menschen hatten bis zum Zweiten Weltkrieg Java verlassen. Bis heute sind es, glaubt man der indonesischen Regierung, etwa vier Millionen Menschen, die im Zuge des größten Umsiedlungsprojekts der Welt, der so genannten »Transmigration«, Java verlassen haben. Vor allem im Dschungel von Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo, sollen sie eine neue Existenz finden.
Die Ankömmlinge auf den dortigen Flughäfen tragen noch die Trachten ihrer Kultur: Verschleierungen, mit gestickten Borten besetzte Tücher die wohlhabenden Javanesen, Verwaltungsbeamte, Mediziner oder Juristen, Sarongs die Balinesen, auch Shorts, auch Batikhemden und T-Shirts. Die hier auf dem Flughafen stehen, strapaziert und voll müder Erwartung, können sich untereinander kaum verständigen. Das Indonesische ist eine spät entwickelte synthetische Amtssprache, die gut zweihundertfünfzig regionale Sprachen und ebenso viele Dialekte ersetzen soll.
Die Ankömmlinge teilen die Erwartung, sonst nichts, und statt einer geeigneten Vorbereitung erhalten sie ein Versprechen. Das alles sollt Ihr haben: ein Haus, Land, Saatgut und ein Präsidentenfoto. Darüber hinaus erhalten sie noch ein wenig Unterricht in Ackerbau und in Hygiene. Aber das kennen sie: Schließlich hat auch auf Java jeder größere Ort ein Familienplanungsdenkmal, Sinnbild der glücklichen Kleinfamilie, und auf den Dörfern gibt es wenigstens das entsprechende Verkehrsschild: Eine Hand mit zwei gereckten Fingern, »dua anak cukup«, »zwei Kinder sind genug!«
Im Waschraum des Flughafens erläutert eine Zeichnung die Benutzung der westlichen Toilette: Hocke Dich nicht mit den Füßen auf den Rand, schöpfe kein Wasser aus dem Loch und stecke auch deinen Kopf nicht hinein! Neben dem Spiegel die Regeln der Körperhygiene: Vergiss auch die Ohren nicht, nicht die Nase und nicht einmal die Spitzen Deiner Ellenbogen! An den Wänden der Halle bleichen die Tafeln mit Tieren und Pflanzen des Waldes, daneben die altmodisch strahlenden Gesichter der Lifebuoy-Reklamen, die monochromen Werbungen für ABC-Drinks und Ultra Milk. Andere Bilder sieht man nicht.
Die Dörfer aber, in denen die Ankömmlinge verschwinden werden, besitzen manchmal ein Fernsehgerät auf einem hölzernen Podest, vor dem man abends dem einzigen Programm folgt: Nachrichten, Bilder von Paraden, Ordensverleihungen und rituelle Tänze. Mal rodet jemand ein Gebüsch, mal zieht er eine Fahne hoch oder macht ein Boot klar, und zwischendurch erklärt Lorne Greene, immer noch in der weiß wattierten »Pa-Bonanza«-Jacke, den Seefuchs oder andere Tiere, die es auf Borneo nicht gibt, wo so viele Arten verbreitet oder sogar endemisch sind. Aber schließlich lebt ja selbst Lorne Green inzwischen nicht mehr.
Die Fernsehwerbung wurde von der Regierung hier schon vor Jahren abgeschafft, um »keine falschen Bedürfnisse« zu wecken. In den Läden ihrer Dörfer finden die Siedler vor allem Früchte, Hühner- und grüne Gänseeier, Dörrfisch, Gewürztütchen, in den Vitrinen das prachtvolle Rot-Gold der Nelkenzigaretten und an den Wänden einzelne Kalenderblätter mit Ansichten von Teneriffa oder Garmisch-Partenkirchen.
In Palangkaraya aber, der erst 1957 gegründeten Hauptstadt, kann man fotokopieren, Fotos entwickeln lassen und technische Apparate kaufen. Hier gibt es vier Kinos, aber Straßenbeleuchtung noch nicht lange. Es gibt ein großes Krankenhaus, aber nur einen Chirurgen für alle, die tagelang in ihren Einbäumen wegen einer Blinddarmoperation oder der Behandlung einer Schnittverletzung hierher unterwegs sind. Es gibt Banken, aber keine, die Schecks oder Dollar akzeptiert. Es gibt Computerspezialisten und korrespondierende Mitglieder wissenschaftlicher Zeitschriften, aber nicht selten solche, deren Glaubenspraxis Animismen, rituelle Schlachtungen und Trance-Tänze einschließt.
Der letzte Gouverneur der Region, immerhin im Rang eines Ministerpräsidenten, verfügte testamentarisch, sein Sarg solle aus dem Holz eines so genannten »Herzbaums« gefertigt werden, eines Baums also, bei dessen Pflanzung in der Wurzel ein menschliches Herz eingesetzt wurde. Die Einheimischen merken sich im Urwald solche Bäume, und es war, als ich nach Palangkaraya kam, kaum ein Jahr her, dass der Bitte des großen Staatsmannes entsprochen worden war.
Auch Anthropophagen, also kannibalistische Stämme mit der Neigung, zum Schutz gegen Dämonen einen menschlichen Skalp an der Außenwand des Hauses anzubringen, soll es bis vor nicht allzu langer Zeit auf Borneo gegeben haben. Der letzte glaubwürdig rapportierte Fall aber stammt aus den fünfziger Jahren.
Eine Anthropologin, die sich jüngst aus keinem anderen Grund in den Urwald aufgemacht hatte, um die Spur dieser »Menschenfresser« aufzunehmen, wurde eines Abends bei vollem Bewusstsein, allerdings nackt, in der Hütte eines Einheimischen gefunden, wo sie sich, völlig verängstigt, in eine Gardine eingerollt hatte. Sie blieb verwirrt. Von Kannibalen konnte sie nicht berichten.
Seit die Regierung die Lebensform der Dayaks für »unzeitgemäß« erklärt hat, sind auch die Kopfjäger von der Bildfläche verschwunden. Zwar haben viele Einheimische bis in die siebziger Jahre hinein die Friedhöfe geheim gehalten, aus Angst, Jäger könnten die Verblichenen ausgraben und ihre Schädel davontragen, in jüngerer Zeit aber soll man sich schon verschiedentlich mit Tierschädeln geholfen haben, immer in der Hoffnung, dass die schlafenden Geister den Betrug nicht merken. Schädel jedenfalls, unter den vier Grundpfosten eines Hauses angebracht, sollen bei der Brautwahl helfen und die Geister repräsentieren, die dem Verstorbenen in der Oberwelt zu Diensten stehen.
Auch ein Schweizer Geistlicher war vor einiger Zeit ausgezogen, Asien im Allgemeinen und Borneo im Besonderen dem richtigen Glauben zu unterwerfen. Nachdem er zu Hause die chinesische Sprache gut genug gelernt hatte, um – wie er glaubte – in ihr radebrechen zu können, bestieg er irgendwo auf dem weiten chinesischen Lande eine improvisierte Kanzel und predigte in einem Idiom, in dem das Schweizerdeutsche mit dem Chinesischen eine Mesalliance eingegangen war. Jedenfalls predigte er etwa eineinhalb Stunden und schritt nach dem Segen erhobenen Hauptes von dannen, bis ein paar Zuhörer, die geduldig angenommen hatten, er erzähle aus seinem eigenen Leben, hinter ihm hergelaufen kamen und riefen: »Herr Jesus, du hast deinen Hut vergessen!«
Anschließend war er enttäuscht ausgezogen, um nun die Buschmenschen Borneos zu evangelisieren. Unglücklicherweise verirrte er sich im Dschungel, erreichte nach Tagen ausgezehrt und bärtig den Fluss und winkte hilferufend den vorbeitreibenden Booten. Die Einheimischen hielten ihn, verwahrlost wie er war, von weißer Haut und in der schwarzen Soutane, für ein Gespenst, wagten nicht, sich ihm zu nähern, und der liebe Gott ließ ihn bei einem Gesträuch am Ufer endlich verhungern.
Der Urwald Borneos brennt in jedem Augenblick an vielen Stellen. Schwer hängen die Schwaden zwischen den Bergen oder gelbgrau über Joseph Conrads melancholischen Flüssen. Manchmal können die kleineren Verkehrsmaschinen wegen des Rauchs über mehrere Wochen nicht fliegen. Aber wer schon vier Tage lang mit dem Boot zum Flughafen unterwegs war, der kehrt nicht gleich um, sondern campiert lieber an Ort und Stelle.
Die Siedler brennen die Gebüsche gleich neben ihrer Hütte ebenso nieder wie hektargroße Parzellen zu Seiten ihrer Felder. Heute gilt: Alles, was die Anwohner eigenhändig gerodet haben, gehört ihnen selbst, und wer beobachtet hat, wie viele Tage es braucht, mit einer Steinaxt einen hundertjährigen Urwaldriesen zu fällen, der versteht die Dankbarkeit, mit der die neuen, noch unerfahrenen Siedler in die Schneisen der Abholzungsfirmen eindringen, um dort durch Brandrodung Land zu gewinnen. Sie fühlen sich durch die hohe Luftfeuchtigkeit vor Funkenflug, durch den sumpfigen Boden vor einer Ausbreitung der Brände geschützt.
Als im Jahr 1983 die Regenzeit jedoch ungewöhnlich lange ausblieb, dörrten die Sümpfe aus und das Feuer zerstörte ein Stück Regenwald von der Größe Taiwans. Dieser schlimmste Brand in der Geschichte aller verzeichneten Brände wurde erst 1984 durch die endlich einsetzenden Regenfälle gelöscht.
Die indonesischen Zeitungen berichteten über die Katastrophe erst ein Jahr nach ihrem Ausbruch. Sie waren durch ausländische Nachrichtenagenturen auf das Feuer aufmerksam gemacht worden. Heute hat die Regierung die Piloten der kleinen Verkehrsmaschinen mit der Beobachtung der Brände beauftragt. Einige berichten, der Brand von 1983/84 sei nie wirklich gelöscht worden, und prompt ließ der nächste Großbrand, dieses Mal um die Jahrtausendwende, nicht auf sich warten.
Dennoch ist die Vielfalt der Pflanzen berauschend, sind die Vegetation, die morphologischen Variationen, die Bizarrerien in Farb- und Formgebung schier unermesslich.
Geologen haben die Bodenqualitäten der Erde auf einer Skala von 1, für unfruchtbaren Sandstrand, und 10, für die Erde Javas, eingeordnet. Danach besitzt der Boden Zentralkalimantans nur die Qualitätsstufe 2 – kaum glaubhaft für jeden, der den Früchte-Reichtum der Märkte hier kennt oder tagelang mit dem Boot durch eine Vegetation gefahren ist, deren biologischer Formenreichtum nur noch mit einigen Korallenriffen vergleichbar ist. 1,7 Millionen Tier- und Pflanzenarten sollen im tropischen Regenwald zu Hause sein. Nicht einmal die Hälfte hiervon ist wissenschaftlich erforscht, zu schweigen von der Analyse der Enzyme und Fermente, der Drogen und Medikamente, die mit der Zerstörung dieses Lebensraums unwiederbringlich verloren gehen.
Seine Fruchtbarkeit verdankt der tropische Regenwald Borneos also nicht primär dem Boden. Sie liegt vielmehr in der Luft, im Blattgrün, in den zahllosen symbiotischen und parasitären Verbindungen zwischen Pflanzen und Tieren. Vierzig Meter über dem Boden wachsen in toten Bäumen Sträucher und Blumen aus den ehemaligen Nestern der Orang-Utans. Kerne, verfaulte Früchte, Kot und vermodernde Zweige gebären eigene Mikrokosmen mit einem hoch verletzlichen inneren Gleichgewicht.
So ist zum Beispiel der Orang-Utan als das einzige Tier zugleich gierig und stark genug, die schwere Durian-Frucht – Delikatesse für Einheimische und Menschenaffen – nicht nur zu ernten, sondern sie viele Meter weit in das heimische Nest zu schleppen, wo der Kern, in den Kot dieses Nests eingelassen oder aus den Wipfeln abgeworfen, noch die Chance des Überlebens und der Fortpflanzung besitzt. Stirbt der Orang-Utan, so fallen auch die Kerne des Durianbaumes unter die immer selben Bäume, und so wäre auch der legendäre Baum Südostasiens ohne den Pongo pygmaeus in dieser Region vom Aussterben bedroht.
Ein ähnlich symbiotisches Verhältnis hat sich zwischen den Umsiedlern und den Abholzungsfirmen gebildet. Einmal in die durch Rodungsarbeiten entstandenen Schneisen eingefallen, sengen und sicheln die Ansiedler Gestrüpp, Kleinholz und Macchie herunter, den Kahlschlag vollendend, der mittelfristig auch ihren eigenen Lebensraum zerstören wird. Die Weltbank hilft bei der Finanzierung dieses Projekts – auch wenn ihr ein Gutachten vorliegt, nach dem in wenigen Jahren kein Baum auf Borneo mehr stehen dürfte, hält die Entwicklung an wie bisher.
Die Siedler auf Zentralkalimantan wissen ebenfalls, dass unter ihren Augen eine Waldart zerstört wird, die sich nie wieder erholen kann und die durch nachgepflanzte Monokulturen oder selbst durch die Einrichtung eines Nationalparks langfristig nicht wirklich bewahrt würde, aber sie können sich ökologische Skrupel am wenigsten leisten. Auf den mühsam gerodeten Feldern ziehen sie die anspruchslosesten aller Pflanzen: Ananas und Trockenreis. Die Ananas wird häufig direkt in die Asche gesetzt. Ihre Frucht bleibt faustgroß, die Märkte sind überschwemmt, entsprechend gering ist der Verkaufspreis. Mehr als eine Ernte im Jahr gibt der Boden nicht her.
Das Saatgut für den Reis stellt die Regierung. Bleibt eine Regenzeit zu lange aus – und als Folge der Klimaveränderung sind auch hier die Jahreszeiten unzuverlässig geworden –, wird das Saatgut verzehrt und man hofft auf die nächste Zuteilung. Nach zwei Ernten ist der Boden ohnehin erschöpft. Man lässt ihn brachliegen, denn nun wächst hier buchstäblich nichts mehr als das harte Alang-Alang-Gras, das den Boden allmählich mit einer so dichten Decke überzieht, dass für lange Zeit nichts hindurch dringt. Erst nach fünfzehn oder zwanzig Jahren werden hier wieder Farne und Bäume wachsen und nach weit über hundert Jahren könnte bei ungestörten Verhältnissen hier sogar eine Art Sekundärwald entstehen, der dem ursprünglichen Regenwald zumindest gliche.
Die Bauern aber ziehen weiter, gewinnen neue Parzellen, schließen sich wieder zu »Transmigrasi«-Siedlungen zusammen. Vereinzelt entstehen Musterdörfer wie Bukitrawi am Kahayan-Fluss, eine Siedlung, auf die die Landesregierung gerne verweist, gibt es doch hier eine Volksschule, eine Krankenbaracke mit sechs Zimmern und ein paar Kioske. Auf dem Bootssteg schlagen die Frauen die Wäsche, darunter schwimmen Kinder in Autoreifen auf den Abwässern.
Wer beim Ackerbau nicht genug verdient, zieht während der Trockenzeit, wenn das Wasser niedrig steht, an den Fluss und wäscht Gold. Die Erfolgreichsten fördern am Tag knapp ein Drittel Gramm. Sie erhalten dafür das Äquivalent einer halben Kinokarte. Und irgendwann kommt »Die Hard III« auch bis hierher.
Die vierzehnjährige Gugah fährt jeden Morgen drei Stunden mit dem Fahrrad zum Gymnasium in die Stadt. Sie verlässt ihr »Transmigrasi«-Dorf im Morgengrauen. Auf den Feldwegen wird es lange nicht hell, der Rauch der Brandrodungen ist oft so dicht, dass man kaum vier Meter weit sehen kann, und ab drei Uhr nachmittags steht die Sonne nur noch als Scheibe im Dunst. Sechs Stunden täglich also fährt Gugah durch eine fast verödete Landschaft. Da aber auch die Lehrer des einzigen Gymnasiums weit und breit sehr schlecht und oft erst mit monatelanger Verspätung bezahlt werden, kommen die Schüler häufig vergeblich. Auch die Lehrer müssen zusätzlich Land beackern oder Gold waschen.
Vor einem Jahr etwa wurde Gugah mit einer Erkrankung der Atemwege in eines der sechs Zimmer der Krankenstation gebracht. Der Arzt aus der Stadt empfahl ihr, künftig auf dem Schulweg ein Taschentuch über den Mund zu binden. Sie gehorchte. Darüber lachen, wenn sie auf ihrem Fahrrad vorbeifährt, die Arbeiter in den Rodungen.
An manchen Tagen wird Gugah von ihrer Freundin Sri in die Stadt begleitet. Sri transportiert auf dem Rücken einen Korb mit Flaschen. Naturheilsäfte und Medikamente finden in der Stadt, wo sich viele keinen Arzt leisten können, guten Absatz. In der chirurgischen Station von Palangkaraya waren, als ich dorthin kam, nur fünf Patienten untergebracht. Sie schliefen unter fleckigen Moskitonetzen. Manchmal liegen Verwandte mit im Bett, manchmal liegen sie darunter.
Da der javanische Chirurg, der hierher versetzt wurde, Preise verlangt, die die wenigsten bezahlen können, wenden sich die Kranken gerne wieder den »Dukuns« zu, Medizinmännern und -frauen, die zwar naturheilkundliche Kenntnisse besitzen, zugleich aber mit animistischen oder totemistischen Mitteln arbeiten, Angst einsetzen und Schwangere und Patienten mit Bruchverletzungen bisweilen schon so lange massiert haben, bis Blutvergiftungen eintraten. Kein Wunder, dass die durchschnittliche Lebenserwartung auf Zentralkalimantan nur bei etwa vierzig Jahren liegt.
Unter diesen Bedingungen vollzieht sich die Entwicklung, der wir den Namen Fortschritt geben, ungleichmäßig, verschiedene Stufen der Kultur werden gleichzeitig erreicht. Über dem Eingang zum Kino hängt ein Schild »höflich, geregelt, ruhig«, unsere »Rambos«, »Rockys« und »Mission Impossibles« kommen trotzdem bis hierher.
Nicht weit vom Kino steht abends auf dem Dorfplatz ein Geschichtenerzähler. Er ist am Nachmittag mit dem Boot angekommen und trägt zerrissene Kleidung, Tierfelle und mehrere Amulette übereinander. Als er seine Decke ausbreitet, von den Tieren erzählt, die nun aus dem Boden kriechen werden, um sich gleich durch die Menge zu bewegen, schreit diese Menge, als erführe sie jedes Wort am eigenen Leib. Dabei steht das Kino nur einen Steinwurf von hier, und der Soundtrack des Films, der gerade da läuft, untermalt auch die Fabeln des Erzählers.
Am Hafen riecht es nach Öl und Sägespänen. Am Rand der Stadt hängt in der feuchten Hitze der Rauch der Brände ringsum. Eine einzige Straße führt heraus aus Palangkaraya. Sie ist etwa dreißig Kilometer lang und die beste Straße auf ganz Zentralkalimantan. Vor dem Krieg wurde sie von den Russen gebaut. Keiner weiß wirklich, warum.
Zu ihren Seiten liegen abgeholzte Wälder, Ananasfelder, kleine Tümpel, in denen die Siedler mit Reusen fischen. Man verkauft auch Mangos an der Straße und Eier und in roten Kanistern Benzin. Es gibt sogar eine Polizeistation an dieser Straße und ein improvisiertes Bordell mit fünf Mädchen, die auf der hölzernen Terrasse Karten spielen und Diät-Cola trinken.
»Kommen Sie her«, winken sie. »Kommen Sie her!«
Ich werde hineingeführt, erhalte eine Cola. Hinter improvisierten Paravents sind fleckige Laken zu sehen, Kissen in verschossenem Rot. Zwei Stunden lang spielen wir Mau-Mau. Dann gehe ich, ohne dass eine einzige zweideutige Geste gemacht worden wäre.
Immerhin hat das kleine Bordell eine Verkehrsanbindung. Aber in Tangkiling, jenem Dorf, zu dem die Straße von Palangkaraya führt, da gibt es nichts. Jenseits von hier ist Dschungel und nichts als Dschungel. Erst hier öffnet sich das mythische Land der Ureinwohner dieser Wildnis, der Waldmenschen, wie sie wörtlich heißen, der Orang-Utans, die heute gejagt und vertrieben, von Transmigranten eingekesselt oder als Haustiere missbraucht werden, und die man früher einmal wie eine eigene Bevölkerung ehrte.
Sie verstecken sich am Tag, nachts laufen sie herum, sprechen, glauben, die Erde sei ihnen untertan und werde ihnen eines Tages ganz zurückgegeben. Auf ihrer Oberlippe tragen sie meist einen gekräuselten Bart, ihre Lippen sind unschön, weil nicht allein gerunzelt, sondern auch angeschwollen und aufgetrieben, überhaupt ist ihr Kopf durch die vorstehende Schnauze verunstaltet; vor allem in jungen Jahren haben sie Ähnlichkeit mit Kindern. Ernsthaft sind sie bis zum Äußersten. Oft unendlich traurig, seufzen sie auch und weinen; erst dreijährig, lachen sie bereits wie ein alter Mann. Gerne tragen sie Kleider, trinken Rum und bedienen sich nach der Mahlzeit des Zahnstochers. Auch entführen sie Negerinnen, um ihrer zu genießen, ernähren sie aber gut. Vermutlich sind sie überhaupt aus einer Vermischung mit den indianischen Weibern entstanden.
Die Zoologie des 17., 18. und 19. Jahrhunderts beschreibt den Orang-Utan wie einen Menschen, der nach dem Sündenfall einen noch tieferen Sturz getan hat als der Homo sapiens. Sie seien früher Menschen gewesen, so werden Einheimische zitiert, aber wegen Gotteslästerung in Tiere verwandelt worden, sie seien die letzte Klasse der Menschen. Bontius, einer der Zuträger für Buffons »Naturgeschichte«, zitiert die Javanesen, »die behaupten, diese Tiere könnten sprechen, hüteten sich jedoch, es zu tun, aus Angst, man könne sie zur Arbeit zwingen«.
›Orang-Utan‹ sagen die Einheimischen, ›der Waldmensch‹, ›homo silvestris‹, sagten die Forscher, oder sogar: ›satyrus indicus‹. Man vermenschlicht den Affen, um ihn anschließend vor Gottes Ebenbild zu blamieren, findet an seinem im Alter geschwollenen Schläfenknochen etwas »außerordentlich thierisch Gemeines«, nennt seine Manieren schlecht, seinen Zeugungsakt schamlos. »Sie sind nur die schlechte Seite des Menschen«, schreibt Oken 1877, »sowohl in leiblicher wie in sittlicher Hinsicht.«
So leicht es den Forschern fällt, dem Orang-Utan gegenüber einen moralisch eindeutigen Standpunkt zu beziehen, so amoralisch geht die Forschung in ihren Untersuchungen selbst zur Sache. Da gibt es rührende Beschreibungen, wie die Tiere im Blätterdach des Urwalds ihre Nester bauen, ihre Kinder »stark und herzhaft« umsorgen, hegen und füttern, und während die Idylle noch währt, fällt der Satz: »erst nach der fünften Kugel nahm seine Kraft ab«, »bei jeder neuen Verwundung legte er die Hand auf die verletzte Stelle und der menschenähnliche Ausdruck seines Gesichts erregte selbst bei seinen Verfolgern Mitleiden«. Anschließend wird anerkennend verzeichnet, das sterbende Tier habe noch versucht, sich ein paar Zweige zu einem Sterbenest zusammenzulegen, und mit der Hand den Jungen den Weg zur Flucht gewiesen. Forschen heißt: Jagen, Beobachten heißt: Sezieren.
Die Zoologen, allen voran der große Alfred Russel Wallace, zeigen sich unablässig gerührt von der Menschlichkeit der Pongiden, gleichzeitig richten sie wahre Massaker an, schlachten schwangere und neugeborene Affen und bringen Kollektionen von Einzelteilen, Organen und Gliedmaßen als Forschungsmaterial wie als Ziergegenstände nach Europa. Erreicht ein Tier einmal lebend den abendländischen Kontinent, wird es dort maximal dreizehn Wochen alt, und noch die durchschnittliche Lebenserwartung im Zoo betrug vor nicht langer Zeit kaum mehr als dreieinhalb Jahre.
Die namhafte Primaten-Forschung versteht sich heute vor allem als Artenschutz. Sie ist unlöslich verbunden mit den Namen von drei Frauen: Dian Fossey lebte fast zwei Jahrzehnte mit Gorillas im Gebirge von Ruanda, bevor sie 1985 ermordet, 1989 von Hollywood filmisch gewürdigt wurde. Jane Goodall arbeitet ähnlich lange, ebenfalls in Afrika, vor allem mit Schimpansen und wurde durch ihre Bücher und Dokumentationen weltberühmt.
Biruté Galdikas, die unbekannteste unter den Dreien, beobachtet seit 1971 Orang-Utans auf einer einsamen Station im Dschungel an der Südküste von Zentralkalimantan. 1946 in Wiesbaden geboren, zieht sie kurz darauf nach Amerika, studiert in Los Angeles und entschließt sich bereits zwei Jahre nach ihrem Abschluss, 25-jährig im indonesischen Urwald Orang-Utans zu erforschen. Seither war sie Gastprofessorin der kanadischen Simon Fraser-Universität und außerordentliche Professorin der Universitas Nasional in Jakarta. Ihre Publikationen sind fast ausschließlich wissenschaftlich, ihre Lehrtätigkeit beschränkt sich inzwischen auf sporadische Vorträge in Kanada und den USA, wo sie verschiedentlich gemeinsam mit Fossey und Goodall aufgetreten ist. Hollywood wird sich für sie wohl nie interessieren.
In ihrem Nachruf auf die Freundin Dian, die zugleich ihr Vorbild war, zitiert sie Dian Fossey mit dem Satz: »Je tiefer man die Würde des Gorillas versteht, desto entschiedener wünscht man, dem Menschen aus dem Weg zu gehen«, und Galdikas schließt an: »Ich verstand genau, was sie meinte.«
Sie verstand genau, lebt sie doch selbst mit ihrem Mann, einem hier geborenen Indonesier, und etwa zwanzig einheimischen Arbeitern eine halbe Tagesreise entfernt von der nächsten menschlichen Ansiedlung, bringt sie doch selbst ihre Zeit damit zu, die Tiere zu erfassen, sie zu beobachten, ihr Verhalten, ihre Nahrung und ihren Stuhl zu analysieren, und verfolgt oft ein Tier auch einfach tagelang durch undurchdringliches und gefährliches Dickicht.
Bleibt die Regenzeit zu lange aus, wird der Fluss – die einzige Verbindung zur Zivilisation – wegen Niedrigwasser unbefahrbar, und die Isolation ist vollkommen. Aber was ändert das? Die kleine Gemeinde ist fast autark. Lebensmittel werden gehortet, Wasserreserven aus dem nächsten Bach bezogen und gefiltert, Strom spendet drei Stunden am Tag ein Generator in einem Holzverschlag. Seit den Tagen, da Galdikas allein mit ihrem ersten Mann und zwei Affen in einer Hütte begann, ist die Sicherheit gewachsen. Die Tiere kommen zur Fütterung, und am Sonntag treffen sogar manchmal die weitläufigeren Familienangehörigen der hier Arbeitenden mit einem Boot ein.
Sogar die damals nicht unberechtigte Angst vor jenen Piraten ist gewichen, die früher von den Philippinen aus in Jahresreisen Borneo umrundeten und über die Flüsse das Küstenhinterland brandschatzten. Sie sind heute hochgerüstet und gefährlich, in die Flussmündungen aber dringen sie kaum mehr vor.
Geblieben ist eine gewisse Fremdheit der Forscherin im Umgang mit Menschen. Manche empfinden sie als ›schwierig‹ oder abweisend, wo sie eher direkt oder unkonventionell auftritt, Fremde verjagt, ihre Zöglinge schützt und lästige Besucher vertreibt. Nicht lange nach unserer ersten Begegnung erklärte mir Biruté Galdikas einmal, die menschliche Natur sei ihr nach so vielen Jahren der Vertrautheit mit Persönlichkeit und Würde der Orang-Utans einfach »less appetizing« erschienen.
Ich hatte Biruté vor vielen Jahren auf dem Cover von »National Geographic« gesehen, eine hübsche, langhaarige Frau von Anfang zwanzig. Da kam sie mit zwei kleinen Orang-Utans auf ihrem Arm einen Steg hinuntergeschlendert und wirkte heidnisch wie die Priesterin einer Naturreligion. An dieses Foto erinnerte ich mich, als Sri und Gugah mir den Namen der legendären Forscherin und Naturschützerin nannten, respektvoll, aber auch beklommen.
Da standen wir vor einem Holzverschlag und blickten auf einen knapp zweijährigen Orang-Utan, der kläglich auf dem Boden lag, sich beschmutzte und kaum Temperament zeigte. Barmherzigerweise hatte man ihm einen Kletterbaum in das Gehege gestellt, einen abgebrochenen, nackt gefressenen Kletterbaum, eigentlich eine Verspottung der athletischen Gaben des Tieres. Das bleifarbene nackte Gesicht war selbst für einen Orang-Utan ungewöhnlich missvergnügt, das Schädelhaar weniger als schütter, die Haut schuppig und die Lymphdrüse unter einem Arm stark geschwollen. Mitten im Urwald wollten die Besitzer »Patut« gefunden haben, wo er von seiner Mutter aufgegeben worden sei, und sie wollten ihn jetzt, da er krank war, schnellstmöglich wieder loswerden.
Orang-Utans haben die gleiche Rippen- und Wirbelzahl und annähernd die gleiche Blutchemie wie Menschen, aber nicht die entsprechenden Abwehrkräfte. Sie stecken sich deshalb vor allem in jungen Jahren sehr rasch mit menschlichen Krankheiten an und siechen dann wehrlos vor sich hin. In Gefangenschaft unter Menschen können sie folglich kaum lange überleben. So saß er also da, von einer gerissenen Windel nur unvollständig bedeckt, ein kümmerliches Orang-Utan-Junges, mit einem winzigen wund gescheuerten Genital, schuppig, wie man unter der lichten Körperbehaarung erkennen konnte, und mimisch ein Stein erweichender Misanthrop.
Patut war winselnd neben seiner von Jägern erschossenen Mutter gefunden worden, erklärten die Zieheltern. Also hatte man den Kleinen entgegen aller Verbote zu sich genommen und sich bemüht, ihm die Natur in Maßen zurückzuerstatten. Aber er aß nur süßes Brot und Bananen, blickte verdrießlich und wurde allmählich leise krank, ohne dass weit und breit jemand hätte sagen können, warum, und ausgerechnet diese arme, lustlose Kreatur, dieser Schatten eines stolzen und einzelgängerischen Pongo pygmaeus war der erste in Freiheit geborene Orang-Utan, dem ich hier begegnen sollte!
»Wohin geht die weitere Reise?«, wollten die Gasteltern wissen.
Ich hatte keinen genauen Plan.
»Nur immer weiter in den Busch.«
Da breiteten sie eine Karte aus, und wir fuhren mit den Fingern Ströme entlang, Ströme, Verästelungen und Mündungen, den ganzen Aderlauf des tropischen Regenwalds, und am Ende aller dieser Kapillaren zeigten sie mir, wo das Camp von Biruté Galdikas zu finden wäre. Da könnte ich doch hinreisen und den kleinen Pongiden in Pflege geben.
Am nächsten Tag machte ich mich mit einem Korb, einem Vorrat an süßem Brot, ein paar Bananen und Patut auf dem Arm zum Flughafen auf, denn die erste Etappe war dank eines echten behördlichen Zertifikats, auf dem Patuts Identität und die meine nebeneinander erfasst waren, noch mit einer kleinen Propellermaschine zu bewältigen.
Ehemals respektierten die Einheimischen die natürliche Vorherrschaft des Orang-Utans im Urwald und waren zur Jagd kaum zu bewegen, ja, es gab sogar Völker, die die Ermordung des Affen mit dem Tod bestraften. Mit dem Auftreten weißer Jäger veränderte sich die Situation: Jetzt begriffen auch die Einheimischen, wie man aus der Belieferung westlicher Zoos ein Geschäft machen konnte.
Schließlich blieb den Behörden angesichts des rasch florierenden Erwerbszweigs nichts anderes übrig, als das Vernünftige zu tun: Man stellte den Orang-Utan unter Artenschutz. Die Transmigranten jagen ihn dennoch manchmal, wenn er sich an die Feldfrüchte und Ernten macht oder die Äcker verwüstet, aber wer einen Pongo pygmaeus erlegt oder ihn als Haustier hält, muss inzwischen mit empfindlichen Strafen rechnen.
Buffon erwähnt in seiner Abhandlung außerdem, die Orang-Utans seien die einzigen Lebewesen außer dem Menschen, die Hinterbacken besitzen. Die von Patut teilten sich bereits im Flugzeug. Hätte ich zu diesem Zeitpunkt Galdikas’ koprologische Studien zum Stuhlgang bei Orang-Utans schon gekannt – sie hatte ihnen unter anderem einen Tesafilmstreifen in die Analgegend geklebt und diesen dann unters Mikroskop gelegt –, ich hätte vielleicht schon eine Diagnose wagen können. So aber erkannte ich angesichts der orange-zimtfarbenen Flüssigkeit, die sich großzügig über die Decke auf meinem Schoß verteilte, allein auf Durchfall.
Orang-Utans sind die größten Obst- und Pflanzenfresser der Welt, sie verzehren über 300 Arten von Früchten, Rinden, Blumen, aber auch kleine Insekten und Honig. Ihr Überleben ist an das des tropischen Regenwaldes unlöslich gebunden. Patut war mit süßem Brot aufgezogen worden und sprach nicht einmal auf die Lieblingsspeise aller Orang-Utans an, die Durian, diese schwere, kinderkopfgroße Frucht, die verwest riecht und faulig schmeckt, und auch unter Einheimischen so beliebt ist, dass sich Bauern schon in den Baumwipfeln mit Orang-Utans um sie geschlagen haben. Vergeblich, die Bauern wurden aus den Wipfeln heruntergestürzt. Schließlich kann man gegen ein Tier, das neunzig Prozent seines Lebens in Bäumen zubringt, nicht dort gewinnen wollen.
Der Orang-Utan wächst langsam. Über zehn Jahre benötigt er bis zur Reife. In einer Erziehung, die ganz auf die Mutter ausgerichtet ist, entwickelt er eine Persönlichkeit, die sich durchaus mit menschlichen Charakterbezeichnungen fassen lässt. Danach war Patut ›verzogen‹. Mit der Überlegenheit des Schwächeren setzte er seine Nahrungswünsche durch, indem er sich fiepend abwandte oder verächtlich prustete und endlich immer wieder verlangte, getragen zu werden.
Währenddessen untersuchte er an mir alles, was ihm interessant vorkam, die helle Haut, Brille und Uhr, Knöpfe und Kragen. Zwischendurch führte er den Geruch auf den Fingerspitzen zur Nase und tastete, wie man es auch bei Begegnungen zwischen wilden Orang-Utans beobachten kann, gelinde schnarchend den Körper seines Hüters ab. Außerdem aß er ungeschickt: Seine Gestik, sein Augenreiben, Strecken, Abwischen, Rückenkratzen und Aufstützen, all das wirkte menschlich, aber seine Voraussicht war gering.
In einem Aufsatz zur Intelligenz der Orang-Utans hat Biruté Galdikas das kinderpsychologische Modell Jean Piagets auf ihre Primaten übertragen und festgestellt, dass bei wild lebenden Exemplaren nur ein verschwindend geringer Anteil der Verhaltensakte mit dem Intelligenzprädikat ›Werkzeuggebrauch‹ ausgezeichnet werden kann. Dafür setzen jedoch fast vierzig Prozent der beobachteten Akte immerhin kognitive Fähigkeiten voraus, so beim Füttern, im Nestbau, in der Mutter-Kind-Beziehung, bei Begegnungen und Bewegungsabläufen.
Die einzige Leistung dieser Art erbrachte Patut in der Nacht. Auf dem Boot hatte ich einen jungen Mann kennen gelernt, der ein bisschen Englisch sprach. Auch er war Wissenschaftler, verriet er mir, ja, mit seinen zweiundzwanzig Jahren war er nichts Geringeres als der größte Blutegel-Forscher Indonesiens. Für die Nacht lud er uns in das Haus seines Vaters ein, der als muslimischer Richter eine hohe Autorität am Ort und zugleich so freundlich war, den fünfzig Kindern vor dem Haus, die gekommen waren, den Weißen mit dem Orang zu sehen, bei Einbruch der Dämmerung etwas Essen hinauszubringen. Wenn wir über die Fensterleiste blickten, sahen wir sie da im Halblicht ruhig auf uns warten.
In dieser Nacht also gelang es Patut, durch zunehmendes Schaukeln das Gleichgewicht seines Korbes so geschickt zu verlagern, dass dieser kippte und seinem Insassen den Ausstieg und die Untersuchung des Hauses ermöglichte. Aber dieses Beispiel zählt nicht. Denn unter zahmen und halbwilden Orang-Utans hat man so zahlreiche hoch entwickelte Formen praktischer Intelligenz beobachtet, dass man gezwungen ist, sie auf das Prinzip der Nachahmung zurückzuführen.
Mehrfach haben Affen später im Lager versucht, das Schloss zu meiner Baracke mit einem Stöckchen zu öffnen – genauso wie sie es mich mit meinem Schlüssel hatten tun sehen –, und einmal wurde ich Zeuge, als ein Weibchen in den frühen Morgenstunden einen Einbaum vom Ufer nicht nur losmachte, sondern sich auch hineinsetzte, mit den Armen ruderte und lenkte, anschließend das mit Wasser voll gelaufene Boot am Ufer durch starkes Schaukeln leerte, um in ihm schließlich stromabwärts zu reisen. Nach eintägiger Suche wurde das Boot später gefunden. Es war am Ende der eigenmächtigen Ausfahrt schlicht versenkt worden.
Galdikas hat Jahre damit zugebracht, intelligente Akte bei wilden Orang-Utans aufzuspüren. Die Ausbeute war nicht groß, trotzdem korrigierte das Resultat die Forschung, die den Orang-Utan als geistig unbeweglich und träge beschrieben hatte. Statt dessen entwarf die Forscherin das Bild eines von zahlreichen zweckbestimmten Abstraktionsvorgängen bestimmten Tierlebens, das in den kleinen Akten des Nestbaus, der Errichtung von Regenschutz, der Nahrungsbeschaffung und Ähnlichem hohe geistige und physische Beweglichkeit entfaltet.
Am nächsten Morgen fand ich am Fluss zwei Bootsleute, die bereit waren, uns nach Tanjung Puting, in das legendäre Camp der Biruté Galdikas, zu bringen. Niemand von all den Leuten, die uns inzwischen in Augenschein genommen hatten, zeigte dem Affen Grimassen oder versuchte, ihn zu Klamauk zu animieren. Bei den Dayaks, den Ureinwohnern Borneos, liegt ein Tabu auf dem Inzest und auf der Lächerlichmachung von Tieren. Bei Verstoß droht dem ganzen Dorf die Strafe der Versteinerung.
Außerdem wirkt der Orang-Utan schon durch die Schwerfälligkeit seiner Bewegung und die gemessene Mimik einigermaßen unanfechtbar. Bereits im 19. Jahrhundert schreibt ein Beobachter: »Die gewöhnlichen Affen erscheinen durch die carrikierte Beweglichkeit ihrer Gesichtszüge wie Verrückte, die anthropomorphen dagegen in der Tat als Orangutangs oder Waldmenschen.« Zweifellos reagiert der Mensch im Vergleich zum Orang-Utan überdeutlich, sogar exaltiert. Vermutlich versteht der Affe ihn deshalb besser, als er den Affen versteht. Aber vielleicht ist auch einfach mehr Affiges im Menschen als Menschenähnliches im Affen.
Zweimal schoben sich auf unserer Bootsfahrt meterlange Schlangen, zweimal Krokodile ins Wasser. Sobald sich eine Wasserpflanze in unsere Schiffsschraube flocht, sprang der Bootsmann trotzdem mit der Machete bewaffnet in die undurchsichtige Brühe und befreite uns in mehreren Tauchgängen, während der Maschinist von oben zusah, dass sich kein Angreifer näherte. Ehemals Feinde der Primaten, sind Schlangen und Krokodile heute allerdings selbst bedroht. Ihr Hauptfeind ist auch der des Orang-Utans: der Mensch.
Patut kehrte in sein altes Habitat ohne eine erkennbare Regung zurück. Der erste wilde Orang-Utan, den wir sahen, stand unter der gleißenden Mittagssonne aufrecht hoch oben in einem schneeweißen Baumgerippe. Er hatte aus den Luftwurzeln eines parasitären Organismus Zweige für sein Nest gerissen und brach kurz darauf in der Nachbarschaft zwei tote Äste ab, um sie zu Boden zu schleudern. Auch das Deponieren von Zweigen auf dem Boden, das Hämmern auf leere Strünke oder Umstürzen von Bäumen folgt nicht blinder Zerstörungswut. Vielmehr werden solche lärmenden Aktionen von den Affen als ein Kommunikationsmittel benutzt, durch das sie ihr Territorium bezeichnen. Häufig erkennt man den Lebensraum der Orang-Utans an den Spuren brachialer Gewalt, die sie in der Natur hinterlassen.
Orang-Utans sind kaum geselliger, als es ein Säugetier sein muss, heißt es. Sie sind ganz sicher wesentlich einsamer und zugleich melancholischer als Schimpansen und Gorillas.
»Wenn Sie von der Würde dieser Tiere so eingenommen waren, wenn Sie sie in so vielen Belangen als höherrangige Kreaturen einzuschätzen gelernt haben, wie konnten Sie sich dann überhaupt den Menschen wieder zuwenden?«, habe ich Biruté Galdikas später gefragt.
»Ich habe mich ihnen vor allem wieder zugewandt«, erwiderte sie prompt, »nachdem ich feststellte, wie wenig sich Orang-Utans untereinander zu sagen haben.«
Vor allem die erwachsenen Männchen sind solche Einzelgänger, dass Begegnungen zwischen ihnen nur etwa einmal pro Jahr beobachtet werden. Durch ihre Langrufe, kilometerweit hörbare Signale, machen sie die geschlechtsreifen Weibchen auf sich aufmerksam und grenzen das eigene Gebiet gegenüber anderen Männchen ab. Da sich die Weibchen weitgehend still verhalten, ist es also offenbar ihnen überlassen, sich den Männchen anzubieten. Diese wiederum akzeptieren nur Weibchen, von deren Fruchtbarkeit sie sich zuvor überzeugt haben.
Bei halbwüchsigen Orang-Utans sind dagegen Vergewaltigungen unfruchtbarer Weibchen keine Seltenheit. Einmal kam ich erst in der Dämmerung zu meiner Baracke zurück und konnte gerade noch zusehen, wie zwischen den Pfählen, auf denen die Baracke stand, ein Weibchen von hinten hart und kurz drangenommen wurde. Die Erregung des halbwüchsigen Männchens war so groß, dass ihm fast die Augen aus dem Kopf traten. Das duldende Weibchen hatte sich dagegen als Beißsperre eine leere Coladose in das Gebiss geschoben und klopfte sich nach überstandener Prozedur den Staub aus dem Beckenfell.
Unter Erwachsenen gibt es dagegen keine Erschleichung, nur ein Ritual von Werbung und Unterwerfung, bei dem entweder das Weibchen wählt oder der Kampf zwischen Männchen entscheidet. Üblicherweise offeriert sich das Weibchen, indem es sein Geschlecht zeigt, das des Männchens in die Hand oder in den Mund nimmt oder sich ihm rückwärtsgehend und -schauend nähert. Nur sehr selten übernimmt das Männchen eine direkte Vaterrolle, eher entwickelt sich eine Art weiblicher Verteidigungspolygamie.
Das Camp von Tanjung Puting kündigt sich durch verwüstete Baumkronen, niedergebrochenes Gehölz und zerstörte Schonungen an. Manche Forscher sprechen von der Zerstörungswut der Orang-Utans, andere nennen es ihr Konstruktionstalent, ihren Bauwillen. Jedenfalls hat Biruté Galdikas, die zu Anfang wohl an antiautoritäre Kohabitation glaubte und keinerlei Grenze zwischen ihrem und dem Lebensraum der Affen ziehen wollte, inzwischen Schlösser an den Türen. Auch vor der Zerstörung ihres Aussichtsturms am Fluss und den Versuchen, die Dächer ihrer Baracken zu zertrümmern, muss sie kapitulieren, selbst wenn sie solche Gewaltakte feinsinnig als Kommunikationsversuche erkennen und beschreiben kann.
Nach tagelanger Reise also kam unsere kleine Gesellschaft endlich im Camp der Biruté Galdikas an, der Bootsmann, der Maschinist, der Blutegel-Forscher, Patut und ich. Auf dem etwa drei Meter hohen Steg, über den man das Camp vom Fluss aus erreicht, saßen im Sonnenlicht ein paar halbwüchsige Orang-Utans. Zwei von ihnen schlossen ihre großen Hände um meine Knöchel, als ich passieren wollte, einer versuchte, den Gürtel zu lösen, ließ aber rasch ab. Der Handabdruck um mein Fußgelenk blieb noch länger weiß.
Diesen Steg erkannte ich gleich als den aus der Reportage in »National Geographic«. Als uns Biruté aber mit zwei Mustern für ein Speisepflanzen-Herbarium entgegentrat, hatte sie wenig Ähnlichkeit mit ihrem Bild von damals. Verwahrlost, ein wenig plump in der Erscheinung und völlig gleichgültig gegenüber ihrer Wirkung, teilte sie mir bereits im dritten Satz mit, allein Patut rechtfertige meinen Aufenthalt in ihrem Camp; nur ihm hätte ich es zu verdanken, wenn ich nicht sofort wieder rausflöge wie alle anderen Besucher, die ihre Arbeit hier nur stören würden. Unfreundlich war das nicht gemeint, eher unverblümt, wie es nach so vielen Jahren in diesem Lebensraum nicht erstaunlich war.
Ihr Umgang mit Affen dagegen ist einzigartig, unverspielt und ebenbürtig, und man kann sich nicht helfen, man vermutet eine gemeinsame Sprache dahinter.
»Wissen Sie, was er hat?«, fragte sie.
Aber bevor ich etwas von Durchfall und Juckreiz sagen konnte, war ihre erste Diagnose fertig:
»Scabies.« Krätze!
»Und wissen Sie, wer es auch hat? Sie!«
Auf meinen Unterarmen, auf denen Patut die längste Zeit unserer Reise zugebracht hatte, waren Entzündungen entstanden. Da wir uns am Abend zuvor an einer Wasserstelle am Fluss wenige Meter unterhalb der Frauen-Toilette waschen mussten, meinte ich, den Juckreiz auf verunreinigtes Wasser zurückführen zu können. Statt dessen war es Patut, den ursprünglich Menschen angesteckt hatten, gelungen, wenigstens eine Krankheit an den Menschen zurückzuerstatten.
»Wie heißt er?«
Ich sagte es ihr, aber sie schüttelte den Kopf. So hieß schon einer ihrer Mitarbeiter.
»Wenn er überlebt, heißt er Roger«, bestimmte sie unwirsch.
Zwei Frauen wurden anschließend angewiesen, meine Kleider zu kochen. Die beiden kicherten, als hätte man ihnen geraten, mit Pfeffer und Salz abzuschmecken. Offenbar hielten sie das Kochen von Textilien für eine dieser typischen versponnenen Ideen der »white monkeys« oder »white devils«, wie die Weißen hier auch genannt werden.
Aber da das Kochen der Wäsche allein nicht reicht, werde ich am nächsten Tag mit Galdikas und mit Patut zu einem Dschungeldoktor aufbrechen, der sich unsere Erkrankung ansehen soll. Eine lange Schlange Einheimischer wartet vor dem Paravent, hinter dem der Arzt sitzt, der auch nichts anderes diagnostizieren kann als Krätze vulgaris. Wir besteigen also wieder das Boot und begeben uns in einer Tagesreise in einen kleinen Flecken mit Apotheke. Zehn Tuben Salben, gerecht verteilt auf Affe und Mensch, sollten ihre Wirkung nicht verfehlen. Da es zu spät für eine Rückreise ins Lager ist, übernachten wir in einer kleinen Holzarbeiterunterkunft. Über der Rezeption hängt der Panzer einer riesigen Meeresschildkröte.
»Die«, bellt Galdikas den eingeschüchterten Portier an, »nehmen Sie sofort runter, und wenn ich sie beim nächsten Mal wieder dort hängen sehe, folgt die Anzeige!«
Der Mann gehorcht, während sie noch spricht. Dass das Tier ja schon tot ist und dort vielleicht Jahre vor Erfindung des Artenschutzes aufgehängt wurde, ändert gar nichts für sie.
»Man muss jeden Einzelnen daran gewöhnen, dass man mit aussterbenden Arten keine Räume schmückt.«
Natürlich war die Freude der Forscherin über den neuen Schützling groß, aber weil der Tod des Orang-Utans durch den des tropischen Regenwalds bestimmt wird, gilt heute dem Wald ihr erstes Augenmerk, und sein Zustand lässt sie enttäuscht, bitter, manchmal höhnisch wirken.
Für Biruté, die hierher kam, um Menschenaffen zu studieren, haben persönliche Interventionen bei Regierungen und der Weltbank eine Bedeutung angenommen, die sie sich nie hätte träumen lassen. Sie macht ihren Auditorien nicht wie Fossey minutenlang die Schreie des Waldes vor, spuckt nicht, wie diese es tat, vor schicken Naturschützern auf den Boden und verkehrt in ihrem ökologischen Kampf, anders als die tote Freundin, immerhin noch mit Verantwortlichen im Rang eines Vizepräsidenten. Dazu war sich Dian Fossey zu schade gewesen. Niemand kann über die Persönlichkeit der Freundin besser Auskunft geben als Galdikas, die einen leidenschaftlichen Nachruf geschrieben hat und den Tod der großen Gorilla-Forscherin heute auf ein von ihr entwendetes und vom Mörder wieder in Besitz genommenes Amulett zurückführt.
Nein, sie selbst ist diesseitiger, praktischer, auch politischer. Ihr Verhältnis zu den Affen ist anders als bei der legendären Toten ohne Zweideutigkeit, und angesprochen auf die Grünen sagt sie mit Nachdruck:
»Ich bin zu der Auffassung gekommen: Je radikaler desto besser.«
Eine Auffassung, die von den Grünen selbst wohl kaum jemand teilt. Für Biruté Galdikas ist selbst Beobachtung und Forschung Luxus geworden gegenüber der Erhaltung. Dadurch hat sich ihr Leben entscheidend verändert. Die Romantik des entrückten, weltfremden Forscherinnenlebens ist vorbei.
Trotzdem gehen noch täglich ihre zwanzig Mitarbeiter vor Morgengrauen in den Dschungel, liegen in Hängematten unter den Nistbäumen der wilden Orang-Utans und tragen in ihre Büchlein ein: »9.00 Uhr: bewegt sich, 9.30: isst ein Blatt, 9.45: vergewaltigt sein Weibchen, 10.20: wechselt den Baum« etc., trotzdem koordiniert Galdikas diese Expeditionen, oft im Tarnanzug zwischen den Gruppen vermittelnd, und schreibt ihre Aufsätze: über den Langschrei, die Paarung, die Bewegung, den Kot.
Anders als bei Jane Goodall ist kein populäres Buch, keine Gesamtdarstellung, nichts Biographisches, nichts Breitenwirksames dabei. Mühevoll gewonnen, mögen ihre Forschungsergebnisse dem Laien wenig spektakulär erscheinen, aber für die Forschung sind sie von elementarer Bedeutung: Nein, Orang-Utans leben keineswegs so unbeweglich wie früher angenommen, doch, die Weibchen können auch bei der Vergewaltigung empfangen. So lauten zwei der wenigen thesenartigen Ergebnisse zum Leben des Orang-Utans, die wir von ihr haben.
Im übrigen häuft sie Material für andere auf; die Einsamkeit des Pongiden: ausgedrückt in den Prozentzahlen seiner Sozialkontakte; die Paarung: zerlegt in Kombinationen, Fristen, Intervalle; die Kommunikation: dargestellt in Kurven und Frequenzen – lauter dreißigseitige Texte aus 12000 bis 45000 Beobachtungsstunden und einem Leben als Voraussetzung, das man in diesen Texten kaum erkennt und das für die meisten unvorstellbar bleibt: Ein Leben, das fast die Einsamkeit eines erwachsenen Orang-Utans reproduziert und das sich in der überbordenden und gefährlichen Monotonie des immer gleichen wilden Areals ständig erschöpft, ein Leben, das Männer eben nicht auf sich nehmen, so meint Galdikas, weil man es nicht nach vier Jahren abbrechen kann und weil es schnelles, thesenhaftes Publizieren nicht erlaubt. So gewinnen andere ihre Theorien aus dem Material, das Galdikas liefert, und das Beste, das ihr passieren könnte, wäre am Ende, wenn es sich um Materialkomplexe und um Theorien handelte, mit deren Hilfe man zur Rettung der Orang-Utans wie des Regenwaldes beitragen könnte.
Abends präsidiert sie beim Essen. Ihre Mitarbeiter sprechen hauptsächlich vom Wald. Einer muss behandelt werden, weil ein giftiger Tausendfüßler über seine Hand gelaufen ist, ein anderer hat eine drei Meter lange Schlange beim Schwanz ergriffen und in die Länge gezogen, so träge war sie nach dem Fressen. Einer bereitet die Quarantäne für Patut vor, ein nächster erzählt von einer neuen Käferart, die er aufgespürt hat. Sie alle sind in diesem Wald geboren. Ihre Erzählungen unterbrechen sie ganz selbstverständlich, indem sie tierische Bewegungsformen und Reaktionen vorspielen, und sie verstehen sich. Man erkennt Familienzusammenhänge unter ihnen schlechter als unter den Orang-Utans im Lager.
Auch der Ehemann von Galdikas sitzt dabei und schnitzt schweigend an einem dreisaitigen Musikinstrument. Er ist klein, stark und gedrungen, ein echter Waldmensch, an dessen Seite ich in den nächsten Wochen erahnen werde, was es heißt, den tropischen Regenwald zu lesen. Nie zuvor und nie später habe ich einen Menschen so selbstverständlich mit seinem Habitat verschmelzen sehen.
Als wir ein paar Tage darauf mit dem Boot zu einer mehrtägigen Unternehmung aufbrechen, wendet sich Galdikas auf dem Steg noch einmal zu ihrem zurückbleibenden Gatten und will zum Abschied geküsst werden. Ihm ist es peinlich. Die Bootsleute stehen und warten.
»Das macht er nicht, aha …«. Sie blickt vor sich hin und denkt nach. Dann bittet sie noch einmal.
»Nein, er will nicht. Das ist interessant, die Einwohner von Kalimantan, wissen Sie …«, und es folgt ein Vortrag, den erst das Bellen des Motors unterbricht.
Für einen Moment war sie ganz weich, jetzt ist sie wieder ganz Beobachterin.
Als wir zwei Tage später zurückkommen, springt ein Hund jauchzend an ihr hoch.
»Was ist mit dem Hund?«, fragt sie, »wessen Hund ist das?«
»Ihrer«, antwortet einer der Männer.
»Ach«, sie streichelt ihn zerstreut, »sie sehen alle gleich aus.«
Monate nach meiner Rückkehr erhielt ich einen Brief des größten indonesischen Blutegel-Forschers. Er war inzwischen ausgezeichnet worden für Arbeiten zur Infarkt-Prophylaxe durch Egel. Aber das erwähnte er nur am Rande. Beigelegt hatte er seinem Brief einen Zeitungsausschnitt. Er zeigte ein mir wohlbekanntes Gesicht. »Little Roger ist jetzt berühmt«, schrieb der Forscher in seinem gebrochenen Englisch. »Er ist soeben von der hiesigen Zeitung interviewt worden.«
Auf dem kleinen Foto sah man in die Augen eines geretteten, aber offenbar unheilbaren Melancholikers.
Der Unberechenbare
John Malkovich auf der Burg des Marquis de Sade
Ende der achtziger Jahre erschrak Amerika vor sich selbst, New York erschrak vor der Verderbtheit der Provinz. Da war aus Chicago – aber gegründet in einer Kleinstadt im Mittleren Westen – eine Theatertruppe in die Stadt gekommen, die sich »Steppenwolf« nannte. Mit Hermann Hesse hatten die Begründer trotzdem nicht viel im Sinn, und was sie der Stadt darboten, hatte mit der mundgemalten Transzendenz des Beatnik-Paten auch nichts zu tun.
»Steppenwolf« brachte »True West«, ein bereits durchgefallenes Stück von Sam Shepard auf die Bühne, so physisch, so real, so »rock ’n’ roll«, dass selbst den Theaterkritikern das Theater plötzlich wieder wichtig vorkam und die Psychologen in die Garderobe des Hauptdarstellers pilgerten, um ihm merkwürdige Fragen zu stellen: »Wie machen Sie das?«, »Wo kommt diese Bosheit her?«, »Sind Sie wirklich so gewalttätig?«
Der Hauptdarsteller lächelte mit dem Charme einer Boa constrictor und sagte leise:
»Es ist nichts. Ich weiß nicht. Ich kopiere doch nur meinen Bruder.«
Seinen Bruder in Benton, Illinois, der ihn geschlagen hatte, wie sein Vater ihn geschlagen hatte, wie sich die ganze Familie so geschlagen hatte, dass es den wunderlichen Hauptdarsteller noch heute sanft an einen Krieg erinnert. Sogar durch den Ort waren sie gelaufen, einer hinter dem anderen her, in der Absicht, sich zu schlagen.
Wer aber war dieser Theaterschauspieler, der sich in »True West« jeden Abend eine Bierdose so hart gegen den Schädel schlug, dass das Publikum Angst bekam? Der Mann, der auf den Straßen von New York überfallen wurde, sich ein Buschmesser kaufte und den Dieb jagte, bis er ihm das neue Messer an die Kehle drücken konnte? Der geschiedene Gatte der »Steppenwolf«-Schauspielerin Glenne Headly, die ihm den Kosenamen »Wurzel allen Übels« gab? Der Kunde, der in Rom aus Ärger über eine nicht erledigte Näherei eine Änderungsschneiderei verwüstete? Sohn eines gewalttätigen Vaters, Bruder von vier schlagkräftigen Geschwistern, die gemeinsam als die schwarzen Schafe in die Geschichte von Benton, Illinois, eingingen?
Malkovich ist nicht Schauspieler geworden, er war es immer und schaufelt seither alle angestaute Erfahrung aus sich heraus.
»Sie sollten Sprecherziehung nehmen«, empfahl ihm ehedem sein Schuldirektor. Daraufhin gründete Malkovich ein Theater, in dem Menschen, die so etwas empfahlen, keinen Einfluss hatten.
Als die »Steppenwolf«-Kompanie Ende der Achtziger aus dem Nichts in die amerikanischen Großstädte kam und es dem Publikum (auch deshalb) angst und bange werden ließ, weil niemand verstand, woher diese Wut kam, die sich in der Provinz aufgestaut hatte und nun in einem expressiven Amoklauf in die Metropolen schwappte, da glaubte man, das Theater erfahre hier eine grundsätzlich neue Definition, und die Journalisten löcherten selbst die Garderobenfrauen: Wie macht dieser Malkovich das?
Dieser Malkovich verstand den Wirbel nicht und verweigerte die Antwort. Noch heute trägt er ein amüsiertes Staunen zur Schau, wenn man ihm mit Fragen zu seiner Technik kommt. Dann verspottet er Method Actors, die monatelang in Polizeistationen arbeiten müssen, um zu wissen, wie man einen Notruf entgegennimmt, und kann nicht verstehen, dass sich Debra Winger durch ihre Arbeit an Bertoluccis »Himmel über der Wüste« fast in die Nervenheilanstalt katapultierte, während er selbst neben dem Set schnitzte, Handarbeiten knüpfte oder Weihnachtskarten schrieb.
Malkovichs Ansatz ist ein anderer. Er traut nicht dem Erlernten, sondern überlässt sich der »diktatorischen Kraft« der Erfahrung. Er kommt aus dem Nichts und verwandelt sich in alles, er ist ein Mann ohne Eigenschaften, also mit allen.
Sechs Jahre nach »True West« und ein paar kleinere Filmrollen weiter findet man John Malkovichs durchtriebenes Gesicht auf dem Plakat von Stephen Frears »Gefährliche Liebschaften« zwischen dem von Glenn Close und Michelle Pfeiffer. Die Liebschaft mit ihr zerrüttet jenseits des Films Malkovichs Ehe, und der Kritiker der »New York Times« verliert seinen untadeligen Ruf. Er nennt die Darstellung des Vicomte de Valmont schlicht »deplatziert und vulgär«.
»Ein wirklich guter Schreiber«, kommentiert Malkovich maliziös, »sogar wirklich humorvoll, nur leider ohne einen Funken Geschmack. Was halten die Leute eigentlich für historische Wahrheit? Dieser ›Stil‹, mit dem sie einen zwangsernähren, lenkt doch nur von Wichtigerem ab. Nein, ich glaube nicht, dass die Leute im 18. Jahrhundert uns so furchtbar unähnlich gewesen sind.«
Als sich ihm am Set zu »Gefährliche Liebschaften« dann ein Historiker nähert und sagt:
»Ich kenne zweitausend Arten der richtigen Verbeugung im 18. Jahrhundert«, verbeugte sich Malkovich, noch als Valmont, und erwiderte:
»Dann kennen Sie jetzt zweitausendundeine.«
Lachhaft, »authentisch« sein zu wollen:
»Niemand war dabei. Niemand kennt das historisch Echte.«
Es interessiert ihn nicht, als personifiziertes Gebärdenmuseum durch einen Kostümschinken zu laufen. Seine Figuren sind alle Zeitgenossen und gehören dem Heute, weil sie von einem heutigen Schauspieler generiert werden. Sein Valmont wäre als Rokoko-Verführer nicht weniger authentisch mit Kaugummi im Mund.
Und dann diese andere Schauspieler-Doktrin: Neben der historischen Authentizität der Figur gehe es um ihre innere Notwendigkeit. Als gäbe es in jeder Situation nur eine richtige Interpretation! Zur Verzweiflung hat er Jane Campion in »Portrait of a Lady« gebracht, als er ihr immer neue Versionen seiner Figur anbot.
»Aber Sie müssen sich doch für eine Variante entschieden haben«, klagte die Regisseurin.
»Vielleicht für diese?«, entgegnete er und zog eine weitere aus dem Ärmel.
»Also die Gefühle bewegen sich ein bisschen, aber Eifersucht bleibt Eifersucht?«
»Ja, nur redet man vielleicht etwas freizügiger darüber. Wenn ich Hitler, den Verführer spielen wollte, ich dürfte ihn nicht historisch wahr spielen, nicht so, wie er in den Filmdokumenten wirkt, da ist er lächerlich. Nein, –«
»Hätte er Sie als Kind verführt?«
»Im Ernst: Hitler, Göring, Goebbels – wenn ich die als Kind gesehen hätte, ich glaube, die hätten mich nicht verführt! Nein, Hitler dürfte man nicht historisch wahr spielen, man müsste vielmehr zeigen, wie er heute als Verführer wirken würde.«
Das ist bezeichnend: John Malkovich hat die Gabe, alles in Gegenwart zu verwandeln. Die »Gefährlichen Liebschaften« waren noch nicht lange aus den Kinos verschwunden, da hatte ich ihn 1990 in London auf der Bühne gesehen in »Burn This«, langhaarig, fett, riechbar. Er spielte wie der Leibhaftige, spuckte in die ersten Reihen, gefährdete jeden einzelnen Zuschauer persönlich, und keiner konnte und durfte den Blick von ihm wenden. Nie zuvor oder später habe ich einen Schauspieler so einschüchternd physisch spielen sehen.
Hier wie im Film feierte er seinen Erfolg mit den Bösen, mit manipulativen Charakteren, seine Autorität wirkt wie aufgeschobene Gewalt. Ja, wenn etwas stimmte an dem Kritikervergleich mit dem jungen Brando, dann war es die sexuelle Ausdünstung, dieses Mann und Frau gleichermaßen Schmeckende seiner Geschlechtlichkeit, das selbst von den Gentlemen am Pausen-Pissoir kommentiert wurde, und Malkovich liebt es bisweilen, den Dingen eine sexuelle Wendung zu geben, wenn man es am wenigsten erwartet.
Als er in Wolfgang Petersens »In the Line of Fire« von Clint Eastwood mit dem blanken Revolver bedroht wird, verpasst er dem stählernen Lauf eine wahrhaft schweinische Fellatio. Spontan.
»Warum?«
»Ich wollte, dass es auch sexuell einschüchternd wirkt.«
»Und?«
»Und ich wollte, dass sich Clint amüsiert.«
Mission erfüllt.
Trotzdem ist Malkovich mehr als der intelligente, selbstbewusste Sonderling mit querulantischen Zügen. Seine Magie hat, eben ähnlich wie bei Marlon Brando, am meisten mit seiner weichen Seite, seinem Androgynen zu tun.
»Mit Menschen ohne ausgeprägte weibliche Seite verstehe ich mich nicht«, sagt Malkovich.
Was verrät uns das über Don DeLillo und Tom Waits, die er zu seinen engen Freunden zählt? Genießen sie seine Gesellschaft, weil es mit Malkovich so leicht ist, multiple Persönlichkeit zu sein, sich zu verwandeln, weil es so aufregend ist, durch seine Augen zu sehen, auch oder gerade weil so Vieles daran schlicht weniger erlebt als erlitten scheint?
Als Glenne Headly ihn verließ, weinte Malkovich, und er weinte ein ganzes Jahr lang. Klinisch gesprochen, versank er in Depressionen. Dieser Mann, der seit einem Jahrzehnt manchmal zweimal wöchentlich zum Psychiater läuft und immer noch Nägel kaut, bändigt zahllose Charaktere in sich, hat sich aber selbst nicht in der Gewalt?
Inzwischen ist er schlank und kahl, aber nicht minder einschüchternd. Er gilt als scheu, als schwer zugänglich. Aus all den Jahren seines internationalen Ruhms gibt es ein einziges Fernsehporträt über ihn, dreißig Minuten lang, vor vielen Jahren von der BBC