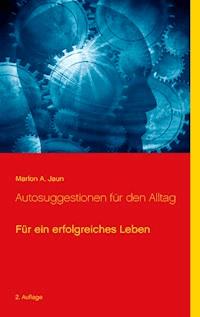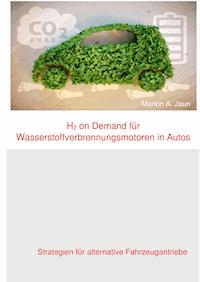
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Energiewende ist beschlossen und der Weg, hin zu CO2-neutralen Autos scheint klar zu sein. Nach wie vor dominieren Benzin- und Dieselfahrzeuge die Straßen. Warum dies so ist, zeigen die Marktkräfte in der zersplitterten Branche des Fahrzeugmarktes auf, welche systematisch analysiert und aufgezeigt werden. In einer Technologieanalyse werden verschiedene Antriebssysteme untersucht und in einer SWOT Analyse dargestellt. Diese zeigt auf einen Blick, wo die Vor- und Nachteile, aber auch die Stärken und Schwächen der einzelnen Antriebssysteme liegen. Wasserstoff scheint bisher der einzige Energieträger zu sein, welcher CO2-neutral verbrennt und bei der idealen Verbrennung lediglich Wasser entstehen lässt. Neben Einsatzgebieten als Treibstoff in Fahrzeugen, kann Wasserstoff auch zum Heizen genutzt werden, wobei die bestehende Erdgastechnologie verwendet werden kann. Trotz der Vorteile hat Wasserstoff als Energieträger den Markt noch nicht durchdringen können. Im Fahrzeugmarkt sind bisher verschiedene Probleme im Bereich der Speicherung des Wasserstoffs, der Reichweite, dem Tankstellennetz und der Herstellkosten für Wasserstoff entstanden. Um die bisherigen Probleme mit Wasserstoff als Treibstoff in Fahrzeugen zu lösen, wurde die Idee verfolgt „Wasserstoff on Demand“ direkt im Fahrzeug zu produzieren. Dabei wurden verschiedene Wasserstoff Herstellmethoden untersucht, welche für ein On-Demand-System geeignet sein können. In einer Machbarkeitsanalyse wurde festgestellt, dass ein Wasserstoff-on-Demand System theoretisch funktioniert. Es ist entweder möglich, den Benzin/Dieselverbrauch mit Wasserstoff zu 100% zu ersetzen, oder aber den Benzin/Dieselverbrauch enorm zu reduzieren. Bei beiden Varianten wird der Wasserstoff direkt im Fahrzeug hergestellt. In einem Fließbildschema wurde ein mögliches System dargestellt, wie dies in der Praxis zum Einsatz kommen könnte. Die Machbarkeit eines solchen Systems muss mit praktischen Versuchen erst noch bestätigt werden. Dieses Buch dient, um Strategien für den alternativen Fahrzeugmarkt zu entwickeln, Technologien weiter zu analysieren, aber auch für weitere Forschungsarbeiten. Für Entwicklungsingenieure dient dieses Buch, um ein Elektrolysesystem on Demand zu entwickeln und in praktischen Versuchen zu testen. Für Autohersteller besteht die Möglichkeit, mit einem H2-on-Demand-System die CO2-Grenzwerte einzuhalten und den CO2-Ausstoß Ihrer Fahrzeuge weiter zu senken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
Marlon A. Jaun hat eine General Management Ausbildung mit Fokus auf Business Engineering und Unternehmensprozessen absolviert und besitzt ein grosses Know-how aus der chemisch / pharmazeutischen Produktion, insbesondere als Chemikant und als Leiter Technikum Verfahrensentwicklung. Der Autor war weiterhin als Business Support Manager / Fachingenieur im Bereich Entsorgung radioaktiver Abfälle und der Energieindustrie (Wasserkraft) tätig. Marlon A. Jaun hat einen Executive MBA Abschluss, ist zertifizierter Ingenieur Eureta, Dipl. Techniker HF Betrieb und Unternehmung (Betriebsökonomie) und hat zwei Berufsausbildungen mit EFZ (Laborist- und Chemikant), mit Fokus auf Chemie, Technik und Naturwissenschaften abgeschlossen. In seiner Freizeit ist Marlon A. Jaun seit über 20 Jahren passionierter Taucher auf der Stufe PADI OWSI Tauchinstruktor und interessiert sich sehr für die verschiedenen Unterwasser-Lebewesen. Er versteht es verschiedene Wissensgebiete geschickt miteinander zu verbinden, so dass ein Gesamtzusammenhang entsteht.
Marlon A. Jaun Dipl. Executive MBA FH Business Engineering
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Management Summary
Einleitung
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
1.2 Bevölkerungswachstum, eingelöste Personenfahrzeuge, CO
2
Emissionen
1.3 Szenarien zur CO
2
Reduktion bei Personenfahrzeugen
Theorie
2.1 Branchenentwicklung alternative Fahrzeugantriebe
2.1.1 Bisherige Entwicklung
2.1.2 Die Triebkräfte des Branchenwettbewerbs
2.1.3 Druck durch Substitutionsprodukte
2.1.4 Zersplitterte Branchen
2.1.5 Strategische Fallen in einer zersplitterten Branche
2.2 Technologieanalyse von Antrieben für Personenwagen
2.2.1 Benzinmotor
2.2.2 Dieselmotor
2.2.3 Erdgasmotor
2.2.4 Wasserstoffverbrennungsmotor
2.2.5 Wasserstoffverbrennungsmotor mit Methanol
2.2.6 Brennstoffzellenantrieb
2.2.7 Rein elektrischer Antrieb
2.2.8 Einteilung nach Technologielebenszyklen
2.2.9 Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren, SWOT Analyse
2.3 Technologie-Analyse Wasserstoff Herstellmethoden
2.3.1 Vision on Demand Systeme
2.3.2 Wasserstoffherstellung durch Elektrolyse von Wasser
2.3.3 Wasserstoffherstellung aus Wasserdampf
2.3.4 Wasserstoffherstellung aus Erdgas
2.3.5 Wasserstoffherstellung aus Methanol
2.3.6 Wasserstoffherstellung aus Ammoniak
2.3.7 Wasserstoffherstellung aus Aluminium
2.3.8 Weitere Wasserstoff Herstellmethoden
2.3.9 Bewertung der Wasserstoffherstellverfahren für on Demand Systeme
2.4 Elektrolyse on Demand
2.4.1 Faraday’sches Gesetz
2.4.2 Benzinäquivalent
2.4.3 Alternatorleistung
2.4.4 Machbarkeitsanalyse
2.4.5 Einspritzanlage mit Lambda (λ)-Regelung und Wasserstoff
2.4.6 Auto starten bei 100% Wasserstoff on Demand Betrieb
2.4.7 Ausblick
Methodologie
3.1 Korrelationsanalyse
3.2 Regressionsanalyse
3.3 5 Wettbewerbskräfte nach M.Porter
3.4 Heizwerte
3.5 Chemisch Stöchiometrische Berechnungen
3.6 Allgemeines Gasgesetz
3.7 Technologielebenszyklen, S-Kurven Konzept, Strategietypologisierung
3.8 SWOT Analyse
3.9 Faraday`sches Gesetz
3.10 Ohm`sches Gesetz
3.11 Transformator Übersetzungsverhältnisse
3.12 ISO Kennzeichen
Ergebnisse / Resultate
4.1.1 Resultate
4.1.2 Skizze H
2
on Demand System zur Herstellung aus Elektrolyse
Diskussion
Konklusionen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 CO2 Ausstoss durch Personenwagen in Mio. t. (M.Jaun, 2015)
Abbildung 2 Szenarien zur CO2 Reduktion bei Personenwagen (M.Jaun, 2015)
Abbildung 3 Anzahl eingelöste Personenwagen nach Treibstoffart 2014 (M.Jaun, 2015)
Abbildung 4 Die Triebkräfte des Branchenwettbewerbs
Abbildung 5 Bestehende Marktkräfte Personenfahrzeuge (M.Jaun, 2015)
Abbildung 6 Aufbau eines Otto-Viertaktmotors
Abbildung 7 Chemische Reaktion im Methanol-Reformer und in der Brennstoffzelle
Abbildung 8 Aufbau und Wirkungsweise einer Brennstoffzelle
Abbildung 9 Komponenten im Brennstoffzellen-Fahrzeug
Abbildung 10 Komponenten des Elektrofahrzeugs
Abbildung 11 Lade/Entladewirkungsgrad verschiedener Batterien
Abbildung 12 Tesla Roadster
Abbildung 13 Commuter Cars
Abbildung 14 Das Technologielebenszykluskonzept
Abbildung 15 Das S-Kurven-Konzept
Abbildung 16 Strategietypologisierung anhand des Innovationsobjektes
Abbildung 17 Elektrolyse von Wasser (M.Jaun, 2015)
Abbildung 18 Energieaufwand für H2-Produktion in Abhängigkeit der Temperatur
Abbildung 19 Blockschema Dampfspaltung mit Nuklearenergie
Abbildung 20 Transformator, Kerntransformator
Abbildung 21 Funktionsschema Einspritzanlage mit Lambdaregelung
Abbildung 22 Formel Berechnung Korrelationskoeffizient
Abbildung 23 Das Technologielebenszykluskonzept
Abbildung 24 Das S-Kurven-Konzept
Abbildung 25 Strategietypologisierung anhand des Innovationsobjektes
Abbildung 26 Skizze H2 on Demand für Wasserstoffverbrennungsmotoren (M.Jaun, 2016)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Vergleich der statistischen Istwerte (M.Jaun, 2015)
Tabelle 2 Korrelation Anteil eingelöster Personenwagen und CO2 Austoss (M.Jaun, 2015)
Tabelle 3 Prognose der CO2 Emissionen durch Personenwagen bis 2045 (M.Jaun, 2015)
Tabelle 4 Szenarien zur CO2 Reduktion bei Personenwagen (M.Jaun, 2015)
Tabelle 5 Eingelöste Personenwagen nach Treibstoffart 2014 (M.Jaun, 2015)
Tabelle 6 Eingelöste Personenwagen 2014 nach Leistung (M.Jaun, 2015)
Tabelle 7 Technische Verbrauchsangaben VW Golf 2.0 TDI Comfortline DSG
Tabelle 8 Benzin- und Tankäquivalente (M.Jaun, 2015)
Tabelle 9 Validierung stöchiom. Gleichung für die ideale Benzinverbrennung (M.Jaun, 2015)
Tabelle 10 Validierung stöchiometrische Gleichung ideale Dieselverbrennung (M.Jaun, 2015)
Tabelle 11 Validierung stöchiom. Gleichung für die ideale Erdgasverbrennung (M.Jaun, 2015)
Tabelle 12 Validierung stöchiom. Gleichung für die ideale Wasserstoffverbr. (M.Jaun, 2015)
Tabelle 13 Validierung stöchiom. Gleichung ideale Methanolverbrennung (M.Jaun, 2015)
Tabelle 14 Einteilung Antriebe nach Technologielebenszyklus (M.Jaun, 2015)
Tabelle 15 Daten zu den Motoren (M.Jaun, 2015)
Tabelle 16 Bewertung der Motoren (M.Jaun, 2015)
Tabelle 17 SWOT Analyse Motoren, Stärken (M.Jaun, 2015)
Tabelle 18 SWOT Analyse Motoren, Schwächen (M.Jaun, 2015)
Tabelle 19 SWOT Analyse Motoren, Chancen (M.Jaun, 2015)
Tabelle 20 SWOT Analyse Motoren, Gefahren (M.Jaun, 2015)
Tabelle 21 Staatseinnahmen CO2 Abgabe und Mineralölsteuern (M.Jaun, 2015)
Tabelle 22 Validierung stöchiometrische Gleichung H2O Dissoziation (M.Jaun, 2015)
Tabelle 23 Validierung stöchiometrische Gleichung H2O Elektrolyse (M.Jaun, 2015)
Tabelle 24 Temperaturverlauf und Prozentanteile des entstandenen Wasserstoffs
Tabelle 25 Validierung stöchiom. Gleichungen H2 Erzeugung aus Erdgas (M.Jaun, 2015)
Tabelle 26 Validierung stöchiom. Gleichung H2 Erzeugung aus Methanol (M.Jaun, 2015)
Tabelle 27 Validierung stöchiom. Gleichung H2 Erzeugung aus Ammoniak (M.Jaun, 2015)
Tabelle 28 Validierung stöchiom. Gleichung H2 Erzeugung aus Aluminium (M.Jaun, 2015)
Tabelle 29 Validierung stöchiom. Gleichung AlCl3 Reaktion mit H2O (M.Jaun, 2015)
Tabelle 30 Wasserstoffgärung verschiedener Bakterien, in Anlehnung an Getoff et al 1977
Tabelle 31 Bewertung für den Einsatz als on Demand Systeme (M.Jaun, 2016)
Tabelle 32 Generatoren Vergleich (M.Jaun, 2016)
Tabelle 33 Ladestrom, theoretische Benzin, CO2 Einsparung mit Wasserstoff on Demand
Tabelle 34 Legende zur Abbildung 26 (M.Jaun, 2016)
Tabelle 35 Betriebszustände Elektrolyseanlage nach Abbildung 26 (M.Jaun, 2016)
Abkürzungsverzeichnis
Management Summary
Die Schweiz und auch die G20 Staaten haben sich mit der Unterzeichnung des Kyoto Protokolls dazu verpflichtet die CO2 Emissionen zu reduzieren, da es wissenschaftlich erwiesen ist, dass CO2 zur Erderwärmung beiträgt, was die menschliche Gesundheit, Fauna und Flora gefährdet. Optimierungspotenzial besteht vorwiegend im Bereich Transport (ohne internationalen Flugverkehr). Im Jahr 2013 wurden durch den Transport 16,1 Tonnen CO2 Emissionen versursacht, welche mit steigender Bevölkerungszahl und mehr eingelöster Personenfahrzeuge ständig ansteigen. Mit umweltfreundlichen Personenfahrzeugen könnten die CO2 Emissionen reduziert werden und doch ist kaum eine positive Trendwende, hin zu umweltfreundlichen Fahrzeugen zu erkennen. Im Jahr 2014 waren 73% der eingelösten Personenfahrzeuge Benzinfahrzeuge und 25,6 % Dieselfahrzeuge. Der Rest von 1,4 % ist auf verschiedene alternative Antriebssysteme wie Elektrofahrzeuge, Erdgas und weitere aufgeteilt. Gründe dafür können sein, dass für die alternativen Antriebe kein oder ein zu wenig gutes Tankstellennetz existiert und alternative Fahrzeugantriebe meist teurer als Benzin- und Dieselfahrzeuge sind. Ein weiterer Grund kann auch in der Strategie des Schweizer Staates liegen, welche auf der einten Seite die CO2 Emissionen senken will, gleichzeitig fossile Energieträger subventioniert und nicht auf die Einnahmen der Mineralölsteuern verzichten möchte. Die Einnahmen durch die Mineralölsteuern betragen pro Jahr durchschnittlich ca. 7-8 % des Staatshaushaltes, was ein relativ grosser Anteil in Bezug auf die gesamte Staatsrechnung ist. Wenn man die verschiedenen Treibstoffe in Bezug auf die Emissionen vergleicht, kommt nur Wasserstoff als Treibstoff in Frage da bei der idealen Verbrennung kein CO2, sondern nur Wasser entsteht. Als Zwischenlösung wäre auch Biogas interessant, bei welchem weniger CO2 Emissionen als bei Benzin und Diesel entstehen. Beim Wasserstoff als Treibstoff gab es in der Vergangenheit verschiedene technische Probleme, welche noch nicht einwandfrei gelöst sind. Beim Tanken von flüssigem Wasserstoff in einen speziell isolierten Tank, verdampft der Wasserstoff über die Zeit da der Tank nicht 100%ig isoliert werden kann und sich erwärmt. Beim gasförmigen Wasserstoff sind enorm hohe Drücke, bis zu 700 Bar notwendig um annährend so weit zu kommen wie mit einem Benzinfahrzeug. Dazu kommt ein fehlendes Wasserstofftankstellennetz und dort wo es Wasserstofftankstellen gibt, kostet 1 kg Wasserstoff über SFr. 8.-. Wasserstoff bleibt jedoch weiterhin interessant da in 1 kg Wasserstoff ca. 3-mal so viel Energie enthalten ist wie in 1 kg Benzin oder Diesel. Theoretisch kann man Wasserstoff nicht nur als Treibstoff in Fahrzeugen nutzen, sondern auch als Energieträger zum Heizen. Die dazu notwendige Technologie ist dieselbe wie im Erdgasbereich. Um Wasserstoff in Fahrzeugen wirtschaftlich nutzen zu können sind weitere Entwicklungsschritte notwendig. Einer davon wäre Wasserstoff on Demand direkt im Fahrzeug herzustellen und im Verbrennungsmotor zu nutzen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es möglich ist Wasserstoff direkt in bestehenden Verbrennungsmotoren zu nutzen. Es gibt auch bereits Ideen und Technologien welche es erlauben den Wasserstoff über die Elektrolysetechnik direkt im Fahrzeug herzustellen und den Benzinverbrauch um bis zu 30% zu reduzieren. Die Herausforderung wird sein eine Elektrolyseanlage so zu konzipieren, welche ein 1:1 Wasserstoff Benzinäquivalent erzeugen kann um Benzin/Diesel 100% ersetzen zu können. Gemäss theoretischen Berechnungen wäre eine solche Anlage im Fahrzeug realisierbar. Den Strom für die Elektrolyse von Wasser wird vom Generator (Alternator) im Fahrzeug abgegriffen und mit einem Transformator so moduliert, dass genügend Strom zur Verfügung stehen sollte. Ob dies praktisch machbar ist muss mit einem Prototyp getestet werden. Aber selbst wenn man praktisch kein 1:1 Benzinäquivalent erzeugen könnte, hätte eine solche Anlage grosses Potenzial die CO2 Emissionen zu senken. Dies würde der Umwelt zu Gute kommen, aber auch den Autoherstellern welche dazu verpflichtet sind die CO2 Emissionen zu senken. Verhindern könnte diese Technologie der Staat und die erdölexportierenden Länder welche durch eine solche Technologie Einnahme-Einbussen in Kauf nehmen müssten, was diese mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht einfach so hinnehmen. Die Erdölexportierenden Länder würden die Preise für fossile Treibstoffe so derart senken, dass die Autofahrer kein Interesse mehr an alternativen Antriebssystemen hätten. Der Staat würde die Technologie nicht ohne Besteuerung bewilligen. Es wurde festgestellt, dass der Staat eine Studie zum Thema Mobility Pricing in Auftrag gegeben hat, dabei sollen keine Treibstoffe mehr besteuert werden, sondern der zurückgelegte Weg. Dies würde aber auch Pendler im öffentlichen Verkehr betreffen. Je nach Tageszeit sollen die Gebühren angepasst werden können um bei Stosszeiten mehr verlangen zu können. Gemäss Bundesgesetz Artikel Nr. 82, Absatz 3 ist Mobility Pricing verboten. Zwei Ausnahmen wurden jedoch bereits durchgesetzt, zum einten ist dies die Nationalstrassenabgabe (Autobahnvignette) und die LSVA (Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe). Um Mobility Pricing umzusetzen wäre eine dritte Ausnahme gemäss diesem Artikel notwendig. Wenn zukünftig nicht mehr der Treibstoff besteuert würde, sondern der zurückgelegte Weg gibt es keinen Anreiz mehr alternative Antriebssysteme zu nutzen. Damit die Strategie um die CO2 Emissionen im Transportbereich zu senken funktioniert, muss der Staat Einnahmeverluste in Kauf nehmen und die Subventionen auf fossilen Energieträgern schrittweise abbauen. Autofahrer welche z.B. Wasserstoff als umweltfreundlichsten Treibstoff nutzen wollen, müssten in den Genuss kommen das dieser steuerfrei ist. Nur wenn die Autofahrer belohnt werden für die Nutzung alternativer Antriebssysteme in Form von weniger Ausgaben als bisher, werden diese bereit sein auf alternative Antriebssysteme umzusteigen. Mit der genannten Strategieänderung des Staates und einer entsprechenden umweltfreundlichen Technologie, kann es funktionieren die CO2 Emissionen im Transportbereich zu senken.
1 Einleitung
Kohlendioxid (CO2) ist hauptverantwortlich für den Treibhauseffekt, welches vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt wird.1 Die CO2 Emissionen beeinflussen die Qualität der Atmosphäre und haben ernsthafte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, Fauna und Flora. 2 (vgl. Übersetzung des Autors nach Bardescu/Legendi 2015 : 1122, 1127). Die Schweiz hat daher im Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen beschlossen, diese zu senken um den globalen Temperaturanstieg auf weniger als 2 Grad Celsius zu beschränken (vgl. Bundesgesetz über die Reduktion der CO2 Emissionen 2011: Art. 1). Der Transport (ohne internationalen Flugverkehr) trägt mit 14.35 Mio. t. CO2 Ausstoss im Jahre 1990 und 16.10 Mio. t. CO2 im Jahr 2013, wesentlich zu den CO2-Emissionen und somit zum Treibhauseffekt bei (vgl. BAFU Treibhausgasemissionen nach Verursachergruppen: 2014). Um die CO2 Emissionen im Bereich Transport zu verringern ist es also notwendig auf Fahrzeuge mit alternativen, umweltfreundlichen Antriebssystemen umzusteigen. Umweltfreundlich im Sinne des Bundesgesetzes, dass keine fossilen Energieträger wie Benzin und Diesel mehr eingesetzt würden. Ein erster Schritt wird bereits getan mit Elektrofahrzeugen, doch ganz neu ist diese Idee nicht. „Das Automobil wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Damals wurde nicht nur der Ottomotor erfunden und bis zur Nutzungsreife entwickelt. Es wurde auch erfolgreich an Elektrofahrzeugen gearbeitet. 1882 stellte Werner Siemens seinen elektrischen Kutschenwagen in Berlin vor. Auf der Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris wurde dann ein praxistaugliches Elektroauto der Weltöffentlichkeit präsentiert, der `Lohner-Porsche`. [...] Das Fahrzeug [...] war 50 km/h schnell und hatte mit einem 400 kg schweren Bleiakku eine Reichweite von beachtlichen 50 km. Da die Reichweite der Benzinmotoren deutlich grösser war, setzten sich diese – wie hinlänglich bekannt – überaus erfolgreich durch.“ (Karle, Elektromobilität 2015 : 17) Das Problem der Reichweite von Elektrofahrzeugen gegenüber Benzin/Dieselfahrzeugen könnte auch heute noch der ausschlaggebende Punkt sein, warum im Jahr 2014 von insgesamt 4`384‘490 eingelösten Fahrzeuge nur 4`439 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge waren (vgl. Bundesamt für Statistik, Personenwagen 2014 : 05 Jan 15). Eine Alternative zu Elektrofahrzeugen bietet BMW mit seinem Modell Hydrogen 7, welches mit reinem Wasserstoff betrieben wird (vgl. BMW Hydrogen 7:http://www.bmw.com/com/de/insights/technology/efficient_dynamics/phase_2/clean_energy/bmw_hydrogen_7.html, Abrufdatum:03.11.2015). Trotz der Tatsache, dass in der Schweiz im Jahre 2014 nur 5 Personenfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb eingelöst waren, was einem Anteil von weniger als 0.0001% der gesamthaft eingelösten Fahrzeuge entspricht (vgl. Bundesamt für Statistik, Personenwagen 2014 : 05 Jan 15), plant Coop die erste öffentlich zugängliche Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz. Dies in Zusammenarbeit mit Axpo welche mit der Produktion aus heimischer Wasserkraft in ein neues Geschäftsfeld vorstossen und einen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten will. Coop plant einen Teil der eigenen Fahrzeugflotte auf wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Autos umrüsten – Autos, die nur Wasserdampf ausstossen. (vgl. Axpo Energiedialog, Mai 2015 : 6-7). Beim Projekt von Coop gibt es mehrere Marktdilemma welche gelöst werden müssen: ohne Wasserstoff-Fahrzeuge gibt es keine Nachfrage nach Wasserstoff-Tankstellen und ohne Wasserstoff-Tankstellen wiederum gibt es keine Nachfrage nach Fahrzeugen welche mit Wasserstoff betrieben werden. Ein weiterer Punkt ist der Wirkungsgrad bei der Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff, welcher ca. 65% beträgt (vgl. Wasserstoff als Energieträger, Getoff et al 1977 : 17). Bei der Umkehrreaktion, der Elektrolyse in Brennstoffzellen, liegt der Wirkungsgrad bei etwa 50 bis 60% (vgl. Elektromobilität Grundlagen und Praxis, Karle 2015 : 37). Ökonomisch und energietechnisch ist es also nicht sinnvoll Wasser durch Elektrolyse in seine Bestandteile aufzuspalten und danach in Brennstoffzellen wieder zu vereinigen um daraus elektrischen Strom zu gewinnen. Wenn man den Wirkungsgrad der Elektrolyse von ca. 0.65 mit dem mittleren Wirkungsgrad in der Brennstoffzelle von 0.55 multipliziert, erhält man einen Gesamtwirkungsgrad von 0.35 was 35% entspricht. Der Wirkungsgrad eines 4 Takt Otto Verbrennungsmotors hingegen kann bis zu 46% betragen (vgl. Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Fischer, Gscheidle et al, 2013 : 200). Aus Gründen der Effizienz des Wirkungsgrades wäre es sinnvoller Wasserstoff direkt in Verbrennungsmotoren einzuspritzen, als den Umweg über Brennstoffzellen zu nehmen, wie dies beim BMW Hydrogen 7 realisiert wurde. Das Problem ist allerdings, dass neben einem hohen Energieaufwand zur Verflüssigung des Wasserstoffs auf -250°C, sich dieser durch unvermeidbare Isolationsverluste verflüchtigt. D.h., wenn ein solches Fahrzeug ungenutzt steht, ist nach einer bestimmten Zeit der Tank durch die Verflüchtigung des Wasserstoffs leer (vgl. Fischer et al, Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik 2013 : 395). Mit einem System bei welchem Wasserstoff direkt bei Bedarf „on Demand“ im Fahrzeug herstellt und in den Verbrennungsmotor eingespritzt wird, wäre auch dieses Problem gelöst. Wenn dieses System ohne grösseren Aufwand und zu angemessenen Kosten in bestehende Verbrennungsmotoren eingebaut werden kann, könnte dies zu einem grösseren Marktpotenzial für Wasserstoffantriebe beitragen. Eine Technologie in diese Richtung bietet das Unternehmen Modern Tech Limited, 145-157 ST JOHN STREET, LONDON, ENGLAND, EC1V 4PW an, bei der ein Elektrolysesystem an den Alternator im Fahrzeug angeschlossen wird und der erzeugte Wasserstoff via Luftansaugsystem in den Motor gelangt. Dieses System braucht weiterhin Benzin oder Diesel, reduziert jedoch den Treibstoffverbrauch gemäss dem Unternehmen um bis zu 35% und somit auch die CO2 Emissionen. Ein Standard PKW HHO Set kostet je nach Grösse und Leistung zwischen 186,90 Euro und 312,00 Euro (vgl. HHO Standard Kit: http://www.hhogas.at/de/11-hho-sets-standard Abrufdatum: 03.11.2015). Wenn man die Leistung dieser Technologie soweit optimieren kann um ein 1:1 Benzin /Dieseläquivalent zu erzeugen, wäre es möglich genügend Wasserstoff on Demand zu erzeugen um das Fahrzeug zu 100% mit Wasserstoff zu betreiben. Dabei könnte Wasser als Treibstoff nachgetankt werden und im Vergleich zu Benzin und Dieselmotoren würde es zu keinen Leistungs- und Reichweitenverlusten kommen. Dies wäre ein klarer Vorteil gegenüber den heutigen alternativen Antriebssystemen, allen voran den Elektrofahrzeugen.
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
Auf der Grundlage des in Kapitel 1 Einleitung erwähnten Projektes von Coop und Axpo zum Bau und Betrieb der ersten öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz und der CO2 Problematik des Treibhauseffektes, ist das Thema zu dieser Masterarbeit mit dem Titel „H2 on Demand für Wasserstoffverbrennungsmotoren in Autos“ entstanden, da es im erwähnten Projekt zwei Marktdilemmas gibt welche gelöst werden müssen. Diese Marktdilemmas sind zugleich Bestandteil der nachfolgenden Thesen.
1. These (1. Marktdilemma)
Ohne gut ausgebautes Wasserstoff-Tankstellennetz, sind Autofahrer auch weiterhin nicht bereit in eine neue Technologie zu investieren und auf Wasserstoff als Treibstoff umzusteigen. Gründe dafür sind hohe Umrüstkosten, da das bestehende Auto verkauft werden muss und ein neues mit der neuen Technologie beschafft werden muss. Der Preis wird mit grosser Wahrscheinlichkeit höher sein als für die bestehende Technologie der Benzin- und Dieselmotoren. Dazu kommt das Risiko eines nicht ausgebauten Wasserstoff-Tankstellennetzes.
2. These (2. Marktdilemma)
Ohne Autofahrer welche Wasserstoff als Treibstoff nutzen, sind Tankstellenbetreiber nicht bereit das Wasserstoff-Tankstellennetz weiter auszubauen, weil das Risiko die Investitionen in diese Technologie nicht amortisieren zu können hoch sind.
3. These
Wenn Autofahrer ihre bestehenden Fahrzeuge mit Benzin- und Dieseltechnologie ohne grossen Aufwand auf die Wasserstoff-Technologie umrüsten können, dabei der Benzin und Dieselverbrauch enorm reduziert oder gar durch Wasserstoff ersetzt wird, sind Autofahrer eher bereit auf die Wasserstoff-Technologie umzurüsten.
4. These
Es gibt eine Technologie, welche es erlaubt bestehende Benzin- und Dieselmotoren ohne grossen Aufwand auf die Wasserstoff-Technologie umzurüsten. Diese Technologie reduziert oder substituiert den Benzin und Diesel als Treibstoff. Bestehende Benzin- und Dieselautos können mit dieser Technologie weiterhin genutzt werden. Der Wasserstoff wird bei dieser Technologie direkt bei Bedarf „on Demand“ im Fahrzeug selbst hergestellt. Somit werden die Autofahrer unabhängig von einem Wasserstoff-Tankstellennetz und können ihre bestehenden Fahrzeuge weiter nutzen. Durch die Kostenersparnis beim Benzin- und Dieselverbrauch, als auch dem Vorteil bestehende Fahrzeuge weiterhin nutzen zu können, ist davon auszugehen ein grosses Kundenpotenzial für die Wasserstoff-Technologie zu erreichen.
5. These
Der Staat verfolgt eigene finanzielle Interessen welche den Erfolg von alternativen Antriebssystemen behindert.
Der Fokus dieser Masterarbeit liegt in der Prüfung verschiedener Wasserstoff-Herstellmethoden, welche als „on Demand“ Systeme in bestehende Benzin- und Dieselautos integriert werden können, um den Benzin- und Dieselverbrauch zu reduzieren oder gar zu ersetzen.
Ziel dieser Masterarbeit ist es mögliche Wasserstoff-Herstellverfahren von „on Demand“ Systemen für Autos mit Verbrennungsmotoren zu ermitteln und daraus Technologie-Skizzen für einen möglichen Einsatz in Benzin- und Dieselautos zu erstellen. Diese Masterarbeit ist relevant um die CO2 Emissionen bei Autos zu reduzieren und kann helfen, Kunden als Autofahrer für die Wasserstoff-Technologie zu gewinnen. Autoherstellern kommt diese Technologie entgegen um die von den verschiedenen Gesetzgebern geforderten CO2 Grenzwerte zu erreichen und einzuhalten. Zu erwähnen ist hier der Abgasskandal von VW, bei der in Dieselfahrzeugen eine Manipulationssoftware installiert wurde, welche die Emissionen nur auf dem Prüfstand unter den erlaubten Höchstwert drückt (vgl. Saskia/Breitinger in Zeitonline 2015: Was wir über den Abgasskandal wissen, http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-09/vw-abgase-manipulation-faq, Abrufdatum: 03.11.2015).
Die folgenden Kapitel 1.2 Bevölkerungswachstum, eingelöste Personenfahrzeuge, CO2 Emissionen und Kapitel 1.3 Szenarien zur CO2 Reduktion bei Personenfahrzeugen sollen die Relevanz für das Thema der CO2 Reduktion bei Autos noch einmal verdeutlichen.
1.2 Bevölkerungswachstum, eingelöste Personenfahrzeuge, CO2 Emissionen
In diesem Abschnitt soll untersucht werden, ob es eine Abhängigkeit zwischen dem Bevölkerungswachstum und der eingelösten Personenfahrzeuge gibt und ob es eine weitere Abhängigkeit zwischen den eingelösten Personenfahrzeugen und den CO2 Emissionen beim Transport gibt. Mit dem Begriff „Bevölkerung“ wird die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz definiert und mit den eingelösten Fahrzeugen explizit nur die Personenfahrzeuge, ohne Motorräder, Anhänger usw. Bei den CO2 Emissionen wird der Transport ohne internationalen Flugverkehr betrachtet. Durch diese Untersuchung und Analyse soll eine Aussage gemacht werden, ob das Masterarbeitsthema aus Sicht der CO2 Emissionen durch Personenfahrzeuge relevant ist.
Tabelle 1 Vergleich der statistischen Istwerte (M.Jaun, 2015)
*1 vgl. Bundesamt für Statistik, Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung 1861-2014 : 2014
*2 vgl. Bundesamt für Statistik, Strassenfahrzeugbestand nach Fahrzeuggruppe : Mai 2015
*3 vgl. Bundesamt für Statistik, Strassenfahrzeugbestand nach Fahrzeuggruppe : Mai 2015
*4 Berechneter Prozentanteil der Personenwagen am Total der Motorfahrzeuge
*5 vgl. BAFU, Treibhausgasemissionen nach Verursachergruppe : 17.09.2015
*6 Berechnete Werte aus Anteil Personenwagen am Total der Motorfahrzeuge in % und CO2 Ausstoss in Mio. t. (ohne internationalen Flugverkehr).
In der Tabelle 1 wurden statistische Ist-Daten aus offiziellen Quellen des Bundesamt für Statistik und dem Bundesamt für Umwelt dargestellt. Ziel war es eine Datengrundlage zu schaffen um daraus die CO2 Emissionen zu ermitteln, welche durch Personenfahrzeuge verursacht werden. Mögliche statistische Zusammenhänge werden in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2 Korrelation Anteil eingelöster Personenwagen und CO2 Austoss (M.Jaun, 2015)
Statistische Auswertungen
Nr. 1
: Vergleich Wohnbevölkerung mit Motorfahrzeugen:
Nr. 2
: Vergleich Personenwagen mit Motorfahrzeugen:
Nr. 3
: Vergleich Motorfahrzeuge mit CO
2
Ausstoss:
Korrelation:
0.98
1.00
0.89
Regression:
y= 1.537x-7E+06
y=0.6903x+379535
y= 1E-06x+9.7337
Die berechneten Korrelationen in Tabelle 2 zeigen, dass die Daten der Wohnbevölkerung mit den eingelösten Personenwagen und dem CO2 Ausstoss zwischen 89% bis 100% korrelieren. Da davon ausgegangen wird, dass die Daten auch einen funktionalen Zusammenhang zueinander haben, wird klar, dass mit steigender Wohnbevölkerung mehr Personenwagen eingelöst werden, welche wiederum mehr CO2 Emissionen verursachen.
Tabelle 3 Prognose der CO2 Emissionen durch Personenwagen bis 2045 (M.Jaun, 2015)
*8 Berechnete Werte gemäss Prognose Bevölkerungsentwicklung, siehe *7
*9