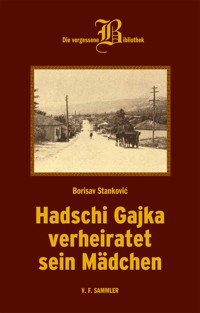
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem hiermit wieder verfügbaren Meisterwerk von 1910 hat der große serbische Heimatschriftsteller Borisav Stanković die überkommenen Sitten, die Kultur und den Menschenschlag des südlichen Serbien in der Zeit unmittelbar nach Ende der osmanischen Herrschaft verewigt. Die Geschichte entführt den Leser in die Gegend um die Bezirkshauptstadt Vranje, aus der auch der Autor selbst stammt, und schildert das faszinierende, teils dramatische Dasein eines Volkes im Spannungsfeld zwischen europäischem und orientalischem Kulturkreis, zwischen Sehnsucht nach der alten Sicherheit und Aufbruch in eine ungewisse Moderne. Die Hauptfigur Sofka, schöne Tochter einer über Generationen hinweg zur städtischen Elite zählenden Familie, wird aus Geldnot in die Sippe des aufstrebenden Bauern Marko verheiratet – ein Sinnbild für die Erweichung der alten Feudalgesellschaft gegenüber dem Ansturm des selbstbewussten Neuen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Borisav Stanković
Hadschi Gajkaverheiratetsein Mädchen
Leopold Stocker Verlag
V. F. SAMMLER
Umschlaggestaltung: DSR – Digitalstudio Rypka, 8143 Dobl
Umschlagabb. Vorderseite: historische Aufnahme der Stadt Vranje um 1900 (CC0 1.0) Umschlagabb. Rückseite: gemeinfrei
Textnachweis: Es handelt sich bei diesem Buch um eine originalgetreue Neuausgabe der im Rahmen der „Bücherei Südost-Europa“ bei Albert Langen und Georg Müller zu München 1935 erschienenen Erstausgabe. Der Originaltext wurde hierzu von Frakturschrift in Antiqua übertragen. Die offenbar auf einen Bearbeitungsfehler zurückgehende Liedzeile „Hadschi Gajka verheiratet ihr Mädchen“ in Originaltitel sowie Innenteil wurde berichtigt. Eigens für die Neuausgabe verfasst wurden Vorwort sowie Glossar. Die ursprüngliche Übersetzerin Sava D. Zeremski konnte verlagsseitig auch durch erheblichen Aufwand nicht ausfindig gemacht werden; sollten Urheberrechtsansprüche an der Übersetzung bestehen, so bitten wir um Kontaktaufnahme.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.
Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
V. F. Sammler
Hofgasse 5 / Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-85365-337-1
eISBN 978-3-85365-345-6
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by V. F. SAMMLER, Graz 2022
Layout: DSR – Digitalstudio Rypka, 8143 Dobl
Inhalt
Vorwort
Hadschi Gajkaverheiratet sein Mädchen
Glossar
Vorwort
von Sladjanka Peric
Das vorliegende Werk von Borisav Stanković hat seine Vorgeschichte. Es wurde unter dem Originaltitel „Hечиста крв“ (dt.: „Unreines Blut“) im Jahr 1900 als Kurzgeschichte herausgebracht und anschließend in damaligen Zeitschriften als Fortsetzungsroman veröffentlicht. Der Roman wurde im Jahr 1910 vollendet und aus Kostengründen um ca. 40 Seiten gekürzt gedruckt. Man glaubte damals, das Geld noch irgendwie beschaffen zu können, aber der Erste Weltkrieg hat dazu geführt, dass das Originalmanuskript verloren ging, sodass die Form der Erstausgabe bis heute beibehalten wurde.
Auch dem heutigen Leser werden das Leben sowie der Aufruhr in der Gesellschaft und der Familie zur damaligen Zeit anschaulich vor Augen geführt. Die Romanhandlung spielt um 1880, nachdem die Stadt Vranje, aber auch die umliegenden Gebiete von der Türkenbesatzung befreit worden sind. Gesellschaftliche Umwälzungen bringen auch neue Lebensweisen mit sich. Emporkömmlinge lösen eine Welle der Veränderungen aus: Sie kaufen Güter billig auf, auf denen sie vielleicht selbst einst als Knechte gearbeitet haben, um ihren Ehrgeiz zu stillen. Die „besseren“ Kreise der Stadt Vranje hatten dank Reichtum, Ansehen und Prestige ein enges Verhältnis zu den bisherigen türkischen Machthabern, den Begs; sie werden überrumpelt und sind nicht bereit, mit den Herausforderungen der neuen Zeit umzugehen. In der Erwartung, dass sich alles von selbst fügen werde, verlieren sie das Geld, die Macht und die Kraft, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Ihr Untergang vollzieht sich nicht nur auf der materiellen, sondern auch auf der biologischen Ebene.
Am Beispiel des Schicksals von Effendi Mita und dessen Familie zeichnet der Autor ein allgemeines Bild der Gesellschaft. Die Tochter Sofka ist innerlich wie äußerlich schön, aber sie spürt, dass ihr durch den Abzug der Türken und die damit verbundenen gesellschaftlichen Umwälzungen das Recht auf Liebe, Glück, Frieden und Anstand verwehrt wird. Der Originaltitel des Romans weist auf den moralischen und biologischen Untergang hin, dessen Ursache – bildlich gesprochen – im „unreinen Blut“ liegen soll. Das Unglück ist über Hadschi Trifun (christliche Gemeinschaften, die länger unter osmanischer Herrschaft standen, übernahmen mit der Zeit die Bedeutung von „Hadschi“: auch wer in das Heilige Land nach Jerusalem pilgerte, um das Grab Jesu Christi zu besuchen, bekam diesen Ehrentitel) auf seine Nachfahren (Effendi Mita, Sofka etc.) gekommen. Stankovićs Werk ist ein psychosoziales Gesellschaftsdrama am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Es verdeutlicht den Durchbruch des Neuen ebenso wie den Verfall, die Hilflosigkeit und das Verschwinden des Alten sowie Aufstieg und Fortkommen derjenigen, die den Herausforderungen der neuen Zeit gewachsen sind. Die Lektüre ermöglicht es uns, die Vergangenheit besser und umfassender zu begreifen und bestimmte gesellschaftliche Strömungen zu verstehen. Historische Umstände – der Abzug der Türken – bringen viele Veränderungen in den sozialen Beziehungen. In Vranje geht buchstäblich die alte Welt unter. Der Roman verdeutlicht die Entfremdung und den Verfall an Leib und Seele auf. Die Befreiung von den Türken bringt mit den ehemaligen Dienern neue „Bosse“, die sich Häuser und Besitz aneignen, ihre bäuerliche, raue Herkunft jedoch nicht verleugnen können. Trotz des Geldes, das die alte und die neue Welt verbindet, gibt es keine gemeinsame Perspektive. Beide teilen das Schicksal des Verfalls und der Verdorbenheit, weil ihr Handeln mit den moralischen Prinzipien der Gemeinschaft unvereinbar ist. Beide Gruppen sind in sich geschlossen und akzeptieren nur schwerlich Entwicklungen, die zu besseren zwischenmenschlichen Beziehungen führen könnten. Effendi Mita und seine Familie wollen ihre Armut lindern, indem sie Sofka für eine große Summe Geld an den Sohn des reichen Bauern Marko verkaufen. Das ist inakzeptabel. Marko kauft Sofka für seinen Sohn Tomtscha, aber nicht nur für diesen, sondern auch für sich selbst, da es in diesen ländlichen Regionen eine Sitte gibt, wonach der Schwiegervater mit seiner Schwiegertochter eine sexuelle Beziehung führen darf. Damit prallen zwei inkompatible Kulturen aufeinander, was Opfer und Leid zur Folge hat. Nach der Hochzeit tritt Marko an Sofkas Gemächer, hat jedoch nicht die Kraft, hineinzugehen, um etwas so Unwürdiges zu tun. Stattdessen reitet er auf seinem Pferd über die Grenze und verunglückt dort. Mita hat sich ebenfalls als unwürdig erwiesen, indem er seine eigene Tochter verkauft hat, und somit ist auch er zum Untergang verurteilt – die beleidigende Art und Weise, wie er von Tomtscha das Geld verlangt und ihn als „Bauernlümmel“ beschimpft, erinnert ihn an seine eigene Herkunft, die ihn schmerzt. Tomtscha gibt Mita das Geld, lässt seine Maske fallen und wird zu dem, was sein Vater war – ein damals nur allzu verbreitetes Verhaltensmuster. Er quält und erniedrigt Sofka; aus ihr wird eine kalte, enttäuschte und frustrierte Frau. Ihre Kinder sind ein Beweis der seelischen wie körperlichen Verdorbenheit und des Verfalls, insbesondere ihrer zunehmenden Trunksucht. Neben Sofkas Schönheit verkümmern auch ihre Wünsche und ihre Sensibilität, welche außer ihr niemand zeigt, weil es sich nicht gehört und in der rauen Welt der reichen Bauern wie Marko, der mit seinem Geld alles kaufen kann, unpassend ist. Obwohl das Gleichnis vom „unreinen Blut“ in diesem Sinne eine komplexe Bedeutung offenbart, ist eindeutig, dass der biologische Verfall und die psychische Verelendung vor der materiellen kommen, diese sogar begünstigen und beschleunigen.
Borisav Stanković hat die moderne Entwicklung der serbischen Literatur am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst, er hat die serbische Prosa, ihre Formen und die Ausdrucksmöglichkeiten Europa nähergebracht. Die serbische Literatur hat durch die Widersprüche und Qualen, Dorfhöfe und Holzzäune, Dampfbäder und Hochzeiten im Vranje des Romans an Europa angeknüpft. Jovan Skerlić, ein herausragender Literaturtheoretiker, und Jovan Dučić, ein berühmter Dichter und Diplomat, haben den Modernismus in Stankovićs Werken hervorgehoben, was auf die Zeitlosigkeit seiner Kunst hinweist. Die Inspiration fand er in seiner eigenen Geburtsstadt Vranje, und sein Roman über die unheilbeladene Sofka hat sich aus einem Gespräch mit dem berühmten dortigen Rechtsanwalt Aleksandar Ristić ergeben. Stanković hat ihm anvertraut, wie er sich das zweistöckige Haus aus Sofkas Kindheit vorstellte:
„Falls du dich noch daran erinnern kannst: Als wir noch Kinder waren, gab es im Hof ein zweistöckiges Haus mit breiten Weinreben, welche den blau bemalten Hausabschnitt hinaufkletterten. Damals konnte man sehen, dass es sich um ein wohlhabendes Haus handelte, in dem jedoch wenig Leben zu sehen war. Das war wie ein Geheimnis für mich. Dieses Haus habe ich mir so in etwa als Sofkas Haus vorgestellt.“
Das war der erste Impuls für Stankovićs Werk. Die künstlerische Umsetzung dauerte lange, und nach der ersten Fassung, die 1900 in der Großstadt Niš in der Zeitschrift „Gradina“ („Der Garten“) veröffentlicht wurde, kam es zu zahlreichen Ausbesserungen und Änderungen. Wie bereits am Anfang erwähnt musste Stanković aus finanziellen Gründen das Ende des Romans für die Druckausgabe um 30 bis 40 Seiten kürzen – er vertraute jedoch dem Leser, selbst aktiv zu werden und das Weltbild und den Sinn des Romans zu erkennen. Besonders auffällig ist, wie authentisch der Roman das Leben im Serbien des auslaufenden 19. Jahrhunderts, die Gesellschaft in Vranje zur türkischen Zeit und nach der Befreiung darstellt. Der Autor hat das Leben der altertümlichen Figuren schriftstellerisch überformt: Wie in einer Linse gebündelt wird die universale literarische Problematik dargestellt, die Figuren sind verletzlich, leben und sterben mit der Erkenntnis, dass der Mensch nur für Trauer und Leid erschaffen wurde. Man vernimmt das Echo der Stimmen der modernen menschlichen Zweifel, der Wünsche und Forderungen. Die Figuren sehnen sich nach Schönheit, Lebenssinn und persönlichem sowie familiärem Glück, welches ihnen jedoch entgleitet und Unglück und Enttäuschung verursacht. Man könnte sagen, dass auf diese Art und Weise enge Beziehungen zwischen früheren und zukünftigen Generationen entstehen. Durch das künstlerische Formen seiner Figuren stellt Stanković Fragen über die Rätselhaftigkeit der menschlichen Seele und ihre Existenzprobleme, die Freiheit und die Wege zu persönlichem Glück und Zufriedenheit.
Stanković selbst wurde am 22. März 1876 in Vranje in eine Schusterfamilie geboren. Er verlor früh seine Eltern und wurde in der Folge von seiner Großmutter Zlata erzogen und ausgebildet. Ausgerechnet sie weckte mit ihren Erinnerungen und Erzählungen in Stanković das Interesse und die Liebe für die Vergangenheit der Familie und des Geburtsortes. Er besuchte die Grundschule, danach das damalige „kleine Gymnasium“ mit seinen drei Klassen in Vranje; die 4. Klasse absolvierte er in Niš. Seine Lehrer und angesehene Kulturschaffende wie Ilija Vukićević, Ljubomir Davidović, Jaša Prodanović und Milivoje Bašić erkannten sein schriftstellerisches Talent. Noch als Gymnasiast schrieb und veröffentlichte er erste Gedichte und während seines zweiten Jahres als Jusstudent in Belgrad seine ersten Kurzgeschichten. Während des Studiums hatte er mit Schwierigkeiten und Knappheit zu kämpfen und begann deshalb früh, zu arbeiten; sein steter Begleiter wurde ein eintöniges Angestelltenleben mit geringem Einkommen. Während des Ersten Weltkrieges wurde Stanković gefangen genommen und im Kriegsgefangenenlager Derventa interniert. Nach der Rückkehr nach Belgrad schrieb er Reportagen und Kurzgeschichten über das Leben in der besetzten Stadt, die später im Sammelband „Unter Besetzung“ veröffentlicht wurden, was ihm viele Unannehmlichkeiten und erhebliche Unzufriedenheit bescherte. Außerhalb des politischen Geschehens wurde er wegen seiner Zusammenarbeit mit Zeitschriften, die im besetzten Belgrad von den österreichischen Machthabern gegründet und finanziert worden waren, marginalisiert. Dauernd angeklagt und nach dem Krieg boykottiert zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und hörte beinahe auf, zu schreiben; er fühlte sich unverstanden und vergessen. Stanković starb 1927 und wurde ohne jegliche Anerkennung beerdigt. Seine wichtigsten Werke wurde im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts veröffentlicht: „Sammlung der Kurzgeschichten aus dem Alten Testament“ (1899), „Die Alten Tage“ (1902) und „Menschen Gottes“ sowie das Drama „Kostana“ im gleichen Jahr.
Obwohl „Hadschi Gajka verheiratet sein Mädchen“ seinerzeit als Fortsetzungsroman in Zeitschriften veröffentlicht wurde, hatte Stanković das Gefühl, dass sich aus dem Ganzen ein Buch entwickeln könnte, in welchem neue Personen und mit ihnen eine neue Moral auftreten würden, aber auch die entgegengesetzte und unvereinbare Welt der Begs und Hadschis, mit Bauern und Emporkömmlingen, die schöne, reiche und angesehene städtische Häuser besetzt haben. Die Leser dieses Romans gewinnen nicht nur das Bild vom Schicksal der schönen Sofka, welche das „unreine Blut“ ihrer Vorfahren in sich trägt; Stanković zeichnet ebenso die vielfältigen, verflochtenen und unterschiedlichen sozialen Beziehungen im südlichen Serbien Ende des 19. Jahrhunderts nach.
1
Von ihren Urgroßvätern und Großvätern wußte man mehr zu erzählen als von ihren Eltern, ja, als von ihr – Sofka – selbst.
Das Haus war alt, als stünde es schon seit der Gründung der Stadt. Die ganze Familie stammte aus diesem Haus. Seit Menschengedenken waren sogar die Bischöfe an hohen Feiertagen zuerst hierher gekommen, um nach dem Gottesdienst zu gratulieren, ehe sie sich zu den anderen alten und angesehenen Familien begaben. In der Kirche hatte die Familie ihren eigenen Stuhl und selbst auf dem Friedhof ihren eigenen Begräbnisplatz. Die Grabsteine waren aus Marmor und Tag und Nacht von brennenden Ampeln erhellt.
Welcher unter den Vorfahren dieses Haus errichtet hatte, wußte man nicht mehr, man wußte nur, daß sie immer schon so reich gewesen waren, wußte, daß Hadschi Trifun – nach dem sie alle Hadschi hießen – nach seiner Pilgerfahrt als der erste so kühn gewesen war, all die in Kellern, Speichern und Ställen verborgenen Reichtümer hervorzuholen und der Welt zu zeigen. Er hatte ein Tor gebaut, hochgewölbt und stark wie das einer Festung, hatte ein Stockwerk auf das Haus gesetzt, es bemalt und mit Schnitzereien verziert. Die Zimmer schmückte er reich mit kostbaren Teppichen und wertvollen, aus den Klöstern von Petsch, Athos und Rila stammenden alten Bildern, er zierte die Wände mit silbernen Becken und goldenen Leuchtern. Neben das Tor hatte er einen Marmorblock hinsetzen lassen, von dem aus er seine weit und breit berühmten Pferde bestieg. Im Winter wie im Sommer trug er den Pelzrock, mit Pistolen und Jataganen in der Waffenschärpe, dazu schwere Stiefel, die bis zu den Knien reichten. Kein Osmane, kein türkischer Gendarm durfte es damals wagen, an seinem Hause vorbeizugehen, geschweige denn dort stehen zu bleiben. Die ganze Nacht mußte am Tor eine Laterne brennen, mußten drei oder vier Nachtwächter davor herumlungern. Da er in allen großen Städten Handel trieb, kam er mit den angesehensten und mächtigsten Leuten in Berührung und war durch seinen Reichtum und seine Beziehungen in der Lage, nicht nur türkische Gendarmen und Kaimakams, sondern sogar Paschas versetzen zu lassen. In allen nationalen Angelegenheiten mußte man zu ihm kommen, sei es, daß man eine Schule, eine Kirche oder ein Kloster erbauen oder instandsetzen, oder sei es, daß man einen gewalttätigen Blutsauger absetzen wollte. Und dann konnte man oben in dem reich ausgestatteten Zimmer sehen, wie die ersten Leute der Stadt die ganze Nacht durch berieten, um ihn schließlich doch alles so machen zu lassen, wie er es für richtig hielt. Was er beschlossen hatte, führte er auch schnell aus. Gewöhnlich auf dem Weg der Bestechung, weil man damit ja am meisten erreicht, und wo das nicht ging, diente die Kugel irgendeines Ungläubigen, eines Albaners oder Katschaken, als Hilfe. Dafür aber mußte in der Kirche die goldene Ampel vor dem Kruzifix ständig für sein Haus brennen, mußte der Stuhl neben dem des Bischofs nur für ihn da sein, und kein anderer durfte ihn während des Gottesdienstes benutzen. Den Armen aber und den Häftlingen in den Gefängnissen mußte zu Ostern, Weihnachten oder zum Fest seines Hauspatrons drei Tage lang Speise und Trank gespendet werden.
Er war streng und schroff. Gefürchtet nicht nur von seinen Hausgenossen, sondern von der ganzen Verwandtschaft. Für seine Leibeignen aber, für die Knechte seines Leibeignengutes in Rataja und für die Müller der Mühle in Sobina zeigte er Herz und Seele. Und doch fürchteten ihn alle; selbst wenn er in Geschäften nach der Türkei gereist war – gewöhnlich verbrachte er den ganzen Sommer dort –, sprach die ganze Familie voll Furcht von ihm. Besonders den kaum erwachsenen Söhnen, die die Stelle ihres Vaters als Familienoberhaupt übernehmen sollten und sich, statt für Haus und Hof zu sorgen, herumtrieben und das Geld vergeudeten, pflegten ihre verwitweten Mütter ständig mit ihm zu drohen, mit dem «Bata», dem Väterchen, wie sie ihn alle nannten.
«Warte nur, warte, bald ist er wieder da. Gestern war ich drüben, und mir wurde gesagt, daß er bald von seiner Reise zurückkommt. Ich will nicht länger vor ihm zittern und beben um deinetwillen. Ich will nicht, daß er, wenn ich dann zu ihm komme, mich mit strengen Augen anstarrt und mich anfährt: ,He, du, warum verheimlichst du mir, was dein …? Glaubst du, ich weiß nicht, wo er sich herumtreibt, was er macht und wieviel Geld er ausgibt? Ich werde ihm den Hals umdrehen wie einem Spatz. Nicht er, noch sonst jemand von euch soll mir wieder vor Augen treten!‘ Darum kann ich es nicht verheimlichen, denn ich will nicht, daß er mich wieder schilt. Nein, ich werde ihm gleich, wenn er wiederkommt, alles erzählen. Wirst es schon sehen!»
So sprachen sie, und das half, das jagte jedem Furcht ein, denn jeder wußte, was ihn erwartete. Und wirklich, kaum war er von der Reise zurück, da stellte sich schon die ganze Verwandtschaft bei ihm ein, die Frauen, Basen und Tanten. Die Männer, die sich am ersten Tage noch nicht getrauten, ihm vor die Augen zu treten, wußten, daß er ihnen durch ihre Frauen ausrichten und befehlen lassen würde, was er ihnen zu sagen hatte.
Sie kamen alle in den oberen Stock hinauf, auf den Altan, wo er zu weilen pflegte. Voll Demut und Furcht wagten sie nicht, ihn anzusehen, weil er ihnen so groß und furchtbar erschien.
«Bist du wieder da, Bata?» begrüßten sie ihn.
«Ja», antwortete er kurz und gelangweilt.
Rief er gar eine der Frauen beim Namen heran, so erschrak sie zu Tode. Denn, das wußten sie, zu nichts Gutem lud er ein, wen er beim Namen heranrief. Sicher hatte sich ihr Mann etwas zuschulden kommen lassen, hatte Geld, das er sich von ihm, dem Bata, geborgt, nicht wiedergegeben, oder hatte ihn gar belogen und es nicht für das Geschäft verwendet, sondern für etwas andres. Trotz aller Strenge vergaß er aber auch die ärmste und entfernteste Verwandte nicht, sondern brachte jeder eine kleine Gabe von seinen weiten Reisen mit.
Er sprach nicht viel, aber was er sagte, das war gesagt. Man vergaß es nicht, und seine Worte und Aussprüche blieben lange in aller Munde. «Ja, wie der selige Hadschi Trifun zu sagen pflegte …»
Wenn er nicht auf Reisen war, hielt er sich stets im Hause auf, im Sommer oben auf dem Altan, im Winter unten in dem großen, geräumigen Zimmer. Den ganzen Tag über saß er da, rauchte, trank Kaffee und erteilte seine Befehle.
Aber obgleich immer alles nach seinem Willen zu geschehen hatte, konnte er mit seinem einzigen Sohne nicht fertig werden. Die Töchter hatte er nach seinem Willen verheiratet und untergebracht. Der Sohn aber war ihm spät geboren worden, da er schon alt war und niemand mehr hoffte, er würde noch Kinder, und gar einen Sohn, bekommen; und als dieser nun heranwuchs, konnte er sich mit ihm nicht vertragen. Wie zum Trotz wollte der Sohn sich nie nach seinem Willen richten. Warum nur? dachte der Alte. Vielleicht weil er nun alt war und nicht mehr Handel treiben, schaffen und verdienen, sich nicht mehr wie früher Achtung erringen konnte. Oder am Ende, und das ärgerte den Alten am meisten, hetzte jemand den Sohn gegen ihn auf. Das war sicher die Mutter. Denn der Alte wußte, daß sie vor der Geburt des Sohnes sich nicht zu mucken gewagt hatte. Auch später durfte sie sich ihrem Manne nicht etwa offen widersetzen, noch seine Befehle mißachten, aber er fühlte, daß sie anders geworden war, als hätte sie es satt, ewig vor ihm zu zittern und sich zu fürchten. Sie ließ ihn ruhig weiter den Dienern und Leibeignen befehlen und sie ausschimpfen, sie selbst aber widmete sich ganz dem Sohne. Mit ihm ging sie aus, besuchte sie die Töchter und andere Verwandte. Und dann fuhren sie alle zusammen auf die Güter, gingen zu Festen, Versammlungen, zu entfernteren Verwandten. Alle, die Mutter und die Schwestern, verwöhnten den Jungen um die Wette. Was er tat, war ihnen heilig. Sie vermochten sich nicht vorzustellen, daß er etwas Unrechtes tun, noch daß etwas, was er angestellt hatte, wirklich schlecht sein könnte. Der Alte jedoch wurde immer aufgebrachter gegen ihn, vielleicht auch aus Eifersucht, brachte es aber trotzdem nie übers Herz, ihn zu schlagen wie seine Diener und Leibeignen.
Als der Sohn gar noch anfing mit den Begs, den Türken, zu verkehren, ja mit ihnen zu trinken, ihre Harems zu besuchen und mit ihren Mädchen und Frauen schönzutun, da geriet der Alte in Zorn. «Wenn er das will», wütete er, «das kennt Hadschi Trifun auch, er war auch einmal jung. Aber dafür sind die Leibeignengüter und die Leibeignenmädchen da. Warum muß er zu Türkinnen, zu Ungläubigen? Bei denen, die immer zu viert nur einen Mann haben, hat die Frau heißes und sehnsüchtiges Blut, sie saugen den Mann aus.» Darum, erklärte der Alte, sei er auch so bleich und schlank und schlapp, mehr Frau als Mann, deswegen möge er ihn auch nicht leiden und wolle ihn nicht sehen.
Hörte der Alte aber, daß trotz seinem Schelten und Toben der Sohn mit den Begs wieder lärmenden Unfug und tolle Streiche vollführt hatte und erst bei Tagesanbruch nach Hause gekommen war, dann ließ er nicht den Sohn, sondern die Mutter kommen: «Hast du ihn gehört?»
Obwohl sie alles gehört hatte, tat sie, als wüßte sie nichts. «Was denn?»
«Wieso: was denn?» fuhr der Alte auf, und schon begann er sich den Schuh auszuziehen, den er nach ihr werfen wollte. «Warum hast du nichts gehört? Wo bist du denn? Lebst du noch? Nichts gehört? Glaubst du, weil ich nicht hinunterkomme, höre und sehe ich nichts? Wann ist er nach Hause gekommen, he?»
«Wann?» wunderte sie sich lebhaft. «Das Kind kommt früh nach Hause, legt sich hin; und sieh, er schläft ja noch.»
Da konnte er sich nicht mehr halten. Seinen Schuh und die Pfeife warf er ihr nach. «Geh, ich will dich nicht mehr sehen!» Er wühlte sich vor Wut in die Kissen, Wut nicht so sehr gegen den Sohn als gegen die Mutter, gegen ihre angeblich so große Liebe zu dem Sohne. Weil sie für ihn log, ihn verteidigte, als ob nur sie ihn liebte, als ob er nur ihr Sohn wäre, als ob nur sie ihm Gutes wünschte. Dabei wußte er ganz genau, wann der Sohn heute nach Hause gekommen war, er hatte ihn doch gehört. Ganz leise nur hatte er den Klopfer gerührt, da war die Mutter schon aus dem Hause gesprungen. Sicher hatte sie auf ihn gewartet und gar nicht geschlafen. Ja, sie hatte nicht den Burschen aufmachen lassen, der immer bewaffnet hinter dem Tor schlief, sondern ihm gewehrt und gesagt: «Nicht du, du machst zu viel Lärm und weckst noch den Alten droben.» Und doch wußte der Alte, daß es ihr nicht etwa leid tat, wenn er durch den Lärm geweckt und gestört wurde; er sollte nur nicht hören, daß ihr Sohn erst bei Tagesanbruch nach Hause kam.
In diesem ewigen Zank und Streit mit dem Sohn starb der Alte. Dem Sohne, besonders aber seiner Frau zum Trotz wollte er nichts davon sagen, daß er sich krank fühlte, er klagte nicht, sondern lag immer oben auf dem Altan und ließ nur die Diener zu sich; und eines Tages fand man ihn tot.
Seit dem Tode Hadschi Trifuns kannte man in diesem Hause nur noch ein Leben des Überflusses voll üppiger Pracht, mit schönen Frauen, kostbaren Kleidern, auserlesenen Speisen, feinem Naschwerk. Nie drangen Lärm, Streit oder Kindergeschrei aus dem Hause, ja, niemand konnte sich rühmen, auch nur häßliche oder laute Worte von seinen Bewohnern gehört zu haben. Alles wurde in Ruhe abgetan. Sie waren bemüht, ihr Leben immer genußreicher zu gestalten: die Zimmer mußten reich und geschmackvoll ausgestattet sein, durch das Haus und über den Hof mußten weiche Frauenkleider rauschen, zarte, gepflegte Gesichter mußten dort zu sehen sein. Rings um das Haus herum wurden die benachbarten Grundstücke und Geschäfte angekauft. Die Ställe und Speicher, die ursprünglich dicht neben dem Hause gestanden hatten, wurden an das äußerste Ende des Hofes verlegt, damit das Einfahren von Getreide und Futter die Ruhe nicht störe. Die Gärten hingegen dehnten sich immer breiter aus, bepflanzt mit den schönsten und seltensten Bäumen, schwarzen Maulbeeren, Kirschen, Weichseln, Äpfeln und kostbaren veredelten Rosen. Gab es für die Frauen keinen anderen Lebenszweck, als sich zu pflegen, sich kostbar zu kleiden, ausländische Speisen zu bereiten und feine Handarbeiten zu machen, vor allem aber schön zu sein, sinnlich, leidenschaftlich, um die Männer zu berücken, so führten auch diese ihr eigenes Leben. Bei den Geschäften auf dem Marktplatz waren sie nie anzutreffen, und auch sonst sah man sie nirgends. Am wenigsten auf ihren Gütern und in den Weingärten. Nur auf das Gut bei Donje Vranje, das nur einen Gewehrschuß von der Stadt lag, kamen sie manchmal hinaus, weil das einen schönen Spaziergang bedeutete und man sich dort, besonders im Sommer und Herbst, ausruhen und erholen konnte. Ihr ganzes Leben war ausgefüllt mit Prunken und Prassen. Oft weilten sie auch in den nahegelegenen Kurorten, wo sie sich von ihren Ausschweifungen heilten, um beim nächsten Gelage wieder viel essen und trinken zu können.
Mit besonderer Pracht wurde das Fest des Hauspatrons, des Heiligen Georg, gefeiert. Wochenlang vorher begann man mit den Vorbereitungen, um die Gäste staunen und die Leute monatelang davon sprechen und erzählen zu machen: «Ach, was es alles auf dem Fest bei den Hadschi Trifuns gegeben hat!» Oder aber die Männer veranstalteten auf dem Gute bei Donje Vranje lärmende Trinkgelage in Gesellschaft von Griechen, Zinzaren, hohen türkischen Beamten, die sie ihres Glaubens wegen nicht hätten einladen dürfen. Dazu wurden Tänzer aus Skoplje geholt, Musikanten, Zurlabläser aus Massuritza und Zigeunerinnen mit sehnigen Körpern und glutvollen Augen. Bis in die Stadt hinein hörte man das Krachen der Gewehre, sah man die Raketen steigen. Nur zu oft endeten diese Gelage mit wüstem Glücksspiel, in dem die Männer leichtsinnig ihre Äcker und Weingärten verspielten.
So trieben sie es. Vom Leben der übrigen Stadt auf Straße und Markt, in Handel und Wandel, hielten sie sich fern, sie sonderten sich immer mehr ab, suchten sich immer mehr von den anderen zu unterscheiden. Damit die Leute sie aber nicht ganz vergaßen, zeigten sie sich bei Versammlungen und Festlichkeiten. Sie spendeten reichlich für den Bau von Schulen und Kirchen; und darum, nicht um ihrer Mitarbeit willen, wurde in das Kirchenpatronat oder den Vorstand bei einer Wohlfahrtssache auch immer ein Mitglied ihres Hauses hineingewählt.
Weil die Welt undankbar und zu Spott, Hohn und Schadenfreude stets bereit war, verheimlichten sie sorgfältig alles, was in der Familie an Zank und Streit vorfiel, ihre schlimmen Gewohnheiten und Leidenschaften, ja, sogar ihre Krankheiten. Und doch hätte es viel zu sehen, zu hören und zu erzählen gegeben, seitdem die Teilung des Vermögens begonnen hatte, seit jeder der Brüder – der Onkel Sofkas – sein eigenes Haus hatte haben wollen und darin alles so, wie es im Stammhaus gewesen war.
Mit Furcht und Schauder gedachte Sofka noch alles dessen, was sie als Kind erlauscht hatte, wenn die Großmutter, die Mutter und die Tanten davon sprachen, ohne zu ahnen, daß die kleine Sofka es hören, geschweige denn verstehen könnte, und alles dessen, was sie in späteren Jahren selbst miterlebt hatte. Noch jetzt zitterte Sofka am ganzen Leibe, wenn sie sich des geisteskranken Onkels erinnerte. Nach einer Krankheit, die ihn zum Krüppel machte, hatte er sich eingebildet, seine Frau betrüge ihn mit dem ersten Angestellten seines Geschäftes, hatte zu trinken begonnen und nun vollends den Verstand verloren. Sofka war oft mit den andern Kindern in das obere Stockwerk, wo man ihn eingesperrt hielt, hinaufgestiegen, um durch das Balkongitter nach ihm zu spähen, wie er, nur in Hemd und Unterhose und mit gefesselten Füßen, umherhüpfte. Wenn er die Kinder erblickte, fing er zu schreien an: «Ach, Maria, diese Dirne, ach, diese Dirne Maria!»
Sowie die Tante das hörte, lief sie schnell hinaus, ihn zur Ruhe zu bringen, jagte die Kinder die Treppe hinunter und zog ihn ins Zimmer zurück. Durch die Decke konnten sie dann sein Geschrei hören: «Weihwasser her! Weihwasser her! Du Hexe! Ich vergehe nach dem süßen Wasser. Au, au!»
Und wieder hörten sie ihn schreien, toben, sich wehren, hörten, wie er an das Bett gebunden wurde, sahen dann die Tante müde und schwach zurückkommen und sich zum Schlaf zurechtmachen, wobei sie seufzte und betete: «O Gott, nimm ihn zu Dir! O Gott, erlöse uns von ihm!»
2
Darum mochte Sofka nie an ihre Vorfahren erinnert werden, weil sie dann tagelang wie krank im Hause herumirrte, als wolle sie sich vor sich selber verstecken. Später erfuhr sie manches aus den Erzählungen anderer Leute.
Als Sofkas Vater herangewachsen war und, wie es sich für einen Sohn aus reichem Hause geziemte, nach Saloniki, ja sogar bis nach Konstantinopel geschickt wurde, um etwas zu lernen und die Welt zu sehen, blieben ihre Großeltern nicht in der Stadt, sondern überließen das Geschäft auf dem Markte dem Gehilfen Tone, ihr Haus aber der Obhut ihrer Dienerin Magda, die sie als Kind aufgenommen und gut verheiratet hatten, und lebten selbst ständig auf dem Leibeignengut. Sie aßen nur, was das Gut hergab, um ja ihrem Mita, Sofkas Vater, mehr Geld schicken zu können, damit dieser in der Fremde recht sorglos zu leben, zu arbeiten und etwas zu lernen in der Lage sei.
Und in der Tat war Sofkas Vater, als er nach Hause kam, ein echter «Effendi» geworden, ein Herr. Er sprach türkisch, arabisch und griechisch besser als seine Muttersprache. Doch war er allen entfremdet. Selbst seinem Vater und der Mutter gegenüber benahm er sich wie ein Fremder. Er aß nicht unten mit ihnen, für ihn mußte oben im Empfangszimmer gedeckt und besonders gekocht werden. Das einzige, was ihn erfreute und stolz machte, war, daß die angesehensten Begs und Paschas um seiner Gelehrsamkeit und Vornehmheit willen mit ihm zu verkehren begannen. Sie forderten ihn auf, ihren Beratungen und Gerichtsverhandlungen beizuwohnen, wo er als Dolmetscher die Verbindung zwischen ihnen und dem Volke herstellte, über das sie zu richten, zu herrschen hatten. Ja, sie luden ihn sogar zu ihren Gastmählern und in ihre Häuser ein. Er aber veranstaltete ihnen zu Ehren Feste und suchte sie dabei an Luxus zu übertreffen. Er galt auch als besonderer Frauenkenner und mußte sein Urteil über die Frauen abgeben, die die Begs zu sich nahmen. Später, als er selbst heiraten sollte, gab es in der Stadt nicht mehr viel reiche Mädchen aus gutem Hause. Ihm blieb also die Wahl zwischen einer reichen Bauerntochter oder einer armen Schönen von Familie. Und er wählte das Letztere. Sofkas Mutter, die jüngste von vielen Schwestern, stammte aus einem achtbaren, aber gänzlich verarmten Geschlecht. Ihre Schwestern hatten alle längst mit kleinen Kaufleuten vorliebgenommen. Theodora, Sofkas Mutter, glich ihnen gar nicht. Sie war mager, schlank, braun, man hätte sie für einen Jungen halten können, und niemand hätte geglaubt, daß aus ihr noch einmal eine Schönheit würde. Nur Effendi Mita ließ sich nicht täuschen. Er nahm sie zur Frau. Und er hatte sich nicht geirrt. Bald nach der Hochzeit entfaltete sich Theodora und erblühte zu vollendeter Schönheit.
Dennoch wurde Effendi Mita ihrer bald satt und setzte seine alte Lebensweise fort. Wie früher, als er noch ledig war, wurde für ihn allein oben gedeckt, er kam selten hinunter, sprach noch seltener mit seinen Leuten, kümmerte sich im Hause um nichts. Und als seine Frau ihm Sofka geboren hatte, mußte sie ganz von ihm getrennt unten bei ihren Schwiegereltern schlafen, damit er in möglichst großer Ruhe und Abgeschiedenheit leben könnte. Wann immer sich eine Gelegenheit bot, verreiste er, angeblich in Geschäften, und wenn diese Reisen auch aus Geldmangel nie lange dauerten, so fanden sie dafür um so häufiger statt. Während einer dieser Reisen starben seine Eltern, und da der Bote ihn nicht rechtzeitig erreichte, konnte er sie nicht mehr aufgebahrt sehen.
Obgleich sich Effendi Mita vom Haushalt und sogar von seiner Frau zurückzog, wurde dort noch in Überfluß und Luxus gelebt. Ewig dankbar, daß er sie genommen, sie zu sich heraufgezogen hatte, entfaltete Theodora Gaben, die man nicht in ihr gesucht hätte. Sie räumte die Zimmer auf, bereitete feine Speisen, empfing Verwandte und Gäste, als stamme sie aus dem vornehmsten und reichsten Hause. Mit keiner Miene, keiner Bewegung, geschweige denn mit einem Wort wehrte sie sich dagegen, daß er sich von ihr und allem fernhielt. Erst als Sofka heranwuchs, begann er mehr um des Kindes als um der Mutter willen hie und da Wärme zu zeigen und sich den beiden zu nähern. Er selbst lehrte Sofka lesen und schreiben. Manchmal, wenn er nach Hause kam, und Sofka war mit der Mutter und anderen Frauen unten und flog ihm entgegen, dann geschah es, daß er das Kind umarmte und herantrat. Sofka fühlte dann seine Hand über ihre Wange, ihr Kinn und ihr lockiges Haar streichen. Noch heute erinnert sie sich an den Duft seiner schmalen Finger und seiner Kleider. «Na, wie geht’s, Sofkitza? Bist du artig gewesen?» Gut gelaunt, blieb er dann, über das Kind gebeugt, vor der Küche stehen, begrüßte die Mutter und die anderen Frauen, statt wie sonst ohne Wort noch Gruß gleich nach oben in sein Zimmer zu eilen. Alle fühlten sich dann wie befreit, besonders die Mutter, die – der anderen Frauen wegen – den Augenblick kaum abwarten konnte, wo sie mit ihm ein wenig sprechen und scherzen durfte. Dann pflegte sie sich über Sofka zu beklagen: «Artig? Den ganzen Morgen läuft sie im Garten herum, reißt Blumen ab und wirft sie wieder fort.»
Seine Hand noch auf ihrem Kopfe fühlend, umschlang dann Sofka seine Knie in der faltigen Tuchhose, sich trotz ihrer Jugend bewußt, daß ihr Umschmeicheln des Vaters die Mutter glücklich machte, und fing sich zu rechtfertigen an: «Nein, Effendichen, nein, Väterchen! Nein, bei deinem Leben!»
Dann nahm er sie auf den Arm, trug sie in sein Zimmer hinauf und spielte mit ihr, bis es dunkel wurde und unten bei der Mutter der letzte Besuch gegangen war. Oft setzte er sie dann auf den Diwan, kniete sich vor sie hin, nahm ihre Hände, legte sich ihre Arme um den Hals und betrachtete das Kind mit einem wunderlich tiefen Blick. Die Augen wurden ihm feucht, und der Mund begann ihm zu beben. Er konnte sich nicht satt an ihr sehen, als weckten ihre Augen, ihr Mund in ihm die Erinnerung an etwas schmerzlich Ersehntes, nie Gefundenes. War es, weil diese schöne kleine Sofka kein Sohn, kein Erbe war? Oder gemahnten ihn diese schmalen, feinen Lippen, diese schwarzen Kinderaugen, diese dunkle Stirn zwischen den langen Locken an die Mutter, wie er sie das erstemal sah, sie ihn das erstemal entzückte? Das Kind auf den Armen tragend, sagte er: «Sofka! … Sofkitza … Vaters Sofkitza!» Und dann küßte er sie. Noch heute fühlte sie es, wie seine rasierten Wangen sie gekratzt hatten.
Wurde diese plötzlich erwachte gute Laune nicht durch einen Besuch oder eine andere Störung verscheucht, so pflegte er auch die Mutter heraufzurufen. Dann aßen sie miteinander Abendbrot, saßen zusammen in seinem Zimmer, und Sofka kann sich nicht an Köstlicheres erinnern als an diese Abende, denen manchmal auch glückliche Tage folgten. Im Wagen fuhren sie dann nach Donje Vranje, dem Leibeignengut, nur sie drei und Magda.
Effendi Mita pflegte es sich im Wagen auf dem Rücksitz bequem zu machen. Er war in feines Tuch gekleidet, aber nicht wie die anderen, sondern nach einem besonders für ihn erfundenen Schnitt kostbarer und teurer angezogen, mit Hosen ohne Verschnürung, weil sie dann leichter waren. Sein langes, trockenes, etwas knochiges Gesicht zeigte wie stets einen geringschätzigen Ausdruck um Augen und Mund, die hohe Stirn trug dicht unter den Haaren eine Querfalte, und unter der Stirn schauten seine ewig müden, ewig nur halboffenen Augen hervor. Die eine Hand hing lässig über das ausgestreckte Bein herab, mit der anderen hielt er Sofka, die geputzt und gekleidet wie ein großes Mädchen auf seinem Schoß saß. Ihr Haar war um Stirn und Ohren in kleine Löckchen gelegt, dazu trug sie einen kleinen Mintan und sehr viel Schmuck. Ihnen gegenüber saß die Mutter, noch rosig und glühend vom Dampfbad. Ihre Augen, diese berühmten großen Augen mit den schön geschweiften Brauen, ihre heißen Wangen strahlten, und um den Mund spielte ein glückliches Lächeln. Der Wagen fuhr einen schmalen Weg bergab, den zu beiden Seiten Weidenbäume säumten und Chausseegräben einfaßten, und der kühl und frisch war. Dann kam man in die Ebene, fuhr zwischen den mit Mais und Tabak gleichmäßig bepflanzten Feldern hindurch, näherte sich immer mehr dem Ziel. Magda, die oben neben dem Kutscher inmitten ihrer Körbe und Bündel mit Speisen und Kuchen saß, konnte es nicht lassen, die vorübergehenden Bauern und Arbeiter zu begrüßen und sich mit ihnen zu unterhalten. Ja, sie war die einzige, die ihre Grüße erwiderte, da Effendi Mita, der mit Sofka auf dem Schoß zurückgelehnt dasaß, niemanden ansah, sondern nur über sein ausgestrecktes Knie hinweg auf seine lackledernen feinen, echt türkischen Halbschuhe blickte, weil er die Grüße nicht sehen wollte, um sie nicht erwidern zu müssen.





























