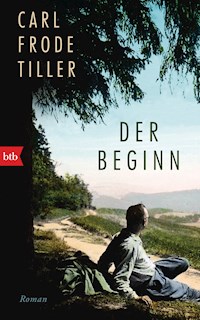9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einem der bedeutendsten Autoren Norwegens - »Eine kunstvolle Geschichte von Trauer und Versöhnung« (Stavanger Aftenblad)
Es ist Heiligabend. Elisabet und Sakarias haben nachmittags das Grab ihres Sohnes besucht, der mit 12 bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Sie haben eine Kerze angezündet, den Schnee vom Grabstein gefegt und wollen den Abend getrennt verbringen, denn sie sind schon lange kein Paar mehr. Doch es kommt anders. Sie gehen gemeinsam in das Haus, in dem sie als Familie gewohnt haben. Elisabet setzt sich ans Klavier und spielt ein Stück, das ihr Sohn oft geübt hat, hängt dabei Bildern und Gedanken nach. Es wird für die Eltern ein ganz besonderer Abend, erfüllt von Melancholie und Erinnerungen. Neben der Trauer erleben sie jedoch gleichzeitig auch ein neues Gefühl von Zusammengehörigkeit und Halt. Die Anwesenheit des Sohnes ist für beide spürbar. Carl Frode Tiller schreibt kunstvoll und menschlich über Leben und Tod und die Verbundenheit mit geliebten Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Es ist Heiligabend. Elisabet und Sakarias haben nachmittags das Grab ihres Sohnes besucht, der mit zwölf bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Sie haben eine Kerze angezündet, den Schnee vom Grabstein gefegt und wollen den Abend getrennt verbringen, denn sie sind seit einiger Zeit kein Paar mehr. Doch es kommt anders. Sie gehen gemeinsam in das Haus, in dem sie als Familie gewohnt haben. Elisabet setzt sich ans Klavier und spielt ein Stück, das ihr Sohn oft geübt hat, lässt Gedanken kommen. Es wird für die Eltern ein ganz besonderer Abend, erfüllt von Melancholie, aber auch von einem neuen Gefühl von Zusammengehörigkeit und Halt. Die Anwesenheit des Sohnes ist für beide spürbar. Carl Frode Tiller schreibt kunstvoll und menschlich über Leben und Tod und die Verbundenheit mit geliebten Menschen.
Carl Frode Tiller, geboren 1970, ist Schriftsteller, Historiker, Musiker und Komponist, der auf Nynorsk schreibt. Er gilt als einer der wichtigsten Autoren der norwegischen Gegenwartsliteratur und virtuoser Meister der psychologischen Zwischentöne. 2005 wurde Tiller zu einem der besten norwegischen Schriftsteller unter 35 Jahren gekürt, seine zehn Romane wurden in 16 Sprachen übersetzt, er erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, u. a. den Brage-Preis und den Literaturpreis der Europäischen Union. Neben Romanen hat Tiller auch Theaterstücke, Kurzgeschichten und andere Kurzprosa für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen geschrieben. Künstler und Werke, die ihn geprägt und inspiriert haben, sind für ihn Ingmar Bergman, Jon Fosse, Johann Sebastian Bach und die Bibel.
Die norwegische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Flukt bei Aschehoug, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Diese Übersetzung wurde mit finanzieller Unterstützung von NORLA veröffentlicht.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2024
First published by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2021
Published in agreement with Oslo Literary Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf und unter Verwendung eines Motivs von Aina Griffin und Jan Alsaker/Observatoriet
Autorenfoto: © Trine Melhuus
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MA · Herstellung: KH
ISBN 978-3-641-29912-5V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
CARLFRODETILLER
HALT
Roman
Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger
Aber Lebendige machen alle den Fehler, daß sie zu stark unterscheiden. Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehn oder Toten. Die ewige Strömung reißt durch beide Bereiche alle Alter immer mit sich und übertönt sie in beiden.
Rainer Maria Rilke, Die erste Duineser Elegie
1
Ich stand in der Tür und schaute ins Wohnzimmer, zu Mama in ihrem langen roten Kleid, das wie Blut vom Klavierhocker auf den Wohnzimmerboden zu fließen schien, und dann zu Papa, der im schwarzen Anzug und mit schicken glänzenden Schuhen im Sessel saß. Mama hatte die Hände auf dem Schoß übereinandergelegt und ein Glas Wein auf das Klavier gestellt, gleich neben die glänzende Bronzebüste, und Papa hatte ein Bein über das andere geschlagen und ein Glas Cognac in der Hand. Sie sagten nichts, saßen nur da, und ich stand nur da, rührte mich nicht. Kandelaber auf Tisch und Fensterbrett, die warmgelben Flammen warfen flackernde Schatten an die Wände. Im Ofen knisterte und prasselte es. In der Fensterscheibe der Verandatür hing der leuchtende Weihnachtsstern, und zwischen Klavier und Sofa stand der Plastikweihnachtsbaum, den Mama immer entschieden abgelehnt, in diesem Jahr aber der Einfachheit halber aufgestellt hatte.
Das war sehr schön, sagte Papa.
Danke, sagte Mama.
Was war das?, fragte Papa.
Bach, sagte Mama. Es ist immer Bach.
Das habe ich gehört, sagte Papa. Aber welches Stück?
Aus dem Wohltemperierten Klavier, Teil zwei, sagte sie, alle Stücke.
Papa nickte und lächelte, dann trank er einen Schluck Cognac, und Mama erwiderte sein Lächeln, dabei erhob sie sich vom Klavierhocker, griff nach dem Weinglas und trank einen kleinen Schluck, sie bewegte sich Richtung Sofa, und ich folgte ihr, sie ging langsam, das lange rote Kleid strich über den Boden, und es sah aus, als würde sie durch das Zimmer gleiten, und ich glitt hinter ihr her, glitt durch ihren Rücken in sie hinein und setzte mich aufs Sofa, ich warf einen Blick auf Sakarias und trank noch einen Schluck Wein.
Keine Angst, Sakarias, sagte ich, ich lächelte und stellte das Weinglas zurück auf den Tisch. Ich habe nicht vor, mich zu betrinken.
Er sagte nichts, lächelte nur zurück.
Heute Abend werde ich nicht alt, sagte ich. Ich bin jetzt schon ziemlich müde.
Ich auch, sagte er. Ich rufe mir gleich ein Taxi. Er sah zu Boden, dann wieder hoch zu mir. Aber vielen Dank, dass ich kommen durfte, Elisabet. Es war ein sehr schöner Heiligabend.
Die Toilettentür war nur angelehnt, und aus dem kaputten Spülkasten drang leises Rauschen, ansonsten war es ganz still.
Ich sah ihn an, war kurz davor zu sagen, er könne gern bis morgen bleiben, unterließ es aber, ich brachte es nicht über mich, zum einen fürchtete ich, er könnte Nein sagen, zum anderen war ich unsicher, ob ich es selbst wollte.
Er konnte meine Gedanken lesen, das sah ich ihm an, wie auch seinem Lächeln, es war freundlich und traurig zugleich, fast nachsichtig.
Es ist ja nicht so, dass ich keine Lust hätte, sagte er.
Ich schluckte.
Aber?, fragte ich.
Ich weiß nicht, sagte er. Es ist vielleicht noch zu früh.
Wir brauchen ja nicht miteinander zu schlafen, sagte ich.
Nein, sagte er.
Wir können einfach zusammen sein, sagte ich.
Er sagte nichts, lächelte weiter.
Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf, mir entfuhr ein leises Lachen.
Mein Gott, hier sitze ich und flehe dich an, über Nacht zu bleiben, sagte ich.
Wahrscheinlich ist es lange her, dass du was mit jemandem hattest, sagte er.
Wir sahen uns an, ganz kurz nur, dann fingen wir beide an zu lachen.
Ich trank einen Schluck Wein.
Das stimmt, sagte ich, sah ihn wieder an, nicht so, wie ich ihn angeschaut hätte, wenn ich ihn zum Sex hätte einladen wollen, sondern mit einem Blick, der ihm klarmachte, dass ich seit unserer Trennung niemanden mehr gehabt hatte.
Er sah mich an und lächelte, wartete einen Moment.
Ich kann gern bis morgen bleiben, Elisabet, sagte er. Wenn du es wirklich willst.
Das will ich, sagte ich.
Wir schauten uns fest in die Augen, Sekunden nur, dann senkte ich den Blick.
Kannst du vor dem Schlafengehen nicht noch was spielen?, fragte er. Es war so schön.
Ich sagte nichts, lächelte nur und nickte, dann schenkte ich mir noch etwas Wein ein, nahm das Glas und ging zum Klavier, ich trank einen Schluck, stellte das Glas neben die Büste, strich mit der rechten Hand das Kleid an Po und Oberschenkeln glatt, damit es unter mir keine Falten warf, und setzte mich auf den Klavierhocker.
Vielleicht kannst du das Stück spielen, das Johannes so gern mochte?, fragte er.
Ich sah ihn an, für ein oder zwei Sekunden erwiderte er meinen Blick, dann schloss er die Augen und lächelte, schüttelte dabei den Kopf.
Aber nicht, wenn du nicht willst, sagte er.
Ich schüttelte den Kopf.
Kein Problem, sagte ich.
Wir sahen uns an und lächelten, dann suchte ich die Noten heraus und schlug sie auf, ich erhob mich kurz, zog den Hocker dichter an das Klavier, und als ich mich vorbeugte, baumelte der Silberanhänger mit der Taube darin kurz vor meinem Gesicht, um sich anschließend, sobald ich den Oberkörper aufrichtete, sanft wieder auf den Kleiderstoff zu legen, ich schloss die Augen und schluckte, im Kamin knackte es laut, ansonsten war alles still, ich ließ ein paar Sekunden verstreichen, dann holte ich tief Luft, hob die Hände und ließ sie auf die Tasten sinken, mit dem Daumen der rechten Hand schlug ich den ersten Ton an, vorsichtig, sanft, als wollte ich eine Vertäuung am Anleger lösen, ich wartete kurz, zögerte die Pause hinaus, damit sie die Musik ausdehnte, nicht so kurz, dass die Dramatik verschwand, und nicht so lang, dass sich die Spannung löste, sondern genau in der richtigen Länge, so spielte ich weiter, ich löste die Vertäuung und ließ mich davontreiben, langsam, langsam, hinein in die Musik, ich spielte einen gebrochenen Mollakkord, öffnete die Augen und schaute auf die rechte Hand, die sich über die Tasten bewegte, dort unten, weit unter mir, seitwärts, wie ein Krebs über den Meeresboden, und dann, während die rechte Hand zum Grundton zurückkehrte und das erste Motiv beendete, ließ ich die linke Hand mit demselben Thema dazukommen, als Comes, nicht tonal dieses Mal, sondern real, keine Modulation, sondern eine exakte Transposition des Dux, ich schloss die Augen und ließ die Finger über die Tasten laufen, schneller und schneller, dabei bewegte ich mich vor und zurück, ich begann wegzugleiten, verschwand mehr und mehr in der Musik, und als ich mitten in der Fuge war, dachte ich nicht länger an das, was ich spielte, ich wollte nicht denken, ich wollte, dass die Hände ihre Arbeit verrichteten, ich wollte, dass mich die Hände hinter die Worte führten und über sie hinaus, ich wollte, dass die Hände mich überraschten, dass sie mich an Orte führten, an denen ich noch nie gewesen war, ich wollte mich im Spiel verlieren, ich wollte in meinem eigenen Spiel aufgehen, und ich spielte und spielte, mein Oberkörper bewegte sich vor und zurück wie der Oberkörper eines orthodoxen Juden, der an der Klagemauer betet, und dann lösten sich die Tasten und kehrten zurück zu den Elefanten in der Savanne, und das Holz löste sich und sammelte sich zu laubschweren Eichen, die stolz im Wald standen, und ich ging hinein in den Wald, tiefer und tiefer, neben und über mir hingen Äste voller Laub, das leicht im Wind zitterte und flackernde Schattenmuster auf den Pfad warf, und der Pfad war voller glatter Wurzeln, die sich über und unter dem Boden wanden, und der schwarze Bach rauschte und strömte, und der kaputte Spülkasten strömte und strömte, und die Musik trieb davon.
2
Danke, sagte Sakarias, als ich fertig war und die Hände von den Tasten in den Schoß hatte gleiten lassen.
Ich sah ihn an und lächelte, und er lächelte zurück.
Wollen wir schlafen gehen?, fragte ich.
Er sagte nichts, nickte nur, wir standen beide auf, bliesen die Kerzen aus und räumten das Wohnzimmer ein bisschen auf, dann umarmten wir uns, spontan und schweigend, einen Moment standen wir da, in fester Umarmung, schließlich gingen wir ins Schlafzimmer, zogen uns aus und legten uns ins Bett, wir waren müde und erschöpft, und wir versuchten nicht einmal, miteinander zu schlafen, unsere Hände suchten einander und drückten zweimal zaghaft zu, während wir uns eine gute Nacht wünschten und uns gegenseitig für den schönen Abend bedankten, und dann schwiegen wir, lagen einfach nur da, jeder unter seiner Decke, es war kalt und dunkel, der kaputte Spülkasten in der Toilette rauschte und gluckerte, und bald ging das Rauschen in das Gluckern von Kaffee über, der in meinen Körper strömte, ich hielt den Knopf der stahlgrauen Kanne gedrückt, bis der Becher voll war, dann stellte ich Mamas Becher darunter und füllte auch ihn, aber was war das, was passierte hier, wie konnte ich neben Elisabet im Bett liegen und zugleich beobachten, wie ich mit Mama im Café war, ich war doch noch gar nicht eingeschlafen, ich war hellwach, also träumte ich nicht, was war es dann, es schien, als hätte die Dunkelheit im Schlafzimmer einen Riss bekommen, direkt unter der Decke hatte sich ein Spalt aufgetan, und durch diesen Spalt sah ich mich selbst für den Kaffee bezahlen, die Becher vom Tresen nehmen und zu unserem Tisch gehen, und der Spalt begann zu wachsen, er wurde größer, er weitete sich so sehr aus, dass das Café mehr und mehr zum Vorschein kam, alles wuchs mir entgegen, breitete sich um mich aus, der Kronleuchter an der Decke, die schachbrettgemusterten Fliesen am Boden mit deutlichen Streifen vom Mopp und die kleinen braunen Holztische mit brennenden Teelichtern darauf, alles kam näher, als wäre das Café ein Fluss, der über die Ufer tritt, als triebe das Café auf mich zu, hinein ins Schlafzimmer, mit Stühlen und Tischen und Gästen, die überall herumschwammen, was passierte hier, das ganze Café entfaltete sich um mich herum, und dort am Fenstertisch ganz hinten im Raum saß Mama.
Danke, sagte sie, als ich den Becher vor sie hinstellte.
Bitte, sagte ich und setzte mich ihr gegenüber.
Sie trank einen Schluck. Mir fiel auf, dass die Altersflecken an ihren Händen und Unterarmen größer geworden waren, in schnörkeligen Mustern, die an Landkarten erinnerten, verteilten sie sich über die Haut.
Und wie geht’s ihr?, fragte sie. Elisabet, meine ich.
Ich wiegte den Kopf bedächtig hin und her, gab ihr zu verstehen, dass es Elisabet nicht so gut ging, und sie lächelte sanft und nickte.
Ich hoffe nur, du schaffst es mal, auf den Tisch zu hauen, sagte sie.
Ich sah sie an, ohne ein Wort zu sagen, merkte, wie sich mein Mund von selbst öffnete.
Ja, kein vollständiger Rückzug, sagte sie. Ich meine nur, dass du es schaffst, in dem Ganzen auf dich selbst aufzupassen.
Ich habe doch gesagt, dass ich das tue, sagte ich.
Sie nickte, dachte sich aber ihren Teil, das sah ich an ihrem Blick, er war ernst, fast traurig. Sie schaute mir direkt in die Augen.
Das tue ich wirklich, sagte ich.
Sie nickte erneut.
Ja, sagte sie leise.
Ich trank einen Schluck Kaffee.
Ich meine … auf den Tisch hauen, sagte ich und stellte den Becher wieder auf die Untertasse.
Reg dich nicht auf, Sakarias, sagte sie.
Ich rege mich nicht auf, sagte ich. Aber du kannst doch nicht erwarten, dass sie es schon verwunden hat, ihr Kind verloren zu haben. Das kann niemand! Ich auch nicht!
Sie schluckte.
Nein, sagte sie.
Das verstehst du doch?
Natürlich verstehe ich das, sagte sie leise.
Ich schloss die Augen und seufzte.
Komm schon, Mama, sagte ich. Ich machte die Augen auf und sah sie an. Hör auf mit diesen Doppelbotschaften! Bitte!
Ihr war schon klar, was ich meinte, aber sie mimte die Ahnungslose, zog die Augenbrauen hoch.
Du behauptest zu verstehen, aber dein Blick und dein Gesichtsausdruck sagen etwas völlig anderes, sagte ich.
Sie versuchte, ihren verständnislosen Gesichtsausdruck beizubehalten, gab jedoch auf, seufzend schloss sie die Augen und schüttelte den Kopf, dann lächelte sie mich an.
Entschuldigung, Sakarias, sagte sie. Es ist nur … ich mache mir einfach Sorgen um dich. Manchmal bist du zu gut für diese Welt.
Ich sah sie an, sie behauptet, ich sei zu gut für diese Welt, was sie aber eigentlich meint, ist, ich sei zu gut für Elisabet, sie hatte mir immer zu verstehen gegeben, dass ich etwas Besseres verdiente. Ich schwieg, schloss die Augen und öffnete sie wieder, langsam, beruhigend.
Ich schaffe das, Mama, sagte ich. Wir schaffen es beide.
Sie nickte.
Ich beugte mich vor, aß ein bisschen von dem Nudelsalat und lehnte mich wieder zurück, dort saß ich und bewegte mich vor und zurück, wie ein orthodoxer Jude, der an der Klagemauer betet, und ich betete und betete, denn Klavierspielen war wie Beten, und ich spielte und spielte, bewegte mich vor und zurück, immer wieder, auf dem Stuhl und dem Klavierhocker und dann wieder auf dem Stuhl.
Aber wie geht es dir denn?, fragte ich.
Sie sah mich an und lächelte das tapfere Lächeln, das sie gern an den Tag legt, wenn ich ihr diese Frage stelle.
Tja, irgendwie muss es ja gehen, sagte sie und wiegte den Kopf hin und her.
Ich nickte.
Manchmal ziehen sich die Tage natürlich schon sehr in die Länge, sagte sie. Aber … das gehört wohl dazu, wenn man alt wird. Sie lachte kurz und traurig.
Ich trank einen Schluck Kaffee.
Du solltest bei der Fitnessgruppe mitmachen, von der du erzählt hast, sagte ich.
Erneut zeigte sie ihr trauriges Lächeln.
Oder?
Sie sah mich an. Fast wirkte sie beleidigt.
Das kann ich nicht mehr, Sakarias, sagte sie. Das weißt du doch. Meine Knie machen nicht länger mit.
Okay, sagte ich.
Sie schüttelte den Kopf und schnaubte durch die Nase, dann drehte sie sich nach rechts und schaute aus dem Fenster. Der Wind war aufgefrischt. Rote welke Herbstblätter wirbelten hoch und trieben über den Bürgersteig.
Ich denke immer öfter darüber nach, wieder nach Namsos zu ziehen, sagte sie.
Aha?
Sie nahm den Kaffeebecher in die Hand.
Ja, sagte sie. Sie sagte es schnell und ohne das J im Anlaut, wodurch es schnippisch klang, oder zumindest unzufrieden. Sie trank einen Schluck und stellte den Becher wieder auf die Untertasse, in der Küche sang ein Topf, eine junge Frau am Nachbartisch tippte wie wild auf ihrem Mac herum, und ich lag vollkommen still im Bett und sah, wie ich dort saß und Mama betrachtete, was war das, was passierte hier, es fühlte sich an wie ein Traum, dabei waren meine Augen weit geöffnet, ich träumte also nicht, vielmehr war ich hellwach.
Ich hielt die Hand vor den Mund und räusperte mich.
Ja, ich kann gut verstehen, dass du darüber nachdenkst, sagte ich. Jetzt, wo du allein bist. Und dann ist da natürlich auch noch Judit mit ihrer Familie.
Ich merkte sofort, dass sie das nicht hören wollte, sie hatte sich vermutlich vorgestellt, dass mich ihre Umzugspläne traurig stimmten, dass ich enttäuscht wäre und vielleicht versuchen würde, ihr den Umzug auszureden.
Mit dem Messer schob ich eine der pestoglänzenden Spiralnudeln auf die Gabel.
Aber für uns wäre es natürlich sehr schade, wenn du wegziehst, sagte ich.
Sie schaute immer noch aus dem Fenster und lächelte, wie man es tut, wenn man zum Ausdruck bringen will, dass jemand etwas Blödes gesagt hat.
So viel wird sich für euch ja nicht ändern, sagte sie.
Komm schon, Mama, sagte ich.
Sie drehte sich zu mir um.
Was denn?
Du verstehst doch, dass wir dich in der letzten Zeit nicht so oft besuchen konnten.
Natürlich, sagte sie. Habe ich was anderes gesagt?
Ich merkte, dass ich auf diese Spielchen keine Lust mehr hatte, ich war schon vorher genervt gewesen, und es nervte mich noch mehr, wenn sie so drauf war, es war so anstrengend, ich merkte, wie sie mir Energie entzog, aber ich schwieg, wollte nichts sagen, es würde nichts bringen, am besten schluckte man es hinunter. Ich nahm die Kaffeetasse und trank einen Schluck, warf zugleich einen Blick auf das tippende Mädchen am Nachbartisch, die langen dünnen Finger hüpften über die Tastatur und die Klaviertasten und wieder über die Tastatur, ich stellte den Kaffeebecher auf die Untertasse, nahm die Gabel in die eine Hand, das Messer in die andere, und jetzt hielt ich plötzlich ein Taschenmesser in der Hand, ein rot-weißes Messer der Schweizer Armee mit Schere und Flaschenöffner und vielen verschiedenen Klingen, wo kommt das denn her, dachte ich, als ich die größte Klinge mit dem Nagel meines Zeigefingers herauszog, ich legte es auf den Rand einer Pappschachtel, die vor mir stand, dann begann ich, die Pappe und die Nudeln damit zu schneiden.
Entschuldige, Sakarias, sagte Mama, sie schloss die Augen und seufzte, ließ die Schultern etwas weiter sinken, so verharrte sie einen Moment, dann öffnete sie die Augen und schüttelte den Kopf. Es ist wirklich nicht meine Absicht … ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich reiße mich jetzt zusammen, sagte sie.
Alles gut, sagte ich. Lächelte sie an.
Ich meine es ernst, sagte sie. Du hast zurzeit genug um die Ohren. Mein Gott. Da musst du dir nicht auch noch mein Gejammer anhören.
Schon gut, Mama, sagte ich. Außerdem kann ich verstehen, dass es für dich im Moment auch nicht so leicht ist. Ihr wart ja trotz allem ein paar Jahre zusammen.
O Gott, erinnere mich bloß nicht an den Typen, sagte sie. Sie sah mich an und lachte, und ich lachte mit.
Ja, ja, sagte ich. Ich nahm das Handy heraus, um nachzusehen, wie spät es war. Es war schon Viertel vor eins. Ich muss langsam zurück ins Museum, sagte ich.
Sie nickte.
Habt ihr im Moment viel zu tun?, fragte sie.
Sehr viel. Die neue Ausstellung soll bis Weihnachten fertig sein, und noch steht viel Arbeit aus, sagte ich, dabei schob ich den Stuhl zurück und stand auf. Im selben Moment ging die Eingangstür auf und wieder zu, und der Luftzug brachte den Geruch von Krustenbraten mit sich, der sich im Café und im Schlafzimmer ausbreitete.
Ich verstehe, dass es guttut, wieder bei der Arbeit zu sein, sagte Mama. Dass es gut ist, an etwas anderes zu denken. Aber du solltest es nicht übertreiben. Pass gut auf dich auf.
Ich nahm die Jacke vom Stuhlrücken.
Das mache ich, Mama, sagte ich.
Ich habe schon genug Leute gesehen, die in diese Falle getappt sind, Sakarias, sagte sie.
Ich bin vorsichtig, sagte ich.
Hoffentlich, sagte sie.
Versprochen, sagte ich.
Ich schob den Stuhl zurück an den Tisch und schlüpfte mit einem Arm in den Jackenärmel.
Du, eine Sache noch, bevor wir gehen, sagte Mama. Du hättest nicht kurz Zeit, für mich ein paar Säcke Brennholz aus dem Keller nach oben zu tragen? Ich würde es ja gern selbst machen, aber ich schaffe es nicht mehr.
Fängst du schon an zu heizen?, fragte ich. Es ist doch erst September.
Die neue Wohnung ist so schlecht isoliert, sagte sie. Abends friere ich. Beim Fernsehen muss ich mir die Beine mit einer Wolldecke zudecken.
Ich nickte.
Natürlich trage ich dir Brennholz hoch, sagte ich. Reicht es, wenn ich morgen nach der Arbeit vorbeikomme? Heute Nachmittag und Abend bin ich ziemlich beschäftigt.
Sie knöpfte gerade ihren Mantel zu und hielt kurz inne, sah zu mir hoch.
Ja …, kam es zögerlich.
Damit wollte sie natürlich sagen, »eigentlich nicht«, das war mir schon klar.
Tja … ich kann nichts versprechen, aber ich versuche, es heute Nachmittag noch unterzubringen. Eigentlich hatte ich keine Lust, ich war so erschöpft, trotzdem sagte ich das.
Sie senkte den Blick, während sie den letzten Knopf schloss.
Nein, nein, sagte sie. Lächelte wieder ihr tapferes Lächeln. Das musst du nicht, Sakarias.
Sicher?, fragte ich.
Ja, doch, sagte sie. Ich glaube nicht, dass es am Wochenende fürchterlich kalt werden soll.
Komm schon, Mama!, sagte ich. Du kannst doch nicht abends dasitzen und frieren.
Du weißt ja, ich habe noch die Elektroheizkörper. Außerdem mache ich die Tür zum Gang zu, dann muss ich nicht so viel heizen. Es geht schon irgendwie, sagte sie und hängte sich die Handtasche über die Schulter. Entschuldigung, sagte sie zu dem jungen Mädchen mit dem Mac.
Sorry, sagte das Mädchen, nahm den Blick nicht vom Bildschirm, hob nur leicht den Po an und zog den Stuhl etwas näher an den Tisch, dann setzte sie sich wieder und schrieb weiter, schneller und schneller, ihre Finger sprangen über die Tastatur und die Tasten, und ich saß auf dem Klavierhocker und spielte und spielte, dabei bewegte ich den Oberkörper vor und zurück, wie ein orthodoxer Jude, der an der Klagemauer zu Gott dem Allmächtigen betet, glauben hieß, erkennen, wie gering man vor Gott war, glauben hieß, sich der Übermacht zu beugen, sich im Sterben zu üben, es war genau wie beim Klavierspiel, auch spielen war, sich im Sterben zu üben, sich hinzugeben, die Vertäuung zu lösen und sich abzustoßen, loszulassen und mitzutreiben, sich fallen zu lassen, und ich fiel und fiel, schneller und schneller, das, was wie Flügelschlagen klang, waren Schläge meiner Ärmel, denn ich war kein Vogel, ich war ein Mensch, und ich fiel und fiel, der große weiße Stein kam immer näher, und der Bürgersteig wurde größer und größer, wuchs mir entgegen, und als ich auf dem Asphalt aufschlug, fiel ich weiter, und im Fallen sah ich, wie sich die Tasten vom Klavier lösten und zu den Elefanten in der Savanne zurückkehrten, und ich sah, wie sich das Holz löste und sich zu stattlichen Eichen sammelte, die stolz im Wald standen, und ich ging hinein in den Wald, tiefer und tiefer, und wo war ich jetzt, wo war ich gelandet, was war das für ein Wald, ich hatte mich verlaufen, aber ich blieb nicht stehen, ich lief einfach weiter, ich lief und lief, spielte und spielte und verlor mich im Spiel, ich dachte an nichts, ich wollte nicht denken, nicht, während ich spielte, ich wollte dorthin, wohin mich die Hände führten, mich in die Musik flüchten, hinter die Worte, weg von ihnen, ich wollte mich von der Musik verschlingen lassen, in der Musik sein, so wie es gewesen war, bevor ich aufgehört hatte, als die Musik noch alles für mich war, aber das ging nicht, ich schaffte es nicht, ich hörte und spürte es, ich hatte es nicht mehr in mir, ich hatte es verloren, ich würde nie wieder auf Tournee gehen, ich würde kein einziges Konzert mehr spielen, dabei wollte ich nichts lieber und versuchte mir ständig einzureden, ich könnte zurückkommen, aber ich wusste, dass es nicht dazu käme.
3
Ich öffnete die Augen und ließ die Hände von den Tasten gleiten, auf den Schoß, gleichzeitig fielen meine Schultern schwer nach unten, so verharrte ich eine Weile auf dem Klavierhocker, reglos und ein wenig zusammengesunken, und im Aufstehen nahm ich das Weinglas in die Hand und ging damit zum Fenster, dort blieb ich stehen.
Ich stand da und blickte auf die Straße. Einer der Nachbarn hob ein großes Weihnachtsgeschenk aus dem Kofferraum seines Wagens, stellte es in den Schnee, schloss den Kofferraumdeckel und trug das Geschenk in die Garage, vermutlich, damit nicht ein neugieriger kleiner Junge oder ein neugieriges kleines Mädchen das Geschenk schütteln, zu sehr betasten oder gar ein Loch ins Geschenkpapier bohren konnte.
Der Anblick versetzte mir einen Stich, es tat immer noch weh, Dinge zu sehen, die an unser früheres Leben erinnerten, und jetzt an Weihnachten ganz besonders. Auch wenn es ein Klischee war, es traf zu.
Ich schloss die Augen und trank einen Schluck Wein, ich dachte zurück an den Tag, an dem es passiert war, wollte nicht daran denken, tat es trotzdem, ich sah vor mir, wie Sakarias und ich zusammen Kaffee getrunken hatten, hier in diesem Zimmer, an einem ganz normalen Tag vor einem halben Jahr, als Sakarias einen Anruf vom St. Olavs Krankenhaus erhielt und sie sagten, Johannes sei verunglückt. Sie fragten, ob jemand bei ihm oder ob er allein sei. Ich saß neben Sakarias und hörte alles mit, und ich wusste sofort, dass Johannes tot war, Sakarias wusste es auch, sagte er später, aber er wollte es nicht wahrhaben, er fragte, warum sie das wissen wollten. Darauf bekam er keine Antwort, denn im selben Moment war sein Akku leer, und wir schafften es nicht zurückzurufen, bevor ein Wagen in die Einfahrt bog und der Pfarrer ausstieg. Auch da wollten wir nicht wahrhaben, dass Johannes tot war. Sakarias drehte sich zu mir um, er will bestimmt mit unserer Mieterin sprechen, ihre Tochter wird demnächst konfirmiert, bestimmt will er mit ihr über die Konfirmation sprechen, meinst du nicht auch, dass er deshalb kommt?, fragte er, ganz bestimmt, sagte ich, ohne es zu glauben, auch Sakarias glaubte es nicht, natürlich nicht, es war vollkommen unrealistisch, aber der Gedanke an Johannes’ Tod schmerzte viel zu sehr, als dass wir ihn an uns heranlassen konnten, er wurde ganz automatisch verdrängt, weggeschoben, ich gehe runter und schaue nach, ob sie da ist, sagte ich in dem Versuch, die Nachricht hinauszuzögern, von der ich wusste, dass sie käme, es war der Versuch, mich an die Hoffnung zu klammern.
Wenn ich an die erste Zeit danach zurückdachte, sah ich Wasserfarben vor mir, ich sah die Bilder, die Johannes als Kind gemalt hatte, bevor er lernte, Figuren zu zeichnen, formlose Bilder mit starken Farben, die sich über das Papier zogen, Farben, die hin und her liefen wie kleine Bäche, Farben, die ineinanderliefen, so sah ich mich selbst, ich löste mich auf, wurde formlos, meine Gefühle durchströmten mich ungebremst, Wut und Angst, Verwirrung und Nichtwahrhabenwollen, Sehnsucht, Verzweiflung und Niedergeschlagenheit, sie kamen in Wellen, in Wallungen, und ich ließ sie kommen, ließ sie über mich hinwegschwappen, ließ sie zu, nicht weil ich es so entschieden hatte, sondern weil mein Körper wusste, dass es erforderlich war, in etwa so, wie er gewusst hatte, was erforderlich war, als Johannes zur Welt kam, Johannes, der jetzt nicht mehr da war, tödlich verunglückt, innerhalb von einer hundertstel Sekunde bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Vor einem halben Jahr.
Die Ärzte rieten uns eindringlich davon ab, ihn uns anzuschauen, es sei besser, ihn so in Erinnerung zu behalten, wie er gewesen war, sagten sie, und ich stimmte ihnen zu, aber Sakarias bestand darauf, der rationale Sakarias, immerzu vernunftgesteuert, schon damals hatte er beschlossen, wie er das Ganze angehen würde, er war sonst eher ein Typ, der Dingen auswich, nicht jedoch in dieser Situation, er wollte nichts beschönigen, wie er sagte, er wollte nicht, dass uns etwas vorenthalten wurde, er wollte alles wissen, alles sehen, und das sollte er haben, das sollten wir haben, denn ich kam trotzdem mit, aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, mitkommen zu müssen, und dort standen wir in dem kühlen Leichenkeller, wie wir es schon hundertmal in Filmen oder Fernsehserien gesehen hatten, zwei Trauernde neben einer Leiche, sie war mit einem grünen Laken bedeckt, das vorsichtig angehoben wurde, sodass wir das, was einmal Johannes gewesen war, zu sehen bekamen, sein Gesicht sah aus wie das einer Gummipuppe, die man zu fest an sich gepresst hatte, die linke Hälfte war eingedrückt, das Auge lag tief im Kopf wie eine Münze auf dem Boden eines Wunschbrunnens, die rechte Hälfte wirkte unversehrt, lediglich verfärbt, aber mitten in der Stirn war eine tiefe Kerbe und zwischen den Haaren ragten zwei spitze weiße, tonscherbenähnliche Schädelknochen heraus, als würde ihm eine Königskrone wachsen, wie ich ein paar Nächte später träumte.
Dennoch bückte Sakarias sich und küsste Johannes’ Gesicht, unter Tränen natürlich, unser Junge, unser Junge, schluchzte er und strich ihm über die rechte Wange, die geschwollen und lila verfärbt war, aber noch intakt. Später verlangte er nach dem Arztbericht, er wollte die Dokumentation haben, wollte von allen Brüchen wissen, den verletzten inneren Organen, ihm reichten die Erklärungen und Beschreibungen der Ärzte nicht, er wollte alles schwarz auf weiß, so genau wie möglich, es spielte keine Rolle, dass er die Fachsprache nicht beherrschte, unverständliche Begriffe könne er ja nachschlagen, sagte er, was er auch tat, einen ganzen Abend lang saß er am Küchentisch und entzifferte Johannes’ Arztbericht, und anschließend machte er exakt das Gleiche mit dem Polizeibericht, er las die Beschreibung des Unfallorts und die Rekonstruktion des Unfallhergangs, er prägte sich die Länge des Bremswegs ein, die angenommene Geschwindigkeit und das Ausmaß der Schäden am Auto.
Dieses extreme Informationsbedürfnis akzeptierte ich, konnte es aber nicht nachvollziehen, nicht ganz, anfangs dachte ich, er könne nicht mit der absoluten Sinnlosigkeit des Ganzen leben, dass es lediglich ein Unfall war, dass so etwas schlicht vorkam, für mich war der Gedanke nahezu unerträglich, und ich glaubte, Sakarias ginge es genauso, ich glaubte, er suchte nach etwas oder jemandem, dem er die Schuld geben konnte, nach etwas oder jemandem, auf den er wütend sein konnte, aber das schien nicht der Fall zu sein, er war voll des Lobs für den Umgang des Krankenhauspersonals mit uns, und auch an der Ermittlungsarbeit der Polizei hatte er nichts auszusetzen, auch nicht an den Sanitätern im Rettungswagen, obwohl zwei seiner Kumpel andeuteten, sie seien zu spät zur Unfallstelle gekommen, sie wären ohnehin zu spät gekommen, sagte Sakarias, womit er natürlich recht hatte.
Sakarias suchte keinen Sündenbock.
Vielleicht fürchtete er sich eher vor seiner eigenen Fantasie, vielleicht wollte er deshalb absolut alles sehen und wissen, weil er Angst hatte, die Bilder und Vorstellungen, die er in seinem Kopf erzeugte, könnten die Wirklichkeit übertreffen – so schrecklich sie auch sein mochte. Vielleicht war es aber auch nur eine Möglichkeit, sich einzureden, von jetzt an gehe es aufwärts, vielleicht ging er dorthin, wo es am meisten wehtat, weil er sich vergewissern wollte, dass es schlimmer nicht kommen konnte, von jetzt an konnte es nur besser werden, einiges deutete darauf hin, zum Beispiel stellte er sich vor und erzählte mir davon, wie Leichen sich zersetzten, er habe nie verstanden, wie das vor sich gehe, sagte er, er hatte sich immer vorgestellt, dass Bakterien den Körper von außen angriffen, aber natürlich setzten Bakterien im Körper den Prozess in Gang. Ich bat ihn, damit aufzuhören, ich sagte, er dürfe sich dem nicht aussetzen, mich auch nicht, das führe zu nichts Gutem, sagte ich, aber er wollte nicht hören, er war unerbittlich, zwar nicht mir gegenüber, er verstummte, wenn ich ihn darum bat, aber er war unerbittlich gegenüber sich selbst, drang vor bis zum Allerschlimmsten, bis zum Allerschrecklichsten, er könne nicht anders, sagte er.
Vielleicht war dieser Drang zum Allerschlimmsten auch Ausdruck seiner Liebe zu Johannes, vielleicht war es der Versuch, im Augenblick des Todes für Johannes da zu sein, irgendwie durchzumachen, was Johannes durchgemacht hatte, ihn irgendwie zu entlasten, keine Ahnung, dachte ich und trank einen Schluck Wein, drehte mich um und ging zurück zum Klavier, ich wollte mich gerade auf den Klavierhocker setzen und weiterspielen, da klingelte es an der Tür.
Verdammt, dachte ich. Ist er schon da?
Ich ging in die Küche, ertrug keine weitere Moralpredigt, daher kippte ich den letzten Schluck Wein in den Ausguss, spülte das Glas aus und stellte es in den Geschirrspüler, gerade noch rechtzeitig, denn Robert wartete nicht, bis ich aufmachte, er trat einfach ein, das hatte er sich nach Sakarias’ Auszug angewöhnt, vermutlich weil er plötzlich auftauchen und mir nicht die Zeit lassen wollte, genau das zu tun, was ich eben getan hatte, weil er mich kontrollieren und auf mich aufpassen wollte, das hielt er für seine Aufgabe als großer Bruder, so wirkte es jedenfalls.
Hallo, sagte er.
Ich antwortete nicht sofort. Ich zog die Augenbrauen hoch und sah ihn an.
Hallo, sagte ich.
Er wartete einen Moment, dann seufzte er und legte den Kopf schief, blickte leicht resigniert.
Sag nicht, du hast es vergessen, Elisabet, sagte er.
Fast hätte ich geantwortet, dass ich ihn frühestens in einer Stunde erwartet habe, ließ es aber bleiben, ich wusste, wie sehr es ihn provozierte, wenn Leute Abmachungen vergaßen oder etwas sagten oder taten, was den Anschein vermittelte, er sei nicht so wichtig, wie er es gern wäre, also riss ich mich zusammen.
Was denn vergessen?, fragte ich.
Er machte den Mund auf und starrte mich kopfschüttelnd an.
Das darf echt nicht wahr sein!, sagte er.
Ich freute mich, setzte aber ein Gesicht auf, als wollte ich sagen, keine Ahnung, worum es geht.
Wir wollten doch ins Seniorenheim!, sagte er, seine Stimme wurde lauter, nicht viel, aber genug, um verärgert zu klingen.
Stimmt, das wollten wir, sagte ich.
Heute ist Heiligabend, Elisabet, sagte er.
Was du nicht sagst, spottete ich.
Seit sie dort ist, besuchen wir Mama jedes Jahr an Heiligabend, sagte er. Wie kann man das bloß vergessen?
Das kannst du wohl nicht verstehen, sagte ich.
Er schnaubte leise und schloss die Augen, schüttelte den Kopf.
Mach dich fertig, sagte er und wedelte genervt mit der Hand. Damit wir loskommen!
Ich spürte die Wut in mir hochkochen, er redete mit mir, als wäre er mein Chef und nicht mein großer Bruder, was mich heute noch mehr reizte als sonst, ich fand, er könnte etwas mehr Rücksicht nehmen, am ersten Heiligabend ohne Johannes, er könnte etwas sensibler und nachsichtiger mit mir umgehen, zwar hatte ich klargemacht, dass ich nicht mit Samthandschuhen angefasst werden wollte, weder von ihm noch von anderen, trotzdem tat es weh, er schien nicht einmal daran zu denken, tat so, als wäre es ein Tag wie jeder andere, ich sah ihn an, am liebsten hätte ich etwas Gemeines gesagt, aber dann fiel mir ein, dass ich nicht gehen konnte, bevor der Krustenbraten fertig war, und das stimmte mich sofort milder.
Ich habe einen Krustenbraten im Ofen, sagte ich, ich sah Robert an und lächelte so liebenswürdig und unschuldig wie möglich. Er ist in einer Viertelstunde fertig.
Robert reagierte nicht so sauer, wie ich gehofft hatte, aber sauer genug, dass ich mich ein bisschen freuen konnte.
O Mann, sagte er. Tja, dann mach dich wenigstens in der Zwischenzeit fertig.
Ich bin fertig, sagte ich. Ich muss nur noch Schuhe und Mantel anziehen.
Er blieb stehen und starrte mich sekundenlang wortlos an.