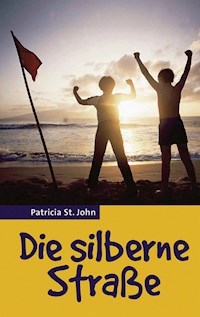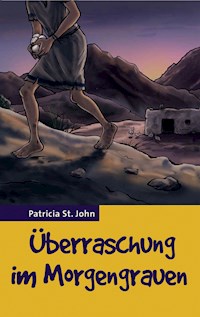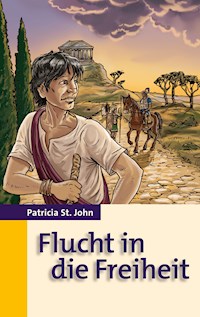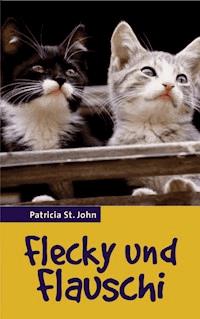Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: BibellesebundHörbuch-Herausgeber: Bibellesebund Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Marokko. Hamid und seine kleine, blinde Schwester Kinza flüchten von zu Hause, als der Stiefvater Kinza an einen Bettler verkaufen will. Hamids Ziel ist die Stadt, viele Kilometer entfernt. Dort wohnt die englische Krankenschwester, zu der er Kinza im Auftrag seiner Mutter bringen soll. Zu diesem Buch gibt es Quizfragen in Antolin. Antolin ist ein Online-Portal zur Leseförderung von Klasse 1 bis 10. Die Schüler lesen ein Buch und können dann unter antolin.de Quizfragen zum Buchinhalt beantworten. Richtige Antworten werden mit Lesepunkten belohnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia M. St. John
Hamid und Kinza
Originaltitel: »Star of Light«
erschienen bei: Scripture Union (Bibellesebund), London
© 1953 by Patricia M. St. John
Deutsch von E. I. Aebi
© 1955 der deutschsprachigen Ausgabe
© 2018 der eBook-Ausgabe
Bibellesebund Verlag, Marienheide
https://shop.bibellesebund.de/
Cover: Georg Design, Münster
ISBN 978-3-95568-325-2
Hinweise des Verlags
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes kommen.
Noch mehr eBooks des Bibellesebundes finden Sie auf
www.ebooks.bibellesebund.de
Inhalt
Titel
Impressum
VORWORT
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
VORWORT
Bitte schaut euch eine Landkarte von Nordafrika an. Seht ihr den kleinen nordwestlichen Zipfel von Marokko? Dort vermischen sich die Wasser des Mittelmeeres mit den wilden Strömungen des Atlantischen Ozeans. An der Küste des Atlantiks donnern und schäumen die Wogen über weite, ununterbrochene Sandflächen. Da und dort ist ein Damm erbaut worden und in dessen Schutz eine kleine Stadt. Alles Übrige ist einsames Uferland, das erst gegen die Sanddünen und schließlich gegen die Berge ansteigt.
Diese Berge dehnen sich als gewaltige Gebirgszüge bis zur Mittelmeerküste aus und blicken stolz auf jene stillen, blauen Wasser herab. Manche dieser Gipfel sind sehr hoch, an den Abhängen mit Kiefern und verkümmerten Wacholderbüschen bewachsen und bis zum Sommeranfang mit Schnee bedeckt. Andere wiederum sind hohe Weidehügel oder nackte Felsgipfel, an deren Fuß Obstgärten und Olivenhaine grünen. Und zwischen diesen Hainen kauern die Dörfer: ein Ziehbrunnen in der Mitte, ringsum ein paar Lehmhütten mit Strohdächern und als Grenzbezeichnungen grüne Kaktushecken.
Die Menschen, die hier leben, nennt man Mauren. Ihre Religion ist der Islam. Er wurde von Mohammed gegründet, der als Prophet verehrt wird.
Ich selbst wohne in der Stadt, in die Hamid seine kleine Schwester Kinza gebracht hat, und ich habe mich auch in seinem Heimatdorf aufgehalten. Ich kenne viele kleine Jungen, die auf die Straße gesetzt wurden, weil ihre Mutter wieder geheiratet hatte. Das traurige Schicksal kleiner Kinder, die nichterwünscht waren und deshalb irgendwo auf eine Treppenstufe gelegt wurden, und das Elendsleben kleiner Blinder, die an Bettler vermietet wurden, all das muss ich als Mis-sionarin immer wieder hören oder mit ansehen. Und wie viele Menschen habe ich angetroffen, die weite und beschwerliche Reisen unternommen hatten, um Heilung von ihrer Krankheit zu suchen! Manchmal haben wir Missionare ihnen helfen können.
So sind denn in der Geschichte von Hamid und Kinza eine Menge von Ereignissen aus dem Leben der maurischen Jungen und Mädchen meines Bekanntenkreises zu einem Ganzen zusammengeflochten. Alles, was Hamid von seinem inneren Erleben sagt, ist mir von einem heimatlosen kleinen Jungen anvertraut worden, der, soweit ich es beurteilen kann, wahrhaft glücklich geworden ist, weil er von Jesus hörte und ihm das Herz öffnete.
Mehr darf ich jetzt nicht verraten. Ihr wollt ja die Geschichte selber lesen. Und wenn ihr das Buch schließlich weglegt, wollt ihr dann nicht in Gedanken ab und zu zurückkehren zu Hamid und Kinza und zu den vielen Kindern, die in den unzähligen über die Berge verstreuten Dörfern leben? Wollt ihr dann manchmal für sie und für die Missionare beten, die das Licht in ihre Finsternis tragen möchten? Ich danke euch.
1. Kapitel
Ein kleines Mädchen kam an einem strahlenden Frühlingsmorgen den Berghang herabgerannt. Flink setzte es mit seinen nackten braunen Beinen über die wild wachsenden Ringelblumen hinweg. In den bewässerten Wiesen weiter unten im Tal blühten die Zwetschgenbäume; von oben betrachtet zogen sich zwei breite Bänder wie weißer Schaum die Flussufer entlang. Übermütige Zicklein tollten zwischen den Blumen, und die Störche hatten eben begonnen, ihre Nester auf den Strohdächern zu bauen. Die Natur erwachte strahlend aus der Winterruhe, und all die Kinder, die über den Berg verstreut lebten, ließen sich von der Frühlingslust anstecken: Sie tanzten und jauchzten und liefen miteinander um die Wette.
Rahma, die quer über die Weiden gerannt war, landete mit einem Satz auf dem Fußweg und hüpfte darauf weiter bergab. Sie war sieben Jahre alt und klein gewachsen, weil sie selten genug zu essen bekam. Ihr Stiefvater und seine Frau hatten sie nicht gern, ja, sie schlugen sie manchmal. Ihre Kleider waren zerrissen, und sie musste so schwer arbeiten, als ob sie schon erwachsen wäre. All das Belastende ihres kleinen Lebens konnte jedoch ihre Freude nicht dämpfen, wenn ihr gelegentlich einmal ein Extra-Vergnügen über den Weg lief. Und heute hatte sie großes Glück. Sie sollte allein die Ziegen hüten, während ihr Bruder irgendeinen geheimnisvollen Spaziergang mit der Mutter unternahm.
Zwei Stunden lang sollte sie frei und allein sein, bloß in Gesellschaft von Störchen und Ziegen! Zwei volle Stunden mit den Zicklein in der Sonne spielen dürfen! Niemand würde sie schimpfen oder sie an den Mühlstein jagen oder ihr schwere Wassereimer aufladen. Ihr müder Körper, von den Fesseln der Arbeit befreit, fühlte sich so leicht an wie ein Wolkenstreifen, und die Ringelblumen, der schillernde Fluss und der Sonnenschein bauten eine goldene Welt um sie auf, eine Welt, auf die keine noch so trübe Zukunft ihre Schatten werfen konnte.
Von weitem erspähte Rahma ihren Bruder. Er wollte gerade ein Pärchen übermütiger Zicklein einfangen, das auf ein Feld mit jungem Weizen zulief. Der Frühling machte die Tiere ganz wild, und sie rannten in alle Richtungen außer der richtigen, blökten dabei quietschvergnügt und sprangen hoch in die Luft. Hamid, ihr Hüter, nahm es ihnen nicht übel, war ihm doch ähnlich zumute. Dicht vor dem Feld stießen die drei aufeinander, und Rahma rannte mitten in sie hinein. Ihre dunklen Kirschenaugen strahlten, und das glatte, schwarze Haar hing ihr in wilden Strähnen um Gesicht und Nacken.
Lachend und schreiend lenkten sie die Zicklein auf die Weide hinaus, wo die übrige Herde graste. Hier wandte sich Hamid seiner Schwester zu und musterte sie erstaunt. Er war es nicht gewohnt, sie so fröhlich und guter Dinge zu sehen; denn Landmädchen lernen früh, ruhig und bedächtig einherzuschreiten und immer auf die älteren, erfahreneren Menschen zu hören. Außerdem war Rahma schon sieben Jahre alt und beinahe eine »kleine Frau«!
»Warum bist du gekommen?«, fragte Hamid.
»Um die Ziegen zu hüten. Die Mutter braucht dich.«
»Weshalb?«
»Ich weiß es nicht. Du sollst irgendwohin gehen. Sie hat geweint und dabei das Schwesterchen angeschaut. Vielleicht ist es krank.«
Das Leuchten in ihren Augen erlosch, als sie an die Tränen ihrer heiß geliebten Mutter dachte. Einzig der Sonnenschein und die Freiheit hatten den Gedanken an die Mutter in den Hintergrund treten lassen. Doch die Mutter weinte neuerdings oft, wenn sie mit Rahma allein war, sodass das Kind sich beinahe daran gewöhnt hatte.
»Gut«, sagte Hamid, »aber pass mir auf die Ziegen auf! Da hast du einen Stock.«
Und damit ging er in Richtung Dorf weg. Er beeilte sich, denn er wollte seine Mutter nicht warten lassen. Aber er sprang nicht und schaute nicht um sich, wie Rahma es getan hatte. Zu viele Fragen waren in ihm erwacht!
Warum sah seine Mutter seit einiger Zeit so besorgt aus, als laste eine geheime Furcht auf ihr? Und warum schien sie das Schwesterchen verbergen zu wollen, sobald ihr Mann oder die ältere Frau in der Nähe waren? Sicher: Die beiden hatten die Kleine nie leiden mögen, aber sie wussten doch, dass sie da war! Weshalb sie denn verstecken? Ja, die Mutter schien sich schon zu sorgen, wenn er oder Rahma nur mit dem Schwesterchen spielten. Sie pflegte sie gleich wegzuschicken. Ob sie sich vor bösen Geistern fürchtete? Oder vor Gift? Hamid fand keine Antwort. Vielleicht hatte die Mutter ihm heute etwas zu sagen. Er ging noch etwas schneller.
Mit einem Seufzer erinnerte sich Hamid daran, dass seine Mutter früher nie so ängstlich dreingeschaut hatte. Damals hatten er und Rahma und drei kleine Geschwister mit der Mutter und dem Vater, der sie liebte, in einem Lehmhäuschen weiter unten im Tal gewohnt. Doch dann hatten die Kleinen zu husten begonnen und waren immer magerer geworden. Als der Schnee fiel und Brot und Heizung spärlich wurden, waren sie schwächer, immer schwächer geworden und schließlich in Abständen von wenigen Wochen gestorben. Man hatte sie alle drei am Osthang des Berges, wo man dem Sonnenaufgang entgegensieht, begraben. Ringelblumen und Gänseblümchen wuchsen auf ihren Gräbern.
Im Winter begann dann auch der Vater zu husten. Niemand achtete darauf, denn ein Mann muss doch den Lebensunterhalt für seine Familie verdienen. So arbeitete er selbstverständlich weiter. Im Frühjahr pflügte er seine Felder und säte Getreide. Eines Abends aber kam er nach Hause und sagte, er könne nicht mehr arbeiten. Bis zum folgenden Herbst lag er auf seiner Matratze und wurde immer schwächer. Zohra, seine Frau, brachte mit Hamid und Rahma das reife Korn ein und ging zum Ährenlesen, so viel sie konnte, um ihn und die Familie einigermaßen ernähren zu können. Aber es nützte alles nichts. Er starb, und seine noch junge, schöne Frau blieb als bettelarme Witwe mit den beiden kleinen Kindern zurück.
Sie verkauften das Haus, die Ziege, die Hühner und den Acker und zogen zur Großmutter. Einige Monate später wurde noch ein Schwesterchen geboren, und mit ihm kehrten neue Hoffnung und Sonnenschein in die leidgeprüfte kleine Familie ein. Sie nannten das Kind »Kinza«, das heißt »Liebling«, und nie wurde ein Kind liebevoller gehegt und gepflegt. Seltsamerweise spielte es aber nicht wie andere seines Alters. Nie schlug es die Händchen zusammen oder griff nach Dingen. Es schlief viel oder schien ins Leere zu starren. Hamid hatte sich oft gewundert, weshalb die bunten Blumensträußchen, die er dem Schwesterchen brachte, ihm gar keine Freude zu machen schienen.
Als Kinza einige Monate alt war, hatte die Mutter einen Heiratsantrag erhalten und sofort angenommen. Sie hatte ja keine Arbeit und kein Geld, um Brot zu kaufen für ihre Kinder! So zog die Familie in ihr neues Heim ein.
Es war kein sonderlich glückliches Heim. Si Mohammed, der Mann, war bereits mit einer älteren Frau verheiratet. Da sie aber nie Kinder gehabt hatte, begehrte er eine zweite Frau. Es machte ihm nichts aus, auch Hamid bei sich aufzunehmen; ein neunjähriger Junge konnte ganz nützlich sein, um die Ziegen zu hüten. Auch gegen Rahma hatte er nichts einzuwenden, weil ein siebenjähriges Mädchen eine brauchbare kleine Magd sein kann. Aber wozu das Schwesterchen gut sein sollte, das konnte er nun allerdings nicht einsehen. Und so wünschte er, dass man Kinza weggab.
»Manche kinderlose Frau würde gern ein Mädchen aufnehmen«, meinte er. »Und überhaupt: Weshalb sollte ich das Kind eines anderen Mannes großziehen?«
Doch die junge Mutter brach in fassungsloses Weinen aus und weigerte sich, irgendwelche Arbeit anzurühren, bevor er nicht seine Meinung änderte. Da willigte er schließlich widerstrebend ein, Kinza eine Zeit lang zu behalten. Seither waren ihretwegen keine Worte mehr gewechselt worden. Oder hatte sich in den letzten Wochen etwas zugetragen, von dem Hamid und Rahma nichts wussten? Wachte deshalb die Mutter so sorgsam über Kinza? Sah sie deshalb so sorgenvoll aus?
Eine Stimme weckte Hamid aus seinen Träumen. Er sah seine Mutter unter einem alten, verkrümmten Olivenbaum stehen, der seine Schatten über einen Ziehbrunnen warf. Sie trug zwei Eimer, hatte sie aber nicht gefüllt, und Kinza war mit einem Tuch auf ihren Rücken gebunden. Die Mutter schien es sehr eilig zu haben.
»Komm schnell, Hamid!«, rief sie ungeduldig. »Wie langsam du gehst! Verstecke die Eimer im Gebüsch! Ich habe sie nur mitgebracht für den Fall, dass Fatima mich fragen sollte, wo ich hinwill. Komm jetzt, schnell!«
»Wohin, Mutter?«, fragte der Junge erstaunt.
»Warte, bis wir um die Ecke sind.« Und schon hastete die Mutter durch das hohe, grüne Gras den Berg hinauf. »Man könnte uns vom Brunnen aus sehen und Fatima erzählen, wohin wir gegangen sind. Mach schnell! Gleich sag ich dir’s.«
Sie eilten vorwärts, bis sie über den Bergkamm hinweg waren und vom Dorf aus nicht mehr gesehen werden konnten. Von hier fiel der Blick in ein anderes Tal. Die Mutter setzte sich, löste das Tuch und nahm die Kleine auf den Schoß.
»Schau sie gut an, Hamid«, befahl sie. »Spiele mit ihr und zeige ihr Blumen.«
Fragend schaute Hamid in das merkwürdig alte, geduldige Gesicht seiner kleinen Schwester. Sie erwiderte sein Lächeln nicht. Sie schien vielmehr irgendetwas in weiter Ferne zu betrachten und ihn gar nicht zu bemerken. Mit einem plötzlich aufwallenden Angstgefühl bewegte er seine Hand vor ihren Augen hin und her. Kinza blinzelte nicht einmal. Sie blieb regungslos.
»Sie ist blind«, hauchte er schließlich. Seine Lippen fühlten sich ganz trocken an, und sein Gesicht war bleich.
Die Mutter nickte und sprang auf.
»Ja«, erwiderte sie, »sie ist blind. Ich habe es vor einiger Zeit schon bemerkt, aber ich habe es vor Fatima und meinem Mann verborgen gehalten. Wenn sie es wissen, werden sie mir Kinza bestimmt wegnehmen. Was geht das blinde Kind eines anderen Mannes sie an? Es wird nie arbeiten, nie heiraten können …«
Tränen erstickten ihre Stimme und füllten ihr die Augen, sodass sie auf dem holperigen Weg stolperte. Hamid ergriff sie beim Arm.
»Wohin gehen wir, Mutter?«, fragte er wieder.
»Zum Grab des Heiligen«, erwiderte sie und eilte weiter, »dort oben hinter dem nächsten Hügel. Sie sagen, er sei ein mächtiger Heiliger und habe schon viele geheilt. Fatima hat mir bloß nie Gelegenheit gegeben zu gehen. Jetzt denkt sie, ich hole Wasser. Ich wollte, dass du mitkommst, weil es ein einsamer Weg ist und ich mich fürchte, allein zu gehen.«
Schweigend stiegen sie bergauf. Dort, wo die grünen, blumenbesäten Weiden felsigem Gelände wichen, lag in einer Mulde eine kleine, von einem überhängenden Busch geschützte Gruft. Der Busch war mit schmutzigen Papierfetzchen behangen. Jedes dieser Zettelchen erzählte eine Leidensgeschichte. Denn hierher kamen die Kranken, die Bekümmerten, die Kinderlosen, die Ungeliebten und brachten ihre Lasten zu dem Gerippe des Verstorbenen. Und sie alle gingen ungeheilt und ungetröstet wieder heim.
Die Mutter legte Kinza vor die Öffnung der Gruft. Sie neigte sich zur Erde nieder, richtete sich wieder auf und rief dabei den Namen Gottes an, von dem sie nichts wusste, und den Propheten Mohammed. Das war ihre letzte Hoffnung. Doch während sie betete, zog eine Wolke vor der Sonne vorüber, und ein kalter Schatten fiel auf das Kind. Es fröstelte, begann zu weinen und tastete nach Schutz suchend nach den Armen der Mutter. Einen Augenblick starrte die Frau wie gebannt auf das Gesicht ihres Kindes, dann hob sie es mit einem enttäuschten Seufzer auf. Gott hatte nicht auf sie gehört, Kinza war noch immer blind.
Den Heimweg legten Hamid und seine Mutter in größter Eile zurück. Es war schon spät, die Sonne ging bereits hinter den Bergen unter. Die Störche flogen klappernd an ihnen vorbei wie dunkle Gestalten vor einem rosaroten Hintergrund. Hamid war zutiefst enttäuscht und empört und in hellem Aufruhr gegen den herrlichen Glanz, der über der Welt lag.
Leuchtende Ringelblumen, zarte junge Weizenhalme, feurige Sonnenuntergänge – was nützte all das? Das Schwesterchen würde sie nie sehen können! Gott kümmerte sich offenbar nicht darum, und der tote Heilige wollte wohl auch nicht helfen. Kleine Mädchen waren ihm anscheinend nicht wichtig genug.
Schweigend erreichten sie den Brunnen. Hamid zog das Wasser herauf, reichte die Eimer seiner Mutter und raste davon, um Rahma und die Ziegen zu holen. Auf halbem Weg kamen sie ihm entgegen, denn Rahma hatte sich vor den wachsenden Abendschatten zu fürchten begonnen. Sie schob ihre kleine Hand in seine, und die Ziegen, die auch gern in den Stall wollten, drängten sich um die Beine der Kinder.
»Wo bist du gewesen?«, fragte Rahma.
»Beim Grab des Heiligen. Weißt du, Kinza ist blind. Vor ihren Augen ist es immer dunkel. Darum hält die Mutter sie versteckt. Fatima und Si Mohammed sollen es nicht merken.«
Entsetzt stand Rahma still.
»Blind?«, wiederholte sie. »Ja – wie ist’s denn mit dem Heiligen? Hat er sie nicht gesund machen können?«
Hamid schüttelte den Kopf.
»Ich glaube nicht, dass dieser Heilige viel wert ist«, sagte er herausfordernd. »Die Mutter ist ja schon zu ihm gegangen, als der Vater so gehustet hat. Aber es hat nichts genützt. Der Vater ist trotzdem gestorben.«
»Es ist Gottes Wille«, meinte Rahma achselzuckend und machte eine hoffnungslose Gebärde – so, als wollte sie sagen: Da können wir nichts mehr ändern.
Eng aneinander geschmiegt, weil es immer dunkler wurde, kletterten sie die Anhöhe zu ihrem Dorf hinauf. Die Augen der Ziegen leuchteten bereits wie kleine, grüne Laternen.
»Ich hasse die Dunkelheit«, flüsterte Rahma fröstelnd. Aber Hamid hob die Augen zum Himmel, der tiefblau über dem Geäst der Olivenbäume hing.
»Ich liebe die Sterne«, antwortete er.
2. Kapitel
Zehn Minuten später gingen sie an den ersten, finsteren Hütten ihres Dorfes vorbei. Da und dort erblickten sie durch geöffnete Türen ein in einem Tontopf glühendes Kohlenfeuer und Familien, die beim trüben Schein einer Lampe um ihr abendliches Mahl saßen. Doch als sie sich ihrem eigenen Heim näherten, konnten sie schon von weitem die zornige Stimme Fatimas, der älteren Frau, hören.
Fatima hasste die neue Frau und ihre drei Kinder und machte ihnen auf jede erdenkliche Weise das Leben schwer. Sie selbst war gebeugt und zusammengeschrumpft durch lange Jahre der Trunksucht. Zohra dagegen war jung und schön. Fatima hatte sich stets nach einem Kind gesehnt; Zohra hatte sechs Kinder gehabt. Da war es vielleicht nicht allzu verwunderlich, dass die ältere Frau so eifersüchtig war und sich über die Ankunft der jüngeren sehr aufgeregt hatte. Ihrem Zorn machte sie dadurch Luft, dass sie den lieben langen Tag wie eine Königin mit gekreuzten Beinen auf ihrer Matte saß und Zohra mit Rahma wie Sklavinnen herumjagte. Heute war Zohra nur entwischt, weil Fatima eingeschlafen war. Unglücklicherweise hatte sie aber nicht lange geschlafen. Wütend über die Abwesenheit der jungen Frau hatte sie ein Nachbarskind auf die Anhöhe geschickt, um auszukundschaften, wo Zohra steckte. So geschah es, dass Zohra, als sie mit ihren Eimern ankam, eine gut unterrichtete Fatima vorfand.
»Du böses, faules, falsches Geschöpf du!«, schrie Fatima sie an. »Mich kannst du nicht hintergehen! Gib mir das Kind! Ich will selber sehen, warum du es vor mir versteckst und so heimlich tust mit ihm, jawohl, und warum du mit ihm zum Heiligengrab schleichst! Gib’s her, sag ich dir. Ich will es haben.«
Mit rohen Fingern entriss sie die Kleine dem schützenden Arm der Mutter und trug sie ans Licht. Zohra aber ließ mit einer hilflosen Gebärde der Verzweiflung die leeren Arme her-absinken. Ach, Fatima musste es ja doch einmal wissen! Auf die Dauer konnte sie, Zohra, die traurige Tatsache nicht verbergen, und es war wohl ebenso gut, wenn Fatima von selbst dahinter kam.
Inzwischen waren die älteren Geschwister eingetreten. Sie duckten sich erschreckt und mit weit geöffneten Augen in die dunkelste Ecke des Raumes. Lautlose Stille herrschte, während Fatima mit den Händen über die Glieder des Kindes strich und auf das ernste Gesicht herabstarrte. Hamid, der den Atem anhielt, wurde auf kleine Geräusche aufmerksam, die er nie zuvor beachtet hatte: das gemächliche, regelmäßige Wiederkäuen des Ochsen im Stall nebenan, das Rascheln im Stroh, wenn die Zicklein sich an ihre Mutter drängten, das schläfrige Gackern der auf der Stange sitzenden Hühner.
In das gespannte Schweigen hinein brach plötzlich eine triumphierende Lachsalve der alten Frau, und Kinza, deren Ohren äußerst empfindlich waren und Lärm und zornige Stimmen kaum zu ertragen schienen, stieß einen Schreckensschrei aus. Fatima hob sie auf und schleuderte sie in den Schoß ihrer Mutter zurück.
»Blind!«, rief sie, »blind wie die Nacht! Und du hast es gewusst. Die ganze Zeit hast du’s gewusst. Du hast sie hierher in das Haus deines Mannes gebracht, damit sie eine Last sei für uns alle. Nie wird sie arbeiten, nie heiraten können! Und du hast sie versteckt gehalten, damit wir es nicht merken. O du verlogenstes aller Weiber! Unser Ehemann soll noch heute Abend alles wissen. Auf jetzt – und bereite sein Abendessen zu! Und du, Rahma, fache die Glut an! Wenn er gegessen hat, werden wir sehen, was er dazu zu sagen hat.«
Das erschreckte kleine Mädchen sprang auf und machte sich am Blasebalg zu schaffen, bis die Flammen aus der Glut emporschossen und seltsame Schatten an die Wände warfen. Zohra ihrerseits legte mit zitternden Händen ihr kleines Kind in die von einem Dachbalken herabbaumelnde hölzerne Wiege und begann, in aller Eile die Bohnen zu zerdrücken und Öl darunter zu schlagen. Ihr Mann war zu einem Nachbarn gegangen und konnte jeden Augenblick zurück sein.
Eben war sie fertig geworden, als man schon seinen energischen Schritt auf dem Fußweg hörte. Ein paar Sekunden später stand er im Türrahmen, ein großer Mann mit schwarzen Augen, schwarzem Bart und einem harten, grausamen Zug um den Mund. Er trug ein langes Gewand aus dunkler, im Haus gesponnener Ziegenwolle und einen weißen Turban um den Kopf. Er grüßte seine Frauen und Stiefkinder nicht, sondern ließ sich mit verschränkten Beinen vor dem niedrigen runden Tisch nieder und verlangte sein Essen. Ob er den Triumph in Fatimas Blick und die weißen, verängstigten Gesichter Zohras und ihrer Kinder bemerkte? Jedenfalls sagte er kein Wort.
Zohra stellte die heiße Schüssel in die Mitte des Tisches, und die Familie scharte sich darum. Löffel gab es nicht. Doch Brot war da, und Zohra brach zwei große Stücke davon für ihren Mann und Fatima und drei kleine für sich, Hamid und Rahma ab.
»Im Namen Gottes«, murmelten sie alle, indem sie ihr Brot in die Schüssel tauchten. Diese Worte sollten die bösen Geister vertreiben, die möglicherweise in der Nähe des Tisches lauerten. Mittags, wenn die Sonne schien, kam es zwar vor, dass Rahma vergaß, die Worte mitzusprechen, aber am Abend vergaß sie es nie! Die zuckenden Schatten und düsteren Ecken ängstigten sie. Sobald die Lampen angezündet waren, kamen ihr die bösen Geister als etwas Wirkliches und allzu Nahes vor. Und ganz bestimmt war das kleine Haus am heutigen Abend mit bösen Geistern erfüllt: finsteren Geistern der Eifersucht, des Zornes, des Hasses, der Grausamkeit, der Furcht. Selbst die kleine Kinza in ihrer baumelnden Wiege schien etwas davon zu spüren, denn sie wimmerte im Schlaf. Si Mohammed runzelte die Stirn.
»Ich mag das Geplärr nicht«, knurrte er. »Nimm das Kind hoch!«
Die Mutter gehorchte. Sie nahm das Kind und hielt es fest an ihre Brust gedrückt. Fatima wartete, bis der Hausherr gegessen hatte, dann streckte sie die Hand aus und befahl mit drohender Stimme:
»Reiche mir dieses Kind!«
Da übergab ihr Zohra das Kind und brach in Tränen aus.
»Was ist denn los?«, fuhr Si Mohammed auf. Seine Frauen mochten streiten, so viel sie wollten – in diesem Land stritten sich die Frauen immer –, aber es war ihm in der Seele zuwider, wenn sie es in seiner Gegenwart taten. Und heute war er den ganzen Tag hinter dem Pflug hergegangen, er war wirklich müde.
»Ja, was ist los?«, stichelte Fatima und hielt das Kind unter die Lampe, sodass das Licht ihm plötzlich voll auf das Gesicht fiel: Doch Kinza blinzelte nicht einmal und wandte den Kopf nicht zur Seite. Si Mohammed schaute das Kind immerzu an.
»Blind!«, schrie Fatima, wie sie es zuvor schon getan hatte. »Blind, blind, blind! Und Zohra hat es gewusst! Sie hat uns beide hintergangen!«
»Nein, nein!«, schluchzte Zohra und wiegte sich weinend hin und her.
»Doch, das hast du!«, rief die Alte.
»Still, ihr Frauen!«, befahl der Mann streng. Und wieder herrschte tiefstes Schweigen in der schwach erleuchteten Hütte. Rahma wurde es auf einmal kalt vor Angst, und ohne sich bemerkbar zu machen, näherte sie sich dem erlöschenden Kohlenfeuer. Ihr Stiefvater forschte in dem winzigen Gesicht, ließ den Lichtschein immer wieder darauf fallen, bewegte die Hände vor den starren Augen hin und her, bis er davon überzeugt war, dass die alte Frau die Wahrheit gesagt hatte. Schließlich stellte er fest:
»Wahrhaftig, sie ist blind.«
Doch der gefürchtete Zornesausbruch kam nicht. Er reichte Kinza ihrer Mutter zurück, kniff die Augen zusammen und zündete sich seine lange Pfeife an. In aller Ruhe zog er an seiner Pfeife, und die Hütte füllte sich mit übel riechendem Qualm. Endlich meinte er:
»Blinde Kinder können ganz einträglich sein. Hüte das Kind gut. Es kann uns viel Geld einbringen.«
»Wie denn?«, fragte Zohra angstvoll und drückte Kinza fester an sich.
»Mit Betteln«, erwiderte der Mann. »Natürlich können wir nicht selbst mit ihr betteln gehen, denn ich bin ein sehr ehrenwerter Mann. Aber es gibt genug Bettler, die sie gern mieten würden, damit sie mit ihnen auf den Marktplätzen sitzt. Die Leute haben Mitleid mit blinden Kindern und sind dann sehr freigebig. Ja, ich glaube, ich weiß bereits einen, der dafür bezahlen würde, das Kind zu mieten, wenn es ein wenig älter ist.«
Zohra wagte kein Wort der Widerrede. Hamid und Rahma jedoch wechselten über den Tisch hinweg einen langen, empörten Blick. Sie wussten, an welchen Bettler der Vater dachte: Es war ein alter, schmutziger und zerlumpter Mann, der grauenhaft fluchen konnte. Und dem sollte ihre liebe kleine Kinza ausgeliefert werden? Bestimmt würde er sie misshandeln und ängstigen.
Zwischen seinen halbgeschlossenen Augenlidern fing der Vater den Blick auf. Böse klatschte er in die Hände und befahl: »Geht schlafen, Kinder, schnell!«
Eilig erhoben sich die beiden, murmelten »Gute Nacht« und verzogen sich in die dunkelsten Stellen im Raum. Hier lagen an den Wänden einige Strohsäcke. Die Kinder legten sich nieder, zogen eine Wolldecke über sich und schliefen ein. Sie zogen sich nicht aus, wuschen sich auch nicht und sprachen kein Abendgebet. Ja, wenn irgendjemand etwas Derartiges vorgeschlagen hätte, so wäre es ihnen bestimmt sehr dumm vorgekommen.
Weshalb Hamid in dieser Nacht erwachte, hätte er nicht sagen können, denn gewöhnlich schlief er fest, bis die Sonne aufging. Doch diesmal richtete er sich um zwei Uhr morgens plötzlich im Bett auf und war hellwach. Das Mondlicht schien durchs Fenster herein, geradewegs auf Kinzas Wiege, und die Kleine stöhnte und wälzte sich unruhig im Schlaf.
Hamid glitt von seinem Strohsack herab und stellte sich neben Kinza in die schöne, silbern glänzende Lichtinsel. Die übrige Familie schlief im Schatten; Streit und Leid waren ausgelöscht und vergessen. Hamid schaukelte die Wiege und streichelte das dunkle Köpfchen seines Schwesterchens, bis die gerunzelte Stirn sich glättete. Ganz ruhig lag das Kind da, ein Händchen wie nach Hilfe suchend auf der Decke ausgestreckt.
Mit finsterem Blick wachte Hamid über dem Kind. Und plötzlich schlug eine warme Welle beschützender Zärtlichkeit in ihm hoch. Kinza war so klein, so geduldig, so unfähig, sich selbst zu verteidigen. Nun, er wollte schon dafür sorgen, dass ihr kein Leid geschah! Sein ganzes Leben lang wollte er sie durch das Dunkel führen und sie mit seiner Liebe umgeben. Er würde ihr Licht und ihr Schutz sein. Einen Augenblick schwoll ihm die Brust vor Beschützerstolz. Doch gleich darauf durchzuckte es ihn schmerzhaft beim Gedanken daran, dass er selbst noch ein kleiner Junge und völlig in der Gewalt seines Stiefvaters war. Der könnte Kinza von ihm wegreißen, und dann würde seine Liebe machtlos sein.
Gab es denn keine stärkere Liebe, die sie schützen konnte? Kein gewisseres Licht, um sie zu führen? Hamid wusste es nicht. Zärtlich beugte er sich über Kinza, um sie zu küssen, und stahl sich dann auf leisen Sohlen wieder zu seinem Lager zurück. Über Kinzas Züge huschte ein Lächeln; sie steckte zwei Finger in den Mund und schlief in ihrer Mondscheinwiege so selig wie eine kleine Prinzessin in ihrem Palast.
3. Kapitel
Die blinde Kinza saß auf der Schwelle ihrer Hütte und hob das Gesicht der Sonne entgegen. Heute war Donnerstag, und an diesem Tag ging Kinza zur Arbeit. Sie war jetzt zweieinhalb Jahre alt, nach Si Mohammeds Meinung alt genug, um wie die übrigen Familienmitglieder ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Still und geduldig saß Kinza da, die schmächtigen Beinchen unter dem Körper gekreuzt, die Hände ruhig im Schoß gefaltet. Es war noch früh, und Hamid, der sie immer auf ihren Arbeitsplatz trug, war mit der Kuh auf den Weideplatz gegangen und würde erst in einer halben Stunde zurück sein. Bis dahin war Kinza frei, das Leben zu genießen, und das tat sie denn auch auf ihre Weise.
Nie hatte sie die Sonne hinter dem Berg aufgehen sehen. Wenn sie aber ungefähr um diese Zeit auf der Türschwelle saß, dann konnte sie damit rechnen, dass auf einmal eine sanfte Wärme sie überflutete und ihren Körper in Wohlbehagen hüllte. Sobald die ersten Sonnenstrahlen das erwartungsvoll erhobene Gesicht berührten, lachte Kinza vor Wonne und streckte die Arme aus wie nach einem geliebten Freund. Danach faltete sie die Hände wieder in ihrem Schoß und blieb zufrieden sitzen, bis es ihr zu heiß wurde. In ihrem kurzen Leben war Kinza von den Menschen, denen sie im Weg war, schon oft gestoßen und geschlagen worden. Die Berührung der Sonne aber war nie anders als sanft gewesen, deshalb war sie ihr so lieb.
Solange Sonnenschein und gutes Wetter herrschten, war Kinza im Großen und Ganzen ein glückliches kleines Menschenkind. Da sie das Licht nie gesehen hatte, fehlte es ihr nicht. Auch gab es ja so viel Angenehmes, das sie fühlen konnte! Da war einmal Mutters Schoß mit seiner Wärme und Geborgenheit. Da waren die starken Arme ihres Bruders. Da waren die feuchten Nasen der Zicklein. Da waren die Sonne und der Wind, der ihr übers Gesicht strich. Manchmal durfte Kinza neben ihrer Mutter sitzen, wenn sie das Korn sortierte. Dann füllte sie sich die Hände mit warmen Hülsen und ließ sie durch ihre Finger gleiten. Das bedeutete das größte Vergnügen für sie.
Auch gab es viel Schönes zu hören: das Blöken, Gackern und Muhen der Bewohner des kleinen Bauernhofes und das gedämpfte Geräusch des Mühlsteins, was bedeutete, dass die Mutter in der Nähe war. Dann das muntere Klirren der Eimer, das Rahmas Rückkehr vom Brunnen ankündigte, das Pusten des Blasebalgs und das Knistern der Holzkohlen, das in der nahen Zukunft etwas zu essen verhieß. Aber am schönsten war für Kinza das Getrippel der heimkehrenden Ziegen, denn auf die Ziegen folgte Hamid, und für Kinza war Hamid der herrlichste Mensch auf Erden.
Sie kannte die Schritte sämtlicher Familienmitglieder. So merkte sie denn auch jetzt an dem besonderen Geräusch, das seine nackten Füße auf der trockenen Erde machten, dass Hamid auf sie zukam. Sie streckte die Arme aus und stieß einen Laut des Entzückens aus. Hamid hob sie auf und band sie auf seinem Rücken fest.
»Markttag, Schwesterchen«, erklärte er. »Hast du etwas zum Frühstück gehabt?«
Kinza nickte. Vor einer guten halben Stunde hatte sie ein Schüsselchen süßen schwarzen Kaffee getrunken und ein Stück Schwarzbrot gegessen. Das war das beste Frühstück, das sie kannte, und sie hatte es in vollen Zügen genossen.
»Also los«, sagte Hamid und trug sein Schwesterchen zum Dorf hinaus. So lange wie möglich blieben sie im Schatten der Olivenbäume, denn im Sommer scheint die Sonne morgens um neun Uhr schon brennend heiß. Doch allzu bald mussten sie die Bäume hinter sich zurücklassen. Der Weg zum Markt führte durch Weizenfelder, die reif waren zur Ernte; die Halme beugten sich unter ihrer goldenen Last, und die Luft war schwer vom einschläfernden Duft der Mohnblumen. Kinza, die die Fähigkeit besaß, einzuschlafen, wo und wann sie es wünschte, legte den Kopf an die Schulter ihres Bruders, schloss die Augen und ließ sich vom Wind, der über die Kornfelder strich, in den Schlaf singen. Auch die Kühe am Fluss sahen schläfrig aus. Knietief standen sie im Sumpf, während ihnen die Fliegen unentwegt um die Köpfe summten.
An diesem Vormittag schienen sehr viele Leute unterwegs zu sein. Am Donnerstag ging nämlich nicht das Dorf auf den Markt, sondern der Markt kam ins Dorf. Jedes größere Dorf in der Gegend hatte seinen bestimmten Tag, an dem alle, die irgendetwas zu verkaufen hatten, über die Berge reisten und sich auf ihrem angestammten Platz auf dem Markt niederließen. Darum hieß zum Beispiel Hamids Dorf das »Donnerstags-Dorf«. Mehrmals musste Hamid in ein Kornfeld ausweichen, um einen stattlichen Händler durchzulassen, der hoch zu Pferd dahergeritten kam, während seine Frau, eine schwere Last tragend, hinter ihm herkeuchte.
Je mehr sie sich dem Marktplatz näherten, desto dichter wurde der Verkehr. Gelbes, verbranntes Gras beherrschte die Gegend, hier und da spendeten Eukalyptusbäume willkommenen Schatten. Die Verkäufer saßen mit gekreuzten Beinen auf der Erde, ihre Ware vor sich aufgestapelt, und die Käufer umringten sie laut schwatzend. Kinza hasste den Markt. Sie hasste das Drängen und Drücken und den Lärm; sie hasste den Staub, von dem sie niesen musste, und die Fliegen, die ihr über das Gesicht krabbelten, und die Flöhe, die sie in die Beine stachen. Am allermeisten aber hasste sie den Augenblick, wenn Hamid sie im Stich ließ und sie allein mit dem alten Bettler zurückblieb.
Um den Abschiedsschmerz zu lindern, hatte Hamid einen Plan ausgeheckt. Wenn es ihm gelang, während der Woche ein Geldstück zu erbetteln, auszuleihen oder zu »stibitzen«, dann sparte er es für den Donnerstagmorgen. Auf dem Weg über den Markt tauschte er es stolz gegen einen Klumpen klebriges, grünes Zuckerzeug ein, das mit Nüssen bespickt war. Solchen grünen Zucker zu schlecken, war für Kinza ein wahrer Hochgenuss.
Mit der Sicherheit eines alten Marktgängers steuerte Hamid geschickt durch die Menge. Er drückte, stieß, bückte sich und gebrauchte seine Ellenbogen, bis er den Sandflecken erreichte, wo Kinza neben dem alten Bettler zu sitzen hatte. Er richtete es so ein, dass er vor dem Bettler ankam; Kinza sollte Zeit haben, ihren grünen Zuckerstängel zu lutschen. Im Geheimen schleckte Hamid erst selbst ein paar Mal daran, dann reichte er ihn, warm und feucht, wie er war, seinem Schwes-terchen. Sie ergriff ihn mit der rechten Hand und begann sogleich, ihn mit ihrer rosigen Zunge rundum abzuschlecken. Ach, wie liebte sie diese süße Klebrigkeit! Mit der Linken klammerte sie sich an den Saum von Hamids Gewand, für den Fall, dass er in Gefahr käme, von der lärmenden Menge weggeschwemmt zu werden.