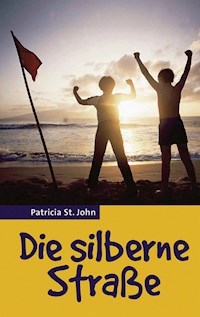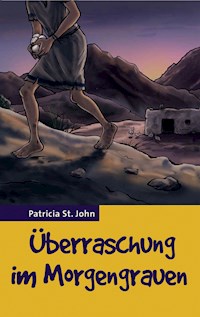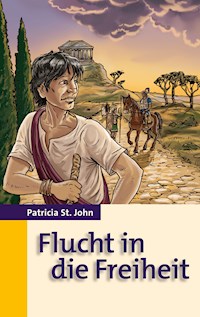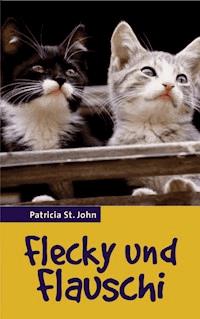Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibellesebund
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Über 40 Geschichten hat die bekannte Autorin in diesem Buch zusammengestellt: Geschichten zum Vorlesen, zum Selberlesen, spannende und humorvolle Geschichten; Geschichten aus der Vergangenheit und der Gegenwart; Geschichten aus Europa und aus anderen Teilen der Welt. Und das Besondere an ihnen ist: Sie sind so ausgewählt und angeordnet, dass sie wichtige Wahrheiten des christlichen Glaubens anschaulich illustrieren. So können Kinder (und nicht nur sie) die großen biblischen Aussagen über Gott, Jesus und den Heiligen Geist sowie die Antwort des Menschen darauf besser verstehen lernen. Gleich die erste Geschichte im Buch, "Das weiße Taschentuch", ist zu einem häufig vorgelesenen Klassiker geworden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia St. John
So groß ist Gott
Geschichten zum Glaubensbekenntnis
Impressum
Originaltitel: »Would You Believe It?«
Erschienen bei: Harper Collins, London, Großbritannien
© 1983 by Patricia St. John.
Deutsch von Renate Mauerhofer und Wolfgang Steinseifer
© 1986 der deutschsprachigen Ausgabe, Bibellesebund Winterthur
8.Auflage 2006
© 2019 der E-Book-Ausgabe
Bibellesebund Verlag, Marienheide
Alle Rechte vorbehalten
https://shop.bibellesebund.de/
Coverfoto: Getty Images, FotoDisc
Covergestaltung: Georg Design, Münster
ISBN 978-3-95568-331-3
Hinweise des Verlags
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch teilweise - nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des Textes kommen.
Noch mehr E-Books des Bibellesebundes finden Sie auf
https://ebooks.bibellesebund.de
Inhalt
Titel
Impressum
Vorwort
I. Ich glaube an Gott, …
… der mich wie ein Vater liebt1. Das weiße Taschentuch
… der mich gemacht und zurückgekauft hat2. Das verlorene Boot
… der die Mauer zwischen uns und ihm abgerissen hat3. Das geschlossene Fenster
II. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn
Warum er zu uns kam4. Warum Scheich Ali rannte
In ihm kam Gott selbst auf die Erde5. Der unerkannte Gast
Warum er als Mensch auf der Erde lebte6. Fußspuren im Schnee
Sein Leben und Vorbild7. Der Mann, der anders war
Er hat sein Leben geopfert8. Der Ring und die Rosen
III. Ich glaube an Jesus Christus, der am Kreuz für uns starb
Er starb, um uns vor dem ewigen Tod zu retten9. Der sicherste Ort
Er litt an unserer Stelle10. Der verbotene Pfad
Sein Tod macht uns vor Gott gerecht11. Ein Leben für ein Leben
IV. Ich glaube an Jesus Christus, der vom Tod auferstand
Sein Sieg über den Tod12. Der Weg durch die Flut
Seine Auferstehung13. Die Stimme in der Dunkelheit
Buße macht Sünde sichtbar14. Weißer als Schnee
Buße ist Bekenntnis der Sünde15. Das Hindernis
Buße ist Umkehr16. Das Fünf-Finger-Gebet
Bekehrung17. Der Kapitän und der Kabinenjunge
V. Ich glaube an den Heiligen Geist, der in uns lebt
Er bewirkt einen Neuanfang18. Der Freund, der sich erinnerte
Er hat Kraft, die verändert19. Ein Zuhause für Virginia
VI. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Frucht wachsen lässt
Er lässt Liebe wachsen20. Eine Überraschung für den Räuberhauptmann
Er gibt Freude21. Ein Siegeslied
Er schafft Frieden22. Die beste Arbeit
VII. Geistlich wachsen in der Beziehung zu Gott
Gott redet durch die Bibel23. Das Buch im Nachttisch
Wie man beten soll24. Die weißen Vögel
Beten im Namen Jesu25. Aischas Brief
Für andere beten26. Die Rettung
Ausdauernd beten27. Warum stürzte die Mauer ein?
Gott erhört Gebet28. Der leere Korb
Gott lässt uns warten29. Der Bus, der nicht anhielt
Gott sagt nein30. Warum musste gerade er sterben?
Gott loben31. Gesang um Mitternacht
VIII. Geistlich wachsen in der Beziehung zu anderen Menschen
Die Bedeutung des Dienens32. Der Weihnachtsgast
Gottes Botschaft weitersagen33. Das Seil
In Notlagen helfen34. Das Mädchen, das nicht vergessen konnte
Die Bedeutung des Gebens35. Das weiße Huhn des Herrn
Ein reines Gewissen36. Der Junge, der das Licht mied
Gemeinschaft mit anderen Christen37. Aus dem Feuer
IX. Gott vertrauen in guten und in schlechten Tagen
Gott gibt Geborgenheit38. Die Streichholzschachtel und die Münze
Gott schützt in Gefahr39. Der Wächter, den sie nicht zu töten wagten
Gott hilft in Schwierigkeiten40. Der unbezwingbare Hügel
Alles wirkt zum Guten mit41. Das hellere Licht
X. Gott vertrauen über den Tod hinaus
Das Beste kommt noch42. Geboren, um zu fliegen
Jesus kommt wieder43. Schritte in der Nacht
Vorwort
»So groß ist Gott – Geschichten zum Glaubensbekenntnis« hat Patricia St. John für junge Leser geschrieben, um ihnen zu helfen, Gott besser kennen zu lernen, über sein Handeln zu staunen und ihm auf sein Reden und Tun zu antworten.
Die hier zusammengestellten Geschichten aus verschiedenen Jahrhunderten und vielen Ländern der Erde sind so etwas wie Gleichnisse. Sie wollen bestimmte biblische Aussagen illustrieren. Dabei kommt es meistens nur auf einen einzigen Hauptgedanken an, und man darf nicht jeden einzelnen Gedanken der Erzählungen auf Gott und sein Handeln zu übertragen versuchen. Sonst werden die Geschichten (wie alle Gleichnisse) überstrapaziert.
Bei alldem geht es nicht um das Vermitteln trockener Dogmatik. Indem wir miteinander wichtige biblische Aussagen über Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist und das Leben als Christen anschauen, kommt es hoffentlich zum Staunen und zur Freude über den großen Gott, der uns liebt und uns als seine Kinder angenommen hat.
Der Verlag
I.
Ich glaube an Gott, …
… der mich wie ein Vater liebtBibeltext: Lukas 15,11-32
1. Das weiße Taschentuch
Der Mann saß auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle und starrte zu Boden. Ein paar Leute musterten ihn im Vorübergehen neugierig und fragten sich, was das wohl für einer sein mochte, der Landstreicher mit den hängenden Schultern und den durchgelaufenen Schuhen. Er aber bemerkte ihre Blicke gar nicht. Er war ganz in Gedanken versunken. Hier, in dieser Stadt, hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als zwanzig Jahren war er in einem kleinen roten Ziegelhaus am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand? Vielleicht war es ja inzwischen abgerissen worden! Hoffentlich hatten sie wenigstens die Stiefmütterchen nicht zertrampelt! Komisch, wie gut er sich noch an die Stiefmütterchen erinnerte und an die Schaukel, die ihm sein Vater gebaut hatte, und an den Gartenweg, auf dem er das Fahrradfahren gelernt hatte. Monatelang hatten die Eltern gespart, um ihm das Fahrrad kaufen zu können.
Zehn Jahre später war aus dem Fahrrad ein Motorrad geworden. Er selbst ließ sich zu Hause immer seltener blicken. Er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde. Vater und Mutter erschienen schrecklich altmodisch und langweilig. Da war es in den Kneipen und Discos doch lustiger!
Heute erinnerte er sich nicht mehr gern an diese Zeit, vor allem nicht daran, wie ihm die Schulden über den Kopf gewachsen waren und er an einem Sonntagnachmittag bei den Eltern aufgetaucht war, um sie um Geld zu bitten. Sie hatten sich so über seinen unerwarteten Besuch gefreut, dass er es nicht übers Herz gebracht hatte, sie um Geld zu bitten. Doch er wusste genau, wo sein Vater das Portmonee aufbewahrte, und als die Eltern dann für einen Augenblick in den Garten gingen, hatte er sich einfach »bedient«.
Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich nach dem, was er getan hatte, nicht mehr nach Hause; und die Eltern hatten jede Spur von ihm verloren. Er war ins Ausland gegangen und sie erfuhren nichts von seinem rastlosen Umherziehen und auch nichts von seinem Gefängnisaufenthalt. Doch dort, in seiner Zelle, hatte er viel an sie gedacht. Manchmal, wenn er sich schlaflos auf seiner Pritsche herumwälzte und der Mond unheimliche Figuren auf die Zellenwand malte, wünschte er sich: »Wenn ich erst wieder aus diesem Loch heraus bin, möchte ich sie noch einmal sehen – wenn sie überhaupt noch leben ... und wenn sie mich sehen wollen.«
Als er seine Strafe abgesessen hatte, fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle; aber Ruhe fand er nicht. Irgendetwas zog ihn heim, eine Sehnsucht, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ. Auf Schritt und Tritt wurde er an das kleine rote Backsteinhaus erinnert, an das Beet mit Stiefmütterchen, an ein Kind auf einer Schaukel, an einen Jungen, der von der Schule nach Hause rannte ...
Er wollte nicht völlig mittellos daheim ankommen, und so legte er einen großen Teil der Reise zu Fuß oder per Anhalter zurück.
Er hätte schon längst da sein können, aber dreißig Kilometer vor dem Ziel waren ihm plötzlich Zweifel gekommen. Was hatte er überhaupt für ein Recht, einfach so bei seinen Eltern hereinzuspazieren? Würden sie in dem heruntergekommenen Kerl, der er geworden war, überhaupt den Jungen erkennen, den sie geliebt hatten und der sie so schrecklich enttäuscht hatte?
Er kaufte sich etwas zu essen und setzte sich unter einen Baum, wo er für den Rest des Tages sitzen blieb. Der Brief, den er am Abend in einen Briefkasten einwarf, war sehr kurz, aber er hatte sich stundenlang damit abgemüht. Er endete mit den Worten:
»Ich weiß, es ist verrückt anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt. Aber entscheidet selbst. Ich werde früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Wenn ich es dort sehe, werde ich zu euch kommen; wenn nicht, werde ich dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davonmachen.«
Und nun war der Donnerstagmorgen da. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Diese Straße gab es jedenfalls noch! Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich einfach auf den Gehsteig und starrte die Steine an.
Ewig konnte er den Augenblick der Wahrheit natürlich nicht hinauszögern. Vielleicht waren die Eltern inzwischen ausgezogen? Wenn kein Taschentuch da war, wollte er wenigstens ein paar Erkundigungen in der Stadt einziehen, ehe er sich wieder auf den Weg machte. Er wagte gar nicht daran zu denken, was er tun sollte, wenn seine Eltern zwar noch dort wohnten, ihn aber nicht mehr sehen wollten.
Mühsam und mit schmerzenden Gliedern erhob er sich. Er war steif vom Übernachten im Freien. Die Straße lag noch im Schatten. Mit unsicheren Schritten wankte er zu der alten Platane hinüber, von der aus, das wusste er, das Backsteinhaus deutlich zu sehen sein würde. Bis dahin hielt er den Blick zu Boden gesenkt.
Mit fest zusammengekniffenen Augen stand er ein paar Augenblicke unter den Ästen des Baumes. Dann holte er tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße hinüber. Und dann stand er da und starrte und starrte ...
Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen – aber es war kein kleines rotes Backsteinhaus mehr. Es schien ganz in weiße Tücher eingehüllt zu sein. Aus allen Fenstern hingen Betttücher und Kissenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten; und aus dem Dachfenster flatterte eine große weiße Gardine quer über das ganze Dach. Rotes Backsteinhaus? Das schien ein Schneehaus zu sein, das da in der Sonne glänzte!
Die Eltern hatten kein Missverständnis riskieren wollen! Der Mann warf den Kopf zurück und stieß einen Freudenschrei aus. Dann rannte er über die Straße und durch die weit geöffnete Haustür direkt in sein Elternhaus hinein.
… der mich gemacht und zurückgekauft hatBibeltexte: 1.Mose 1,26-31; 1.Mose 3
2. Das verlorene Boot
Viele Samstagnachmittage hatte Jonas in der Garage verbracht und an seinem Boot gearbeitet. Den Rumpf hatte er aus einem massiven Holzblock geschnitzt, den er ausgehöhlt und mit Sandpapier geglättet hatte. Bei den Segeln hatte ihm seine Mutter geholfen, und die Bespannung für die Takelage hatte er naturgetreu einem richtigen Schoner nachgebildet, dessen Foto er in einer Zeitschrift gefunden hatte. Es war ein tolles Segelschiff, und das Beste war, dass er es selbst gemacht hatte.
Nun war es fertig, stand im Wohnzimmer und wurde von allen bewundert. Jonas’ Vater war besonders beeindruckt.
»Das hast du aber wirklich prima gemacht, Jonas. Ich bin stolz auf dich. Du bist sehr geschickt«, sagte er. »Was wirst du denn als nächstes basteln?«
Daran hatte Jonas noch gar nicht gedacht. Jetzt war erst einmal das Boot fertig. Das war das Wichtigste.
An einem schönen Frühlingstag nahm er sein Boot mit zum Kanal, um es dort schwimmen zu lassen. Er suchte sich dafür den schönsten Platz aus: einen sandigen Uferstreifen zwischen Binsen versteckt, wo er früher einmal das Nest einer Moorhenne gefunden hatte. Es war ideales Segelwetter: Die Sonne schien, der Wind füllte die Segel und trieb das Schiff in die Mitte der trägen Strömung. Jonas kniete am Ufer und ließ den Bindfaden, den er am Heck befestigt hatte, durch seine Finger gleiten. Gleich würde er die Uferböschung hinaufklettern und den Pfad entlanglaufen, der neben dem Kanal herführte; aber zuerst wollte er einfach nur sein herrliches Schiff bewundern. Er war so in den Anblick vertieft, dass er die Stimmen hinter sich gar nicht hörte, und er fuhr zusammen, als drei Jungen, die viel älter waren als er, plötzlich neben ihm auftauchten. Jonas umklammerte seinen Bindfaden fester, denn diese Jungen kannte er nicht. Vielleicht stammten sie von einem der Lastkähne, die den Kanal hinauf- und hinunterfuhren.
»He, lass uns auch mal!«, sagte der Älteste.
»A-aber nur einen Augenblick«, stotterte Jonas. »Dann will ich mein Boot wieder einholen.«
Er schluckte und das Herz schlug ihm bis zum Hals, denn diese Jungen sahen nicht gerade friedlich aus. Der Große hatte ihm schon die Fadenrolle aus der Hand gerissen und holte das Boot ein. Dabei zerrte er so ruckartig an der Schnur, dass das Boot kenterte und die Segel sich voll Wasser sogen. Als es fast am Ufer war, spürte Jonas plötzlich einen Stoß im Rücken, und im nächsten Augenblick landete er unsanft zwischen Binsen und Nesseln. Seine Finger krallten sich in den Morast und der nasse Lehm spritzte ihm in die Augen, sodass er einen Moment nichts sehen konnte. Als er sich endlich wieder hustend und spuckend aufgerafft hatte, waren die Jungen verschwunden – und mit ihnen das Boot. Alles, was er sah, waren niedergetrampelte Binsen und die Trauerweiden.
Jonas kletterte die Uferböschung hinauf. Nichts. Die Jungen waren hinter einer der vielen Hecken verschwunden, die sich neben dem Kanal hinzogen, und er konnte nicht einmal erkennen, in welche Richtung sie sich davongemacht hatten. Und überhaupt – selbst wenn er sie verfolgen und einholen könnte, was vermochte er gegen die drei auszurichten? Tränen der Wut und Verzweiflung stiegen in ihm auf. Doch Jonas beherrschte sich mühsam, wischte sich die Hände ab und machte sich auf den Heimweg. Er wusste, dass seine Eltern einen Besuch machten, und er bezweifelte, dass die Polizei etwas unternehmen würde, wenn er dort anriefe und seine Geschichte erzählte.
Als seine Eltern heimkehrten, berichtete Jonas, was geschehen war. Sein Vater zog sogleich wieder los, um in der Nachbarschaft Erkundigungen einzuziehen; doch niemand hatte die drei fremden Jungen gesehen. Beim Abendessen war Jonas sehr still, und als er dann im Bett lag, konnte er die Tränen nicht länger zurückhalten. Sein Vater hatte ihm angeboten, ihm beim Bau eines neuen Bootes zu helfen – aber das würde nicht dasselbe sein. Dieses Boot war sein allererstes gewesen. Er hatte es ganz allein gemacht, und ihm allein hatte es gehört. Nie würde er dieses Boot vergessen.
Wochen vergingen. Jonas baute mit seinem Vater ein neues Boot und ließ es auf dem Kanal schwimmen, aber immer und immer wieder dachte er an sein altes. Manchmal lag er wach im Bett, erinnerte sich an den glänzenden Rumpf und die geblähten Segel und fragte sich, wo es wohl jetzt stecken mochte.
Eines Nachmittags fuhr er mit dem Fahrrad in die Stadt, um ein Geburtstagsgeschenk für seine Mutter zu kaufen. Nachdem er etwas Schönes gefunden hatte, wählte er für den Heimweg eine Abkürzung, die ihn durch schmale Seitensträßchen führte. Dort gab es viele Trödelläden und Jonas bestaunte die verstaubten Auslagen in den blinden Fenstern. Was es da nicht alles gab! Plötzlich machte er eine Vollbremsung. Da, mitten in einem Schaufenster zwischen einer alten Gitarre und einem Messing-Kohleneimer, da stand sein Boot!
Jonas lehnte sein Fahrrad an eine Mauer und stürzte in den Laden.
»Das Boot im Fenster!«, rief er atemlos. »Das ist meines. Ich hab’s gemacht.«
Der alte Ladeninhaber blickte ihn über den Rand seiner Brille an.
»Irrtum, junger Mann«, wies er ihn zurecht. »Es gehört mir. Ich hab’s vor Wochen ein paar Jungen abgekauft. Eben erst habe ich es ins Fenster gestellt.«
»Aber ich hab’s doch gemacht. Es gehört mir, wirklich! Bitte, geben Sie es mir!«
»Nur, wenn du mir den Preis bezahlst. Er steht auf dem Anhänger.«
»Aber ich hab all mein Geld ausgegeben!«
»Dann musst du dir eben noch was besorgen.«
Jonas merkte, dass all sein Reden nutzlos war. Aber noch war es nicht zu spät. Er raste nach Hause. Sein Vater war gerade im Garten beschäftigt.
»Papa!«, rief er ihm schon von weitem atemlos zu. »Du musst mir unbedingt etwas Geld leihen!«
»Geld leihen? Wofür denn? Und wie viel denn? Und wie willst du’s mir zurückzahlen?«
»Ich wasch dir das Auto oder mähe hundertmal den Rasen oder mache alles, was du willst. Aber du musst mir das Geld leihen. Es ist für mein Boot ... Wenn ich mich beeile, schaffe ich’s noch bevor der Laden schließt.«
Der Vater warf einen bedauernden Blick auf seine geliebten Rosen, seufzte und nickte zum Auto hinüber.
»Spring in den Wagen. Es ist schon fast halb sieben. Und im Übrigen bringst du das Boot nicht auf dem Fahrrad nach Hause, ohne die Takelage zu beschädigen. Unterwegs kannst du mir genau erzählen, was eigentlich los ist.«
Der alte Mann wollte gerade die Ladentür abschließen, da stürzte Jonas auf ihn zu.
»Ich hab das Geld!«, rief er. »Geben Sie mir jetzt bitte mein Boot!«
»Ich verkaufe dir mein Boot«, sagte der Alte kichernd und holte es aus dem Schaufenster.
Schweigend fuhren Jonas und sein Vater nach Hause. Jonas untersuchte seinen Schatz genau. Erst als sie in die Garageneinfahrt einbogen, fand er seine Sprache wieder.
»Weißt du was, Papa?«, sagte er. »Ich hab gerade gedacht, eigentlich gehört mir das Boot jetzt zweimal. Ich hab’s gemacht und ich hab’s gekauft. Ist das nicht zum Staunen?«
»Ja, da hast du Recht«, stimmte sein Vater zu. »Und sicher wirst du jetzt besonders gut darauf aufpassen ...«
Aber Jonas hörte das schon nicht mehr. Er war aus dem Auto gesprungen, um seiner Mutter die Geschichte zu erzählen.
… der die Mauer zwischen uns und ihm abgerissen hatBibeltext: Epheser 2,12.18
3. Das geschlossene Fenster
Anna war – von ein paar Erkältungen abgesehen – noch nie richtig krank gewesen. Sie konnte sich gar nicht vorstellen, warum ihr der Hals so wehtat und warum sie sich so elend fühlte. Ihre Mutter blickte sie erstaunt an, als sie den Teller mit ihrem Lieblingsgericht, Bratwurst und Pommes frites, von sich schob.
»Nanu, das hast du doch sonst so gern, Anna!«, sagte sie. »Was ist denn los mit dir?«
»Ach, nichts«, flüsterte Anna, und dann schien sich auf einmal die ganze Welt zu drehen und sie legte den Kopf auf den Tisch.
»Kind, du bist krank!« Mutters besorgte Stimme schien von weither zu kommen. »Lass mich mal deine Stirn fühlen! Du liebe Zeit, du bist ja der reinste Backofen! Jetzt aber nichts wie ins Bett mir dir, Liebes!«
Es war eine unvergessliche Nacht. Anna schlief und wachte auf und schwitzte und fror; so oft sie einschlief, hatte sie unheimliche, Furcht erregende Träume und rief nach ihrer Mutter, die stets an ihrer Seite war. Als der Tag anbrach und die Vögel zu zwitschern begannen, wachte Anna richtig auf und wollte wissen, was mit ihr los war.
»Dein Hals ist schlimm entzündet und du hast hohes Fieber«, sagte die Mutter, die aussah, als hätte sie die ganze Nacht kein Auge zugetan. »Papa ruft gerade den Doktor an.«
Der Arzt kam schon bald darauf und untersuchte ihren Hals und dann ihren ganzen Körper. Dabei brummte er etwas vor sich hin und schüttelte mehrmals den Kopf. Er sah ziemlich besorgt aus. Anna hörte ihn im Flur mit der Mutter sprechen, konnte aber nichts verstehen.
Stunden vergingen. Anna döste ein und erwachte und trank Wasser, und ihre Mutter saß neben ihr. Dann fiel sie in einen tiefen Schlaf. Es wurde wieder Nacht, und die Mutter schlief neben ihr auf einer Matratze am Boden.
»Solange sie da ist«, dachte Anna, als sie einmal erwachte, »so lange ist alles in Ordnung. Wenn nur die schrecklichen Halsschmerzen endlich aufhören würden!«
Am nächsten Morgen läutete das Telefon, und dann kam Vater und richtete ihnen aus, was der Arzt ihm gesagt hatte. »Anna, die Untersuchungen haben ergeben, dass du Diphtherie* hast. Du musst deshalb auf die Isolierstation im Krankenhaus. In etwa einer halben Stunde ist der Krankenwagen hier und holt dich ab.«
»Du kommst aber mit, Mami, oder?«, krächzte Anna und sah ihre Mutter mit ängstlichen Augen an.
Die druckste herum und sah ganz verzweifelt aus. »Ich – das darf ich leider nicht«, murmelte sie schließlich. »Sie holen dich hier weg, weil deine Krankheit ansteckend ist. Aber die Krankenschwestern werden bestimmt sehr lieb zu dir sein, und ich besuche dich heute Nachmittag.«
Wenn es Anna besser gegangen wäre, hätte sie es im Krankenhaus bestimmt ganz lustig gefunden, denn auf der Station gab es noch andere Kinder und die Schwestern waren freundlich. Aber ihr Hals brannte immer noch wie Feuer und sie hatte schrecklich Heimweh. So lag sie nur in ihrem Bett, kämpfte mit den Tränen und blickte zur Tür hinüber.
Mutter hatte versprochen am Nachmittag zu kommen, und Anna sehnte sich nach ihr, nur nach ihr.
Dann kam auf einmal die Schwester zu ihr herüber und sagte: »Sieh mal, Anna, da am Fenster ist deine Mutter! Nicht hinsetzen; schön liegen bleiben! Wink ihr einfach zu und lach sie an!«
»Aber zeigen Sie ihr doch, wo die Tür ist!«, rief Anna. »Lassen Sie sie schnell herein. Ich muss ihr unbedingt was sagen ..., es ist unheimlich wichtig.«
»Tut mir Leid, Anna«, sagte die Krankenschwester sehr freundlich, »aber hier darf niemand herein, denn all die Kinder auf unserer Station haben ansteckende Krankheiten. Du möchtest doch sicher nicht, dass deine Mutter krank wird, oder? Wenn du deiner Mutter was Wichtiges zu sagen hast, sag’s mir, ich richte es ihr dann aus.«
Anna schüttelte den Kopf. Sie hatte nichts auszurichten und sie brachte vor Enttäuschung keinen Ton heraus. Da war ihre Mutter, ihre starke, tröstende Mutter, der einzige Mensch, der ihr jetzt helfen konnte, so nah und wäre so gern ganz bei ihr gewesen; doch sie konnten sich nur hilflos durch die Trennscheibe anschauen. Die Schwester durfte nicht einmal das Fenster öffnen. Sie lächelten einander noch einmal tapfer zu, und dann winkten beide zum Abschied. Anna, die sich schrecklich krank fühlte, vergrub ihren Kopf in den Kissen und weinte, denn es war so, als hätte die Mutter sie überhaupt nicht besucht.
Die Zeit verging im Schneckentempo, und Anna ging es jeden Tag ein wenig besser. Dann geschah etwas Wunderbares. Anna saß in ihrem Morgenmantel am Fenster und ihre Mutter kam wie gewöhnlich, um sie zu besuchen. Doch an diesem Nachmittag öffnete die Schwester das Fenster.
»So, jetzt könnt ihr euch in aller Ruhe unterhalten!«, sagte sie.
Und wie sie sich unterhielten! Es gab so viel zu erzählen und zu hören – die Neuigkeiten einer ganzen Woche. Sie redeten und redeten, bis die Sonne hinter den Bäumen verschwand und die Krankenschwester Anna ermahnte, jetzt müsse sie aber wieder ins Bett. Schon lange hatte Anna nicht mehr so tief und fest geschlafen wie in dieser Nacht. Wie gut war es doch zu wissen, dass nie mehr eine Trennscheibe zwischen ihr und ihrer Mutter sein würde. Das Fenster würde nun jeden Tag weit offen stehen.
Jetzt verging auch die Zeit schneller, denn das Wetter war schön und Anna durfte mit ihrer Mutter im Park spazieren gehen und draußen mit anderen Kindern spielen. Und vom Fenster ihres Krankenzimmers aus sah sie blühende Hecken und Lämmer, die auf den Wiesen umherhüpften. Nun würde es nicht mehr lange dauern, und sie durfte wieder nach Hause.
Endlich war der ersehnte Tag gekommen. Anna trank im Zimmer der Stationsschwester Kakao, da kam der Arzt mit einem Aktenordner in der Hand herein.
»Aha, da bist du ja, Anna«, sagte er. »Na, es scheint alles in Ordnung zu sein. Sie können ihre Mutter anrufen, Schwester, und ihr mitteilen, dass sie Anna heute abholen kann.«
An diesem Nachmittag musste Anna sich nicht mehr am Tor von ihrer Mutter verabschieden, sondern konnte mit ihr ins Auto steigen und nach Hause fahren. Keine geschlossenen Fenster mehr und keine Abschiede! Endlich wieder daheim!
*Ansteckende Krankheit, die heute nur noch selten vorkommt, weil Kinder dagegen geimpft werden.
II.
Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn
Warum er zu uns kamBibeltexte: Hebräer 1,1.2; 2,9-18
4. Warum Scheich Ali rannte
Der arabische Scheich Ali saß am Schreibtisch in seinem prächtig ausgestatteten Büro. Es war der reinste Palast inmitten eines Gartens, wo im Schatten eines knorrigen Maulbeerbaumes Iris und Narzissen blühten. Der Scheich war ein reicher und mächtiger Mann. Vor ihm lagen Kontoauszüge und Hauptbücher und ein Terminkalender, und sein Sekretär schrieb eifrig. Scheich Ali selbst schien in seine Bücher vertieft, doch dazwischen wanderte sein Blick immer wieder durch die Fenster nach draußen, wo ein kleiner Junge in den Ästen des Maulbeerbaumes herumkletterte. Mit seinen dunklen Augen, dem schwarzen Haar und den verwaschenen Jeans sah er aus wie viele andere Jungen in der Umgebung; aber dieser Junge, der da unten spielte, war Sadik, der einzige Sohn und Erbe des Scheichs, der Augapfel seines Vaters. Und weil er vor dem Fenster herumtobte, kam sein Vater an diesem Vormittag weniger schnell mit seiner Arbeit voran als gewöhnlich.
Scheich Ali blätterte nachdenklich in seinem Terminkalender. Am Abend erwartete er wichtige Gäste, und seine Frau hatte zu ihrer Familie reisen müssen, um bei einer Hochzeit dabei zu sein. Nun ja, das machte nichts. Schließlich hatte er eine Menge guter Diener. Er drückte auf den Klingelknopf und ein Bote glitt geräuschlos herein.
»Schick mir Abdullah und den Koch!«, sagte der Herr. Einen Augenblick später standen beide in ihren fleckenlosen Uniformen vor ihm. »Abdullah, geh zum Markt und besorge alles, was für den Abend benötigt wird!«
Abdullah verneigte sich und zog sich zurück.
»Und du, bereite ein reichhaltiges Festmahl zu und lass es auftragen!«
Der Koch nickte zustimmend und verschwand ebenfalls wieder.
»Schick mir den Gärtner!«, befahl der Herr, und im Handumdrehen erschien dieser.
»Pflücke die saftigsten Früchte und die schönsten Blumen!«
Strahlend verschwand der Gärtner wieder. Es machte ihm Freude den Gästen vorzuführen, was für Herrlichkeiten in seinem Garten wuchsen.
Scheich Ali war zufrieden. Seine Diener würden alle nötigen Vorbereitungen für den Abend treffen. Nun konnte er sich wieder seinen Geschäften zuwenden.
Briefe mussten zugestellt und Besprechungen vorbereitet werden. Bei den Schafgehegen drohte eine Mauer einzustürzen – der Chef des Bautrupps wurde herbeigerufen. Ein Dutzend andere Angelegenheiten mussten erledigt werden und ein Dutzend Diener kümmerten sich stillschweigend darum. Der Scheich blieb an seinem Schreibtisch sitzen und nippte an seinem schwarzen Mokka. Er musste keinen Finger rühren, nur Aufträge erteilen.