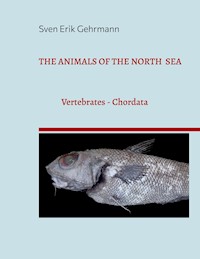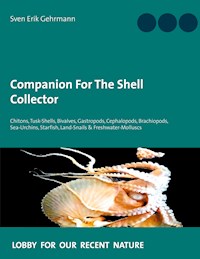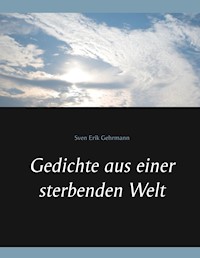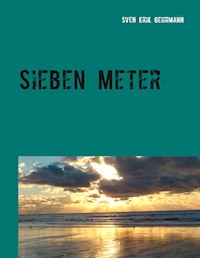Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk basiert auf dem "World Register Of Marine Species (Worms)", welches eine internationale Plattform der Wissenschaft darstellt. Diese umfasst die derzeit gültigen wissenschaftlichen Namen und Systematiken unserer rezenten Meerestiere. Dieses Buch stellt mehr als 600 verschiedene Arten der Mollusken aus Meer-und Süßwasser vor. Und darüber hinaus auch einige Arten der Seeigel, Seesterne und Armfüßer, womit sich die Zahl der diversen Arten auf insgesamt mehr als 780 erhöhte. Das Werk stellt die Arten in den Kontext ihrer Lebensräume, ihrer Überlebens- und Fortpflanzungsstrategien, sowie ihrer aquaristischen Haltbarkeit, sofern man lebende Exemplare bekommen kann. Dieses Buch stellt beides vor: Die lebenden Tiere für die Vivaristen und ihre leeren Schalen für die Sammler. Viele der hier gezeigten Arten sind nicht häufig, ungewöhnlich oder sogar selten. Darüber hinaus runden einige Fotos von Originalhabitaten und Aquarienaufnahmen das Werk ab. Am Rande wurde auch zu einigen aktuellen Umweltproblematiken Stellung genommen, welche in herkömmlichen Werken über diese Materie leider meist nicht erwähnt werden. Ein sehr informatives Buch, welches gleichzeitig zum Nachdenken und Aktivwerden anregen soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einführung
Zwar trägt dieses Werk den Titel „Handbuch für den Muschelsammler“, doch soll es nicht nur irgendwelche toten Molluskenschalen illustrieren. Diese Intention lag bei der Erstellung dieses Buches nicht vor. Vielmehr wollte ich die großartige biologische Diversität mariner Schalen aus allen Weltmeeren zeigen, was sowohl tropische Arten als auch Spezies der Kaltwasserzonen einschließt. Dabei habe ich als Grundlage das WORLD REGISTER OF MARINE SPECIES (WORMS) herangezogen, welches eine internationale Plattform der Wissenschaft darstellt. Diese umfasst die derzeit gültigen wissenschaftlichen Namen und Systematiken unserer rezenten Meerestiere. Falls sich nach Veröffentlichung dieses Buches mal wieder der eine oder andere lateinische Gattungsname geändert hat, so bitte ich hierfür um etwas Nachsicht. Leider sind die Taxonomen ständig mit Revisionen beschäftigt, weshalb man die Vergabe der wissenschaftlichen Namen nicht als statisches Gebilde verstehen darf.
Wenn man sich so daran herantastet, Meerestiere besser kennen zu lernen, so entwickelt man schnell ein umfangreiches Wissen und Verständnis über die verschiedenen Arten, ihre Überlebensstrategien, ihre Art des Nahrungserwerbes und wie sich die Arten selbst gegen die vielen Räuber wehren und verteidigen. Und darin liegt ein viel größerer Gewinn als der bloße Besitz einer toten Schale eines verblichenen Lebewesens. Darüber hinaus habe ich dann und wann auch erwähnt, ob und wie verfügbare Arten in einem Meerwasseraquarium gehalten werden können. Und sehr viele dieser Erfahrungen sind meine eigenen, die ich auf diesem Wege gerne mit der stetig wachsenden Zahl der Meerwasseraquarianer teilen möchte. Denn lebende Seetiere in einem Aquarium zu beobachten bedeutet gleichzeitig die Chance, diese Tiere besser kennen und schätzen zu lernen, als wenn man tote Schalen sammelt. Und dies beinhaltet die Hoffnung, dass eine weltweite Gemeinschaft von naturbegeisterten Menschen wächst, welche beginnt, eine Lobby für diese interessanten Tiere zu bilden und deren Habitate zu schützen. Die allermeisten Arten sind inzwischen bedroht, weil die Menschheit immer stärker wächst und die Lebensbedingungen für Wildtiere sich stetig verschlechtern. So sagen uns diverse Experten ein bisher nicht dagewesenes Artensterben voraus, dem schätzungsweise 30-40% aller bisher bekannten Arten zum Opfer fallen könnten! Und dies „nur“ durch anthropogene Einflüsse. So wie Klimaveränderungen, Meeresverschmutzung und Überfischung, um nur die wichtigsten zu erwähnen. Darüber hinaus gibt es weitere Schalen von Seetieren, die für Sammler und Hobbybiologen interessant sind. Hierzu gehören unter anderem Armfüßer, Seeigel und Seesterne. Und weil eine wachsende Anzahl von Sammlern sich neuerdings auch diesen Feldern zugewandt hat, habe ich einige dieser interessanten Tiere in den Kontext dieses Werkes integriert. Das Internet bietet uns die großartige Chance, internationale Netzwerke zu gründen und zu unterstützen, um uns für die (leider!) breitflächig schwindende Fauna des einen Weltmeeres gemeinsam mit vielen Stimmen und Unterstützern einzusetzen. Zugunsten einer offensichtlich in vielerlei Hinsicht geschädigten Umwelt, deren Geschöpfe bisher ungehört von der Masse der Menschen jeden Tag nach Erlösung schreien…
Sven Erik Gehrmann, im Frühjahr 2020.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Hinweise:
Das wissenschaftliche System der Mollusken (stark vereinfacht)
Klassifizierung einer Molluske
Historische Muschelschalen
Wie man Muschelschalen in Szene setzt
Die Muschelsammlung
Marine Habitate
Mangrovengürtel
Seegraswiesen
Lagunen
Felsenküsten
Korallenriffe
Wracks
Muschelbänke
Offener Ozean
Die Gemeine Müllbank
Stamm Mollusca - Weichtiere:
Klasse
Polyplacophora
- Käferschnecken
Superfamilie
Chitonoidea
Klasse
Scaphopoda -
Zahnschnecken
Zahnschnecken -
Dentaliidae
Klasse
Gastropoda
– Schnecken
Kugelschnecken -
Akeridae
Seehasen -
Aplysiidae
Sonnenradschnecken –
Architectonicidae
Klinkhörner & Wellhornschnecken – Superfamilie
Buccinoidea
Familie
Buccinidae
Familie
Colubrariidae
Familie
Columbellidae
Familie
Fasciolariidae
Familie
Melongenidae
Familie
Pisaniidae
Blasenschnecken -
Bullidae
Pantoffelschnecken -
Calyptraeidae
Wurm-, Turm- und Hornschnecken - Superfamilie
Cerithioidea
Hornschnecken –
Cerithiidae
Schlammhornschnecken –
Potamididae
Schlitzwurmschnecken –
Siliquariidae
Turm-, Schrauben- und Wurmschnecken –
Turritellidae
Superfamilie
Conoidea
– Kegelschnecken, Schraubenschnecken, Turriden etc.
Kegelschnecken
- Conidae
Weitere Turridenschnecken -
Raphitomidae
Schraubenschnecken -
Terebridae
Kanopenkrüge -
Cylichnidae
Turridenschnecken -
Turridae
Kauris –
Cypraeidae
Wendeltreppen -
Epitoniidae
Kaffeebohnen -
Ellobiidae
Feigenschnecken -
Ficidae
Wattschnecken -
Hydrobiidae
Floßschnecken –
Janthinidae
Schlitzschnecken -
Fissurellidae
Seeohren oder Abalonen -
Haliotidae
Strandschnecken -
Littorinidae
Felsenschnecken – Superfamilie
Muricoidea
Babylonschnecken -
Babyloniidae
Gerippte Mitraschnecken -
Costellariidae
Harfenschnecken -
Harpidae
Randschnecken -
Marginellidae
Mitraschnecken -
Mitridae
Felsen- oder Stachelschnecken -
Muricidae
Unterfamilie
Ergalataxinae
Unterfamilie
Coralliophilinae
- Korallenschnecken
Unterfamilie
Muricinae
Unterfamilie
Muricopsinae
Unterfamilie
Rapaninae
– Igelschnecken und andere
Unterfamilie
Ocenebrinae
Lampen- & Vasenschnecken -
Turbinellidae
Faltenschnecken -
Volutidae
Unterfamilie
Amoriinae
Unterfamilie Athletinae
Unterfamilie
Volutinae
Netzreusenschnecken -
Nassariidae
Mond- oder Nabelschnecken -
Naticidae
Superfamilie
Lottioidea
– Schildkrötennapfschnecken –
Lottiidae
Nixenschnecken -
Neritidae
Olivenschnecken -
Olividae
Schlitzschnecken -
Pleurotomariidae
Weberschiffchen & Eischnecken -
Ovulidae
Superfamilie
Patelloidea
- Echte Napfschnecken
- Patellidae
Kerfen -
Triviidae
Flügelschnecken und Teufelskrallen – Superfamilie
Stromboidea
Flügelschnecken aus Atlantik und Mittelmeer -
Aporrhaiidae
Geschossflügelschnecken -
Seraphsidae
Tibiaschnecken
- Rostellariidae
Flügelschnecken und Teufelskrallen -
Strombidae
Tonnenschneckenartige –
Tonnoidea
Froschschnecken –
Bursidae
Helmschnecken –
Cassidae
Tritonshörner –
Charoniidae
Behaarte Tritonshörner –
Cymatiidae
Tonnenschnecken -
Tonnidae
Superfamilie –
Trochoidea -
Kreiselschneckenartige
Delphinchen –
Angariidae
Kreiselschnecken –
Calliostomatidae
Kreiselschnecken –
Tegulidae
Kreiselschnecken –
Trochidae
Turbanschnecken -
Turbinidae
Schirmmützenschnecken –
Umbraculidae
Wurmschnecken -
Vermetidae
Trägerschnecken -
Xenophoridae
Klasse
Bivalvia
, Muscheln
Sattelmuscheln -
Anomiidae
Archenmuscheln -
Arcidae
Islandmuscheln -
Arcticidae
Astarte Muscheln -
Astartidae
Herzmuscheln -
Cardiidae
Unterfamilie
Cardiinae
Unterfamilie
Fraginae
Unterfamilie
Lymnocardiinae
Unterfamilie
Laevicardiinae
Unterfamilie
Orthocardiinae
Unterfamilie
Trachycardiinae
Unterfamilie
Tridacninae -
Riesenmuscheln
Juwelenkästchen -
Chamidae
Trapezmuscheln -
Carditidae
Gebogene Archenmuscheln -
Cucullaeidae
Samtmuscheln -
Glycymerididae
Felsenbohrer –
Hiatellidae
Zungenmuscheln –
Glossidae
Zackenaustern -
Gryphaeidae
Mangrovenaustern -
Isognomonidae
Hammeraustern -
Malleidae
Feilenmuscheln -
Limidae
Mondmuscheln -
Lucinidae
Unterfamilie
Fimbriinae
– Körbchenmondmuscheln
Superfamilie
Mactroidea
– Korbmuscheln
Korbmuscheln –
Mactridae
Schnabelmuscheln -
Nuculanidae
Sandklaffmuscheln -
Myidae
Miesmuscheln -
Mytilidae
Austern -
Ostreidae
Büchsenmuscheln –
Pandoridae
Kammmuscheln -
Pectinidae
Steckmuscheln -
Pinnidae
Sattelaustern -
Placunidae
Perlaustern -
Pteriidae
Superfamilie
Solenoidea
– Rasiermesser- & Scheidenmuscheln
Rasiermessermuscheln –
Pharidae
Scheidenmuscheln -
Solenidae
Stachelaustern -
Spondylidae
Echte Bohrmuscheln -
Pholadidae
Superfamilie
Tellinoidea
- Sägezähne, Pfeffermuscheln, Sandmuscheln, Tellmuscheln und andere
Pfeffermuscheln -
Semelidae
Sandmuscheln -
Psammobiidae
Tellmuscheln -
Tellinidae
Superfamilie
Veneroidea
– Venusmuscheln
Falsche Bohrmuscheln – Unterfamilie
Petricolinae
Venusmuscheln -
Veneridae
Bohnenmuscheln -
Thraciidae
Klasse
Cephalopoda
, Kopffüßer
Zehnarmige Kopffüßer – Superordnung
Decapodiformes
Präparation eines Kopffüßers
Posthörnchen-
Spirulidae
Perlboote -
Nautiloida
Papierboote -
Argonautidae
Landschnecken
Landschnecken aus Europa
Tropische Landschnecken
Süß- und Brackwasserschnecken
Tropische Schnecken aus dem Süßwasser
Nixenschnecken des tropischen Brack- und Süßwassers
Europäische Süßwasserschnecken
Süßwassermuscheln
Süßwassermuscheln aus Eurasien
Muscheln aus Südostasien für die Aquaristik
Muscheln aus Südostasien der Schmuckindustrie
Tiere aus anderen Stämmen, die nicht zu den Weichtieren gehören
Stamm
Brachiopoda
, Armfüßer
Stamm
Echinodermata
, Stachelhäuter:
Seeigel -
Echinoidea
Seesterne –
Asteroidea
Abschließende Hinweise:
Danksagungen
Literatur und Quellen
Warum die moderne Meerwasseraquaristik einen echten Beitrag zum Umweltschutz leisten kann
Ein Aquarium für Schnecken aus dem Mittelmeer
Epilog, Frühjahr 2020
Index der wissenschaftlichen Namen
Das wissenschaftliche System der Mollusken (stark vereinfacht)
Benötigen Muschelsammler und Hobbyisten überhaupt wissenschaftliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Mollusken? Natürlich nicht, würden wohl die meisten Leute sagen. Aber auf der anderen Seite ist es eine profane Tatsache, dass insbesondere die Mollusken meist unter ihrem wissenschaftlichen Namen gehandelt werden. So ist es also doch geboten, zumindest den wissenschaftlichen Namen einer Muschel zu kennen, um Missverständnissen vorzubeugen. Der große Vorteil liegt darin, dass alle Muschelsammler aller Länder eine einzige gemeinsame wissenschaftliche Sprache benutzen: Latein. So ist es überhaupt kein Problem mehr, Muschelschalen zu bestellen oder anzubieten, auch wenn man diese von der anderen Seite des Globus bestellt. Das habe ich selbst ausprobiert! So bestellte ich mir Muscheln aus Neukaledonien (einer Inselgruppe bei Australien mit der Hauptstadt Noumea), die mir dann nach Hannover in Deutschland geschickt wurden. Hierfür eignen sich besonders Internet-Netzwerke wie etwa das Liebhabernetz delcampe.net, wo Käufer und Verkäufer ständig bewertet und überwacht werden. Hier kann man bei entsprechend guter Beurteilung auch sehr hochpreisige Stücke ohne Risiko einkaufen. Wenn alle Beteiligten das gleiche Grundwissen hätten, so könnten also auch alle von dem wissenschaftlichen System profitieren. Und das scheint in der Tat auch die Grundidee der ersten Wissenschaftler wie etwa Linne`, Lammarck, Leach oder Montague gewesen zu sein, die dieses System anwendeten. Heutzutage könnte theoretisch jeder eine neue Art beschreiben, sofern er die dafür vorgeschriebenen Regeln beachtet. Hierfür ist es noch nicht einmal nötig, Biologie studiert zu haben. In den letzten Jahrzehnten wurden so etliche neue Arten auch von wissenschaftlichen Laien beschrieben – also was hindert Sie daran? Das Einzige was man dafür benötigt, sind ein paar Grundkenntnisse in der Taxonomie und der Anatomie der beschriebenen Art. Mit Hilfe von Universitäten kann man sich auch Beschreibungen ähnlicher Arten beschaffen und sich daran entlang hangeln. Dann sollte man die Arbeit noch von einer wissenschaftlichen Fachkraft prüfen lassen, bevor man sie dann in einem entsprechenden Journal publiziert. Sofern es zu der neuen Art schon eine Gattung gibt, sollte man diese dann auch übernehmen, um späteren Revisionen vorzubeugen. Der Artname einer neuen Art kann dagegen frei gewählt werden, sollte jedoch möglichst latinisiert werden und vor allem sinnvoll sein. Gut gewählte lateinische Namen können oft schon eine kleine prägnante Beschreibung der Art liefern, in dem sie wesentliche Eigenschaften der Art komprimiert darstellen. Trägt eine Art etwa den Namen „ruber“, dann weiß man schon, dass sie rot gefärbt ist. Oder heißt sie gar „cornutus“, dann weiß man, dass es sich um eine Art mit Hörnern handelt. Man kann Artnamen aber auch zu Ehren anderer vergeben, indem man deren Nach- oder Vornamen latinisiert. So entstehen dann Namen wie etwa „muelleri“, „weinkauffi“ etc.. Der Nachteil dieser Benennungsmethode besteht jedoch darin, dass ein so vergebener Name leider kaum noch etwas über das beschriebene Lebewesen und dessen Merkmale aussagt. Deshalb sollte eigentlich besser immer das beschriebene Subjekt im Fokus sein.
Klassifizierung einer Molluske
Nachfolgend sei ein Beispiel aufgeführt, wie ein Weichtier in den wissenschaftlichen „Baum“ der Taxonomie einsortiert werden kann. Dieser „Baum“ sollte jedoch besser als eine Kette verstanden werden, denn das griechische Wort Taxon (Plural Taxa) bedeutet wörtlich übersetzt „Glied einer Kette“. Um diesen Sachverhalt näher zu beleuchten, wurde hier die Herkuleskeule Bolinus brandaris, eine häufige Purpurschnecke des Mittelmeeres, mitsamt der taxonomischen „Kette“ dargestellt:
Klassifikation:Biota (Lebewesens)
Königreich:Animalia (Tiere)
Stamm:Mollusca (Weichtiere)
Klasse:Gastropoda (Schnecken;
Unterklasse:Caenogastropoda
(Schnecken mit Gehäuse)
Ordnung:Neogastropoda (Neue Schnecken)
Superfamilie:Muricoidea (Felsenschnecken und andere)
Familie:Muricidae (Felsenschnecken)
Unterfamilie:Muricinae (Echte Felsenschnecken)
Gattung:Bolinus (Purpurschnecken)
Art:brandaris (Herkuleskeule)
Während der letzten Jahrzehnte wurde das taxonomische System stark revidiert. Dabei wurden immer mehr Teile in die taxonomische Gliederung eingefügt. So wurde die ursprüngliche Materie leider immer komplizierter und intransparent. Es mag sein, dass sich die Taxonomen lediglich als die „wahren“ Experten etablieren wollten, es kann aber auch durchaus zutreffen, dass einige Ergänzungen sinnvoll waren, um verschiedene Familien und Arten besser voneinander abgrenzen zu können. Es bleibt zu hoffen, dass sich hier langfristig eine objektive Wahrheit durchsetzen wird.
Historische Muschelschalen
Dieses Bild zeigt eine Skulptur aus den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Dabei handelt es sich um Aphrodite, die griechische Göttin der weiblichen Schönheit.
Bacchus, der Gott des Weines und des Müßigganges.
Die Geburt der Venus, Sandro Botticelli, gemalt anno 1485/1486.
Seite → ganz und Vorseite, oben:
Statuen und Muscheln
Während des 16. und des 17. Jahrhunderts wurden die Schalen tropischer Muscheln aus der Karibik und dem Indischen Ozean bei der adligen Oberschicht in Europa populär. Solche Schalen wurden gerne in Gärten und Gebäude integriert und bedeuteten ein Statussymbol. Zu dieser Zeit waren solche Schalen extrem teuer und waren für die nichtadlige Bevölkerung meist unerschwinglich. Die hier gezeigten mit Muscheln geschmückten Mauern zeigten das Kunstverständnis der Könige und Königinnen von Hannover in Deutschland, welche mit der königlichen Familie in England verwandt waren und für einige Jahre sogar beiden Königreichen gleichzeitig vorstanden. Hätte diese politische Union nur einige Jahrzehnte länger bestanden, so wären Europa möglicherweise einige sinnlose Kriege erspart geblieben. Die Aufnahmen zeigen typische Gebäude der Rokoko-Ära aus den Herrenhäuser Gärten in Hannover, der Hauptstadt Niedersachsens. Nach dem 2. Weltkrieg wurden diese historischen Gebäude wiederhergestellt und renoviert, da die meisten von ihnen den alliierten Bomben zum Opfer fielen. Alle paar Jahre müssen die dort eingearbeiteten Muscheln ebenfalls erneuert werden, weil insbesondere ihre Farben unter dem Einfluss von saurem Regen und den ultravioletten Anteilen des Sonnenlichtes unweigerlich ausbleichen. So kann man hier gut sehen, dass die Schale rechts oben im Bild ein neueres Exemplar ist, während die anderen bereits etwas älter sind. Das Arrangement selbst stellt den griechischen Gott Bacchus dar, der bekannt war als der Gott des Luxus und des Weines.
Vorseite, unten:
Die Geburt der Venus
Dieses großartige Gemälde malte Sandro Botticelli für Lorenzo de Medici, der einst einer der größten Kunstmäzene seiner Epoche war. In Wahrheit zeigt das Bild nicht die Geburt der Venus, sondern vielmehr die Ankunft der neuen Göttin auf der griechischen Insel Cythera.
Im Gegensatz zur Darstellung der Göttin als nackter Schönheit wurde die Venus jedoch nicht als antikes Sexsymbol verstanden. Vielmehr galt die Göttin als ein Symbol für einen reinen Verstand und für Weisheit.
Die Bekleidung der anderen Personen rund um die Göttin ist typisch für die Renaissance. Zum Glück für die Nachwelt entging dieses Werk den Bilderverbrennungen der Reformationszeit.
Während denen diverse großartige Kunstwerke öffentlich wegen religiösem Fanatismus verbrannt wurden, weil man sie für obszön hielt. Dieses geschah insbesondere in Florenz, wo der Mönch Savanarola ein unerbittliches religiöses Regiment führte, um göttliche Strafen abzuwenden. Noch heute kann das Originalgemälde in den Uffizien von Florenz in Italien bestaunt werden. Die gemalte überdimensionierte Muschel ist sehr typisch für die mediterrane Meeresfauna. Es handelt sich dabei um die Große Pilgermuschel Pecten maximus, welche außerdem eine hervorragende Delikatesse ist. Ergänzend dazu sei angemerkt, dass die Muschel ihren Namen der Tatsache verdankt, dass tatsächlich Pilgerreisende die leeren Schalen verwendeten, um zu betteln oder um sie als leicht tragbares Essgeschirr zu verwenden. Diese Schalen waren sehr praktisch, da sie leicht waren und schnell unter dem Gewand verstaut werden konnten.
Wie man Muschelschalen in Szene setzt
Selbstverständlich wäre es die beste Aufbewahrungsmethode für Molluskenschalen, wenn man diese in geschlossenen Schränken lagern würde, um ihre Farben vor den ultravioletten Anteilen des Sonnenlichtes zu schützen. Das würde allerdings auch bedeuten, dass man die Sammlung nicht vor Augen hat. Diese „korrekte“ Art der Aufbewahrung würde daher die gleiche Langeweile wie das Sammeln von Briefmarken bedeuten! Daher könnte es ein guter Kompromiss sein, Teile der Sammlung in einem Vitrinen Schrank auszustellen. Eine Prämisse dafür ist es jedoch, dass direktes Sonnenlicht vermieden wird, welches die Farben der Schalen ausbleicht. Die Schalen selbst kann man mit Elementen wie kleinen Steinen, anderen Seetieren oder auch künstlichen Dekorationen kombinieren. In dem hier gezeigten Vitrinen Schrank wurden künstliche Steine und Korallen verwendet, um ein fiktives marines Habitat darzustellen – hier eine Felsenküste. Selbstverständlich wäre echter Sand eines Strandes ein gutes Element, um die Schalen von Muscheln zu präsentieren, die sich darin eingraben. Für die Darstellung weiterer Arten des Meeresgrundes eignen sich auch Kies und Schill (Bruchstücke kleiner Muschelschalen). Die richtige Mischung aus echten und künstlichen Bestandteilen kann dem Betrachter einen gewissen Überrealismus vermitteln, so dass im besten Falle ein Kind fragen würde, ob die ausgestellten Seetiere noch leben!
Die Muschelsammlung
Möchte man kleine und zerbrechliche Schalen dauerhaft aufheben, so sollte man diese in kleinen Plastikkisten aufbewahren, um sie vor Zerbruch, Staub und Sonnenlicht zu schützen, welches ihre Farben zerstören könnte. Diese Muschelkistchen sollte man in Ordnern oder in geschlossenen Schränken aufbewahren. Einzelne Schalen sollten zunächst bestimmt werden und dann mit kleinen Zetteln versehen werden, welche den lateinischen Namen, den Fundort oder andere wichtige Details beinhalten. Große Muschelgläser oder Setzer Kästen mögen zwar auf den ersten Blick dekorativ erscheinen, aber speziell zerbrechliche dünne Schalen sind hier nicht gut aufgehoben. Außerdem können den Schalen so Staub und Sonnenlicht zusetzen und sie schnell unansehnlich werden lassen. Außerdem können sie aus einem offenen Setzer-Kasten auch herausfallen und zerbrechen. Das Beste wäre es, wenn man die Schalen im Setzer-Kasten durch eine davor angebrachte Scheibe aus Glas oder Plexiglas sichern würde. Das würde die Schalen tatsächlich vor Bruch und Staub schützen, doch dürfen sie trotzdem niemals direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Darüber hinaus könnte man den Setzer-Kasten auch einfach in einem geschlossenen Schrank unterbringen. Die Schalen ihrerseits sollte man nach Familien oder Herkunft sortieren, was ebenfalls ein ästhetisches Element für die Sammlung sein könnte.
Kegelschnecken (Conidae) in einem Setzer-Kasten. So präsentiert bleichen sie entweder durch das Sonnenlicht aus oder sie könnten sogar herausfallen… Allerdings sind solche Kästen immer ein sehr dekoratives Element bei der Innenraumgestaltung.
Diese Plastikboxen können in Schränken oder Aktenordnern aufgehoben werden. Eine sehr effektive Methode, um insbesondere schmale, dünne und leicht zerbrechliche Schalen zu schützen und übersichtlich sortiert aufzubewahren.
Solche Muschelgläser sind eine sehr unsichere Aufbewahrungsmethode für Muschelschalen, insbesondere für die dünnen und leicht zerbrechlichen Schalen…
Marine Habitate
Muscheln und die Überreste von Meerestieren kann man an den verschiedensten Orten und unter diversen Umständen entdecken. Nachstehend seien daher einige Lebensräume in Kurzform vorgestellt. Einige Meerestiere benötigen das ganze Jahr über möglichst gleiche Lebensbedingungen, die sich kaum verändern. Andere wiederum haben sich an den Gezeitenwechsel, schwankende Salinitäten und Temperaturen und weitere Lebensbedingungen angepasst. Einige Organismen vertrauen ihrer Tarnung, während andere leuchtende Farben besitzen, um ihre Feinde von ihrer Ungenießbarkeit oder Giftigkeit zu überzeugen. Auf den folgenden Seiten werden daher einige marine Habitate vorgestellt, damit man einen Eindruck davon bekommt, welche Umstände und Naturgewalten auf die Bewohner dieser Lebensräume einwirken.
Mangrovengürtel
Die tropischen Mangrovengürtel könnte man auch als eine Pufferzone zwischen Meer und Land beschreiben. Mangroven sind Bäume, die verschiedene Salinitäten, Schlamm, Stürme, Hitze, Sturmfluten und einen hohen Grad an ultravioletten Strahlungsanteilen des Sonnenlichtes tolerieren können. Indem sie Stecklinge in die schlammigen Areale um sich herum verbreiten oder aus Kriechsprossen neue Triebe durch den Schlamm treiben, können sie sogar zur Landgewinnung beitragen. Und ihre starken Wurzeln können komplette Küstenabschnitte gegen tropische Wirbelstürme absichern. Die Vernichtung von Mangrovenwäldern – insbesondere für die Anlage von Garnelenfarmen – bedeutet, einen wichtigen natürlichen Schutzgürtel der tropischen Küsten zu zerstören. Mangrovenpflanzen in ein tropisches Riffaquarium zu integrieren ist eine gute Idee und dient der biologischen Wasseraufbereitung. Denn über ihre Wurzel entnehmen die Mangroven dem Aquariensystem Nitrate und Phosphate, welche sie gleichzeitig als Dünger für ihr eigenes Wachstum nutzen. Wenn man die Wurzeln jedoch nicht im Aquarium zu Gesicht bekommen möchte, dann sollte man die Mangroven in einem dem Wasserkreislauf des Aquariums angeschlossenen und gut beleuchteten Filterbecken anbringen. Unter natürlichen Bedingungen dienen Mangrovenwurzeln vielen Fischarten als Brutgebiete. Während der Flut versuchen dann auch größere Raubfische wie Haie und Tarpons zwischen den Mangroven Beute zu finden, doch sorgen auch sie zwischen den undurchdringlichen Wurzelgeflechten für den eigenen Nachwuchs. Die tropischen Mangrovengürtel bieten Winker- und Mangrovenkrabben, Schwimmkrabben, Austern, Schnecken, Weichkorallen, Einsiedlerkrebsen, Quallen und vielen anderen Wirbellosen Schutz- und Rückzugsräume. Sie schützen ihre Bewohner vor Stürmen und brechen die gewaltigen Kräfte der Wellen. Alle Organismen, die sich hier aufhalten, haben ebenfalls einen starken Einfluss auf die Mangroven, denn sie produzieren Detritus, von dessen Abbauprodukten sich die Mangroven ernähren. Darüber hinaus leben in den Mangrovenwäldern auch viele verschiedene Vogelarten, die ohne Mangroven sonst nicht an den Küsten leben könnten.
Seegraswiesen
Seegraswiesen gibt es sowohl in gemäßigten Klimazonen als auch in den Tropen und Subtropen. Seegräser sind hochentwickelte Blütenpflanzen und sind nicht mit den Seetangen und Algen verwandt. Seegräser verankern sich mit ihren starken Wurzeln, den so genannten Rhizomen, vor allem in schlammigen Böden und nutzen so die vielen darin gespeicherten Nährstoffe. Das bedeutet aber auch, dass Seegräser von der organischen Überdüngung der Küstenzonen durch menschliche Einflüsse stark profitieren. So hat das Seegras etwa an den einst korallenriffreichen Küsten Kenias die Riffe mittlerweile fast vollständig ersetzt, was auch die biologische Vielfalt zerstörte. Auf der anderen Seite bieten Seegraswiesen einer ganz eigenen Fauna Zuflucht, wie etwa Krabben, Garnelen, Schnecken, Seenadeln und Seepferdchen und etlichen mehr. Hier kann man nur wenige spezialisierte Weichtiere aufspüren, wie insbesondere einige Arten der Nixenschnecken, der Wattschnecken oder einige Muschelarten, die sich gerne zwischen den Rhizomen des Seegrases ansiedeln. Manchmal kann man hier auch Kopffüßer wie etwa den Tintenfisch entdecken, die hier auf kleine Fische und Krebse lauern oder die hier ihrem Brutgeschäft nachgehen. An einigen Küsten – wie etwa den deutschen Küsten der Nordsee – wurden die ehemals großen Seegrasbestände durch menschliche Einflüsse bereits während der 1930er Jahre nachhaltig zerstört. Dabei zerstörte ein Virus die meisten Seegraspflanzen, die vorher so häufig gewesen waren, dass man mit ihren getrockneten Blättern Betten ausstopfte. Heutzutage findet man hier nur noch kleine Reliktbestände von Seegras, die leider nur einen winzigen Bruchteil der Ursprungsbestände darstellen.
Lagunen
Eine Lagune könnte man auch als einen marinen See beschreiben, der vom umgebenden Meer abgetrennt wurde. Außerdem können Lagunen auch zwischen Strand und dem oft vorgelagerten Saum Riff entstehen, so dass stetig neue Tiere aus dem Meer durch den Einfluss von Gezeiten oder Sturmfluten in diese Zone eindringen. Die Lagunen selbst sind meist recht flache Areale mit sandigen oder schlammigen Böden, die nicht eben vielen Tieren Deckungsmöglichkeiten bieten (mit der Ausnahme von Stellen mit Seegrasbewuchs). Weil Seevögel hier besonders leicht Beute machen können, müssen die hier lebenden Tiere erfolgreiche Überlebensstrategien vorweisen können. So haben etwa die Spinnenschnecken der Gattung Lambis lange Dornen und besonders dicke Schalen. Und wenn man sie umdreht, verteidigen sie sich energisch mit ihrem scharfen und sichelförmigen Deckel, mit dem sie sich außerdem auch schnell wieder umdrehen können. Andere Mollusken setzen lieber auf Masse, statt auf Klasse. Sie treten in ungeheuren Mengen auf und produzieren Millionen von Jungtieren, um die Verluste durch Fressfeinde auszugleichen. Während wieder andere Arten versuchen, sich durch Eingraben in das Substrat ihren Feinden zu entziehen. Die meisten dieser Arten Leben von Diatomeen, organischen Abfällen oder Aas jeglicher Art, während nur wenige Arten räuberisch veranlagt sind. Da während der letzten Dekaden die wachsenden Bevölkerungen in den tropischen Küstengebieten überhandgenommen haben, sind die Lagunen besonders bedrohte Refugien geworden, da sie meist leicht zugänglich sind und ohne Probleme von den Anwohnern ausgebeutet und verschmutzt werden können.
Felsenküsten
Es gibt sehr verschiedene Arten felsiger Küsten. Dabei gibt es Felsen aus Kalkgesteinen, Gesteinen vulkanischen Ursprunges oder aus Sandstein. Felsen findet man oft in sehr exponierten Lagen, und es gibt zahlreiche verschiedene Meeresorganismen, die sich daran angepasst haben, auch diese Siedlungsräume für sich zu erschließen. Schnecken und Muscheln, die sich daran adaptiert haben, können der Kraft der anbrandenden Wellen, starken Strömungen und vielen Räubern standhalten. Einige sind dazu in der Lage, die kleinsten Spalten und Ritzen für sich zu nutzen, während andere sind auf den Felsen festsaugen, sich mit Byssusfäden anheften, oder sich sogar selbst Löcher in den Felsen ätzen oder bohren können. Auf den Schalen der hier lebenden Mollusken wiederum siedeln sich dann oft Algen oder andere Wirbellose an. So kann man hier häufig Seepocken, Röhrenwürmer, Bryozoen und andere interessante Tiere auffinden. Insbesondere Einsiedlerkrebse findet man an Felsküsten oft in großen Mengen, weil sie von den leeren Gehäusen abgestorbener Schnecken profitieren. Diese Krebse wiederum sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Fische, wie etwa Lippfische. Und so ist dieses Habitat ein reich gedeckter Tisch für viele verschiedene Meerestiere. Darüber hinaus jagen auch größere Mollusken wie etwa Oktopus und Tintenfisch gerne in diesem Biotop, wobei sie dazu in der Lage sind, die unebenen Oberflächenstrukturen der Felsen mit ihren Körpern zu imitieren. Muschelsammler können an Felsenküsten eine große Vielfalt an Molluskenschalen und Seeigeln finden, insbesondere während der Ebbe in den vielen kleinen Gezeitentümpeln.
Eine typische Felsenbucht auf der Insel Rhodos, welche starke plattentektonische Verwerfungen des Bodens und starke Erosionskräfte des Meeres sichtbar werden lässt
Korallenriffe
Tropische Korallenriffe werden von den winzigen Polypen der Steinkorallen erschaffen. Diese Polypen sind zwar nur wenige Millimeter groß, doch haben sie trotzdem das größte Bauwerk des Tierreiches erschaffen, nämlich das Große Barriere Riff vor Australiens Küsten. Korallenriffe sind sehr komplexe Ökosysteme, in denen die kleinsten Organismen oft die größte Wichtigkeit für das gesamte System haben. So leben zum Beispiel die meisten Korallen in Symbiose mit mikroskopisch kleinen Algen, den so genannten Zooxanthellen, die als Symbiosepartner im Gewebe der Koralle leben. Diese produzieren für die Koralle Nährstoffe und Sauerstoff und unterstützen so das Wachstum der Korallenkolonien. Darüber hinaus sind diese Symbiosebeziehungen auch von Riesenmuscheln und einigen Stachelhäutern bekannt. Dieses könnte ein perfektes System sein, wenn nicht der Mensch dasselbige durch Meeresverschmutzung, Raubbau an den Riffen und die Folgen der menschgemachten Klimaerwärmung gefährden würde. Insbesondere die übermäßige Erwärmung des Seewassers bedeutet eine sehr ernste Bedrohung für ganze Riffe, weil die Korallen bei einer zu langanhaltenden hohen Temperatur gezwungen sind, ihre Zooxanthellen abzustoßen. Denn sie müssen sich dann zwischen zwei Übeln entscheiden: Behalten sie ihre Zooxanthellen, dann produzieren diese zu viel Sauerstoff und vergiften die Korallen. Stoßen sie jedoch alle Zooxanthellen ab, so sind sie ohne diese nicht mehr lebensfähig, bleichen schließlich aus und verenden dann am so genannten „Coral-Bleaching“. So können innerhalb kurzer Zeiträume komplette Ökosysteme zugrunde gehen, denn ohne Korallen verschwinden auch die Fische und eine Ödnis aus kahlen Korallenskeletten bleibt zurück. Dieses Phänomen konnte weltweit beobachtet werden, wenn die Wassertemperatur länger als einen Monat mehr als 30° Celsius betrug. Wenn Sie es schaffen, die Benutzung eines Autos oder eine Flugreise zu vermeiden, dann können Sie auf diesem Wege auch einen kleinen Beitrag zum Schutz tropischer Riffe leisten! Korallenriffe bieten einer großen Vielfalt von Algen, Wirbellosen und Fischen eine Heimat. Alles gehört durch diverse Vernetzungen zusammen, und wir sind dazu herausgefordert, dieses empfindliche Ökosystem möglichst nicht zu stören.
Wracks
Wracks bieten hervorragende künstliche Siedlungsflächen für zahlreiche Wirbellose. Insbesondere an Stellen des Meeresbodens, wo sonst Sand oder Schlamm eine Besiedlung unmöglich machen würden. Viele Wracks – wie insbesondere auch die Wracks von Flugzeugen und Schiffen aus dem 2. Weltkrieg im indopazifischen Korallenmeer – wurden innerhalb weniger Jahrzehnte von so vielen Korallen und Wirbellosen besiedelt, dass man sie kaum noch als unnatürlichen Ursprungs erkennen kann. Im Gegensatz dazu steht die Tatsache, dass viele Wracks leider auch eine latente Gefahr für ihre neuen Bewohner sind, denn häufig enthalten sie Chemikalien, Öl, Giftstoffe aller Art oder Munitionsreste, die selbst nach Jahrzehnten unter Wasser immer noch scharf sind und jederzeit explodieren könnten. So können im Laufe der Zeit die hier gespeicherten Stoffe über die Wirbellosen Tiere in die marinen Nahrungsketten gelangen und so zurück zu den Menschen gelangen, die ihre Nahrung aus dem Meer fischen. Taucher lieben es, hier in die Geschichte oder die Biodiversität dieses Habitates einzutauchen. Doch sei es an dieser Stelle gesagt, dass Wracktauchen gefährlich und nicht für Anfänger geeignet ist. In Schiffswracks findet man oft Langusten, Hummer, Meeraale, Muränen, große Zackenbarsche, Kraken, große Dorschfische und andere Räuber, die sich hier ihre Wohnhöhlen erschließen. Heutzutage bestehen die meisten Schiffswracks aus Stahl, der nach einiger Zeit verrostet, und dadurch Wracks noch gefährlicher für Taucher macht, da Stahl auch brechen kann und dann scharfe Ecken und Grate aufweist. Daran kann man sich übel verletzen, was bei einem Tauchgang besonders unangenehm ist.