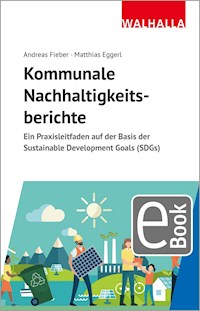33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Nachhaltigkeit ist in aller Munde - das Thema umfasst viele Dimensionen. Dieses Handbuch beinhaltet v.a. Ziele, Klimawandel und die Politikebene. Der Autor spannt in diesem Handbuch den Bogen von den begrifflichen Grundlagen über die wichtigsten weltweiten Vereinbarungen, einer entsprechenden Bestandsaufnahme und Prognosen zur Nachhaltigkeit bis hin zu den konkreten Maßnahmen für eine nachhaltige Welt. Hierbei werden die internationalen Maßnahmen (Vereinte Nationen und Europäische Union) als auch nationale Politik behandelt und bewertet. Das Buch schließt mit einem Ausblick in die ferne Zukunft. Der Autor zielt auf eine grundlegende Sensibilisierung für notwendige Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeit ab. Damit können künftige Generationen auf einer ökonomisch, ökologisch und sozial intakten Umwelt aufbauen. Das Handbuch richtet sich an Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und an Menschen, die nach Orientierung suchen. Sie werden mit diesem Buch umfassend über Geschichte, aktuelle Situation und Lösungen für nachhaltiges Leben und Wirtschaften informiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Fieber
Handbuch Nachhaltigkeit
Ziele, Klimawandel, Politik
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung: © Inimma-IS iStockphoto
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838562971
© UVK Verlag 2024— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6297
ISBN 978-3-8252-6297-6 (Print)
ISBN 978-3-8463-6297-6 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Die COVID-19-Pandemie (Corona) verursachte 2020 und 2021 weltweit mehr als zwei Jahre Ausnahmezustand (Corona-Lockdown). Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24.2.2022 herrscht in Europa ein offener Krieg. Die Bilder von menschlichem Leid und ökologischer Zerstörung in der Ukraine sind allgegenwärtig. Die Zahl der Flüchtlinge steigt weltweit unverändert an. Die Berichte über das Voranschreiten des Klimawandels und dessen Folgen werden immer alarmierender. Autoritäre Regime stehen im Konflikt mit den demokratisch regierten Ländern. Menschenrechte werden dem Machterhalt geopfert.
Trotz oder gerade wegen dieser überwiegend schlechten Nachrichten ist es wichtig, den Optimismus und die Motivation, voranzukommen und voranzugehen, nicht zu verlieren. Die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen durch die Menschheit ist kein unabänderliches Schicksal.
Eine negative und depressiv oder resignativ geprägte Stimmungslage verbessert weder die individuelle Situation noch den Zustand unseres Planeten.
Wenn wir negativ gestimmt sind und in Depressionen verfallen, wird sich der Zustand der Welt nicht verbessern. Dies gilt vor allem für das Thema Nachhaltigkeit mit den drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Im Bereich Ökologie handelt es sich um die wichtigste Herausforderung unserer Zeit. Es steht nicht mehr und nicht weniger als die Bewohnbarkeit des einzigen für die Menschheit geeigneten Planeten auf dem Spiel.
Intention dieses Buchs:
Das Buch bietet den Leserinnen und Lesern fundiertes Wissen zum Thema Nachhaltigkeit. Sie werden dadurch befähigt, die politischen Diskussionen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen fachkundig einzuordnen.
Weiterhin soll das Buch Neugier und Zuversicht auf Zukunft vermitteln.
Zielgruppe dieses Buchs:
Das Buch richtet sich an Personen, die am Erhalt unseres Planeten interessiert sind und einen eigenen positiven Beitrag leisten wollen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Sie reichen von der Anpassung des Geschäftsmodells für Unternehmen bis zu täglichen privaten Konsumentscheidungen. Daher ist das Buch für Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft genauso relevant wie für Bürgerinnen und Bürger.
Das Buch ist ebenso geeignet für Studierende zahlreicher Fächer. Sie finden hier sehr hilfreiche Anregungen zum Beispiel für Haus-, Bachelor- oder Masterarbeiten.
Inhalt dieses Buchs:
Teil A: Begriff Nachhaltigkeit: Darstellung der Geschichte der Nachhaltigkeit und eine Begriffsdefinition.
Teil B: Grundlegende weltweite Vereinbarungen: Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele und das Klimaabkommen von Paris werden erläutert.
Teil C: Bestandsaufnahme und Prognosen zur Nachhaltigkeit: Aktueller Stand der Umsetzung und Prognosen zur Zielerreichung der Nachhaltigkeitsziele
Teil D: Maßnahmen für eine nachhaltigere Welt: Auswahl der zahlreichen Maßnahmen, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und Deutschland für die Bewältigung der Herausforderungen realisiert worden sind.
Wichtiger Hinweis:
Der Redaktionsschluss war der 31. März 2024; lediglich beim EU-Lieferkettengesetz und dem EU-Nature Restoration Law (NRL) wurde der Stand bis zum 30. Juni 2024 eingearbeitet.
Danksagung:
Mein besonderer Dank gilt Heidrun Fieber für die kritische Durchsicht des Manuskripts und ihre wertvollen sowie aufmunternden Hinweise. Außerdem bedanke ich mich besonders bei Julia Bernhardt und Joline Siehr für Recherchearbeiten in den (Un)tiefen des Internets.
Schließlich bedanke ich mich bei Dr. Jürgen Schechler, der mir die Gelegenheit verschaffte, dieses Buch zu schreiben.
Pfaffing, im Juli 2024 Andreas Fieber
Abkürzungsverzeichnis
°C
Grad Celsius
Abb.
Abbildung
Abs.
Absatz
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AG
Aktiengesellschaft
AI
Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz, KI)
ANK
Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz
AR
Assessment Reports
AR6 SYR
Synthesebericht für den sechsten Sachstandsbericht
Art.
Artikel
AStV
Ausschuss der Ständigen Vertreter des Rats der Europäischen Union
AtG
Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz)
AVmEG
Altersvermögensergänzungsgesetz
AVmG
Altersvermögensgesetz
AWA
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse
Az.
Aktenzeichen
BAS
Bulletin of the Atomic Scientists (Berichtsblatt der Atomwissenschaftler)
BayKlimaG
Bayerisches Klimaschutzgesetz vom 23.11.2020 (GVBl. S. 598, 656, BayRS 2129-5-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2022 (GVBl. S. 704) geändert worden ist
BBNJAgreement
Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (UN-Hochseeschutzabkommen)
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
BEHG
Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz)
BGE
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH
Bio.
Billionen
BIP
siehe GDP
BKAmt
Bundeskanzleramt
BMEL
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BMJ
Bundesministerium der Justiz
BMUV
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
BMW AG
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMZ
Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit
BNK
Berichtsrahmen nachhaltige Kommune
BOGA
Beyond Oil and Gas Alliance
BremKEG
Bremisches Klimaschutz- und Energiegesetz vom 24. März 2015 (Brem.GBl. 2015, S. 124), zuletzt mehrfach geändert und §§ 2a, 4a und 6a neu eingefügt durch Gesetz vom 28. März 2023 (Brem.GBl. S. 313)
BUND
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
C2C
Cradle to Cradle („von Wiege zu Wiege“, „vom Ursprung zum Ursprung“)
CapEx
Capital Expenditures (Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter)
CAT
Climate action tracker
CBAM
Carbon Border Adjustment Mechanism (CO2-Grenzausgleichssystem)
CBD
Convention on Biological Diversity (Übereinkommen über die biologische Vielfalt, Biodiversitätskonvention)
CCS
Carbon Dioxide Capture and Storage
CHF
Schweizer Franken
CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen)
CMA
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (Treffen der Vertragsparteien des Pariser Abkommens)
CMP 11
11th Meeting of the Parties to the 1997 Kyoto Protocol (11. Treffen der Mitglieder des Kyoto-Protokolls von 1997)
CO2Äq
Kohlenstoffdioxid Äquivalente, CO2-Äquivalente (Carbon Dioxide equivalent, CO2e)
COP1
1. UN-Klimakonferenz in Berlin, Deutschland, 1995 (United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties)
COP3
3. UN-Klimakonferenz in Kyoto, Japan, 1997 (United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties)
COP15
15. UN-Klimakonferenz in Kyoto, Japan, Kopenhagen, Dänemark, 2009 (United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties)
COP16
16. UN-Klimakonferenz in Cancún, Mexiko, 2010 (United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties)
COP18
18. UN-Klimakonferenz in Doha, Katar, 2012 (United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties)
COP21
21. UN-Klimakonferenz in Paris, Frankreich, 2015 (United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties)
COP26
26. UN-Klimakonferenz in Glasgow, Vereinigtes Königreich, 2021 (United Nations Climate Change, Conference of the Parties)
COP27
27. UN-Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh, Ägypten, 2022 (United Nations Climate Change, Conference of the Parties)
COP28
28. UN-Klimakonferenz in, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 2023 (United Nations Climate Change, Conference of the Parties)
COP29
29. UN-Klimakonferenz geplant in, Aserbaidschan, 2024 (United Nations Climate Change, Conference of the Parties)
CORSIA
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
CS3D
siehe CSDDD
CSDDD
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937, Lieferkettengesetz)
CSR
Corporate Social Responsibility, siehe NFRD
CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive (Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen), RICHTLINIE (EU) 2022/2464 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen
CSR-RUG
Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz)
D
Deutschland
DEHSt
Deutsche Emissionshandelsstelle
DNK
Deutscher Nachhaltigkeitskodex
DNS
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
DNSH
Do No Significant Harm (Keinen nennenswerten Schaden anrichten)
DüngG
Düngegesetz
EBeV
Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2023 bis 2030 (Emissionsberichterstattungsverordnung 2030 - EBeV 2030)
E-Bike
Electric Bike (Elektrofahrrad)
EBIT
Earnings before Interest and Taxes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, operatives Ergebnis)
ECF
European Climate Foundation
EC
European Commission
EEG
Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
EESC
European Economic and Social Committee (Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss)
EFRAG
European Financial Reporting Advisory Group
EFTA
European Free Trade Association (Europäische Freihandelsassoziation)
EG
Europäische Gemeinschaft
EGMR
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
EK
Europäische Kommission
EKF
Energie- und Klimafonds
EMRK
Europäische Menschenrechtskonvention
EnEff-RL
Energieeffizienzrichtlinie
ERK
Expertenrat für Klimafragen
ESEF
European Single Electronic Format
ESG
Environmental, Social, Governance
ESR
Effort Sharing Regulation
ESRS
European Sustainability Reporting Standards
EStG
Einkommensteuergesetz
et al.
und andere
EU Tax-VO
EU Taxonomie-Verordnung: Verordnung (EU) 2020/852 des europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
EU
Europäische Union
EU-27
Europäische Union mit 27 Mitgliedsländern ab 2020, nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs
EU-30
EU-27 zuzüglich Norwegen, Island und Liechtenstein
EUA
European Union Allowance (Emissionsberechtigung)
EU-EHS
EU-Emissionshandelssystem (European Union Emissions Trading System, EU-ETS)
EU-ETS
siehe EU-EHS
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EU-Kommisson
Europäische Kommission
EUR
Euro
Eurostat
Statistical Office of the European Communities (Statistische Amt der Europäischen Union)
EUVR
EU Voluntary Review
EWG Bln
Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz vom 22. März 2016
EWKG
Gesetz zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein) vom 7. März 2017
EWPBG
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
EWSG
Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen)
FCKW
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
FDP
Freie Demokratische Partei
FfE
Forschungsstelle für Energiewirtschaft
FFF
Fridays for Future
F-Gase
fluorierte Gase
FNH
Forum Nachhaltige Holzenergie
G7
Gruppe der Sieben (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten)
GDP
Gross domestic product (Bruttoinlandsprodukt, BIP)
GEG
Gebäudeenergiegesetz
GFN
Global Footprint Network
gha
global hectar (globaler Hektar)
GHG
Greenhouse Gas (Treibhausgas)
GHS
Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GML
Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH
GRÜNE
Die Grünen – Die Grüne Alternative
GSDR
Global Sustainable Development Report (globaler Nachhaltigkeitsfortschrittsbericht)
Gt
Gigatonnen
GWh
Gigawatt pro Stunde
HKlimaG
Hessisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Hessisches Klimagesetz) vom 26. Januar 2023
HLPF
High-level Political Forum on Sustainable Development (Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige Entwicklung)
HmbKliSchG
Hamburgisches Gesetz zum Schutz des Klimas (Hamburgisches Klimaschutzgesetz) vom 20. Februar 2020
HPS
Home Power Solutions AG
i. V. m.
in Verbindung mit
i.V.m
in Verbindung mit
ICCM
International Conference on Chemicals Management (Internationale Konferenz zu Chemikalien-Management)
IEA
International Energy Agency
IESR
Institute for Essential Services Reform
IfD Allensbach
Institut für Demoskopie Allensbach
ILO
International Labour Organization (Internationale Arbeitsorganisation)
IMO
International Maritime Organization (Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen)
INC
Intergovernmental Negotiating Committee (Zwischenstaatlicher Verhandlungsausschuss)
IPBES
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystem-Dienstleistungen, auch als Weltbiodiversitätsrat oder Weltrat für Biologische Vielfalt bezeichnet)
IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen, Weltklimarat)
Iran
Islamische Republik Iran
ISIN
International Securities Identification Number (Internationale Wertpapierkennnummer)
ITAD
Thermische Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.
IUCN
International Union for Conservation of Nature (Internationale Union zur Bewahrung der Natur)
JRC
Joint Research Center
Kap.
Kapitel
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KI
siehe AI
KlG
Klima- und Innovationsgesetz
KlimaG BW
Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg vom 7.2.2023
Klimaschutzgesetz NRW
Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2021
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
KSG
Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.8.2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist
KTF
Klimatransformationsfonds
kWh
Kilowattstunde
LKSG
Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes (Landesklimaschutzgesetz) vom 19. August 2014
LkSG
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
LLDCs
Landlocked Developing Countries
LULUCF
Land Use, Land Use change and Forestry (Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft)
MAGICC
Model for the Assessment of Greenhouse Gas Induced Climate Change
MDGs
Millennium Development Goals
METS
Maritime Emissions Trading Scheme
Mio.
Millionen
MJ
Megajoules
Mrd.
Milliarden
Mt
Megatonnen (= Eine Million Tonnen)
Mtoe
Megaton of oil equivalent (Megatonne Öleinheit)
NABU
Naturschutzbund Deutschland e.V.
NDC
Nationally Determined Contributions
nEHS
nationales Emissionshandelssystem
NFRD
Non-Financial Reporting Directive, EU-Corporate-Social-Responsibility-Richtlinie, bgekürzt CSR-Richtlinie, RICHTLINIE 2014/95/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen
NGO
Non-governmental organization
NKlimaG
Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (Niedersächsisches Klimagesetz)
NOx
Stickstoffoxide
Nr.
Nummer
NRDC
Natural Resources Defense Council
NRL
Nature Restoration Law (Renaturierungsgesetz)
NRO
Nichtregierungsorganisationen
o. D.
ohne Datum
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
ÖVP
Österreichische Volkspartei
OffVO
Offenlegungsverordnung
OpEx
Operational Expenditures (Betriebsaufwand)
PET
Polyethylenterephthalat (thermoplastischer Kunststoff)
PIEs
Public Interest Entities
Pkw
Personenkraftwagen
PLP
Pippi Langstrumpf-Prinzip
PM
Particulate Matter (Feinstaub)
RCPs
Representative Concentration Pathways (Repräsentative Konzentrationspfade)
RL
Richtlinie
RNE
Rat für Nachhaltige Entwicklung
Russland
Russische Föderation
S.
Seite
SAICM
The Strategic Approach to International Chemicals Management (der Strategische Ansatz zum Internationalen Chemikalienmanagement)
SBI
Subsidiary Body for Implementation (Nebenorgan für die Umsetzung)
SBSTA
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (Nebenorgan für wissenschaftliche und technologische Beratung)
SDGs
Sustainable Development Goals (globale Nachhaltigkeitsziele)
SE
Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)
SFB
Sustainable Finance Beirat
SFDR
Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)
SKSG
Gesetz Nr. 2107 zum Klimaschutz im Saarland (Saarländisches Klimaschutzgesetz) vom 12. Juli 2023
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPM
Summary for Policymakers (Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung)
SSP
Shared Socioeconomic Pathways (gemeinsame sozioökonomische Entwicklungspfade)
StandAG
Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz)
SUV
Sport Utility Vehicles (Geländelimousinen oder Stadtgeländewagen)
SYR
Synthesebericht
Tab.
Tabelle
TEHG
Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz - TEHG)
ThürKlimaG
Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Thüringer Klimagesetz) vom 18. Dezember 2018
TWh
Terrawattstunde
u. a.
unter anderem
UN
United Nations (Vereinte Nationen)
UNCHE
United Nations Conference on the Human Environment (Umweltkonferenz der Vereinten Nationen
UNCLOS
United Nations Convention on the Law of the Sea (UN-Seerechtsübereinkommen, SRÜ)
UNDP
United Nations Development Programme (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen)
UNEA
UN Environment Assembly (Umweltversammlung der Vereinten Nationen)
UNEP
United Nations Environment Programme (Umweltprogramm der Vereinten Nationen)
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen)
UNGC
United Nations Global Compact (Global Compact der Vereinten Nationen)
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen)
Urt. v.
Urteil vom
USA
United States of America
USD
US-Dollar
V‑Dem Institute
Varieties of Democracy Institute, Universität Göteborg, Schweden
Vj.
Vierteljahr
VKU
Verband der Kommunalen Unternehmen
VLRs
Voluntary Local Reviews (Freiwillige lokale Fortschrittsberichte)
VNRs
Voluntary National Reviews (Freiwillige Nationale Fortschrittsberichte bzw. freiwilli-ge Staatenberichte)
VO
Verordnung
VZ BW
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
WCED
World Commission on Environment and Development (Weltkommission für Umwelt und Entwicklung)
WEF
World Economic Forum (Weltwirtschaftsforum)
WHO
World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
WMO
World Meteorological Organization (Weltorganisation für Meteorologie)
WpHG
Wertpapierhandelsgesetz
WSSD
World Summit on Sustainable Development (Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung)
WTO
World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
Prolog
Narrativ dieses Buches:
In der alltäglichen Berichterstattung überwiegen negative Nachrichten. Diese erregen mehr Aufmerksamkeit und lassen sich dadurch besser verkaufen als gute Nachrichten (siehe Kapitel 3 Positive Nachrichten versus Negativität):
„only bad news are good news“
Andererseits ist die weltweite Lage der Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen, gemessen an den Tatsachen, wirklich verbesserungsfähig.
Dazu kommt eine unglaubliche Informationsflut. Theoretisch befähigt diese den Teil der Weltbevölkerung, der Zugang zu einem unzensierten Internetanschluss hat, sich über jedes beliebige Thema fundiertes Wissen anzueignen. Oft genug sorgt jedoch die schiere Masse an Möglichkeiten, sich zu informieren für Verwirrung. Dies gilt insbesondere, wenn die Medien für Falschnachrichten (Desinformationen oder fake news) missbraucht werden.
Die größte Herausforderung beim Verfassen des vorliegenden Buches bestand entsprechend darin, die massenhaft verfügbaren Informationen einerseits auf ihre Richtigkeit hin zu bewerten und andererseits sie in ihrer Quintessenz zusammenzufassen.
Die unfassbare Menge an Quellen meist negativer Nachrichten resultiert oft in einer Reizüberflutung und erklärt die hohe Bedeutung von Narrativen (sinnstiftende Erzählungen) in unserer Zeit. Narrative fassen komplexe Sachverhalte stark vereinfacht zusammen.
Durch die Erzählung eines optimistischen Narrativs über eine denkbar positive Entwicklung der Menschheit hin zu (mehr) Nachhaltigkeit möchte der Autor die Leserinnen und Leser dahingehend optimistisch und zuversichtlich stimmen. Diesem können Sie hoffentlich spätestens nach Lektüre dieses Buches zustimmen.
Im Anschluss an das Narrativ erfolgt die Darstellung der Fakten per 31.3.2024. Beim EU-Lieferkettengesetz und dem EU-Nature Restoration Law (NRL) wurde der Stand bis zum 30. Juni 2024 eingearbeitet.
Narrativ Klimawandel, künstliche Intelligenz und globale Nachhaltigkeitsziele (SDGs):
Ein Teil der Menschheit konnte durch die Nutzung fossiler Energien unglaubliche Macht (Bsp.: British Empire) und Wohlstand (Bsp.: Deutschland) aufbauen.
Dadurch wurden sehr große Mengen an Treibhausgasemissionen freigesetzt. Diese sind im Wesentlichen für die globale Klimaerwärmung verantwortlich. Obwohl Ursache und Wirkung seit Jahrzehnten wissenschaftlich belegt sind, war die Menschheit bis 2022 nicht fähig, die jährlichen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Für die Beseitigung oder Linderung der bereits entstandenen oder noch zu erwartenden Umweltschäden entstehen sehr hohe Kosten. Dabei belasten Umweltkatastrophen oft gerade auch (arme) Länder, deren Anteil am globalen Ausstoß der Treibhausgasemissionen in Vergangenheit und Gegenwart gering war bzw. ist.
Die Folgen der globalen Klimaerwärmung werden mit der Zeit als existenzielle Gefahr wahrgenommen. Eine ungebremste Erwärmung würde die Welt in Kriege und Chaos stürzen und somit die bestehenden ökonomischen und sozialen Machtverhältnisse bedrohen.
Allmählich setzt sich weltweit die Überzeugung durch, dass die Treibhausgasemissionen verringert und der Atmosphäre wieder entnommen werden müssen. Dies trifft die Entwicklungsländer besonders hart, da sie noch am Anfang ihrer wirtschaftlichen Entwicklung stehen und auf die Vorteile der Förderung und Nutzung fossiler Energien verzichten müssen.
In forschungsstarken Ländern werden Technologien zur Marktreife gebracht, die eine Abkehr von der fossilen Wirtschaft ermöglichen. Weiterhin werden Effizienzsteigerungen erzielt. Für künstliche Intelligenz (KI), werden neue Rahmenbedingungen geschaffen. KI wird zum Wohle der Menschheit verwendet. Dadurch kann sie ihr Potential bei den notwendigen Fortschritten in den Bereichen Konsistenz und Effizienz voll entfalten. Weiterhin ist ein Teil der Menschheit bereit, sein Verhalten anzupassen.
Mit den vorgenannten Strategien gelingt es der Menschheit, durch eine nicht für möglich gehaltene gemeinsame Kraftanstrengung die globale Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter (Mittelwert der Jahre 1850 bis 1900) bis 2050 auf 2 °C Celsius zu begrenzen.
Wirtschaftlich profitieren die Länder, denen es gelingt, Technologien für Konsistenz und Effizienz zu entwickeln und zu vermarkten. Zusätzlich erhöhen Menschen, die ihre Lebensweise an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgerichtet haben, ihren persönlichen Wohlstand:
Ihr Verhalten wird vom Staat monetär belohnt (Bsp.: Steuererleichterungen in Deutschland beim Kauf und Betrieb einer Fotovoltaikanlage). Außerdem erzielen sie eine „Wohlfühlrendite“ (gutes Gefühl).
Der afrikanische Kontinent kann ebenfalls profitieren, da dort die Grundlagen für erneuerbare Energien (Sonne, Geothermie) in großem Maße vorhanden sind. Diese ermöglicht neue Exportchancen in die entwickelten Länder.
Für den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie werden große Mengen an Rohstoffen wie Gallium, Indium, Kadmium, Kupfer, Lithium, Nickel, Platin, Silizium und Silber benötigt. Daher zählen rohstoffreiche Länder gleichfalls zu den Gewinnern der Maßnahmen gegen die globale Klimaerwärmung.
Aufgrund der positiven Nebenwirkungen der Anstrengungen zur Begrenzung der globalen Klimaerwärmung können bedeutende Fortschritte bei der Verwirklichung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs), erreicht werden (Bsp.: SDG 1 Keine Armut).
Die Machteliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erkennen, wie nah sie die Menschheit an den Abgrund einer menschengemachten Katastrophe geführt hatten. Dadurch entwickeln sie ein neues Verständnis über die Zusammenarbeit zwischen den Menschen (Soziales) sowie den Umgang mit der Natur (Ökologie). Zugang zu machtvollen Positionen erhalten nur Personen, die diesen neuen Konsens verinnerlicht haben. Der weltweite Wohlstand wird gleichmäßig verteilt. Kriege sind nicht mehr notwendig. Die Krisen der Biodiversität und der Verschmutzung können erfolgreich bewältigt werden.
Globale Nachhaltigkeitsrisiken unverändert hoch
Die wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen sich jährlich im schweizerischen Davos. Organisiert werden diese Begegnungen vom Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF). Zur Vorbereitung werden regelmäßig im Januar eines Jahres die bedeutsamsten Risiken für die Menschheit ermittelt und veröffentlicht. Diese betreffen die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit:
Ökonomie
Ökologie
Soziales
Das WEF definiert globales Risiko als ein mögliches Ereignis mit gravierenden negativen Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Bevölkerung oder natürliche Ressourcen.1
In der Vergangenheit haben die umweltbezogenen und sozialen Risiken immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das WEF zeigt in seinem Bericht von 2024, welche Risiken in den nächsten zehn Jahren, bis 2034, den größten negativen Einfluss auf die Menschheit haben könnten.
Top-Ten-Risiken für den Zeitraum 2024 bis 2034, Reihenfolge nach dem Ausmaß der befürchteten Auswirkungen, Daten von The Global Risk Report 2024,2 eigene Darstellung
An dieser Einschätzung wird deutlich, dass eine Einengung der Diskussion über Nachhaltigkeit auf die Ökologie zu kurz greift. Vielmehr beeinflussen sich die drei Dimensionen gegenseitig:
Ökologische Risiken haben neben einer ethischen Komponente (Bsp.: Vernichtung von Tierarten und Zerstörung von deren Lebensräumen) regelmäßig Auswirkungen auf Soziales und die Ökonomie. Der Klimawandel wird zu einem Anstieg des Meeresspiegels und zu vermehrten Umweltkatastrophen führen. Übermäßiger Verbrauch an Ressourcen (Bsp.: Trinkwasserverbrauch durch die Landwirtschaft und die Textilindustrie) könnte einen Mangel in der Zukunft hervorrufen. Die Sicherung des Zugangs zu lebensnotwendigen Ressourcen, wie z. Bsp. Wasser, könnte Klimakriege auslösen. Dies wird die Zahl der Flüchtlinge weiter ansteigen lassen (Risiko Nr. 7). Die ökonomischen Kosten für die Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Eintreten von Klimakatastrophen sind in den betroffenen Gebieten sehr hoch.
Nach Ansicht des WEF besteht die Gefahr, dass sogenannte Klimatische Kipppunkte (Climate tipping points) überschritten werden. Darunter versteht das WEF
„langfristige, potenziell irreversible und sich selbst verstärkende Veränderungen kritischer planetarischer Systeme infolge des Überschreitens einer kritischen Schwelle oder eines "Kipppunkts" auf regionaler oder globaler Ebene.“3
Dies könnte den Verlust an Artenvielfalt und den Zusammenbruch von Ökosystemen bewirken (Risiko Nr. 3). Neben den ökologischen wären in diesem Fall weitreichende ökonomische und soziale Verwerfungen zu befürchten.4 Beispielsweise ist nach Angaben der Europäischen Kommission mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts von der Natur und deren erbrachten Dienstleistungen abhängig. Mehr als 75 % der Nahrungsmittelpflanzenarten sind auf Bestäuber angewiesen.5
Soziale Krisen können zu ökologischen und ökonomischen Schäden führen. Ein Beispiel hierfür sind die bewusst angerichteten Zerstörungen von Infrastruktur etc. in der Ukraine als Folge des russischen Überfalls vom 24.2.2022.
Ökonomische Krisen können zu ökologischen und sozialen Schäden führen. Die Gefahr einer Schuldenkrise steht im Global Risk Report 2024 an Nr. 17.6 Überschuldete Staaten und Kommunen haben keine oder wenige finanzielle Mittel für ökologische und soziale Projekte. Insolvente Unternehmen müssen Konkurs anmelden und verschwinden vom Markt. Arbeitslosigkeit und Armut steigen.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken kann durch eine nachhaltige Lebensweise verringert oder der Eintritt wenigstens hinausgezögert werden. Das Ausmaß der Schäden kann durch vorausschauendes Handeln gemindert werden.
Die Risiken sind der Weltgemeinschaft seit langem bekannt. Es gibt eine lange Historie von Konferenzen für mehr Nachhaltigkeit auf der Ebene der Vereinten Nationen (United Nations, UN). Daraus sind zahllose Absichtserklärungen und nationale Gesetze entstanden.
Der Stand der Umsetzung ist bislang nicht befriedigend:
Ökonomisch:
Die Ungleichheit in der Leistungskraft der Volkswirtschaften besteht weiterhin.
Ökologisch:
Die notwendige Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist weltweit noch nicht erfolgt. Die globalen jährlichen Treibhausgasmissionen sind 2022 auf einen neuen Höchststand gestiegen. Lediglich für 2020 war im Vorjahresvergleich eine Reduzierung zu verzeichnen. Diese beruhte auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie (Lockdown). Sie war nicht auf eine dauerhafte, nachhaltigere Art des Wirtschaftens oder des gesellschaftlichen Lebens zurückzuführen.
Sozial:
Die Zahl der gewaltsam vertriebenen Personen (forcibly displaced Persons) ist im Jahr 2022 auf einen neuen Höchststand gestiegen.1
Aufmerksamkeit und damit neuen Schwung bewirkten weltweite Protestbewegungen, initiiert durch den Schulstreik von Greta Thunberg ab dem 20.8.2018.
Die Beherrschung der genannten Risiken stellt für die Menschheit eine große Herausforderung dar. Durch die Umstellung auf eine nachhaltigere Lebensweise könnten diese bewältigt werden.
Im folgenden Teil A wird zunächst der Begriff Nachhaltigkeit definiert. Anschließend werden in Teil B zwei wesentliche Beschlüsse der Weltgemeinschaft dargestellt: Beschluss der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele und das Übereinkommen von Paris.
Teil C enthält den aktuellen Stand und Prognosen zur Zielerreichung dieser Beschlüsse.
Die umfangreichen Maßnahmen auf Ebene der UN, EU und Deutschlands sind Inhalte von Teil D.
Teil A: Begriff Nachhaltigkeit
In diesem Abschnitt steht der Begriff Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Zunächst wird die historische Entwicklung des Begriffs kurz dargelegt. Anschließend werden verschiedene Konzepte erörtert. Ergebnis ist ein Verständnis über den Inhalt des Begriffs Nachhaltigkeit wie er in diesem Buch verwendet wird.
1Historische Entwicklung des Begriffs Nachhaltigkeit
1.1Der Nachhaltigkeitsbegriff in der Forstwirtschaft
Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde in Deutschland ab dem 18. Jahrhundert in der Forstwissenschaft entwickelt und durch sie geprägt.1
In der vorindustriellen Zeit wurde nahezu die gesamte Wärmeenergie durch das Holz der Wälder bereitgestellt.2 Dies führte dazu, dass Holz eine immer knappere Ressource wurde. Im 18. Jahrhundert wurde der Holzmangel zunehmend als Problem wahrgenommen.3 Als Strategie zur Behebung dieses Problems formulierte 1713 der Freiberger (Sachsen) Oberberghauptmann Hans (Hannß) Carl von Carlowitz in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht “ (1713) den forstwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsbegriff.4
Demnach sollte pro Jahr nicht mehr Holz geschlagen werden als nachwachsen konnte. Der Wald sollte auf diese Weise in seiner Ertragsfunktion für künftige Generationen erhalten bleiben.5 Heute wird folgendes Zitat als Kernsatz seines Werkes angesehen:
"Wird derhalben die größte Kunst/Wissenschaft/Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darinnen beruhen / wie eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen / daß es eine continuierliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe / weiln es eine unentberliche Sache ist / ohne welche das Land in seinem Esse (im Sinne von Wesen, Dasein, d. Verf.) nicht bleiben mag.”6
Carlowitz beschränkte sich nicht nur auf die ökologische Nachhaltigkeit. Vielmehr wird in seinem Werk in Konturen das Dreieck der Nachhaltigkeit sichtbar. Ökonomische Sicherheit, ökologisches Gleichgewicht, und soziale Gerechtigkeit bilden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit und sind Grundlage des heutigen Verständnisses von Nachhaltigkeit.7
Exkurs: Hans Carl von Carlowitz
Das Leben von Hans Carl von Carlowitz und die Geschichte des Nachhaltigkeitsbegriffs wird von der Sächsischen Carlowitz-Gesellschaft auf ihrer Homepage ausführlich dargestellt.8
1.2Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung
Vom 5.6. bis 16.6.1972 fand in Stockholm die erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen statt (United Nations Conference on the Human Environment, UNCHE). Diese legte die Basis für die darauffolgende globale Umweltpolitik. Ministerpräsident von Schweden war damals Olof Palme.
Der kanadische UN-Funktionär Maurice Strong hielt am 5.6.1972 die Eröffnungsrede und beschwor bereits damals, was heutzutage im Wesentlichen unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstanden wird:1
„Wir sind heute zusammengekommen, um unsere gemeinsame Verantwortung für die Umweltprobleme einer Erde zu bestätigen, deren Verwundbarkeit wir alle teilen. Diese Zusammenkunft dient nicht nur uns selbst, sondern auch künftigen Generationen. Denn wir treffen uns als Treuhänder für alles Leben auf dieser Erde und für das Leben in der Zukunft.“
Die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi formulierte Nachhaltigkeit am 14.6.1972 in Stockholm aus der Sicht der Entwicklungsländer. Demnach sind Umwelt und Entwicklung gemeinsam zu betrachten:
„Das Leben ist eins, und wir haben nur diese eine Erde. Alles ist miteinander verknüpft: Bevölkerungsexplosion, Armut, Unwissenheit, Krankheit, Umweltverschmutzung, die Ansammlung von nuklearen, biologischen und chemischen Waffen. Ein Teufelskreis! Jedes Thema ist wichtig, aber es wäre vergebliche Mühe, jedes einzeln zu behandeln.“
Im Original:2
„Life is one and the world is one, and all these questions are inter-linked. The population explosion; poverty; ignorance and disease, the pollution of our surroundings, the stockpiling of nuclear weapons and biological and chemical agents of destruction are all parts of a vicious circle. Each is important and urgent but dealing with them one by one would be wasted effort.”3
Exkurs: Indira Gandhi und Olof Palme
Die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi und der Premierminister von Schweden, Olof Palme trafen sich am 5.6.1972 anlässlich der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm. Beide fielen einem Attentat zum Opfer. Indira Gandhi wurde am 31.10.1984 in Neu-Delhi, Olof Palme am 28.2.1986 in Stockholm ermordet.
Im Laufe der Jahre gewann die globale Umweltpolitik an Bedeutung, der Begriff Nachhaltigkeit wurde weiterentwickelt, die Dimensionen neu gewichtet.4 Schließlich gründeten 1983 die Vereinten Nationen die „Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ (World Commission on Environment and Development, WCED). Die WCED hatte das Mandat, einen Perspektivbericht zu langfristig tragfähiger, umweltschonender Entwicklung im Weltmaßstab bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus zu erstellen. Die Vorsitzende dieser Kommission war die frühere Umweltministerin und damalige Ministerpräsidentin von Norwegen, Gro Harlem Brundtland. Deshalb wird die Kommission als Brundtland-Kommission bezeichnet. Brundtland war damals die erste Ministerpräsidentin, die vorher das Amt einer Umweltministerin ausgeübt hatte. Durch ihre Berufung sollte gesichert werden, dass der Umweltaspekt nicht von untergeordneter Bedeutung blieb.5
1987 veröffentlichte die WCED ihre Definition des Begriffs Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung in der Publikation „Unsere gemeinsame Zukunft“ (Our common future):
„Nachhaltige Entwicklung (Sustainable development) ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“
Im Original:
„Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“6
Ein Zusammenhang zwischen der historischen Definition von Carlowitz und der Begriffsbestimmung von Nachhaltigkeit („sustainability“) gemäß der WECD besteht nicht. Den Teilnehmenden der Brundtland-Kommission war die historische Quelle vermutlich nicht bekannt.7
Der Brundtland-Bericht wurde weltweit, insbesondere in Deutschland, mit Interesse aufgenommen und führte in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zu einer breiten Beschäftigung mit dem Konzept des sustainable development, wie es vom Bericht definiert wurde. Fragen der Ökologie, der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftens und des globalen sozialen Gefälles wurden in weiten Kreisen diskutiert und drangen tief in das Bewusstsein der Gesellschaft ein. Das Konzept des sustainable development wurde zu Leitmaßstab und Schlagwort zahlreicher politischer Bestrebungen.
Gleichzeitig war der Nachhaltigkeitsbegriff von Beginn an Kritik ausgesetzt und wurde als schwammig, inhaltsleer oder überladen kritisiert.8 Die Kritik bezog sich auf die formelhafte Verwendung des Begriffs, die nach Meinung der Kritiker eine Auseinandersetzung mit den strittigen Punkten und Maßnahmen überlagern oder gar verhindern würde. Die allgemeine Definition war der Preis für die internationale Zustimmung zum Leitbild der Nachhaltigkeit.9 Konsequenz ist die beliebige Verwendbarkeit des Begriffs durch die politischen Parteien von links bis rechts, sonstige gesellschaftliche Gruppen und die Wirtschaft.10 Häufig wird der Begriff für Grünfärberei (Greenwashing) missbraucht. Die Definition von Nachhaltigkeit lässt sehr viel Spielraum für Interpretationen und ist keineswegs eindeutig. Tremmel (2004) konkretisierte den Begriff mit Hilfe von Kriterien.11
Das heutige Verständnis von Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung entspricht weitestgehend der Definition des Brundtland-Berichts.12 Beispielsweise wird sie in der aktualisierten Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2021 angewandt.13
Für den Begriff „sustainable development“ gibt es keine eindeutige deutsche Übersetzung. Der von der Bundesregierung eingesetzte Rat von Sachverständigen für Umweltfragen übersetzte diesen in seinen Umweltgutachten der Jahre 1994, 1996 und 1998 als „dauerhaft umweltgerechte Entwicklung“14. Seit dem Jahr 2000 spricht er hingegen von „nachhaltiger Entwicklung“15.
Die Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt“ übersetzt den Terminus dagegen in ihrem Abschlussbericht des Jahres 1998 als „nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung“. Weitere Beschreibungen sind „langfristig tragfähige Entwicklung“16, „dauerhafte Entwicklung“17 oder „zukunftsfähige Entwicklung“18.
Die Übersetzungsunterschiede bezogen sich auf den ersten Begriffsbestandteil „sustainable“, der tendenziell mit den Bereichen Natur und Ökologie verbunden wurde. Die zweite Komponente Entwicklung („development“) kann eindeutiger übersetzt werden. Allerdings muss dies ebenfalls inhaltlich mit Leben gefüllt werden.
15 Jahre vor der Definition des Begriffs Nachhaltigkeit in „The common future“ erschien im Jahr 1972 der Bericht des Club of Rome unter dem Titel „The Limits to Growth“.19 Darin wurde das Prinzip des Wachstums kritisch hinterfragt. Mit dem Begriff Entwicklung („development“) wurde von der Brundtland-Kommission das Konzept des Wachstums inhaltlich aufgenommen. Gleichzeitig wurde der in die Kritik geratene Terminus („growth“) vermieden. Aus Sicht der Brundtland-Kommission war für die Bewältigung der sozialen Herausforderungen weltweit sogar ein schnelleres ökonomisches Wachstum notwendig:
„Die Welt stellt heute siebenmal mehr Güter her als noch 1950. Angesichts der Bevölkerungswachstumsraten wird eine Verfünffachung bis Verzehnfachung der Produktionsleistung erforderlich sein, nur um den Verbrauch von Industriegütern in den Entwicklungsländern bis zur Abflachung des Bevölkerungswachstums im nächsten Jahrhundert auf das Niveau der Industrieländer anzuheben.“
Im Original:
„The world manufactures seven times more goods today than it did as recently as 1950. Given population growth rates, a five- to tenfold increase in manufacturing output will be needed just to raise developing world consumption of manufactured goods to industrialized world levels by the time population growth rates level off next century.”20
Die kritische Frage, ob dieses ökonomische Wachstum mit der ökologischen Nachhaltigkeit vereinbar ist, wurde von den Mitgliedern der Brundtland-Kommission reflektiert.21 Wachstum wurde im Bericht jedoch nicht als Widerspruch zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen gesehen. Die auf historischen Erfahrungen begründete Annahme lautete: „mit weniger mehr produzieren“ („producing more with less“). Dahinter stand die Theorie, dass für Produktion und wirtschaftliches Wachstum durch Innovation und Effizienzsteigerung immer weniger natürliche Ressourcen benötigt werden.22
Neben der ökonomischen Wachstumskomponente beinhaltet der Begriff Entwicklung (development) eine soziale Komponente. Zusätzlich zur quantitativen (= Wachstum) wird eine qualitative Steigerung des Wohlstandes für die gesamte Welt angestrebt. Qualitative Änderungen können beispielsweise eine Verbesserung beim Zugang zu Nahrung, natürlichen Ressourcen, Bildung, Gesundheitsversorgung sowie eine fairere Einkommensverteilung bedeuten.
Im Brundtland-Bericht selbst werden die Ziele nur vage angeschnitten.23 Unter Entwicklung wird grundsätzlich ein „positiver Wandel“24 verstanden.
Das Konzept von nachhaltiger Entwicklung gemäß dem Brundtland-Bericht ist stark anthropozentrisch ausgerichtet. Der Mensch steht im Mittelpunkt der geforderten ökonomischen, ökologischen und sozialen Verbesserungen:25
Ökonomisches Wachstum soll den Lebensstandard der Weltbevölkerung erhöhen.
Die Erhaltung der Ökosysteme und der natürlichen Grundlagen wird unter dem Leitziel des Erhalts einer lebensermöglichenden Umgebung für den Menschen betrachtet.
Maßnahmen des sozialen Ausgleichs, der Wohlfahrt, der Gesundheitsversorgung, der Kulturförderung u.v.m. sollen zu gesellschaftlichem Frieden und einer höheren Lebensqualität führen.
Wenngleich der Natur ein gewisser Eigenwert zugesprochen wird, tritt die Ausrichtung auf den Menschen im Brundtland-Bericht insgesamt doch sehr klar hervor. Dies hat im Sinne der Durchsetzbarkeit der geforderten Maßnahmen zwei Vorteile:
Die Bedeutung menschlichen Wohlempfindens ist im Gegensatz zu einem postulierten Eigenwert der Natur unumstritten.
Die Akzeptanz für das Ergreifen von Maßnahmen wird gesteigert.
Da die im Brundtland-Bericht zugrunde gelegte Interpretation des Nachhaltigkeitsbegriffs bis heute prägend ist, lassen sich die Ausführungen auf das vorherrschende Verständnis des Begriffs Nachhaltigkeit verallgemeinern. Nachhaltige Entwicklung enthält nach diesem Verständnis nachstehende Merkmale:
prozesshaft
zukunftsgerichtet
dauerhaft bzw. stetig
anthropozentrisch
ökonomische, ökologische und soziale Bereiche betreffend.
Nachhaltige Entwicklung bezieht sich auf die vielen Prozesse und Wege, die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen des Lebens in Einklang zu bringen. Langfristiges Ziel ist eine nachhaltige Welt.26
Nachhaltige Entwicklung betrifft sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen Generationen.
Zusammenfassung:
Die Idee der Nachhaltigkeit wurde bereits im 18. Jahrhundert in der Forstwirtschaft entwickelt.
Durch die erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen von 1972 in Stockholm wurde die Bedeutung des Begriffs erstmals einer breiten Öffentlichkeit bewusst.
Das heutige Verständnis von Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung beruht vor allem auf dem im Jahre 1987 veröffentlichten Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ (Our common future) der sogenannten Brundtland-Kommission.
2Konzepte der Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit beruht auf den drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales, auch bekannt als die „Drei Säulen der Nachhaltigkeit“. Zwischen den Generationen soll „Gerechtigkeit“ erreicht werden, sowohl innerhalb der aktuellen Generation als auch gegenüber zukünftigen Generationen. Unklar ist, wie dies erreicht werden kann. Als Konzepte werden die starke, schwache und ausgewogene Nachhaltigkeit vorgestellt. Ebenso wird debattiert, ob Verhaltensänderungen oder technologischer Fortschritt entscheidend für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele sind.
Am Ende des Abschnitts wird definiert, wie der Begriff Nachhaltigkeit in diesem Buch interpretiert wird.
2.1Drei-Säulen-Modell, Vorrangmodell und Integrationsmodell
Der Nachhaltigkeitsbegriff umfasst die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales.1 In Deutschland entwickelte die Enquête-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ das sogenannte Drei-Säulen-Modell. Die Kommission ging grundsätzlich von einer Gleichrangigkeit der drei Dimensionen aus – eine Position, die heute als Mehrheitsmeinung angesehen werden kann.2 Die Darstellung erfolgt typischerweise als „Tempel der Nachhaltigkeit“.3
Drei-Säulen-Modell mit gleichberechtigten Dimensionen, eigene Darstellung
Das Modell kann um weitere Säulen erweitert werden, z. Bsp. Kultur. Allerdings suggeriert das Säulen-Modell eine Trennung der Dimensionen der Nachhaltigkeit, die in der Realität nicht zu beobachten ist.
Daneben gibt es Ansätze, die die ökologische Dimension als Basis betrachten – Stichwort natürliche Grundlagen – und damit eine Gleichrangigkeit der drei Ebenen ablehnen.4 Eine intakte Umwelt sei die Voraussetzung für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Das Vorrangmodell kann auf zwei verschiedene Arten dargestellt werden: In der folgenden Abbildung ist die Ökologie am wichtigsten, gefolgt von Soziales und Ökonomie.
Vorrangmodell mit Ökologie als wichtigste Dimension, eigene Darstellung
Alternativ kann Ökologie als Fundament für ein Haus dienen, auf der die beiden anderen Dimensionen gleichberechtigt aufbauen.5
Zwei-Säulen-Konzept mit den natürlichen Ressourcen als Grundlage, eigene Darstellung
Beim drei- oder zwei Säulenmodell entsteht der Eindruck, dass die Säulen getrennt voneinander agieren.
Durch das Integrationsmodell wird dieser Mangel behoben. Wirtschaft und Gesellschaft sollen den Bereich verwirklichen, der von den drei gleichberechtigten Dimensionen gleichermaßen abgedeckt wird.
Integrationsmodell mit gleichberechtigten Dimensionen, eigene Darstellung
2.2Ökonomie als Grundlage für Ökologie und Soziales
Zunächst werden die Zusammenhänge zwischen ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit und die Bedeutung der sozialen Nachhaltigkeit dargestellt. Daraus wird ein Verständnis von Nachhaltigkeit mit der Ökonomie als Fundament abgeleitet.
Zusammenhänge zwischen ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit:
Ökologie als wichtigste Dimension und Grundlage ist eine nachvollziehbare Zielvorstellung. In unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist jedoch ökonomischer Erfolg (bei Unternehmen) oder ökonomische Leistungskraft (bei Kommunen) Voraussetzung, also das Fundament für ökologisches und soziales Handeln. Ökonomisch erfolgreiche Unternehmen sind häufig sehr innovativ und können einen positiven Einfluss auf ihre Umwelt ausüben. Nur durch eine erfolgreiche Verknüpfung von ökonomischer Leistungsfähigkeit mit ökologischer und sozialer Verantwortung ist das große Ziel der Nachhaltigkeit auf allen Ebenen realistisch zu erreichen. Außerdem bedingt ökonomische Nachhaltigkeit einen effizienten Umgang mit Ressourcen. Allerdings nur, solange diese nicht kostenlos zur Verfügung stehen, sondern mit einem Preisschild versehen sind.
Ökonomische Nachhaltigkeit ist eine Bedingung, die in einem kapitalistischen System stets erfüllt sein muss. Im Folgenden wird die ökonomische Dimension deshalb als „primus inter pares“ angesehen.
Einige Beispiele verdeutlichen, dass es nicht ausreicht, nur ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu verfolgen. Es muss zusätzlich wirtschaftlich erfolgreich sein.
Beispiel: Oatly Group AB (ISIN: US67421J1088)
Ein mahnendes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist die börsennotierte Oatly Group AB. Das schwedische Unternehmen produziert und vertreibt unter der Marke OATLY! weltweit Pflanzendrinks als vegane Milchersatzprodukte.
Ökonomisch war das Unternehmen bislang nicht erfolgreich. Die mit der Erstnotiz verbundenen hohen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Der Umsatz konnte zwar von 2019 bis 2023 um 284,8 % gesteigert werden, gleichzeitig wurden in diesem Zeitraum lediglich Verluste in Höhe von insgesamt 875,8 Mio. USD erzielt. Darin sind die geschätzten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 enthalten.
Oatly Group AB: Umsatzerlöse und operatives Ergebnis von 2019 – 2023, in Mio. USD, Daten von https://www.finanzen.net/bilanz_guv/oatly, abgerufen am 7.3.2024, eigene Darstellung
Bei den Aktionären wurde sehr viel Kapital vernichtet. Zunächst stieg der Aktienkurs bis auf einen Höchstkurs von 28,73 USD (11.6.2021). Anschließend ging es fast nur noch bergab. Der Aktienkurs verringerte sich seit dem Schlusskurs am 20.5.2021 (20,2 USD) bis zum Schlusskurs des Jahres 2023 um 94,5 %.
Oatly Group AB: Aktienkurs von 2021 – 2023 (Schlusskurs jeweils am 31.12. eines Jahres), in USD, Daten von https://www.finanzen.net/historische-kurse/oatly_group_registered, abgerufen am 7.3.2024, eigene Darstellung
Unternehmen, welche nicht in der Lage sind, langfristig Gewinne zu erzielen, werden in einer Marktwirtschaft nicht dauerhaft existieren. Anlegerinnen und Anleger, die die ökonomische Dimension nicht beachten, werden ihr Anlagekapital verlieren. Damit sind sie nicht mehr in der Lage, einen Beitrag zur Transformation der Wirtschaft zu leisten.
Beispiel: Beyond Meat (ISIN: US08862E1091)
Ein weiteres Beispiel aus der Lebensmittelbranche ist Beyond Meat. Das US-Unternehmen bietet eine ganze Reihe pflanzlicher Alternativen zu tierischen Produkten an. Verwendet werden Ersatzprodukte wie Erbsen und Soja. Beyond Meat wurde 2006 gegründet und wird seit Mai 2019 an der Börse gehandelt. Das Unternehmen erwirtschaftete bis 2023 nur negative operative Ergebnisse (EBIT). Der Eröffnungskurs betrug am 3.5.2019 in Deutschland 85,00 EUR. Der Schlusskurs am 28.3.2024 belief sich auf nur noch 7,779 EUR. Das ist ein Kursverlust von 90,8%.
Beispiel: Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0)
Die Siemens Energy AG ist ein weltweit tätiger Industriekonzern auf dem Energiesektor. Das deutsche Unternehmen nahm am 22.6.2023 in einer sogenannten Ad-hoc Mitteilung die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zurück. Grund waren Qualitätsprobleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa.1 Der Schlusskurs stürzte daraufhin innerhalb eines Tages von 23,38 EUR (22.6.2023) auf 14,65 EUR (23.6.2023), also um 37,3% ab.
Der größte Teil der Klimabewegung um Fridays for Future stellt die ökonomische Logik des marktwirtschaftlichen Systems nicht infrage. Ihre Forderungen beziehen sich meist auf ordnungspolitische Maßnahmen und Veränderungen im bestehenden Wirtschaftssystem.2 Die letzte Generation fordert beispielsweise sofort wirksame Maßnahmen gegen den voranschreitenden Klimawandel. Diese sind erstaunlich zurückhaltend und überschaubar. Die Organisation verlangte am 15.6.2023 auf ihrer Webseite lediglich ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen und die Einführung eines bezahlbaren Personennahverkehrs durch ein 9-Euro-Ticket. Weiterhin soll ein Gesellschaftsrat verbindliche Maßnahmen für folgende Frage erarbeiten: „Wie beendet Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe auf sozial gerechte Weise?“ (https://letztegeneration.org/, abgerufen am 15.6.2023 unter dem Reiter „Wandel 2023“).
Für die Europawahl im Juni 2024 wurde von der letzten Generation die politische Vereinigung „Parlament aufmischen“ gegründet.
Auf ihrer Webseite werden diese Forderungen erhoben:
Stärkung und Veränderung der Demokratie durch Gesellschaftsräte
Gerechter Ausstieg aus Öl, Gas & Kohle so schnell wie möglich
Soziale Gerechtigkeit weltweit
Unterstützung von Bewegungen für soziale und Klimagerechtigkeit
Die übergroße Mehrheit der politischen Akteurinnen und Akteure in der Bundesrepublik folgt der ökonomischen Logik. Die Systemfrage wird nicht gestellt. Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 10.12.2021 wird in der Präambel als Ziel formuliert, „die soziale Marktwirtschaft als eine sozial-ökologische Marktwirtschaft neu zu begründen“.3 Die CDU schreibt auf ihrer Webseite „Wir denken Umwelt- und Klimaschutz immer mit wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung zusammen.“4
Konsens ist zudem, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz nicht als Gegensätze zu betrachten. Voraussetzung für die Akzeptanz von Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes in der Gesellschaft ist der Erhalt des Wohlstandes. Slogans wie „there are no jobs on a dead planet“ gewichten soziale und ökonomische Fragen nicht ausreichend.5 Jeder Mensch möchte ein menschenwürdiges Leben führen. Die Frage ist, wie kann dies erreicht werden? Durch ökonomisches Wachstum oder durch eine Verringerung der Ungleichheit? Nicht umsonst lautet das erste globale Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen SGD 1 „Keine Armut“.
Bedeutung der Ökologie für die Ökonomie:
Die EU-Kommission hat am 22.6.2022 einen Vorschlag für eine „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wiederherstellung der Natur“ veröffentlicht.1 Dieser Entwurf wird als Renaturierungsgesetz (Nature Restoration Law, NRL) bezeichnet.
Mit dem NRL sollen Klima- und Biodiversitätsschutz miteinander verbunden werden. Weiterhin argumentiert die EU-Kommission mit wirtschaftlichen Gründen. Demnach sei mehr als die Hälfte des globalen BIP von der Natur und deren erbrachten Dienstleistungen abhängig. Weltweit seien mehr als 75 % der Nahrungsmittelpflanzenarten auf Bestäuber angewiesen.2
Die Natur erbringt für die Menschheit zahlreiche wertvolle Dienstleistungen:3
Versorgungsleistungen: Alles, was direkt der Natur entnommen werden kann.Beispiele sind Bau- oder Brennholz, Trinkwasser, essbare Pilze oder Beeren.
Regulierungsleistungen: Regulation des Weltklimas, Bestäubung und Verhinderung von Erosion, etc.
Basisleistungen: Fähigkeit bestimmter Organismen – meist über Photosynthese – aus anorganischen Molekülen organische zu machen, fruchtbaren Boden zu bilden und globale Nährstoffkreisläufe aufrecht zu erhalten.
Kulturelle Leistungen: Erholung, die wir in der Natur finden, die Inspiration oder ihre ästhetischen Werte.
Versöhnung von Ökonomie und Ökologie:
Nachhaltigkeit kann nur erreicht werden, wenn umwelt- und sozialverträglich gewirtschaftet wird. Es macht keinen Sinn ohne Rücksicht auf Ökologie und Soziales Gewinne zu erwirtschaften und anschließend einen Teil davon zur Beseitigung der angerichteten Schäden zu verwenden.
Ökonomie und Ökologie können durch marktwirtschaftliche Instrumente miteinander vereinbart werden. Eine Lösung ist die Bepreisung von bisher nicht in wirtschaftlichen Rechnungen erfassten Naturgütern. Damit werden diese in den Kostenrechnungen der Unternehmungen als Kosten erfasst und dementsprechend effizient eingesetzt. Die unbedarfte Verschwendung im Sinne von „was nichts kostet, ist nichts wert“1 endet damit.
Für die Nutzung der Atmosphäre als Speicher für Treibhausgasemissionen wurde eine Belastung der Emittenten mit Kosten durch die Einführung des EU-weiten CO2-Emissionshandelssystems, abgekürzt EHS (European Union Emissions Trading System, EU-ETS) realisiert. Dieses wurde 2005 zur Umsetzung des internationalen Klimaschutzabkommens von Kyoto von 1997 eingeführt. Es ist eines der zentralen Klimaschutzinstrumente der EU.2 In Deutschland wurde im Dezember 2019 zusätzlich mit der Verabschiedung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG), ein nationaler CO2-Emissionshandel (nEHS), beschlossen. Damit wurde in Deutschland für die Sektoren Wärme und Verkehr eine CO2-Bepreisung eingeführt. Diese ist seit dem 1.1.2021 wirksam. Auf dieser Grundlage wurde ein fester CO2-Preis von 25 EUR pro Tonne festgelegt. Dieser Preis wird laufend erhöht. Ab 2026 gilt ein Preiskorridor von 55 EUR bis 65 EUR pro Emissionszertifikat. Ab 2027 soll sich der Preis frei durch Angebot und Nachfrage am Markt bilden (§ 10 Abs. 2 BEHG). Als sozialer Ausgleich erfolgte gleichzeitig eine Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher durch den Wegfall der Umlage auf den Strompreis gemäß dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG-Umlage) und durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale gemäß dem Einkommensteuergesetz (EStG).
Alternativ könnten die Einnahmen aus der Bepreisung von CO2 für die Schuldentilgung verwendet werden. Die CO2-Emissionen schädigen die Umwelt auf Kosten der künftigen Generationen. Durch die Schuldentilgung hätten diese mehr finanziellen Spielraum, um die negativen Folgen der CO2 Emissionen zu bekämpfen.
Es ist nicht zielführend, die ökonomischen und sozialen Ziele den ökologischen Zielen unterzuordnen. Ein gesunder Planet ohne Arbeitsplätze bedeutet Armut und würde zu sozialen Krisen führen. In einem solchen Umfeld sind die Menschen zuallererst mit der Sicherung ihrer Existenz beschäftigt, ökologische Nachhaltigkeit spielt nur eine untergeordnete Rolle. In letzter Konsequenz können soziale Krisen zu schweren Auseinandersetzungen um Ressourcen, die wirtschaftlichen Wohlstand ermöglichen, führen. Die Vereinten Nationen formulieren die Bedeutung der ökonomischen und sozialen Entwicklung in der Präambel zum Beschluss der Agenda 2030 so: „Die Beendigung der Armut ist daher eine Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung“.3
Ökonomischer Erfolg ohne Rücksicht auf ökologische und soziale Folgen:
Ökonomischer Erfolg auf Kosten der Dimensionen Ökologie und Soziales führt letztlich zu einer nicht lebenswerten Umwelt und macht daher ökonomisch ebenfalls keinen Sinn. Die erzielten Gewinne werden in so einem Umfeld nicht nachhaltig im Sinne von langfristig sein. Vielmehr ist eine Art des Wirtschaftens anzustreben, bei der als Bedingung die ökologische und soziale Nachhaltigkeit gewährleistet werden kann.
Beispiel: Überfischung
Analog zum bereits erwähnten Beispiel in der Forstwirtschaft wird z. B. mit der Überfischung der Weltmeere lediglich kurzfristig ein ökonomischer Erfolg erzielt. Der Anteil der Fischbestände innerhalb biologisch nachhaltiger Grenzen verringerte sich weltweit in den Jahren 1974 bis 2019 vom Höchstwert von 91,5 % im Jahre 1978 auf 64,6 % im Jahre 2019 um 26,9 Prozentpunkte:
Anteil der Fischbestände innerhalb biologisch nachhaltiger Grenzen weltweit in den Jahren 1974 bis 2019, Daten von Statista und FAO 20221, eigene Darstellung
Langfristig werden durch die Schädigung des Ökosystems Wasser die ökonomischen Grundlagen der Fischerinnen und Fischer beeinträchtigt. Dies führt zu entsprechenden sozialen Folgen wie z. B. Arbeitslosigkeit. Die Überfischung ist somit gerade aus ökonomischen Gründen weder mit dem klassischen Drei-Säulen-Modell2 noch mit dem hier präferierten Zwei-Säulen-Modell vereinbar (Haus der Nachhaltigkeit (House of Sustainability) mit der Ökonomie als Fundament im Rahmen der planetaren Grenzen).
Analog zum menschengemachten Klimawandel sind die Tatsache der Überfischung und deren gravierenden negativen Folgen für alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit seit langem bekannt. Trotzdem gelingt es nicht, eine Lösung zu finden und durchzusetzen. Offenbar werden die wirtschaftlichen Zwänge einzelner Unternehmen bzw. Branchen stärker gewichtet als die Bedürfnisse der Weltgemeinschaft.3 Die Interessen der künftigen Generationen können auf internationaler Ebene nicht durchgesetzt werden (siehe Kapitel 7 Realisierung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs)).4
Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil:
Unternehmen sind in einer Marktwirtschaft gewinnorientiert. Eine Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften wird gelingen, wenn dies für die Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen verbunden ist. Die Unternehmen müssen für sich einen wirtschaftlichen Mehrwert erkennen. In Deutschland kann Nachhaltigkeit zu einem bedeutsamen Instrument im Wettbewerb genutzt werden. Dies betreffen zum Beispiel die Bereiche Personal, Finanzierung und Absatz:
Personal: Nachhaltigkeit und werteorientierte Unternehmensführung sind wichtige Aspekte bei der Auswahl des künftigen Arbeitgebers.
Investoren und Finanzdienstleister: Die Bedeutung der ESG-Kriterien nimmt weiter zu. Je besser die Unternehmen dort aufgestellt sind, umso einfacher und günstiger erhalten sie die benötigten Finanzmittel.
Kundinnen und Kunden: Diese haben meist eine sehr große Auswahl und wollen das Gefühl haben, die richtige Wahl getroffen zu haben. Nachhaltigkeit wird dabei zu einem wichtigen Kaufkriterium. Sie möchten bei den Guten kaufen.
Für die Realisierung der genannten Wettbewerbsvorteile ist Glaubwürdigkeit entscheidend. In Zeiten von Social Media kann Grünfärberei existenzgefährdende Auswirkungen haben.
Wichtigkeit der sozialen Nachhaltigkeit:
Neben der ökonomischen und ökologischen Dimension hat die soziale Komponente gleichfalls eine sehr hohe Bedeutung. Während der Mensch mit der ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit nur indirekt in Verbindung steht, liegt das Hauptaugenmerk bei der sozialen Nachhaltigkeit auf dem Menschen selbst. Ökologie ist als vorrangige Zielvorstellung zwar nachvollziehbar, aber selbst als Idealvorstellung nicht sinnvoll. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist.
Soziale Nachhaltigkeit trägt zum Beispiel dazu bei, kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Diese führen regelmäßig zu ökonomischen und ökologischen Schäden.
Beispiel: Überfall Russlands am 24.2.2022 auf die Ukraine
Ökonomische und soziale Schäden in der Ukraine und weltweit:
Für die Ukraine wird bis zum Jahr 2026 ein kumulativer Verlust beim Bruttoinlandsprodukt von etwa 120 Mrd. EUR erwartet. Der ukrainische Kapitalstock (Bsp.: Gebäude, Infrastruktur) könnte im selben Zeitraum durch die angerichteten Zerstörungen um mehr als 879 Mrd. Euro sinken. 2023 musste die Ukraine 37% ihres Bruttoinlandsproduktes (GDP) für das Militär verwenden.1
Drittländer, die nicht direkt am Krieg beteiligt sind, werden gleichfalls wirtschaftlich belastet. Deren Kosten sollen bis 2026 ca. 231 Mrd. EUR betragen. Davon entfallen ca. 65 Mrd. EUR auf die Europäische Union (EU) und davon wiederum ca. 14–18 Mrd. EUR auf Deutschland.2
Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), haben bis Ende 2022 ca. 5,7 Mio. Flüchtlinge die Ukraine verlassen. Zusätzlich werden ca. 5,9 Mio. Personen als Binnenvertriebene geführt (displaced Persons).3 Die Zahl der kriegsbedingten Toten und Verletzen in der Ukraine ist nicht bekannt. Das Arbeitskräftepotenzial für die ukrainische Wirtschaft und Gesellschaft wird demnach durch den Krieg stark eingeschränkt.
Ökologische Schäden in der Ukraine und weltweit:
Die kriegsbedingten Treibhausgasemissionen (Bsp.: Spritverbrauch der Militärfahrzeuge, -flugzeuge und -schiffe, kriegsbedingte Feuer und Explosionen) werden für den Zeitraum 24.2.2022 bis 1.9.2023 auf 150 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente geschätzt. Dies entspricht in etwa den jährlichen Treibhausgasemissionen Belgiens. In dieser Rechnung sind die geschätzten Treibhausgasemissionen für den Wiederaufbau der Ukraine enthalten.4 Diese Emissionen tragen weltweit zur globalen Erwärmung bei.