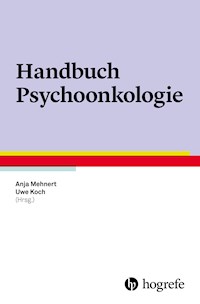
Handbuch Psychoonkologie E-Book
79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die psychosoziale Unterstützung von Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung und ihren Angehörigen stellt einen wichtigen Aspekt einer umfassenden onkologischen Versorgung dar. Zielsetzung des Handbuchs ist es, dem Leser eine orientierende Einführung in aktuelle Entwicklungen in der onkologischen Behandlung und Versorgung von Patienten zu geben sowie über verhaltensbezogene und psychosoziale Risikofaktoren der Krebsentstehung zu informieren. Die einzelnen Kapitel behandeln krankheitsspezifische psychosoziale Belastungen im Hinblick auf spezifische Patientengruppen und das Behandlungsteam, einschließlich Aspekten der Krankheitsverarbeitung und der kurz- wie längerfristigen psychosozialen Krankheitsfolgen. Des Weiteren gibt das Handbuch einen Überblick über den Stand der Forschung zu Diagnostik und Kommunikation, zu psychosozialen Interventionen bei Krebs sowie zu aktuellen Entwicklungen der psychoonkologischen Versorgung und der Versorgungsforschung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Anja Mehnert
Uwe Koch
(Hrsg.)
Handbuch Psychoonkologie
Prof. Dr. Anja Mehnert, geb. 1973. 1993–1999 Studium der Psychologie an der Universität Hamburg. 2005 Promotion. 2010 Habilitation.1999–2012 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seit 2012 Leiterin der Sektion Psychosoziale Onkologie und seit 2014 Professorin für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig. Forschungsschwerpunkte: Psychoonkologie, Versorgungsforschung, Interventionsforschung.
Prof. Dr. Uwe Koch, geb. 1943. 1965–1976 Studium der Psychologie und Humanmedizin an der Universität Hamburg. 1972 Promotion. 1978 Habilitation. 1970–1979 Wissenschaftlicher Assistent am Psychologischen Institut der Universität Hamburg sowie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 1979–1993 Leiter des Lehrstuhls für Rehabilitationspsychologie an der Universität Freiburg. 1993–2007 Direktor des Instituts und der Poliklinik für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Seit 2007 hauptamtlicher Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg. Forschungsschwerpunkte: Psychologie chronischer Erkrankungen, Psychoonkologie, Versorgungsforschung, Rehabilitationsforschung.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel.: +49 551 99950 0
Fax: +49 551 99950 111
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hogrefe.de
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2016
© 2016 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2474-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2474-4)
ISBN 978-3-8017-2474-0
http://doi.org/10.1026/02474-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
1 Geschichte und Entwicklung der Psychoonkologie
1.1 Die Entwicklung der Psychoonkologie im internationalen Raum
1.2 Meilensteine der Entwicklung der Psychoonkologie in Deutschland
1.3 Fachgesellschaften der Psychoonkologie
1.4 Wissenschaftliche Förderprogramme im Bereich der deutschen Psychoonkologie
Literatur
2 Krebsepidemiologie in Deutschland
2.1 Wie häufig ist Krebs?
2.1.1 Inzidenz
2.1.2 Prävalenz
2.1.3 Mortalität
2.1.4 Zeitliche Trends
2.1.5 Überlebensraten
2.1.6 Prävention
2.2 Woher stammen die Daten?
2.2.1 Aufgaben epidemiologischer Krebsregister
2.2.2 Krebsregistrierung in den einzelnen Bundesländern
2.2.3 Deutsches Kinderkrebsregister
2.2.4 Zentrum für Krebsregisterdaten
2.3 Wo findet man die Daten?
2.3.1 Krebs in Deutschland
2.3.2 GEKID-Atlas
2.3.3 Berichte der einzelnen Landeskrebsregister
2.4 Fazit
Literatur
3 Ätiologische und pathogenetische Grundlagen der Krebsentstehung
3.1 Tumorenentstehung
3.2 Eigenschaften von Tumorzellen
3.2.1 Genomische Instabilität und pro-inflammatorisches Tumorstroma
3.2.2 Das Aufrechterhalten von Wachstumssignalen
3.2.3 Das Umgehen von wachstumshemmenden Signalen
3.2.4 Das Widersetzen gegen Apoptose
3.2.5 Die Fähigkeit zur unbegrenzten Replikation
3.2.6 Das Einleiten einer Neubildung von Blutgefäßen
3.2.7 Die Aktivierung von Invasion und Metastasierung
3.2.8 Die Deregulierung von intrazellulären Stoffwechselprozessen
3.2.9 Das Vermeiden einer Vernichtung durch das Immunsystem
3.3 Kanzerogene
3.3.1 Chemische Substanzen
3.3.2 Strahlen
3.3.3 Viren und Bakterien
3.4 Genetische Prädisposition
Literatur
4 Zielgerichtete medikamentöse Therapie
4.1 Einführung
4.2 Toxizität
4.3 Antihormonelle Therapie
4.4 Wachstumsfaktor-Rezeptoren
4.5 Genveränderungen
4.6 Immunkontrolle
4.7 Zusammenfassung
Literatur
5 Medizinische Grundlagen der Krebserkrankung und der onkologischen Versorgung
5.1 Krebsfrüherkennung
5.2 Erfolge und Grenzen der Krebsfrüherkennung am Beispiel ausgewählter Entitäten
5.2.1 Prostatakarzinom
5.2.2 Mammakarzinom
5.2.3 Zervixkarzinom
5.2.4 Kolorektales Karzinom
5.2.5 Malignes Melanom
5.3 Primärprävention ist wirksamer als Sekundärprävention
5.4 Krebsdiagnostik – Voraussetzung für eine evidenzbasierte Behandlung
5.4.1 Die Erstuntersuchung
5.4.2 Die fachonkologische Diagnosestellung
5.4.3 Spezielle Verfahren
Literatur
6 Nebenwirkungen, Langzeitfolgen und Spätkomplikationen multimodaler Krebstherapien
6.1 Einleitung
6.2 Multimodale interdisziplinäre Therapiekonzepte
6.3 Akute Nebenwirkungen
6.4 Langzeitfolgen und Spätkomplikationen der multimodalen Therapie
6.5 Zusammenfassung
Literatur
7 Sekundärneoplasien nach Primärtherapie als besondere Belastung von Krebspatienten
7.1 Einleitung
7.2 Karzinogene Wirkung der Tumortherapie
7.3 Auftreten von Sekundärmalignomen und psychologische Belastung
7.4 Sekundärneoplasien bei spezifischen Patientenkollektiven
7.4.1 Sekundäre maligne Neoplasien in der pädiatrischen Onkologie
7.4.2 Sekundärmalignome nach Therapie des Morbus Hodgkin
7.4.3 Sekundärmalignome bei Keimzelltumor-Patienten
7.5 Fazit
Literatur
8 Das Versorgungssystem für Krebskranke in Deutschland
8.1 Einleitung
8.2 Onkologische Zentren
8.3 Ambulante Versorgung
8.3.1 Rehabilitation
8.3.2 Palliative Versorgung
8.4 Selbsthilfe
8.5 Ausblick
Literatur
9 Palliativmedizinische Versorgung onkologischer Patienten
9.1 Palliativmedizin: Historie und Prinzipien
9.2 Versorgungsformen in der Palliativmedizin
9.3 Onkologische Patienten in palliativer Erkrankungssituation
9.4 Palliativmedizin und Onkologie: Integration und Abgrenzung
9.5 Aufgaben der Palliativmedizin bei onkologischen Patienten
9.6 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
10 Somatische Risikofaktoren für die Krebsentstehung
10.1 Tabakkonsum und Krebserkrankungen
10.2 Ernährung und Krebserkrankungen
10.3 Übergewicht, Adipositas und Krebserkrankungen
10.4 Körperliche Aktivität und Krebserkrankungen
10.5 Sonne bzw. UV-Strahlung und Krebserkrankungen
10.6 Empfehlungen zur Prävention
Literatur
11 Psychosoziale Risikofaktoren bei der Entstehung einer Krebserkrankung
11.1 Mögliche Mechanismen
11.2 Methodische Aspekte
11.2.1 Operationalisierung der untersuchten Konstrukte
11.2.2 Studiendesign
11.2.3 Klassifikationsfehler
11.2.4 Confounder
11.3 Stand der Forschung
11.4 Fazit
Literatur
12 Soziale Ungleichheit und Krebs
12.1 Das Konzept der sozialen Ungleichheit in der Sozialepidemiologie
12.2 Soziale Ungleichheit und Krebserkrankungen
12.2.1 Inzidenz, Überlebens- und Mortalitätsraten: Ausgesuchte nationale Befunde
12.2.2 Inzidenz, Überlebens- und Mortalitätsraten: Ausgesuchte internationale Befunde
12.3 Soziale Ungleichheit und onkologische Versorgung
12.4 Fazit
Literatur
13 Krankheits- und behandlungsübergreifende psychosoziale Belastungen und Behandlungsbedarf
13.1 Formen psychosozialer Belastungen im Kontext einer Krebserkrankung
13.2 Häufigkeit psychischer Probleme und psychischer Komorbidität
13.3 Versorgungsbedarf bei Krebspatienten
13.4 Zusammenfassung
Literatur
14 Brustkrebs und gynäkologische Tumoren
14.1 Mammakarzinom (Brustkrebs)
14.2 Gynäkologische Tumoren
14.3 Körperliche Veränderungen und ihre Bedeutung
14.3.1 Brustverlust, Brustveränderung und Brustwiederaufbau
14.3.2 Entfernung der Ovarien (Ovarektomie)
14.3.3 Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie)
14.3.4 Entfernung oder Veränderungen an der Scheide
14.3.5 Veränderungen am Gebärmutterhals
14.3.6 Veränderung der Blasen- oder Darmtätigkeit
14.3.7 Haarverlust oder Haarveränderungen
14.3.8 Schleimhautreizungen
14.3.9 Lymphödeme
14.3.10 Vorzeitige Wechseljahre
14.4 Psychische Belastungen und Belastungsreaktionen
14.4.1 Belastungen, psychische Störungen und Betreuungsbedarf
14.4.2 Lebensqualität
14.5 Die junge Patientin – besondere Herausforderungen
14.6 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
15 Patienten mit gastrointestinalen Tumoren
15.1 Einleitung
15.2 Epidemiologische Aspekte – Inzidenz und Ätiologie
15.2.1 Das Ösophaguskarzinom
15.2.2 Das Magenkarzinom
15.2.3 Das Leberzellkarzinom bzw. Hepatozelluläre Karzinom
15.2.4 Das Gallenblasen- und Gallengangskarzinom
15.2.5 Das Pankreaskarzinom
15.2.6 Das Kolorektale Karzinom
15.2.7 Zusammenfassung
15.3 Indikationen und Ziele psychotherapeutischer Behandlung chirurgischer Patienten
15.4 Zusammenfassung und Fazit
Literatur
16 Prostatakrebs und urologische Tumoren
16.1 Psychoonkologische Aspekte beim Prostatakarzinom
16.2 Psychoonkologische Aspekte bei anderen urologischen Tumoren
16.3 Ausblick
Literatur
17 Hämatologisch-onkologische System-erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der Stammzelltransplantation
17.1 Hämatologisch-onkologische Erkrankungen
17.2 Hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT)
17.3 Ausblick
Literatur
18 Kopf-Hals-Tumoren
18.1 Epidemiologische und medizinische Aspekte
18.1.1 Klassifizierung und Inzidenz
18.1.2 Risikofaktoren und Mortalität
18.1.3 Therapieformen
18.1.4 Psychische Komorbidität
18.1.5 Weitere spezifische Belastungen
18.2 Interventionsmöglichkeiten
18.3 Fazit
Literatur
19 Lungenkrebs
19.1 Beschwerdebild
19.2 Diagnostik
19.3 Therapie
19.3.1 Operation
19.3.2 Strahlentherapie
19.3.3 Systemtherapie
19.4 Palliativmedizinische Begleitung
19.5 Psychoonkologische Betreuung
19.6 Ausblick
Literatur
20 Hautkrebs
20.1 Psychosoziale Belastung und Lebensqualität
20.2 Krankheitsverarbeitung und Interventionsansätze
20.3 Patienten mit Gesichtsdefekten
20.4 Patienten mit jahrelanger Behandlungsverzögerung
20.5 Ausblick
Literatur
21 Psychoonkologische Diagnostik in der Onkologie
21.1 Einleitung
21.2 Zielsetzung psychoonkologischer Diagnostik
21.3 Methoden psychoonkologischer Diagnostik
21.3.1 Screening-Instrumente
21.3.2 Standardisierte Interviewverfahren
21.4 Besonderheiten der psychoonkologischen Diagnostik
21.5 Ausblick
Literatur
22 Partizipative Entscheidungsfindung und Empowerment: Stärkung der Patientenbeteiligung in der Onkologie
22.1 Hintergrund
22.2 Modelle der Entscheidungsfindung in der Medizin
22.2.1 Definition und Anwendungsbeispiele einer partizipativen Entscheidung
22.2.2 Prozessschritte der Partizipativen Entscheidungsfindung
22.2.3 Auswirkungen auf die Mitarbeit von Patienten
22.2.4 Entscheidungshilfen („Decision Aids“)
22.3 Empowerment
22.4 Anwendung der partizipativen Entscheidungsfindung
22.4.1 Situationen medizinischer Unsicherheit
22.4.2 Patientencharakteristika
22.5 Vorbereitung von Ärzten
22.6 Fazit
Literatur
23 Kommunikation und Kommunikationstrainingsprogramme in der Onkologie
23.1 Erwartungen von Patienten in der Onkologie
23.2 Warum Kommunikationstraining in der Onkologie?
23.3 Was sind Inhalte von Kommunikationstrainings in der Onkologie?
23.4 Arztzentrierte und patientenzentrierte Techniken
23.5 Umgang mit Emotionen
23.6 Buchmetapher
23.7 Überbringung einer schlechten Nachricht
23.8 Gesprächstechniken/Schritte zur partizipatorischen Entscheidungsfindung
23.9 Wie werden die Inhalte des Kommunikationstrainings vermittelt?
23.10 Was bringt das Kommunikationstraining?
Literatur
24 Laienätiologie und Krankheitsverarbeitung
24.1 Laienätiologie/Kausalattributionen
24.1.1 Theoretische Modelle
24.1.2 Psychoätiologie
24.2 Krankheitsverarbeitung (Coping)
24.2.1 Theoretische Modelle
24.2.2 Taxonomie von Coping
24.2.3 Messung von Coping
24.2.4 Krankheitsverarbeitung im Verlauf einer Krebserkrankung
24.2.5 Bewältigungsmuster des sozialen Umfelds/der Familie
24.2.6 Genderaspekte des Copings
24.2.7 Adaptivität der Krankheitsverarbeitung
Literatur
25 Soziale Unterstützung bei Tumorpatienten
25.1 Unterstützungsarten und Unterstützungsebenen
25.2 Soziale Unterstützung und Anpassung an die Erkrankung
25.3 Änderungen der Sozialen Unterstützung im Verlauf der Erkrankung
25.4 Erklärungsansätze zur Wirkung der sozialen Unterstützung
25.5 Negative Folgen der sozialen Unterstützung
25.6 Dosis-Wirkungs-Zusammenhang
Literatur
26 Familie, Partnerschaft und Krebs
26.1 Einführung
26.2 Folgen der Krebserkrankung für den Partner: Belastungsquellen und Belastungsverläufe
26.3 Formen des Umgangs mit Belastungen – Dyadisches Coping
26.4 Paarbezogene Interventionen
26.5 Fazit
Literatur
27 Sexualität und Krebserkrankungen
27.1 Konzepte und Definition sexueller Funktionsstörungen
27.2 Empirische Befunde zur Sexualität bei Krebserkrankungen
27.3 Langzeitkonsequenzen von Krebserkrankungen bezüglich der Sexualität
27.4 Diagnostik sexuellen Erlebens und Verhaltens in der Psychoonkologie
27.5 Psychologische Interventionen bei sexuellen Folgen von Krebserkrankungen
27.6 Prävention
27.7 Fazit
Literatur
28 Lebensqualität im Kontext der Psychoonkologie
28.1 Einführung
28.2 Historische Aspekte
28.3 Lebensqualität – Stand 2015
28.4 Zusammenfassung
Literatur
29 Fatigue – das tumorassoziierte Erschöpfungssyndrom
29.1 Einleitung
29.2 Klinische Präsentation
29.3 Auswirkungen
29.4 Prävalenz
29.5 Ätiologie und Pathogenese
29.6 Diagnostik
29.7 Therapie
29.7.1 Nicht medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
29.7.2 Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten
29.8 Ausblick
Literatur
30 Schmerz und Schmerztherapie
30.1 Einleitung
30.2 Grundlagen der Tumorschmerztherapie
30.3 Epidemiologie
30.4 Schmerzformen
30.5 Pathophysiologie
30.6 Schmerzdiagnostik und Schmerzmessung
30.7 Leitlinien der Tumorschmerztherapie
30.7.1 Basistherapie
30.7.2 Wechsel des Opioids
30.7.3 Grundlagen der Therapie von Durchbruchschmerzen
30.8 Psychotherapeutische Behandlungsverfahren
30.8.1 Schmerzbewältigungstraining
30.8.2 Psychologische Schmerztherapie
30.8.3 Psychotherapie bei Schmerz
30.9 Fazit für die Praxis
Literatur
31 Psychologische Aspekte hereditärer Krebserkrankungen
31.1 Einführung
31.2 Genetische und klinische Grundlagen
31.3 Genetische Beratung: Vermittlung „objektiver“ genetischer Risiken und subjektive Risikowahrnehmung
31.4 Leben mit genetischem Risiko – Auswirkungen von genetischen Testergebnissen auf Individuen und Familien
31.5 Protektive und Risikofaktoren für höhere Vulnerabilität
31.6 Weitergabe von genetischen Testergebnissen – Auswirkungen auf familiäre Beziehungen
31.7 Psychosoziale Unterstützung
Literatur
32 Kognitive Funktionsstörungen bei Krebserkrankungen und -therapien im Erwachsenenalter
32.1 Einführung
32.2 Begriffsklärung
32.3 Theoretisches Rahmenmodell, multifaktorielle Genese und Risikofaktoren
32.3.1 Tumorassoziierte kognitive Veränderungen
32.3.2 Therapieassoziierte kognitive Veränderungen
32.3.3 Symptomassoziierte kognitive Veränderungen
32.4 Häufigkeit, Verlauf und Art kognitiver Funktionsstörungen
32.4.1 Prävalenz und Verlauf
32.4.2 Betroffene kognitive Funktionen
32.4.3 Selbstbericht kognitiver Funktionsstörungen
32.5 Alltagsrelevanz, Diagnostik und Therapie
32.6 Fazit
Literatur
33 Weibliche Fertilität und Krebserkrankung
33.1 Krebserkrankung und Kinderwunsch als medizinische und psychosoziale Herausforderung
33.2 Kinderwunsch bei Krebspatientinnen – die Studienlage
33.3 Gefährdung der weiblichen Fertilität durch die Krebstherapie
33.4 Maßnahmen zum Schutz der Fruchtbarkeit
33.5 Entscheidungen treffen
33.5.1 Entscheidungsfindung zur Inanspruchnahme fertilitätsprotektiver Maßnahmen
33.5.2 Entscheidungsfindung zum Versuch einer Schwangerschaft
33.6 Fazit
Literatur
34 Psychoneuroimmunologie und Krebs
34.1 Stress und Krebs: Epidemiologische Befunde
34.2 Biologische Mechanismen
34.2.1 Stress-Reaktionssysteme
34.2.2 Stressmediatoren und DNA-Schädigung/primäre Tumorentstehung
34.2.3 Stressmediatoren und Tumorwachstum/Angiogenese
34.2.4 Stressmediatoren und Metastasierung
34.2.5 Immunsuppression und -evasion
34.3 Sind psychologische Interventionen bei Krebs biologisch wirksam?
34.3.1 Effekte von psychologischen Interventionen auf Krankheitsprogression und Überleben
34.3.2 Effekte psychologischer Interventionen auf biologische Mechanismen
34.4 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
35 Belastungsfaktoren und psychosoziale Belastungsreaktionen bei Kindern und Jugendlichen
35.1 Einleitung
35.2 Pädiatrische Onkologie: Entwicklung und aktuelle Situation
35.3 Psychosoziale Versorgung in der pädiatrischen Onkologie
35.4 Belastungen
35.4.1 Krankheits- und therapieabhängige Belastungen
35.4.2 Krankheitsunabhängige Belastungen
35.5 Ressourcen
35.6 Reaktionen
35.7 Ausblick
Literatur
36 Diagnostik und Therapie bei Kindern, Jugendlichen und ihren Familien
36.1 Einführung
36.2 Psychosoziale Versorgungskonzepte
36.3 Fachliche und institutionelle Voraussetzungen
36.4 Grundhaltung
36.5 Diagnostik
36.6 Festlegung der Behandlungsindikation
36.7 Therapie
36.8 Ausblick
Literatur
37 Krebs im jungen Erwachsenenalter – Adolescent and young adults (AYA) with cancer
37.1 Epidemiologie
37.2 Entwicklungsaufgaben im jungen Erwachsenenalter
37.3 Psychosoziale Belastungen
37.4 Psychosozialer Unterstützungsbedarf
37.5 Psychoonkologische Versorgung
37.6 Fazit
Literatur
38 Kinder krebskranker Eltern
38.1 Einleitung
38.2 Häufigkeit, belastete Subgruppen und Risikofaktoren
38.3 Interventionen für Kinder krebskranker Eltern
38.3.1 Bedarf an spezifischen Interventionen
38.3.2 Inhalte zielgruppenspezifischer Interventionen
38.3.3 Kindzentrierte Familienberatung nach dem COSIP-Konzept
38.3.4 Perspektiven für die Versorgungspraxis
Literatur
39 Psychosoziale Gesundheit älterer Patientinnen und Patienten in der Onkologie
39.1 Einleitung
39.2 Alter
39.3 Diagnostik der psychosozialen Gesundheit im höheren Alter
39.4 Psychosoziale Gesundheit von älteren Krebspatienten
39.4.1 Querschnittstudien
39.4.2 Längsschnittstudien
39.5 Interventionen
39.6 Fazit und Ausblick
Literatur
40 Interkulturelle Aspekte und Migration
40.1 Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland
40.2 Die besondere gesundheitliche Situation von Menschen mit Migrationshintergrund
40.3 Krankheitsvorstellungen
40.4 Bedarf und Inanspruchnahme psychologischer und psychiatrischer Versorgung
40.5 Forschungsbedarf für eine kultursensible Psychoonkologie in Deutschland
Literatur
41 Psychoonkologische Versorgung in Deutschland
41.1 Einleitung
41.2 Berücksichtigung der Psychoonkologie in Leitlinien, im Nationalen Krebsplan und in onkologischen Spitzenzentren
41.3 Die psychoonkologische Versorgungssituation
41.4 Psychoonkologische Versorgung im Akut-Bereich
41.5 Psychoonkologische Versorgung im ambulanten Bereich
41.6 Psychoonkologische Versorgung in der Rehabilitation
Literatur
42 Onkologische Rehabilitation und Rückkehr von Krebspatienten zur Arbeit
42.1 Rehabilitative Angebote für Krebspatienten
42.2 Rückkehr von Krebspatienten zur Arbeit
Literatur
43 Leitlinien und Qualitätssicherung in der Psychoonkologie
43.1 Einführung
43.2 Allgemeine Aspekte von evidenzbasierten Leitlinien
43.3 Leitlinienentwicklung in der Psychoonkologie
43.4 Leitlinienentwicklung in Deutschland
43.5 Methodische Schritte der Leitlinienentwicklung
43.6 Inhalte der Leitlinie
43.7 Qualitätsindikatoren
43.8 Ausblick
Literatur
44 Ambulante psychosoziale Krebsberatungsstellen
44.1 Einleitung
44.2 Versorgungssituation
44.3 Zielgruppen, Unterstützungsbedürfnisse und Zugang
44.4 Ziele und Leistungsspektrum
44.5 Evidenz zur Wirksamkeit psychosozialer Krebsberatung
44.6 Qualitätssicherung
44.7 Ausblick
Literatur
45 Psychoonkologische Versorgung im Allgemeinkrankenhaus durch Liaisondienste
45.1 Bedarf an psychoonkologischer Unterstützung
45.2 Organisationsformen der psychoonkologischen Versorgung
45.3 Personelle Ausstattung von Liaisondiensten
45.4 Inanspruchnahme
45.5 Rahmenbedingungen für psychoonkologische Versorgung im Krankenhaus
45.6 Patientenbezogene Liaisonaufgaben
45.7 Teaminterventionen
45.7.1 Niederschwellige informelle Kontakte
45.7.2 Teilnahme an regelmäßigen interdisziplinären Teambesprechung oder ärztlichen und/oder pflegerischen Übergaben
45.7.3 Teilnahme an Visite
45.7.4 Teilnahme am Tumorboard oder Tumorkonferenz
45.7.5 Gemeinsame Fallbesprechunge/Balintgruppen
45.7.6 Fortbildungsangebote
45.8 Dokumentation und Qualitätsicherung
45.9 Ökonomische Absicherung der Liaisonversorgung
45.10 Zukünftiger Entwicklungsbedarf
Literatur
46 Gemeinschaftliche Selbsthilfe
46.1 Begriffsbestimmungen und -differenzierung
46.2 Struktur, Arbeitsweise und Integration
46.3 Inanspruchnahme der Selbsthilfe
46.4 Wirkungen der Selbsthilfe
46.5 Fazit
Literatur
47 Zum Stand der Interventionsforschung in der Psychoonkologie
47.1 Ausgangssituation
47.2 Psychoonkologische Interventionen und Lebensqualität
47.2.1 Fragestellung
47.2.2 Methodik
47.2.3 Deskriptive Ergebnisse
47.2.4 Effektstärken
47.2.5 Effektmoderatoren
47.3 Psychoonkologische Interventionen und Überlebenszeit
47.4 Offene Fragen
Literatur
48 Psychoedukation
48.1 Definition
48.2 Themen
48.3 Didaktik
48.4 Effektivität
48.5 Wirkmechanismen
48.6 Offene Fragen
Literatur
49 Psychodynamische Interventionen bei Krebspatienten
49.1 Gruppenpsychotherapie mit Krebskranken am Beispiel der Supportiv-Expressiven Therapie
49.2 Manualisierte psychodynamische Psychotherapien für fortgeschrittene Krebserkrankungen
49.2.1 Meaning-centered group psychotherapy (MCGP)
49.2.2 Dignity Therapy
49.2.3 Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM)
49.3 Kurzpsychotherapie bei depressiven Krebskranken
49.4 Fazit
Literatur
50 Entspannungsverfahren
50.1 Einleitung
50.2 Entspannungsverfahren und Evidenz
50.2.1 Progressive Muskelrelaxation
50.2.2 Autogenes Training
50.2.3 Hypnose
50.2.4 Imaginative Verfahren und Visualisierungen
50.2.5 Achtsamkeitsbasierte Interventionen, Meditation und Yoga
50.3 Besonderheiten für das Arbeiten mit Onkologischen Patienten
50.4 Indikation und Kontraindikation
50.5 Fazit
Literatur
51 Körperliche Aktivität und Tumorerkrankungen
51.1 Einleitung
51.2 Körperliche Aktivität und Primärprävention
51.3 Bewegungstherapie während der Behandlungsphase
51.4 Rehabilitation und Gesundheitsförderung
51.5 Rezidivsenkung
51.6 Palliativtherapie
51.7 Ausblick
Literatur
52 Künstlerische Therapien
52.1 Bedeutung der Künstlerischen Therapien für die Psychoonkologie
52.2 Musiktherapie
52.3 Kunsttherapie
52.4 Forschungsfragen und Ausblick
Literatur
53 Komplementärmedizin bei Krebspatienten
53.1 Einleitung
53.2 Ernährung und Bewegung
53.3 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Yoga und andere achtsamkeitsbasierte Interventionsprogramme
53.4 Arznei- und Heilmittel aus Pflanzen
53.4.1 Misteltherapie
53.4.2 Granatapfelsaft bei Prostatakarzinom
53.4.3 Weihrauch-Extrakt
53.5 Phytotherapie in der supportiven Begleitbehandlung von Krebspatienten
53.6 Zusammenfassung
Literatur
54 Psychopharmakologische (Mit-)Behandlung von psychischen Beeinträchtigungen bei Krebspatienten
54.1 Depressive Störungen/Depressive Episoden
54.1.1 Auswahl eines Antidepressivums
54.1.2 Andere Präparate in der Behandlung depressiver Störungen bei Krebspatienten
54.2 Ängste
54.3 Schlafstörungen
54.4 Delir
54.5 Suizidalität
54.6 Besonderheiten in der psychopharmakologischen Behandlung von Krebspatienten
Literatur
55 Grundlagen psychotherapeutischer Interventionen bei Krebs: Verständnis und Zielperspektiven, Interventionsansätze und Settings
55.1 Einleitung
55.2 Begriffsbestimmung: Psychotherapeutische Interventionen in der Psychoonkologie
55.3 Behandlungsauftrag und therapeutische Beziehung
55.4 Indikation für den Einsatz von psychotherapeutischen Interventionen in der Psychoonkologie
55.5 Unterschiedliche Interventionen in der Psychoonkologie
55.5.1 Beratung, Krisenintervention, Psychoedukation, Psychotherapie
55.5.2 Einbezug anderer psychosozialer Interventionen
55.5.3 Unterschiedliche Settings psychoonkologischer Arbeit
55.6 Interventionsformen
55.6.1 Supportive Ansätze
55.6.2 Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze
55.6.3 Systemisch orientierte Ansätze
55.7 Fazit
Literatur
56 Psychologische Interventionen bei Progredienzangst
56.1 Einleitung
56.2 Behandlung dysfunktionaler Progredienzangst – PaThe
56.2.1 Selbstbeobachtung und Diagnostik
56.2.2 Angstkonfrontation und Neubewertung
56.2.3 Verhaltensänderung und Lösungen
56.2.4 Wirksamkeit
56.3 Weitere Behandlungsansätze
56.4 Fazit
Literatur
57 Trauer
57.1 Einleitung
57.1.1 Trauer und ihre Mythen
57.1.2 Verläufe von Trauer
57.2 Psychologische Modelle der Trauer
57.3 Komplizierte bzw. prolongierte Trauer
57.4 Empirische Ergebnisse zur Trauer
57.6 Psychosoziale Interventionen bei Trauernden
57.7 Fazit
Literatur
58 E-Health-Angebote in der Onkologie
58.1 E-Health: Voraussetzungen und allgemeine Entwicklungen
58.2 E-Health-Angebote für Krebspatienten und deren wissenschaftliche Überprüfung
58.2.1 Angebotsformen
58.2.2 Wirksamkeit
58.2.3 Differenzielle Wirksamkeit
58.2.4 Prädiktoren der Inanspruchnahme
58.3 Zusammenfassung und Fazit
Literatur
59 Maladaptive Krankheitsverarbeitung: Anpassungsstörung, Angststörungen und Posttraumatische Belastungsstörung
59.1 Anpassungsstörung
59.1.1 Strategien im Zusammenhang mit maladaptiver Krankheitsverarbeitung bei Krebserkrankungen
59.2 Angststörungen
59.2.1 Generalisierte Angststörung
59.2.2 Panikstörung
59.2.3 Panikstörung mit Agoraphobie
59.2.4 Therapie von Angststörungen
59.3 Posttraumatische Belastungsstörung
59.3.1 Therapeutische Interventionen bei PTSD
59.3.2 Posttraumatische Reifung
59.4 Fazit
Literatur
60 Depression und Suizidalität
60.1 Einführung
60.2 Epidemiologie/Prävalenz
60.3 Ätiologie
60.4 Diagnose und Differenzialdiagnose (ICD-10)
60.5 Therapie
60.5.1 Psychotherapie
60.5.2 Pharmakotherapie
60.5.3 Suizidalität
60.6 Fazit
Literatur
61 Sinnorientierte Interventionen
61.1 Lebenssinn und existenzielle Belastungen
61.1.1 Theoretische Konzepte
61.1.2 Stand der empirischen Forschung
61.2 Sinnorientierte Interventionen
61.2.1 Inhalte und Ziele
61.2.2 Wirksamkeit
61.2.3 Herausforderungen und Forschungsbedarf
61.3 Fazit
Literatur
62 Stigmatisierung und Krebs
62.1 Einleitung – Stigma und gesundheitsbezogene Stigmatisierung
62.2 Der Prozess der Stigmatisierung
62.3 Ursachen und Verlauf der Stigmatisierung bei Krebspatienten
62.4 Befunde zur Stigmatisierung bei Krebs
62.4.1 Messverfahren zur Erfassung krebsbezogener Stigmatisierung
62.4.2 Einzelbefunde zu Krebs und Stigmatisierung
62.5 Fazit
Literatur
63 Cancer Survivorship-Programme
63.1 Einleitung
63.2 Stand der Survivorship-Forschung
63.3 Ziele von Cancer Survivorship-Programmen
63.4 Komponenten eines Cancer Survivorship-Programms
63.5 Zusammenfassung
Literatur
64 Perspektiven der Psychoonkologischen Forschung
64.1 Psychoonkologie als Gegenstand der Forschung
64.2 Rahmenbedingungen der psychoonkologischen Forschung
64.3 Aufgaben der psychoonkologischen (Versorgungs-)Forschung
64.3.1 Strukturelle Bedingungen der psychoonkologischen Versorgung
64.3.2 Psychoonkologische Epidemiologie
64.3.3 Psychoonkologisches Assessment
64.3.4 Effektivität und Effizienz psychoonkologischer Maßnahmen
64.3.5 Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in der Psychoonkologie
64.4 Fazit
Literatur
65 Die Rolle des Psychoonkologen und Belastungen der Behandler
65.1 Einleitung
65.2 Was ist Burnout?
65.3 Burnout in der Onkologie
65.4 Arbeitsbelastungen in der Onkologie
65.5 Ursachen von Arbeitsüberlastung im Krankenhaus
65.6 Maßnahmen: die Rolle des Psychoonkologen
65.7 Ausblick
Literatur
66 Fortbildung in der Psychoonkologie
66.1 Fort- und Weiterbildung als essenzieller Aspekt der Qualitätssicherung in der Psychoonkologie
66.2 Psychoonkologie als interdisziplinäres Fachgebiet
66.3 Heterogene Ausbildung der unterschiedlichen in der Psychoonkologie tätigen Berufsgruppen
66.4 Anforderungen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Psychoonkologie
66.5 Fazit
Literatur
Die Autorinnen und Autoren des Bandes
Sachregister
|11|Vorwort der Herausgeber
In den letzten Jahrzehnten, in denen sich die Psychoonkologie oder Psychosoziale Onkologie in Deutschland wie auch international zunehmend etabliert hat, hat sich neben der Auftretenshäufigkeit, Diagnostik und Behandlung auch die Wahrnehmung von Krebserkrankungen in der Gesellschaft verändert. In den Industrieländern finden wir heute die höchsten Inzidenz- und die niedrigsten Mortalitätsraten über alle Krebserkrankungen hinweg. Auch wenn Krebs noch immer zu den Krankheiten zählt, die mit einer hohen Lebensbedrohung und invasiven Behandlungen einhergehen, überleben zunehmend mehr Patientinnen und Patienten den Krebs oder sie leben lange mit der Erkrankung. Weltweit sind es mehr als 32 Millionen Menschen, die allein in den letzten fünf Jahren die Diagnose Krebs erhielten und mit ihr leben.
Therapien, die das Leben verlängern, beeinträchtigen die Lebensqualität von Patienten. Überleben bedeutet deshalb für viele Betroffene auch ein Leben mit körperlichen und psychosozialen Folgeproblemen. Dazu zählen beispielsweise chronische Schmerzen, Funktionseinschränkungen, Fatigue und psychosoziale Belastungen sowie Einbußen in der Selbstständigkeit im Alltag oder in der Teilhabe an Arbeit. Eine Krebserkrankung bedeutet für den Patienten wie seine Familie und das soziale Umfeld einen tiefen Einschnitt und beeinflusst alle Lebensbereiche.
Krebs ist aber auch eine Erkrankung geworden, über die offener und selbstverständlicher gesprochen wird und werden kann. Dies gilt sowohl innerhalb der Familie und im Freundeskreis als auch in Bezug auf das professionelle Behandlungsteam. Dieser offenere Umgang wird durch eine frühe und verbesserte Diagnostik, eine umfassende Behandlung und Nachsorge, die psychosoziale Aspekte als einen wichtigen Teil der Therapie berücksichtigt, und das verbesserte Überleben begünstigt, die der Erkrankung einen Teil ihres Schreckens genommen haben. Dazu beigetragen haben auch die Patienten und Angehörigen, die eine Kommunikation auf Augenhöhe, eine stärkere Beteiligung an medizinischen Entscheidungen und der Behandlung sowie die Stärkung der Patientenrechte fordern.
Die Psychoonkologie ist eine relativ junge, interdisziplinäre Disziplin, die sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts etabliert hat, um den zahlreichen psychosozialen Herausforderungen, mit denen Krebspatienten und Angehörige wie auch das Behandlungsteam konfrontiert sind, zu begegnen. Das Handbuch Psychoonkologie soll aktuelle Erkenntnisse und Trends in der Psychoonkologie umfassend im Sinne eines Standardwerkes für die Klinik und Forschung darstellen.
Das Inhaltsverzeichnis spiegelt die Struktur des Handbuchs wider. Nach einer kurzen Einführung in die Entwicklung der Psychoonkologie befassen sich die Autorinnen und Autoren der ersten Kapitel des Buches mit den medizinischen |12|Grundlagen der Krebserkrankung, dem Versorgungssystem für Krebskranke in Deutschland sowie mit verhaltensbezogenen und psychosozialen Risikofaktoren für die Krebsentstehung. Zielsetzung dieser ersten Kapitel ist es, dem Leser eine knappe und aktuelle Einführung in wichtige epidemiologische und medizinische Grundlagen der Onkologie und damit einen orientierenden Rahmen über aktuelle Entwicklungen in der onkologischen Behandlung und Versorgung von Patienten zu geben.
Der Block zu den Belastungsfaktoren und psychosoziale Belastungsreaktionen umfasst sowohl die Darstellung krankheitsübergreifender Belastungen als auch die spezifischen Belastungssituationen bei ausgewählten Diagnosegruppen. Im Anschluss an die Beiträge zur psychologischen Diagnostik, Entscheidungsfindung und Kommunikation werden spezifische Aspekte der Krankheitsverarbeitung sowie verschiedene häufige Krankheitsfolgen erläutert. In den nachfolgenden Kapiteln finden sich Beiträge zu spezifischen Zielgruppen psychoonkologischer Forschung und Versorgung wie erkrankte Kinder und Jugendliche. Die Autorinnen und Autoren der Beiträge zu psychoonkologischen Interventionen skizzieren zum einen das breite Spektrum evidenzbasierter therapeutischer Angebote für Patienten und Angehörige und gehen zum anderen auf Interventionen bei spezifischen Problemen ein. Dieser Teil des Buches fokussiert auf die aktuellen Entwicklungen psychoonkologischer Leitlinien, Merkmale der Qualitätssicherung in der Psychoonkologie, auf das psychosoziale Versorgungssystem im Überblick inklusive Krebsberatung, Konsiliar- und Liaisondienste, die onkologische Rehabilitation, die Selbsthilfe sowie spezifische Versorgungsprogramme/Survivorship-Programme. Darüber hinaus werden Aspekte psychoonkologischer Forschung erläutert. Das Handbuch schließt mit Beiträgen zur Rolle und den Belastungen psychoonkologischer Behandler und des Behandlungsteams sowie zur Fortbildung in der Psychoonkologie.
Als Herausgeber war es uns ein besonderes Anliegen, die inzwischen in vielen Bereichen breiten und fundierten psychoonkologischen Erkenntnisse für die Leser konzentriert darzustellen. Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre Zeit, Geduld und die Arbeit, die hinter dem Schreiben eines Beitrags steht, das Wissen und die eigenen Erfahrungen in die jeweiligen Kapitel einzubringen. Wir danken dem Hogrefe Verlag für die Bereitschaft, das Handbuch zu verlegen und die angenehme Zusammenarbeit. Insbesondere danken wir Natalie Ladehoff für die Unterstützung bei der Realisierung des Buches.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Leipzig und Hamburg, im Januar 2016
Anja Mehnert und Uwe Koch
|13|1 Geschichte und Entwicklung der Psychoonkologie
Uwe Koch, Jimmie C. Holland und Anja Mehnert
Eine systematische Entwicklung der Psychoonkologie ist international ab Mitte der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts zu beobachten. Die gravierenden Veränderungen im Gesundheitswesen (u. a. rasante medizintechnologische Entwicklungen, großer Wissenszuwachs, Verknappung der finanziellen Ressourcen, Veränderungen des Spektrums vieler Erkrankungen in Richtung auf chronische Erkrankungen) gingen auch einher mit wachsenden Ansprüchen der Patienten an die Gestaltung der Arzt-Patienten-Kommunikation. Das paternalistische Modell der Arztrolle verlor schrittweise an Bedeutung, Patienten entwickelten höhere Ansprüche im Sinne eines stärker patientenorientierten und von Partizipation geprägten Arztverhaltens. Diese Veränderung von Einstellungen tangierte auch den Umgang mit Krebs. Das vorher häufig tabuisierte und stigmatisierende Wort „Krebs“ wurde zunehmend im Kontext mit der Diagnose einer Krebserkrankung ausgesprochen und die mit dieser Diagnose verbundenen Gefühle der Patienten konnten häufiger angesprochen werden. Ein zweites Stigma, das die Berücksichtigung von psychologischen Aspekten einer Krebserkrankung lange einschränkte, betraf die negative Haltung gegenüber psychischen Problemen und psychischen Erkrankungen. Auch hier sind inzwischen deutliche Einstellungsveränderungen in der Bevölkerung im Sinne einer größeren Offenheit festzustellen.
In den letzten 30 Jahren entwickelte sich die Psychoonkologie zu einer Teildisziplin der Onkologie wie auch der psychosozialen Medizin. Sie kann sich inzwischen auf eine breite Basis gesicherten Wissens stützen und damit substantiell zur Versorgung von Krebspatienten beitragen. Das heute verfügbare breite Spektrum psychoonkologischer Interventionen reicht von Strategien zur Veränderung von mit einem Krebsrisiko verbundenen Lebensstilen im Sinne der Primär- und Sekundärprävention und zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens z. B. bei der Teilnahme an Krebsfrüherkennungsmaßnahmen über den Umgang mit psychischen Problemen im Zusammenhang mit einem erhöhten genetischem Krebsrisiko, Maßnahmen zur Reduktion psychischer Belastungen und Symptomkontrolle (insbesondere bezogen auf den Umgang mit Ängsten, Depression, Schmerz oder Fatigue) bis hin zum Umgang mit den psychosozialen Folgen bei Langzeitüberlebenden nach einer Krebserkrankung (Cancer Survivorship) oder den Umgang mit den psychologischen Aspekten der Palliativversorgung. Heute, zu Beginn des 3. Jahrtausends, ist die Psychoonkologie eine der am klarsten definierte |14|Subdisziplin innerhalb der psychosozialen Dienste im Krankenhaus und ein Modell für die erfolgreiche Anwendung von Verhaltens- und Sozialwissenschaften in der Medizin. (vgl. Holland & Weiss, 2010; Watson et al., 2014).
1.1 Die Entwicklung der Psychoonkologie im internationalen Raum
Holland und Weiss (2010) nennen in ihrer Darstellung der Geschichte der Psychoonkologie als Wurzeln u. a. die Thanatologie-Bewegung in den frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts, Feinbergs Ansätze zur Psychotherapie mit sterbenden Patienten am Karolinska-Institut in Stockholm Mitte der 50er-Jahre, richtungsweisende Aktivitäten von Sutherland und anderen am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC; Sutherland et al., 1952; Bard & Sutherland, 1955; Dyk & Sutherland, 1956) sowie von Shands und anderen am Massachusetts General Hospital in den USA (Shands et al., 1951; Abrams & Finesinger, 1953).
Als weitere wichtige Entwicklungen beginnend in den 60er-Jahren sind die Arbeiten von Elisabeth Kübler-Ross (1969) zur Kommunikation mit Sterbenden und Cecily Saunders (Saunders & Baines, 1991) im Rahmen der Londoner Hospiz Bewegung zu nennen. In den 1970er-Jahren beginnen erste, meist kleinere Gruppen psychoonkologische Aktivitäten in verschiedenen europäischen Ländern. Als Pioniere sind hier u. a. zu nennen: Christina Bolund in Stockholm, Kati Muszbek in Budapest, Margit von Kerekjarto in Hamburg, Darius Razavi in Belgien, Steven Greer gefolgt von Maggie Watson in London und später dann Peter McGuire in Manchester. Als weitere wichtige Entwicklungen sind das Project Omega von Avery Weisman (1993) und die Etablierung des WHO „Collaborating Center for Quality of Life Research“ ab 1987 mit Fritz van Damm und später mit Neil Aaronson zu nennen (vgl. Aaronson, 1987).
Zu Beginn der 1980er-Jahre begannen sich weltweit Fachgesellschaften im Bereich der Psychoonkologie zu formieren. Im Jahr 1982 wurde die British Psychosocial-Oncology Society (BPOS), 1985 die Canadian Psychosocial Society (CAPO) und 1986 die American Psychosocial Oncology Society (APOS) gegründet. In dieser Zeit entstanden auch in Deutschland zwei Fachgesellschaften (s.u.). Auf der internationalen Ebene wurde auf Initiative von Jimmie Holland 1984 zunächst die von der amerikanischen Psychoonkologie deutlich geprägte International Psycho-Oncology Society (IPOS) gegründet. Im Sinne eines europäischen „Gegengewichts“ entstand 1987 die European Psycho-Oncology Society (ESPO), die ab Ende der 80er-Jahre regelmäßig europäische Kongresse für Psychoonkologie veranstaltete. Nach dem elften und letzten Kongress der ESPO in Heidelberg (Kongresspräsidentin: Monika Keller) strukturierte sich die ESPO |15|Ende 2001 um. Aus der Fachgesellschaft für Individualmitglieder wurde eine Dachorganisation von Fachgesellschaften, die European Federation of Psycho-Oncology Societies (EFPOS), die aber wenige Jahre nach ihrer Gründung ihre Aktivitäten einstellte.
Unter der Federführung von IPOS wurde 1992 der erste Weltkongress für Psychoonkologie in Beaune durchgeführt (Kongresspräsident: Robert Zittoun). Es folgten Kongresse in Kobe (1995), in New York (1996) und 1998 erstmals in Hamburg (750 Teilnehmer, Kongresspräsident: Uwe Koch). Es schlossen sich Weltkongresse in Melbourne (2000), Banff (2003), Kopenhagen (2004), Venedig (2006), London (2007), Madrid (2008), Wien (2009), Quebec (2010), Antalya (2011), Brisbane (2012), Rotterdam (2013), Lissabon (2014) und Washington DC (2015) an.
Im Jahr 1983 erschien erstmals das Journal of Psychosocial Oncology. Herausgeber war James R. Zabora. Zentralere Bedeutung für das Fach erlangte die von Jimmie Holland und Maggie Watson ab 1992 herausgegebene Zeitschrift Psycho-Oncology. Stark zur Identitätsbildung hat weiterhin das 1989 erstmals von Jimmie Holland und Julia Rowland herausgegebene Handbook of Psycho-Oncology beigetragen, das inzwischen in der überarbeiteten dritten Auflage erschienen ist. Das Gleiche gilt für die von IPOS kontinuierlich vergebenen Forschungspreise: der Arthur M. Sutherland Award, der Bernhard Fox Memorial Award, der Hiroomi Kawano New Investigator Award und der Noemi Fisman Award for Lifetime Clinical Excellence.
Auch einzelne Publikationen haben das Bild der Psychoonkologie in der (wissenschaftlichen) Öffentlichkeit stark mitgeprägt. David Spiegel (1989) und Fawzy und Kollegen (1993) fanden bei unterschiedlichen Gruppen von Krebskranken (Brustkrebspatientinnen, Melanom-Patienten) bei Teilnahme an psychoonkologischen Interventionsprogrammen Vorteile bezüglich der Überlebenszeit. Diese Ergebnisse, die sich in den nachfolgenden Replikationsuntersuchungen so nicht bestätigen ließen, haben Diskussionen über psychoonkologische Themen weit über die Fachgrenzen hinweg hervorgerufen.
Aus der seit Mitte der 1990er-Jahre stark durch IPOS geprägten Weiterentwicklung der internationalen Psychoonkologie sind insbesondere noch einige weitere Aktivitäten zu nennen. So wurde Ende der 90er-Jahre die IPOS Psychosocial Academy gegründet. Sie bietet mit internationalen Dozenten vor jedem der inzwischen jährlich durchgeführten Weltkongresse ein umfangreiches Workshop-Programm an. Darüber hinaus ist das IPOS Multilingual Core Curriculum in Psycho-Oncology, ein webbasiertes mehrsprachiges Fortbildungsprogramm zu nennen. Systematisch strukturierte und didaktisch gut konzipierte Vorlesungen zu zentralen Themen der Psychoonkologie werden relevanten Zielgruppen in verschiedenen Sprachen angeboten. 2006 wurde unter dem Dach von IPOS die Fe|16|deration of Psycho-Oncology Societies begründet. Sie versteht sich als Austauschort der verschiedenen nationalen psychoonkologischen Fachgesellschaften.
1.2 Meilensteine der Entwicklung der Psychoonkologie in Deutschland
Die Entwicklung der Psychoonkologie in Deutschland ist auch vor dem Hintergrund des Entwicklung der Psychosozialen Medizin und hier insbesondere der Psychosomatik und der Medizinischen Psychologie zu verstehen (vgl. Weiner, 1990; Adler et al., 2011). Auf der theoretischen Ebene dominierten bis in die 1970er-Jahre verschiedene theoretische Ansätze: psychogenetische/psychoanalytische Konzepte, der Ansatz einer ganzheitlichen klinischen Medizin und psycho-physiologische Ansätze. Während die Psychosomatik im engeren Verständnis die Einflüsse psychischer Faktoren auf die Entstehung bzw. Mitentstehung von körperlichen Erkrankungen fokussierte, entwickelte sich ab Mitte der 70er-Jahre komplementär die Somatopsychologie, die sich insbesondere mit den psychischen Auswirkungen von körperlichen Erkrankungen auf die psychische Befindlichkeit befasst. Dieser unterschiedlichen Betrachtung entspricht ein Wandel in der Orientierung in der frühen Psychoonkologie in Deutschland, nämlich von einem zunächst dominierenden Interesse an einer „Psychoätiologie“ der Krebserkrankung hin zu einer stärkeren Konzentration auf die Krankheitsfolgen. Eine entscheidende strukturelle Weichenstellung für die Entwicklung der psychosozialen Medizin in Deutschland war die Approbationsordnung von 1970, die zu einer Institutionalisierung der psychosozialen Fächer an den Medizinischen Fakultäten der Bundesrepublik Deutschland führte.
Ein Ereignis von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Psychoonkologie stellte ohne Zweifel die Gründung der Deutschen Krebshilfe durch Dr. Mildred Scheel im Jahre 1974 dar. Das von der Krebshilfe verfolgte Konzept schrieb der psychosozialen Betreuung von Krebspatienten von Anfang eine zentrale Bedeutung zu. Dies spiegelt sich auch in der Förderpolitik wider. In den 40 Jahren ihres Bestehens hat die Deutsche Krebshilfe zahlreiche Vorhaben, die einen direkten Bezug zur Entwicklung der Psychoonkologie in Versorgung und Forschung aufwiesen, finanziell unterstützt. Auf Initiative von Mildred Scheel wurde 1979 die Psychosoziale Nachsorgeeinrichtung für Krebspatienten an der Chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg aufgebaut. Diese erste europäische Einrichtung für die Nachbetreuung von Krebspatienten kann als Kristallisationspunkte der sich schrittweise etablierenden deutschen Psychoonkologie angesehen werden. Die Einrichtung, die inhaltlich eng mit dem Heidelberger Seminar für Psychosoziale Onkologie verbunden war, wurde bis 1984 von Almuth Sellschopp geleitet. Ihre Nachfolge übernahm ab 1984 Reinhold Schwarz.
|17|Einen deutlichen inhaltlichen Bezug zur Entwicklung der Psychoonkologie weist die Gründung des Krebsinformationsdienstes (KID) im Jahre 1986 am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg auf. Der von Almuth Sellschopp mit aufgebaute KID verstand sich von Anfang an als eine Institution zur Förderung der Patientenkompetenz. Das Angebot richtet sich an jeden, der Fragen zu Krebs hat: Patienten, ihre Familien und Freunde sowie an Menschen, die sich über Krebsvorbeugung und Krebsfrüherkennung informieren wollen. Für alle Fachleute, die an der Versorgung von Krebspatienten beteiligt sind, bietet der Krebsinformationsdienst individuell recherchierte Fakten und Quellen.
Auf die sich Ende der 1970er-Jahre in Deutschland entwickelnde Psychoonkologie nahmen über die bereits zuvor erwähnten Akteure hinaus einige weitere Personen Einfluss. Zu nennen sind hier u. a. Claus Bahne Bahnson, Margit von Kerekjarto und Fritz Meerwein. C. Bahnson – aus den USA zurückgekehrt – hatte dort u. a. in Philadelphia lange Zeit einen Consultation-Liaison-Service für Psychoonkologie aufgebaut und geleitet und in Kalifornien eine der ersten psychoneuroimmunologischen Studie weltweit initiiert. Er beriet die Deutsche Krebshilfe beim Aufbau der Psychosozialen Nachsorgeeinrichtung in Heidelberg und bot Fortbildungen und Schulungen im Bereich der Familientherapie bei Krebspatienten an (Bahnson, 1979). Margit von Kerekjarto, eine Schülerin des Hamburger Psychosomatikers Arthur Jores, führte bereits Anfang der 70er-Jahre Krebspatienten im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf psychologische Beratung und Psychotherapie durch und baute ab Ende der 70er-Jahre eine klinische und forschungsbezogene Gruppe auf, die bis heute zu den führenden psychoonkologischen Arbeitsgruppen in Deutschland zählt. Von Fritz Meerwein gingen wesentliche Impulse für die Gestaltung des ärztlichen Gesprächs aus (Meerwein, 1969, 1981). Er war auch Initiator des medizinpsychologischen Dienstes an der Abteilung für Onkologie des Universitätsspitals Zürich und gilt zu Recht als ein Pionier der Psychoonkologie in der Schweiz.
Die damalige schnelle Entwicklung der Psychoonkologie in Deutschland wurde auch durch die starke Resonanz auf Selbstdarstellungen in Büchern von betroffenen Krebspatienten in der Öffentlichkeit mitbestimmt. Zu nennen sind hier insbesondere die Bücher von Maxi Wander (1977), Fritz Zorn (1977), Susan Sontag (1978) und Liselotte Bappert (1979). Die Sichtbarkeit der Psychoonkologie als Wissenschaftsdisziplin dürfte sich auch durch 2 Werke in der Jahrbuchreihe „Medizinische Psychologie“, nämlich „Psychosoziale Onkologie“ von Rolf Verres und Monika Hasenbring (1989) sowie von Uwe Koch und Joachim Weis „Psychoonkologie – eine Disziplin in der Entwicklung“ (2009) erhöht haben. Auch das hier vorgelegte Handbuch der Psychoonkologie versteht sich in dieser Zielsetzung. Der inzwischen erreichte Entwicklungsstand der Psychoonkologie in Deutschland wird weiterhin durch die Tatsache gestützt, dass inzwischen mehrere für diese Disziplin spezifische Forschungspreise regelmäßig vergeben wer|18|den. Zu nennen sind hier der Reinhold Schwarz-Preis für Nachwuchswissenschaftler, der Helmut-Wölte Preis für innovative Projekte in der psychoonkologischen Versorgung und der Loni und Hans Faust-Preis für herausragende Projekte und Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der psychoonkologischen Versorgung. Darüber hinaus sind in den letzten 20 Jahren zahlreiche Preise des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (Roemer Preis und DKPM Promotionspreis) an Forscher und Forscherinnen verliehen worden, die im Bereich der Psychoonkologie geforscht haben.
1.3 Fachgesellschaften der Psychoonkologie
Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie e.V. (dapo) wurde 1983 gegründet. In ihr haben sich verschiedene Berufsgruppen (Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Kreativtherapeuten, Seelsorger, Pflegekräfte und weitere Berufsgruppen) zusammengeschlossen, die in der medizinischen und psychosozialen Versorgung von Krebskranken und deren Angehörigen tätig sind. Als bundesweite Vereinigung will die dapo den Austausch zwischen den einzelnen Professionen intensivieren, Erfahrungen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern bündeln sowie deren wissenschaftliche Bearbeitung anregen und unterstützen. Weiterhin will die dapo die Anerkennung der psychoonkologischen Versorgung und Forschung als integraler Bestandteil der Onkologie unterstützen.
Die Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie (PSO) in der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) wurde 1988 anlässlich des 19. Deutschen Krebskongresses in Frankfurt/Main gegründet. Ziel der Gründung war die Integration der Psychoonkologie als junges Arbeitsgebiet in die Onkologie sowie die Stärkung psychoonkologischer Forschung. Die PSO ist organisatorisch in die DKG eingebunden. Unter der Leitung des damaligen Sprechers der PSO, Reinhold Schwarz, wurden die ersten psychosozialen Krebskongresse in Deutschland in den Jahren 1989 und 1991 sowie zur Lebensqualitätsforschung in Kooperation mit der EORTC-Quality of Life Study Group 1994 und 1996 in Heidelberg durchgeführt. Die Forschungsaktivitäten im Rahmen der EORTC-Lebensqualitätsforschung werden von Susanne Singer bis heute aktiv weitergeführt. Eine weitere frühe Initiative der PSO war ein Memorandum zur Einrichtung eines Lehrstuhls für Psychoonkologie an die damalige Gesundheitsministerin Prof. Dr. Ursula Lehr im Jahre 1989. Die Initiative, die auf die akademische/universitäre Verankerung der Psychoonkologie zielte, war damals nicht erfolgreich. Erst im Jahr 2012 wurde bundesweit die erste Professur für Psychosoziale Onkologie am Universitätsklinikum Leipzig eingerichtet (Stelleninhaberin Anja Mehnert).
Ein wichtiges Anliegen der PSO war von Anfang an die Verbesserung der Qualität der psychosozialen Versorgung von Krebskranken durch entsprechende Fort- |19|und Weiterbildungen. Das gemeinsam seit 1994 von PSO und dapo realisierte bundesweite Programm „Weiterbildung Psychosoziale Onkologie“ (WPO) wurde 2006 als eigenständige Tochterorganisation WPO e.V. etabliert. Diese Einrichtung bietet zum einen ein interdisziplinäres Curriculum (WPO-IC) für unterschiedliche Berufsgruppen aus dem Bereich der Psychoonkologie (Psychologen, Ärzte, Sozialarbeiter, Seelsorger u. a.), zum anderen ein Curriculum für approbierte Psychotherapeuten (WPO-PT) an. Die PSO war auch die federführende Fachgesellschaft bei der Entwicklung und Implementierung der S3-Leitlinie „Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten“ (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe & AWMF, 2014; Projektleitung: Joachim Weis und Uwe Koch).
Spezifisch für die Anliegen der psychosozialen Unterstützung im Rahmen der pädiatrischen Onkologie wurde 1989 die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft in der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (PSAPOH) gegründet. Die PSAPOH versteht sich als Netzwerk und als unterstützende Organisation der im psychosozialen Bereich tätigen Mitarbeiter in Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern. Die Arbeit der PSAPOH zielt auf die Förderung der psychosozialen Versorgung krebskranker und hämatologisch erkrankter Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien als integraler Bestandteil der Pädiatrischen Onkologie und Hämatologie. Die Förderung der Qualifikation und Fortbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt ein wichtiges Anliegen dar. Die Projektgruppe Qualitätssicherung der PSAPOH hatte die Federführung bei der Entwicklung und Implementierung der S3-Leitlinie „Psychosoziale Versorgung in der Pädiatrischen Onkologie und Hämatologie, die im Jahr 2008 als S3-Leitlinie von der AWMF veröffentlicht und 2013 aktualisiert wurde.
1.4 Wissenschaftliche Förderprogramme im Bereich der deutschen Psychoonkologie
Die Robert-Bosch-Stiftung förderte Ende der 70er- und in der ersten Hälfte der 80er-Jahre ausgewählte psychoonkologische Projekte mit Modellcharakter. Das erste staatlich geförderte Programm stellte der BMBF-Förderschwerpunkt „Rehabilitation von Krebskranken (1987–1995) dar. Die 18 Projekte des Förderschwerpunktes hatten weniger die medizinische Rehabilitation sondern vielmehr die Psychoonkologie als thematischen Schwerpunkt. Die Projekte bezogen sich auf Prozesse der Krankheitsbewältigung, Belastungen von Berufsgruppen in der Onkologischen Versorgung, psychoonkologische Versorgungsmodelle und Interventionsansätze (vgl. Koch & Weis, 1998).
Nach größerer zeitlicher Latenz beschloss 2007 die Deutsche Krebshilfe die Implementierung des Förderschwerpunkts „Psychosoziale Onkologie“. In der |20|ersten Förderphase standen die Themen differenzieller Versorgungsbedarf, Inanspruchnahmeverhalten, die Weiterentwicklung von Interventionen, Versorgungskonzepte der psychosozialen Versorgung sowie psychoonkologische Versorgungsstandards im Vordergrund. In der zurzeit noch laufenden 2. Ausschreibungsrunde handelt es sich insbesondere um kontrollierte Evaluationsstudien unterschiedlicher Interventions- und Versorgungsangebote.
Eine weitere inzwischen abgeschlossene Förderung der Deutschen Krebshilfe bezog sich auf den Themenkomplex „psychosoziale Hilfen für Kinder krebskranker Eltern“ (2009–2012). Mit diesem Programm war die Erwartung verbunden, psychosoziale Versorgungsangebote für Kinder und Jugendliche mit einem an Krebs erkrankten Elternteil bedarfsorientiert und qualitätsgesichert weiter zu entwickeln und mittelfristig in der Versorgungspraxis zu verankern. Das geförderte multizentrische Verbundprojekt setzte sich mit den folgenden Themen auseinander: Identifikation des differenziellen Versorgungsbedarfes, Analyse der bestehenden Versorgungsangebote, Entwicklung und Evaluation von Interventionskonzepten und Entwicklung von nachhaltigen strukturellen Versorgungskonzepten und geeigneten Qualitätssicherungsstandards (Romer et al., 2014).
Zu nennen sind darüber hinaus zwei weitere noch aktuelle Förderprogramme der Deutschen Krebshilfe mit Bezug zur Psychoonkologie: das Förderprogramm „Psychosoziale Krebsberatungsstellen“ (seit 2008) und das Förderprogramm „Palliativmedizin“ (seit 2007). Das Programm Krebsberatungsstellen verfolgt das Ziel, ein Netzwerk qualitätsgesicherter Krebsberatungsstellen („Kompetenz-Beratungsstellen“) aufzubauen, die als Impulsgeber und beratende Instanzen für weitere Beratungsstellen in Deutschland fungieren sollen. Das Programm Palliativmedizin will einen Beitrag zur Verbesserung der palliativmedizinischen Versorgung und Ausbildung leisten. Im Rahmen dieses Programms fördert die Deutsche Krebshilfe vier Stiftungsprofessuren an den Standorten Bonn, Erlangen, Freiburg und Mainz. Darüber hinaus werden stationäre und ambulante Palliativdienste sowie wissenschaftlich ausgerichtete Projekte zur palliativmedizinischen Versorgung unterstützt.
Als letztes und besonders aktuelles Programm sind Projekte im Rahmen des Förderschwerpunkts „Forschung im Nationalen Krebsplan“ des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) zu nennen. Unter den Zielen 9 bis 13 werden Projekte gefördert, die darauf zielen, Krebspatienten bei Bedarf eine angemessene psychoonkologische Versorgung zu ermöglichen und Patientenorientierung, Kommunikation und Patientenkompetenz zu fördern.
|21|Literatur
Aaronson, N. (Ed.). (1987). The quality of life of cancer patients. New York: Ravens Press.
Abrams, R. E. & Finesinger, J. E. (1953). Guilt Reactions in Patients with Cancer. Cancer,6, 474–482. Crossref
Adler, R., Herzog, W., Joraschky, P., Köhle, K., Langewitz, W., Söllner, W. et al. (Hrsg.). (2011). Psychosomatische Medizin. Theoretische Modelle und klinische Praxis (7. Aufl.). München: Elsevier.
Bahnson, C. B. (1979). Das Krebsproblem in Psychosomatischer Dimension. In T.v. Uexküll (Hrsg.), Lehrbuch für Psychosomatische Medizin (S. 685 – 698). München: Urban und Schwarzenberg.
Bappert, L. (1979). Der Knoten: Vertrauen u. Verantwortung im Arzt-Patient-Verhältnis am Beispiel Brustkrebs. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Bard, M. & Sutherland, A. M. (1955). Psychological Impact of Cancer and its Treatment IV Adaptation to Radical Mastectomy. Cancer,8, 656–672. Crossref
Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe & AWMF (2014). Leitlinienprogramm Onkologie: Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten, Leitlinienreport 1.0 (AWMF-Registernummer: 032/051OL). Zugriff am 05.03.2015 unter http://leitlinienprogramm-onkologie.de/Leitlinien.7.0.html.
Dyk, R. B. & Sutherland, A. M. (1956). Adaptation of the Spouse and Other Family Members to the Colostomy Patients. Cancer,9, 123–138. Crossref
Fawzy, F. I., Fawzy, N. W., Hyun, C. S., Elashoff, R., Guthrie, D., Fahey, J. L.et al. (1993). Malignant melanoma. Effects of an early structured psychiatric intervention, coping, and affective state on recurrence and survival 6 years later. Archives of General Psychiatry,50, 681–689. Crossref
Holland, J. & Rowland, J. (1989). Psycho-Oncology. New York: Oxford University Press.
Holland, J. & Weiss, T. R. (2010). History of Psycho-oncology. In J.Holland (Ed.), Handbook of Psycho-Oncology (pp. 3 – 12). New York: Oxford University Press.
Kerekjarto, M. v. & Schug, S. (1987). Psychosoziale Betreuung von Tumorpatienten im ambulanten und stationären Bereich: Bilanz eines 5jährigen Modellversuchs. München: Zuckschwerdt.
Koch, U. & Weis, J. (Hrsg.). (1998). Krankheitsbewältigung bei Krebs und Möglichkeiten der Unterstützung. München: Schattauer.
Koch, U. & Weis, J. (2009). Psychoonkologie 2009. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie (Bd. 22). Göttingen: Hogrefe.
Kübler-Ross, E. (1969). Death and dying. New York: Scribner.
Meerwein, F. (1969). Grundlagen des ärztlichen Gesprächs. Bern: Huber.
Meerwein, F. (1981). Einführung in die Psycho-Onkologie. Bern: Huber.
Romer, G., Bergelt, C. & Möller, B. (Hrsg.). (2014). Kinder krebskranker Eltern-Manual zur kindzentrierten Familienberatung nach dem COSIP-Konzept. Göttingen: Hogrefe.
Saunders, C. & Baines, M. (1991). Leben mit dem Sterben: Betreuung und medizinische Behandlung todkranker Menschen. Bern: Huber.
Shands, H. C., Finesinger, J. E., Cobb, S. & Abrams, R. E. (1951). Psychological Mechanisms in Patients with Cancer. Cancer,4, 1159–1170. Crossref
Sontag, S. (1978). Illness as Metaphor. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Spiegel, D., Bloom, J. R. & Kraemner, H. C. (1989). Effects of psychological treatment on survivial of patients with metastatic breast cancer. Lancet,2, 888–892. Crossref
|22|Sutherland, A. M., Orbach, C. G., Dyk, R. B. & Bard, M. (1952). The Psychological Impact of Cancer and Cancer Surgery: Adaptation to the Dry Colostomy. Cancer,5, 852–872. Crossref
Verres, R. & Hasenbring, M. (Hrsg.). (1989). Psychosoziale Onkologie. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie (Bd. 3). Heidelberg: Springer. Crossref
Wander, M. (1977). Guten Morgen, du Schöne. Protokolle nach Tonband. Berlin: Der Morgen.
Watson, M., Dunn, J. & Holland, J. (2014). Review of the history and development in the field of psychosocial oncology. International Review of Psychiatry,26, (1), 128–135. Crossref
Weiner, H. (1990). Auf dem Weg zu einem integrierten biomedizinischem Modell. Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie,40, 81–101.
Weisman, A. (1993). An Omega Interview. Journal of Death and Dying,27, (2), 97–103. Crossref
Zorn, F. (1977). Mars. München: Kindler.
|23|2 Krebsepidemiologie in Deutschland
Sylke R. Zeissig und Maria Blettner
2.1 Wie häufig ist Krebs?
2.1.1 Inzidenz
In Deutschland erkrankten nach Schätzung des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) im Jahr 2010 ca. 252 400 Männer und ca. 224 900 Frauen neu an einem bösartigen Tumor. Die Diagnose einer Krebserkrankung betrifft jeden zweiten Mann (51 %) und etwa 43 % aller Frauen im Laufe ihres Lebens (Robert Koch-Institut & Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. [RKI & GEKID], 2013). Diese Zahlen umfassen alle bösartigen Neubildungen einschließlich Lymphomen und Leukämien, ohne die nicht-melanotischen Hautkrebserkrankungen, die zwar sehr häufig auftreten, jedoch nur selten zum Tod führen und daher nach internationaler Übereinkunft nicht in die Schätzungen epidemiologischer Register eingehen. Bei Männern ist Prostatakrebs mit ca. 65 800 Neuerkrankungen jährlich, bei Frauen Brustkrebs mit etwa 70 300 Fällen am häufigsten (vgl. Abb. 2.1). Bei Frauen steht der Darmkrebs an zweiter Stelle, gefolgt vom Lungenkrebs, bei Männern war das Bronchialkarzinom 2010 etwas häufiger als die kolorektalen Tumoren. Die vier Tumorarten machen mehr als 50 % aller Krebserkrankungen aus. Bemerkenswert auch deshalb, weil hier ein enormes Potenzial liegt, die Krankheitslast zu reduzieren.
Abbildung 2.1: Prozentualer Anteil der häufigsten Tumorlokalisationen an allen Krebsneuerkrankungen in Deutschland 2010 (ohne nicht-melanotischen Hautkrebs). Genehmigter Nachdruck aus: RKI & GEKID (2013)
|24|Das Risiko, an Darmkrebs oder an Lungenkrebs zu erkranken, ist durch den Lebensstil beeinflussbar. Im Mittel erkranken Betroffene beiderlei Geschlechts mit 69 Jahren. Allerdings fällt die Beziehung zwischen Lebensalter und Krebsinzidenz bei den Geschlechtern unterschiedlich aus: Bei Männern treten Krebserkrankungen seltener vor dem 55. Lebensjahr auf. In höherem Alter kehrt sich das Verhältnis um, mit ab dem 65. Lebensjahr fast doppelt so hoher Inzidenz bei Männern (vgl. Abb. 2.2).
Abbildung 2.2: Altersspezifische Erkrankungsraten nach Geschlecht für Krebs gesamt (ICD-10 C00 – 97 ohne C44), 2009–2010. Genehmigter Nachdruck aus: RKI & GEKID (2013)
2.1.2 Prävalenz
Für 2010 prognostizierte das ZfKD eine 5-Jahres-Prävalenz für alle Krebserkrankungen von ca. 770 000 Männern und 753 000 Frauen. Das heißt, ca. 1,4 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Krebsdiagnose, die nicht länger als fünf Jahre zurück liegt und damit gemeinhin noch nicht als geheilt gilt (RKI & GEKID, 2013).
2.1.3 Mortalität
Nach Schätzungen des Robert Koch-Institutes (2013) verstirbt in Deutschland jede fünfte Frau und sogar jeder vierte Mann an Krebs. Die häufigste Krebstodesursache bei Frauen ist der Brustkrebs, bei Männern das Bronchialkarzinom |25|(RKI & GEKID, 2013). Leider ist inzwischen auch bei den Frauen Lungenkrebs an zweiter Stelle – mit einem nur geringfügig höheren Anteil als Krebserkrankungen des Darmes, die bei Männern die zweithäufigste und bei Frauen die dritthäufigste Todesursache darstellen (vgl. Abb. 2.3).
Abbildung 2.3: Prozentualer Anteil der häufigsten Tumorlokalisationen an allen Krebssterbefällen in Deutschland 2010 (Quelle: Amtliche Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden). Genehmigter Nachdruck aus: RKI & GEKID (2013)
2.1.4 Zeitliche Trends
Absolut gesehen hat die Zahl jährlich neu auftretender Krebserkrankungen in Deutschland von 2000 bis 2010 bei Frauen um 14 %, bei Männern um 21 % zugenommen (vgl. Abb. 2.4). Allerdings ist dieser Anstieg – gerade bei den Männern – in erster Linie dem veränderten Altersaufbau der Bevölkerung geschuldet.
Entsprechend niedriger fällt der Anstieg der altersstandardisierten Erkrankungsraten im gleichen Zeitraum aus: Kein Anstieg für Männer und nur 7 % für Frauen, was im Wesentlichen dem Anstieg der Neuerkrankungsraten an Brustkrebs nach Einführung des Mammografie-Screenings zwischen 2005 und 2009 zugeschrieben werden kann. Die altersstandardisierten Sterberaten sind bei beiden Geschlechtern rückläufig (vgl. Abb. 2.5; RKI & GEKID, 2013).
Abbildung 2.4: Absolute Zahl der Neuerkrankungs- und Sterbefälle, nach Geschlecht, Krebs gesamt (ICD-10 C00 – 97 ohne C44), Deutschland 1999–2010. Genehmigter Nachdruck aus: RKI & GEKID (2013)
Abbildung 2.5: Altersstandardisierte Erkrankungs- und Sterberaten, nach Geschlecht, Krebs gesamt (ICD-10 C00 – 97 ohne C44), Deutschland 1999–2010. Genehmigter Nachdruck aus: RKI & GEKID (2013)
|27|2.1.5 Überlebensraten
Die relativen Überlebensraten (Überleben Krebskranker in Relation zum Überleben der allgemeinen Bevölkerung, geschätzt anhand von Sterbetafeln entsprechend der Alters- und Geschlechtsstruktur) sind je nach Lokalisation stark unterschiedlich. Die Spanne reicht von über 90 % (Malignes Melanom, Hoden, Prostata) bis unter 20 % (Lunge, Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse). Mit durchschnittlichen 61 % für Männer und 67 % für Frauen liegen die Überlebensraten aktuell deutlich besser als noch vor einigen Jahrzehnten. Dazu haben auch Verschiebungen im Spektrum der Lokalisationen beigetragen wie der Rückgang der prognostisch ungünstigen Magentumoren und bei Männern der Bronchialkarzinome bei gleichzeitiger Zunahme von Darm-, Brust- und Prostatakrebs mit eher günstiger Prognose (RKI & GEKID, 2013).
2.1.6 Prävention
In vielen epidemiologischen Studien wurden die Risikofaktoren für die verschiedenen Tumorarten untersucht, auch um mögliche Präventionsstrategien zu entwickeln. Der wichtigste Risikofaktor für das Entstehen von Krebs ist das Rauchen: ca. 90 % aller Lungenkrebsfälle und etwa ein Drittel aller Krebsfälle insgesamt sind dem Tabakkonsum anzulasten (Colditz & Hunter, 2000). Neben dem Rauchen beeinflussen Ernährungsgewohnheiten, Alkohol, Übergewicht und Bewegungsmangel die Krebsentstehung. Es ist seit langem bekannt, dass Viren zu Krebs führen können: Schätzungsweise 5 bis 15 % aller Krebserkrankungen weltweit werden inzwischen Infektionen mit Viren und anderen Erregern angelastet. Am bekanntesten sind sicher die Ergebnisse zu HPV und Gebärmutterhalskrebs; Hepatitis-Infektionen können zur Entstehung von Leberkrebs beitragen. Es wird geschätzt, dass ca. 5 bis 10 % aller Tumoren durch erbliche Faktoren entstehen und nur 1 bis 2 % durch umweltbedingte Faktoren wie Luftschadstoffe und ionisierende Strahlung (Colditz & Hunter, 2000). Einige Faktoren, die zur Entstehung von Tumoren beitragen, sind auch für den weiteren Verlauf der Krankheit von Bedeutung. So wurde in einigen Studien untersucht, dass Raucher eine geringere Überlebenschance haben als Nichtraucher, ebenso ist bekannt, dass Sport als adjuvante Therapie sinnvoll ist.
2.2 Woher stammen die Daten?
2.2.1 Aufgaben epidemiologischer Krebsregister
Epidemiologische Krebsregister beobachten das Auftreten und die Trendentwicklung aller Formen von Krebserkrankungen. Damit werden Grundlagen für die Gesundheitsplanung bereitgestellt und Daten in anonymisierter Form für die epidemiologische Forschung genutzt.
|28|Wichtige Voraussetzung zur Beantwortung dieser Fragen ist die bevölkerungsbezogene flächendeckende Erfassung aller Krebsneuerkrankungen in definierten Erfassungsgebieten (z. B. einem Bundesland).
2.2.2 Krebsregistrierung in den einzelnen Bundesländern
Inzwischen werden in ganz Deutschland neuauftretende Krebserkrankungen systematisch auf Basis eigener Ländergesetze erfasst (vgl. Tab. 2.1). Datenschutz spielt eine wichtige Rolle im sensiblen Bereich der Krebsregistrierung. Für länderübergreifende Fragestellungen ist die „Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID)“ ein gemeinsamer Ansprechpartner der epidemiologischen Krebsregister (vgl. Tab. 2.1). Noch ist nicht in allen Bundesländern das Ziel einer flächendeckenden Registrierung erreicht. Das Zentrum für Krebsregisterdaten schätzte jedoch 2012, dass für eine Bevölkerung von mehr als 50 Millionen Einwohnern belastbare Daten zur Inzidenz von Krebserkrankungen vorliegen (RKI & GEKID, 2013). Deutschland hat damit zur Spitzengruppe weltweit aufgeschlossen.
Tabelle 2.1: Internetadressen der Krebsregister in Deutschland
Bundesland
Internetadresse
Krebsregister Baden-Württemberg
http://www.krebsregister-bw.de
Krebsregister Bayern
http://www.krebsregister-bayern.de
Krebsregister Bremen
http://www.krebsregister.bremen.de
Hamburgisches Krebsregister
http://www.hamburg.de/krebsregister
Krebsregister Hessen
http://www.laekh.de
Krebsregister Nordrhein-Westfalen
http://www.krebsregister.nrw.de
Krebsregister Niedersachsen
http://www.krebsregister-niedersachsen.de
Krebsregister Rheinland-Pfalz
http://www.krebsregister-rheinland-pfalz.de
Krebsregister Saarland
http://www.krebsregister.saarland.de
Krebsregister Schleswig-Holstein
http://www.krebsregister-sh.de
Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen
http://www.krebsregister.berlin.de
Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID)
http://www.gekid.de
Deutsches Kinderkrebsregister
http://www.kinderkrebsregister.de
|29|2.2.3 Deutsches Kinderkrebsregister
Seit 1980 werden am Deutschen Kinderkrebsregister in Mainz Krebsfälle bei Kindern unter 15 Jahren (seit 2009 unter 18 Jahren) flächendeckend für ganz Deutschland (seit 1991 auch für die neuen Länder) erfasst. Etwa 1 800 Patienten jährlich werden aus den pädiatrisch-onkologischen Einrichtungen gemeldet, die in der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) zusammengeschlossen sind (vgl. Tab. 2.1).
2.2.4 Zentrum für Krebsregisterdaten
Auf Grundlage der Daten der epidemiologischen Krebsregistrierung in Deutschland schätzt das Robert Koch-Institut jährlich die Zahl aller pro Jahr in Deutschland neu aufgetretenen Krebserkrankungen. Nach dem Bundeskrebsregisterdatengesetz von 20091 liefern die Landeskrebsregister hierfür jährlich die Daten an das 2010 neu entstandene Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD).
2.3 Wo findet man die Daten?
2.3.1 Krebs in Deutschland
Alle zwei Jahre wird von GEKID und ZfKD gemeinsam die Broschüre „Krebs in Deutschland“ herausgegeben. Darin werden für 24 ausgewählte Krebsarten Daten zur Neuerkrankungsrate (Inzidenz), Sterblichkeit (Mortalität), 5-Jahres-Prävalenz (Zahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt lebenden Personen, die innerhalb der fünf Jahre zuvor an Krebs erkrankt sind) und Überlebensraten dargestellt (RKI & GEKID, 2013). Informationen zu zeitlichen Trends, Risikofaktoren und zur internationalen Einordnung runden das Bild ab. Ein eigenes Kapitel ist Krebs bei Kindern und Jugendlichen gewidmet. Die Broschüre ist in gedruckter Form beim Robert Koch-Institut erhältlich bzw. steht zum Download zur Verfügung (RKI & GEKID, 2013).
2.3.2 GEKID-Atlas
Der interaktive Krebsatlas zur aktuellen Krebshäufigkeit und -sterblichkeit in den Bundesländern ist über die Homepage der GEKID (www.gekid.de) abrufbar. Dort können in tabellarischer und kartografischer Form interaktive Ländervergleiche für 23 Krebslokalisationen inklusive der Darstellung von Zeittrends durchgeführt werden.
|30|2.3.3 Berichte der einzelnen Landeskrebsregister
Viele der Landeskrebsregister veröffentlichen ihre Ergebnisse regelmäßig in Form gedruckter und/oder online verfügbarer Jahresberichte, darüber hinaus bieten inzwischen die meisten Register eine interaktive Datenbankabfrage über ihre Internetseiten an (vgl. Tab. 2.1).
2.4 Fazit
Krebs gehört in Deutschland zu den häufigsten Erkrankungen und ist leider auch eine häufige Todesursache. Trotz erheblicher Fortschritte in der Therapie von Krebserkrankungen bleibt die Diagnose für die Betroffenen ein (lebens)bedrohliches Ereignis. Um weitere Ansätze zur Prävention generieren zu können, ist die Ursachenforschung von großer Bedeutung im Kampf gegen diese Erkrankung. Verbesserte Heilungschancen und die damit hohe Prävalenz von Krebserkrankungen in unserer Gesellschaft stellen aber auch eine Herausforderung für die Erforschung der Langzeitfolgen von Krebs dar. Für die Psychoonkologie bedeutsam sind hier besonders Studien zur Versorgungsrealität, zur Lebensqualität und zu möglichen psychischen Spätfolgen Langzeitüberlebender mit Krebs. Zur Qualitätssicherung der onkologischen Versorgung wurde im Rahmen des Nationalen Krebsplans im Frühjahr 2013 das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz2 (KFRG) verabschiedet. Damit ist zu erwarten, dass wir in einigen Jahren – neben der epidemiologischen – auch eine flächendeckende klinische Krebsregistrierung in Deutschland haben werden. Damit werden zukünftig sehr viel detailliertere Daten zum Verlauf von Krebserkrankungen auch für die Versorgungsforschung vorliegen.
Literatur
Colditz, G. A. & Hunter, D. (Eds.). (2000). Cancer Prevention: The Causes and Prevention of Cancer (Vol. 1). Berlin: Springer.
Robert Koch-Institut & Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (RKI & GEKID) (Hrsg.). (2013). Krebs in Deutschland 2009/2010 (9. Ausgabe). Berlin: Autor.
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bkrg/gesamt.pdf
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil 1 Nr. 16, ausgegeben zu Bonn am 8. April 2013
|31|3 Ätiologische und pathogenetische Grundlagen der Krebsentstehung
Anna Brandt und Martin Trepel
3.1 Tumorenentstehung
Man nimmt an, dass das Tumorwachstum von einer normalen Körperzelle ausgeht, die schrittweise zu einer sog. Tumorstammzelle transformiert (Böcker et al., 2012). Daraus bildet sich eine monoklonale Zellpopulation. Ein Teil der Tumorstammzellen differenziert sich dann mit Merkmalen ähnlich denen des Muttergewebes, ein anderer Teil proliferiert. Mit der Zeit verdrängen und ersetzen die Tumorzellen die normalen Zellen.
Eine Tumorzelle entsteht schrittweise durch eine Reihe von Defekten in verschiedenen Genen. Sie treten meist nicht zum gleichen Zeitpunkt ein, sondern entwickeln sich möglicherweise über mehrere Jahre, in denen die betroffenen Zellen entweder als Tumorzellvorstufen oder bereits als manifeste Krebszellen bestehen. Diese Defekte betreffen v. a. Gene, die regulatorische Funktionen ausüben. Zwei antagonistisch wirkende Klassen von Genen sind bei der Tumorentstehung besonders häufig verändert: wachstumsfördernde Protoonkogene und wachstumshemmende Tumorsuppressorgene (Kumar et al., 2003). Mutierte Protoonkogene werden als Onkogene bezeichnet. Die Wirkung von Onkogenen ist dominant, d. h. sie wird auch manifest, wenn nur eines der zwei Allele verändert ist. Bei den Tumorsuppressorgenen hingegen müssen beide Allele verändert sein, um Zellen zu transformieren.
Bei den genetischen Veränderungen, die zur Aktivierung von Onkogenen oder Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen führen, kann es sich um Punktmutationen, Translokationen, Deletionen oder Amplifikationen von Genabschnitten handeln. Einige Beispiele: Punktmutationen in RAS-Genen werden in etwa 20 % aller Tumoren gefunden, so z. B. bei Tumoren des Pankreas und des Kolons. Chromosomale Translokationen wie die Translokation t(9; 22) mit daraus resultierender Bildung des sog. Philadelphia-Chromosoms bei der chronisch myeloischen Leukämie führen durch Bruch und anschließende Verknüpfung nicht zueinander gehörender Abschnitte des Genoms zu Fusionsgenen, deren Produkte in ihrer Funktion verändert sind. Bei Deletionen oder Amplifikationen kommt es zum Verlust bzw. zur Vermehrung von genetischem Material.
|32|3.2 Eigenschaften von Tumorzellen
In einem Versuch, trotz der großen Diversität der verschiedenen Tumorerkrankungen gemeinsame Prinzipien bei der Tumorentstehung zu identifizieren, haben Hanahan und Weinberg sechs fundamentale Eigenschaften von Tumorzellen beschrieben, welche diese während der Tumorprogression erwerben (Hanahan & Weinberg, 2000). Später wurden diese sechs Eigenschaften um zwei weitere charakteristische Eigenschaften ergänzt und es wurde vorgeschlagen, dass diesen maligne Tumoren kennzeichnenden Eigenschaften (Hallmarks of Cancer) als Grundvoraussetzungen eine genomische Instabilität und ein pro-inflammatorisches Tumorstroma zugrunde liegen (Hanahan & Weinberg, 2011). Im Folgenden sollen diese acht Eigenschaften von Tumorzellen sowie deren Voraussetzungen in vereinfachter Form zusammengefasst werden.
3.2.1 Genomische Instabilität und pro-inflammatorisches Tumorstroma
Den spezifischen Eigenschaften von Tumorzellen liegen als Grundvoraussetzungen eine genomische Instabilität und ein pro-inflammatorisches Tumorstroma zugrunde.
Der maligne Phänotyp entsteht durch eine Reihe von Veränderungen im Genom der Tumorzellen. Unter physiologischen Bedingungen sorgen verschiedene DNA-Reparaturmechanismen dafür, dass DNA-Schäden, die durch chemische Substanzen, Strahlen oder andere Mutagene ausgelöst werden, entfernt werden (Ciccia & Elledge, 2010). Treten beispielweise während der DNA-Replikation Basenfehlpaarungen auf, werden diese durch das DNA-Reparatursystem erkannt und beseitigt. Vorstellbar ist, dass Tumorzellen dann entstehen können, wenn spontane Mutationen im Genom an den Stellen entstehen, die z. B. für die Regulation der DNA-Reparatur oder die für die Reparatur benötigte Zellzyklusregulation oder aber für die Regulation des programmierten Zelltodes (Apoptose, die dann initiiert wird, wenn DNA-Schäden nicht repariert werden können) verantwortlich sind. Das ist Grundlage der sog. „Genetischen Instabilität“, die dafür sorgt, dass die Zelle sich trotz fehlerhaften Genoms weiter vermehren kann und durch spontane weitere Mutationen, die ebenfalls nicht repariert werden, zusätzliche Eigenschaften erworben werden, die die Tumorzellen charakterisieren. Dies erklärt zum einen den Erwerb eines so komplexen Eigenschaftsmusters, wie es im Folgenden geschildert wird. Es erklärt aber auch die Tatsache, dass manifeste Tumoren in der Situation, in der sie klinisch apparent und diagnostiziert werden, trotz der eigentlich ursprünglich monoklonalen Zellpopulation (also alle Zellen des Tumors leiten sich wahrscheinlich aus einer Mutterzelle ab) längst sehr heterogene Zellpopulationen mit im Einzelnen möglicherweise sehr unterschiedlichen Ei|33|genschaften sind. Das spielt für die pathologische Diagnostik und die medikamentöse Behandlung maligner Tumoren eine wichtige Rolle.
Eine genomische Instabilität kann nicht nur durch spontane Mutationen erworben werden, sondern auch angeboren sein. Ein Beispiel für eine solche Konstellation ist die seltene erbliche Erkrankung Xeroderma pigmentosum, die durch einen Defekt im sog. „Nukleotid-Exzisions-Reparatursystem“ charakterisiert ist, das durch UV-Strahlung verursachte DNA-Schäden repariert. Patienten mit dieser Erkrankung entwickeln nach Sonnenexposition vermehrt Karzinome der Haut.
Neben Veränderungen im Genom der Tumorzellen spielt bei der Tumorentstehung auch das Umfeld der Tumorzellen (das sog. „Microenvironment“) eine wichtige Rolle (Grivennikov et al., 2010). Dort kann man sehr häufig unterschiedlich dichte Infiltrate von Entzündungszellen beobachten. Diese Zellen, die zusammen mit anderen Zelltypen das sog. „Tumorstroma“ bilden und in engem Kontakt mit den Tumorzellen stehen, können viele der typischen Eigenschaften von Tumorzellen fördern, indem sie z. B. Wachstumsfaktoren sezernieren und die Tumorzellen so zur Proliferation anregen.
3.2.2 Das Aufrechterhalten von Wachstumssignalen
Onkogene wirken wachstumsfördernd. Die Expressionsprodukte von Onkogenen heißen Onkoproteine. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Tumorzellen unabhängig von Wachstumsfaktoren oder anderen äußeren Signalen produziert werden können. Wachstumsfaktoren interagieren mit ihrer Zielzelle über spezifische Rezeptoren auf der Zelloberfläche, die meistens der Familie der Rezeptoren mit Tyrosinkinaseaktivität angehören, und aktivieren so Bestandteile der intrazellulären Signaltransduktionskaskade. Das Signal wird zum Zellkern weitergeleitet und leitet dort die Transkription von Zielgenen ein. Um Wachstumssignale aufrechtzuerhalten, bedienen sich Tumorzellen unterschiedlicher Strategien, die verschiedene Abschnitte dieser Signaltransduktionskaskade betreffen.
Tumorzellen können die Fähigkeit erwerben, den Wachstumsfaktor zu sezernieren, für den sie den passenden Rezeptor besitzen (autokrine Sekretion) und werden dadurch unabhängig von äußeren Wachstumssignalen. So sezernieren beispielweise Glioblastomzellen häufig den Wachstumsfaktor PDGF (engl. platelet-derived growth factor).
Viele Tumoren weisen durch Mutationen oder Amplifikationen veränderte Wachstumsfaktorrezeptoren auf. Der Wachstumsfaktorrezeptor Her2/neu ist bei ca. 20 % aller Mammakarzinome überexprimiert. Dies führt dazu, dass bereits geringe Mengen von Wachstumsfaktoren ausreichen, um die Tumorzellen zur Proliferation anzuregen. Anti-Her2-Antikörper blockieren den Her2-Rezeptor und wer|34|den mit Erfolg bei Patienten eingesetzt, bei denen Her2 überexprimiert ist (Eisenhauer, 2001).
Jeder Bestandteil der intrazellulären Signaltransduktionskaskade kann potenziell als Onkogen wirken, das Wachstumssignale zum Zellkern sendet. Eine wichtige Funktion kommt hier dem Ras-Protein zu. Das Ras-Protein ist zentraler Bestandteil der Signaltransduktionskaskade vom Wachstumsfaktorrezeptor zum Zellkern (Löffler et al., 2007). Die Inaktivierung vom Ras-Protein wird über das GTPase-aktivierende Protein (GAP) vermittelt, indem es die GTPase-Aktivität von Ras fördert und es so in Ras-Guanosindiphosphat (-GDP) überführt. Das durch Mutation veränderte Ras-Protein kann das GAP-Protein nicht mehr binden, was dazu führt, dass Ras im aktivierten Zustand verbleibt und wachstumsfördernde Signale zum Zellkern senden kann.
Das Aufrechterhalten von Wachstumssignalen kann auch durch Veränderungen in Genen ausgelöst werden, welche die Transkription regulieren. Durch Überexpression des Myc-Transkriptionsfaktors werden beispielsweise verschiedene, das Zellwachstum fördernde Gene angeschaltet. Durch die Bildung von Cyclin-abhängigen Kinasen (CDKs) können die Tumorzellen in den Zellzyklus eintreten und proliferieren (Deshpande et al., 2005). Amplifikationen des MYC-Gens werden bei verschiedenen Tumoren wie z. B. bei kleinzelligen Bronchialkarzinomen oder bei Lymphomen beobachtet.
3.2.3 Das Umgehen von wachstumshemmenden Signalen
Tumorsuppressorgene wirken wachstumshemmend. Die Produkte von Tumorsuppressorgenen werden auch Anti-Onkoproteine genannt. Sie hemmen den Übergang in die Synthese-Phase (S-Phase) des Zellzyklus. Die beiden am besten verstandenen Anti-Onkoproteine sind das Retinoblastom-Protein (Rb) und das Protein p53 (Burkhart & Sage, 2008; Lane, 1992; Sherr & McCormick, 2002).
Die normale Funktion von Rb besteht darin, den Eintritt in die S-Phase des Zellzyklus zu verhindern. Wenn es durch Mutationen im Retinoblastom-Gen oder Mutationen in Genen, die Rb regulieren, zu einem Funktionsverlust von Rb kommt, können die Zellen ungehindert in den Zellzyklus eintreten und proliferieren. Mutationen im Retinoblastom-Gen sind in verschiedenen Tumoren nachweisbar. Beim familiären Retinoblastom, einem Tumor der Netzhautzellen des Auges, der meistens noch vor dem fünften Lebensjahr auftritt, wird eine Mutation als Keimbahnmutation ererbt, während die zweite Mutation als somatische Mutation erworben wird.
Das Protein p53 wird auch als „Hüter des Genoms“ bezeichnet, da es beim Auftreten von DNA-Schäden den Übergang in die S-Phase des Zellzyklus hemmt, damit die Zellen die Möglichkeit bekommen, die DNA-Schäden zu reparieren |35|oder den programmierten Zelltod (Apoptose) einzuleiten. Bei Funktionsverlust von p53 können die Zellen ihre DNA-Reparaturmechanismen nicht aktivieren, die Apoptose kann nicht eingeleitet werden und genetische Schäden akkumulieren. p53 ist bei über der Hälfte aller malignen Tumoren mutiert.
3.2.4 Das Widersetzen gegen Apoptose
Tumorzellen können durch Mutationen in Genen, welche die Einleitung des programmierten Zelltodes, der Apoptose, regulieren, einen Überlebensvorteil gegenüber normalen Zellen erwerben. Es gibt unterschiedliche Signalwege zur Aktivierung der Apoptose. Eine zentrale Rolle in diesen Signalwegen spielen u. a. verschiedene Caspasen, die Mitochondrienmembran und das Protein Bcl-2 (Cory & Adams, 2002).
Bei einem großen Teil der follikulären Lymphome, einem Tumor aus der Gruppe der B-Zell-Lymphome, kann man die t(14; 18)-Translokation nachweisen. Durch diese Translokation wird Bcl-2 überexprimiert. Bcl-2 schützt die Lymphomzellen vor der Apoptose. Weil bei ihrer Entstehung v. a. eine verlängerte Lebensdauer der Lymphomzellen und nicht primär ein gesteigertes Zellwachstum eine Rolle spielt, wachsen follikuläre Lymphome charakteristischerweise langsam.





























