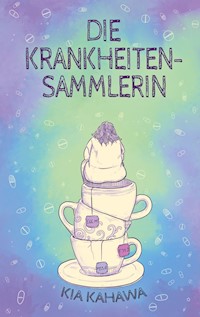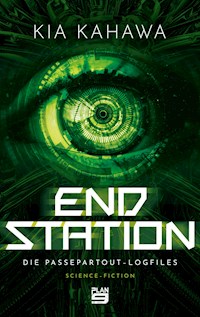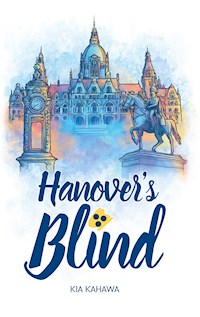
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Blinde tanzen nicht?Adam will ein Leben, das man tanzt. Keines, das lediglich die Wahl des geringsten Übels bedeutet. Der Studienabbrecher ist auf der Suche nach dem, was andere haben: einen gleichberechtigen Platz in der Gesellschaft. Um endlich auf eigenen Beinen zu stehen, immigriert er in seine Traumstadt Hannover. Doch die Möglichkeiten, sich als Mensch mit Behinderung ein eigenständiges Leben aufzubauen, sind begrenzt. Er verheimlicht seine Sehbehinderung, ohne zu erkennen, dass er sich damit selbst die größten Hürden baut. Sein Neuanfang lehrt Adam das Lieben, Tanzen und das Scheitern. Eine Erzählung über den Mut, sich von Erwartungen zu lösen und den eigenen Weg zu erkennen. Und über jene Dinge, die wir nicht sehen. Vielleicht sind das die Wichtigsten.Eine Novelle, die Hannover detailgetreu aus der Sicht eines Sehbehinderten zeigt, die Blindheit der Sehenden beklagt und sich für ein Miteinander auf Augenhöhe stark macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kia Kahawa (*1993) ist Schriftstellerin und Texterin. Sie schreibt Entwicklungsromane und dystopische Utopien.
Am liebsten hat die junge Autorin Bücher, in denen die Protagonisten ihre eigenen Widersacher sind.
Für alle, die mit offenen Augen durch die Welt gehen.
Inhaltsverzeichnis
Hauptbahnhof
Spannhagengarten
Maschsee
Langenhagen
Mitte
Laatzen
Sehnde
Kirchrode
Linden
Döhren
Hannover
Noltemeyerbrücke
Kronsberg
Hauptbahnhof
Hauptbahnhof
Nein. Das war das erste Wort, das ich von mir gegeben habe. Zehn Monate, nachdem ich das Licht der Welt erblickt hatte. Natürlich erinnere ich mich nicht daran. Das Thema Licht ist für mich ohnehin etwas kompliziert, aber ich greife vor.
Meine Eltern haben mich immer gut behütet. In der Schule glänzte ich mit meinen Leistungen in den geisteswissenschaftlichen Fächern. Naturwissenschaften waren nicht meins, bis auf Mathe. Mathematik ist in allen Sprachen gleich, und das gefällt mir daran. Ich mag Dinge, die genormt sind. Verlässlichkeit ist mir sehr wichtig, und Zahlen und Gleichungen sind definitiv verlässlich. Doch wie in der Mathematik gibt es auch im richtigen Leben Variablen. Mein Leben ist eine davon, aber ich kann sie nicht berechnen. Wie ich auch die Formel umstelle, die Gleichung meines Lebens hat keine eindeutige Lösung für mich.
Deswegen mag ich Musik. Eigentlich würde ich gerne tanzen. Es nimmt mich immer mit, wenn ich meine Lieblingsmusik höre. Sie schwingt in mir, bringt etwas in Bewegung, was sonst im alltäglichen Leben ruht. Aber ich tanze nie. Da ist wieder diese Sache. Licht.
Also habe ich unter Betteln und Flehen durchgesetzt, Klavierunterricht zu bekommen. Als Teenager wünschte ich mir, Kontrabass spielen zu können. Aber das Instrument sei zu anstrengend zu lernen und der Koffer des Instruments zu groß für jemanden wie mich. »Jemand wie ich«, das ist eine der Normen, die mir zwar begreiflich sind, aber tief in mir auf Ablehnung stoßen. Vielleicht liegt das daran, dass ich niemanden kenne, der wie ich ist. Alle Menschen haben ihre Besonderheiten, die sie einzigartig machen. Aber zurück zum Klavier. Mein Klavierlehrer war zufällig ein Angestellter meines Vaters. Ich nahm also Privatunterricht bei ihm zu Hause und lernte das Instrument und die Musik lieben. Nach den ersten Sonaten war meine Technik in Ordnung und ich hätte etwas aus meinem Talent machen können. Aber ich wollte lieber improvisieren. Jazz-Klavier hat erstaunlich wenig mit klassischen Sonaten zu tun.
Für mich haben Mathematik und Musik viel gemeinsam. Beim Improvisieren setzen sich die gelernten Harmoniemuster in meinem Kopf zusammen wie die Grundkompetenzen der Mathematik, die ich in den vergangenen Jahren gelernt habe. Dann kam mein A-Level1. Während der Klausuren war alles still. Nur das Knacken von Schokolade, kurze Hustenanfälle und das Seufzen meiner Mitschüler füllte den Raum. Ach, und mein ekstatisches Tippen. Man könnte meinen, ich hätte die Tastatur verprügelt, so energisch hämmerte ich auf die blöden Tasten ein. Muss ich die anderen genervt haben!
Und nun, was soll ich sagen. Jetzt habe ich einen Abschluss, gerade mein Studium kurz nach Beginn des vierten Semesters geschmissen und stehe an irgendeinem Gleis in Hannover. Vielleicht Gleis 8, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es eine Fahrplanänderung gab. Richtig zugehört habe ich nicht, weil ich gerade Sigur Rós auf den Ohren hatte. Fantastische Musik für einen Neuanfang! Meine Eltern haben mir immer verboten, in Bussen und Bahnen Kopfhörer zu tragen. Ich bräuchte mein Gehör für den Notfall.
Ein paar Minuten vergingen. Vielleicht auch nur lang gezogene Sekunden. Ich hatte keine Lust, meine Uhr aufzumachen und nachzufühlen. Lieber genoss ich, wie sich die Menschentraube, die sich vor der Tür des ICE gebildet hatte, Stück für Stück auflöste. Die Gesprächsfetzen sollte man mal aufzeichnen!
Hinter mir beschwerte sich eine Frau mittleren Alters, dass sie keine Lust hätte, die gesamte Zugfahrt zu stehen. Bis Berlin seien es gute zwei Stunden. Der Zug sei überfüllt. Eine junge Osteuropäerin motzte lautstark über ihren Freund. Oder Ex-Freund. So, wie die blökte, war sie am Telefonieren. Nicht weit von ihr gab ein Mann seinen Koffer an jemanden ab und machte einen Vorschlag. Seine Begleitung sollte das Gepäck beider Personen nehmen und er zwänge sich durch die Menschenansammlung, um einen Sitzplatz zu ergattern. Cleveres Vordrängeln nenne ich das. Manchmal genoss ich das Leid der anderen. Aber auch nur, weil ich noch nie im Zug stehen musste.
Ein stämmiger Mann, locker anderthalb Köpfe größer als ich, rempelte mich an.
»Kannst du nicht aufpassen?«, raunte er und beschleunigte seine Schritte.
Mir war nicht nach Konversation. Ich schenkte ihm ein schiefes Lächeln. Seinem entnervten Raunen nach zu urteilen rollte er mit den Augen und verschwand. Oder war schon längst verschwunden. Ja, ich glaube, er war bereits weg. Er hatte es schließlich eilig.
Für einen Tag im Spätfrühling war es ziemlich kühl. Der Wind fegte über das Gleis. Der ICE, der mich in meine neue Heimat entlassen hatte, fuhr ab. Ich stand noch immer gedankenverloren am Gleis. War der einzige Mensch an diesem Ort.
Mein Handy vibrierte kurz. Ich zückte das iPhone, freute mich, dass ich keine neidischen Blicke erntete. Eigentlich konnte ich Apple nicht leiden. Was für eine Prestige-Marke! Die Blicke der Neider entgingen mir nicht immer, oder vielleicht bildete ich sie mir ein. So ein teures Gerät sollte man sich nicht leisten können, wenn man mit dem letzten Ersparten seines Ausbildungsgeldes in einen Flieger stieg und in einer fremden Stadt Fuß fassen wollte.
»Wo bist du Fragezeichen vor Angst schreiendes Gesicht.«
»Wenn ich das wüsste«, sandte ich als Sprachnachricht.
Meine Tante antwortete sofort. »Ich kann keine Sprachnachrichten hören. Gesicht mit rollenden Augen.«
»Idiot.« Ich stöhnte unmerklich. Dann diktierte ich, was ich per Copy & Paste an meine Tante weiterleitete. »Wir treffen uns unterm Schwanz.«
Behinderte sind nicht dumm, im Gegenteil. Ich glaube, wenn man nur vier von fünf Sinnen zur Verfügung hat, wird man ziemlich geschickt im Umgang mit dem Leben. Zumindest dann, wenn einem keiner diktiert, wie man zu leben hat.
Ich hatte meine Recherchen über Hannover gemacht. Unterm Schwanz nannte man den beliebtesten Treffpunkt direkt vorm Hauptbahnhof. Da steht eine große Statue, die irgendeinen Typen auf einem Pferd darstellt. Unter dem Schweif des Pferdes treffen sich die Hannoveraner mit Externen. Leute, die in der Stadt wohnen, wählen dafür die Kröpcke-Uhr. Ich konnte es kaum erwarten, sie zu sehen.
»Du kannst ja doch schreiben Punkt«, sagte mir das Prestige-Telefon. »Sicher Komma dass du den Weg findest Fragezeichen.«
Ich hielt meinen Daumen kurz auf die untere rechten Bildschirmkante und ließ sie wieder los. WhatsApp bestätigte mir, dass die Sprachnachricht gesendet wurde. Sollte meine Tante doch denken, ich hätte etwas zu ihrer Aussage zu sagen! Das Gesicht, das sie machte, wenn sie dreizehn Sekunden Umgebungsgeräusche und Bahnansagen hörte, hätte ich zu gerne gesehen. War aber nicht möglich. Also zog ich den nervigen Stock aus der Jackentasche, seine Faltmechanik verlängerte ihn und mein Rolli teilte mir sofort mit, dass ich an einem Aufmerksamkeitsfeld stand. Hier ging es also lang. Klasse.
Rolli ist der weiße Ball am Ende des Blindenstocks. Ich konnte ihn noch nie leiden, weder Stock noch Ball. Das ist wie bei diesen kannibalischen Spinnen, die ihre Eltern nach der Geburt auffressen. Eine Hand, die einen füttert, sollte man nicht beißen, aber ich tat es. Schon in der Grundschule hatte ich »nein« zum Stock gesagt. Wahrscheinlich, weil ich nicht herausstechen wollte. Als Grundschüler, der weder ein gewöhnliches Schulbuch lesen noch einen Aufsatz über seinen schönsten Tag in den Ferien schreiben konnte, fiel man allerdings zwangsläufig auf. Whatever. Jedenfalls hatte meine Mutter mir vorgeschlagen, dem Ball einen Namen zu geben. Ich nannte ihn Rolli, und seitdem war der Stock für mich kein entblößendes Instrument mehr, sondern ein nerviges Hilfsmittel mit einem Namen.
Ich meisterte die Rolltreppe und war zehn Minuten nach meiner Ankunft bereits auf Hilfe angewiesen.
»Entschuldigung, können Sie mir sagen–«
»Nein.«
Idiot.
»Entschuldigung?«
»Sorry, muss zum Zug.«
Depp.
Ich ging ein paar Schritte ins Innere des Hauptbahnhofes. Wurde drei Mal angerempelt. Die Gerüchte stimmten wohl: Hannoveraner konnten nicht laufen. Neben mir hörte ich Stimmen. Eine Frau mit tiefer Stimme unterhielt sich mit einem Typen. Ich schnappte Gesprächsfetzen über eine mir unbekannte Serie auf. Der Mann sprach nasal, etwas quäkig zog er die Vokale lang und schien die Zähne nicht auseinanderzubekommen. Es klang, als stünde ein Klischee-Informatiker vor mir. Nerd-Shirt, Brille, Kellerkind.
»Entschuldigung, wie komme ich zum Schwanz?«
»Wie bitte?« Die Frau schien entsetzt. Der Kerl lachte.
»In Richtung Kröpcke. Ich bin unterm Schwanz verabredet.«
»Achso. Einfach da lang«, antwortete sie und deutete mir scheinbar den Weg mit ihrer Hand.
»Links oder rechts?«
Offenbar legte sie den Kopf schief. Dann erkannte sie, dass ich einen Stock in der Hand hatte, nahm sich einen Atemzug, um mich als behindert abzustempeln und erklärte mir den Weg, als sei ich ein Vollidiot.
Ich bedankte mich artig, wünschte den Herrschaften einen schönen Tag und ging die ersten beiden Schritte. Dann hielt ich inne und drehte mich kurz um: »Eine Frage habe ich noch.«
»Ja, bitte?«, entgegnete mir die Dame höflich.
»Trägt Ihr Freund eine Brille?«
»Oh, er ist nicht mein –« Sie kicherte nervös.
»Ja, wieso?«, antwortete die männliche Stimme.
»Nur so. Schönen Tag noch!«, erwiderte ich und machte mich auf den Weg.
Sagte ich doch: ein Nerd mit Brille.
Meine Tante begrüßte mich mit einer kurzen Umarmung, stahl meinen Koffer und hakte sich bei mir ein. Typisch Altenpflegerin. Sie führte mich zu ihrem Auto, während sie mich mit furchtbar oberflächlichem Small Talk quälte. Sie war ausgezeichnet darin, Tretminen in Gesprächsthemen zu erkennen und diese zu umschiffen. Also fiel kein Wort über meine geschiedenen Eltern, das abgebrochene Studium oder meinen heldenhaften Erfolg, den Treffpunkt auszuerkiesen und ganz allein zu finden, bis wir aus dem Auto stiegen.
»Da wären wir«, kündigte sie meine neue Bleibe an, während sie mein Gepäck aus dem Kofferraum hievte.
Willkommen im Konjunktiv. Hier könnte man sich wohlfühlen.
In einer Sphäre peinlichen Schweigens betraten wir ein Mehrfamilienhaus und erklommen vier Treppen. Das Holz knarrte, unsere Schritte hallten an den Wänden wider. Im Erdgeschoss befanden sich Fliesen an der Wand. Quadratisch. Ein stilistisches No-Go, wenn man mich fragt.
Vor ihrer Wohnung angekommen, stellte sie meinen quietschpinken Koffer geräuschvoll ab und entledigte sich ihrer Schuhe. Ich hatte nicht vor, Rolli in der fremden Wohnung zu benutzen, behielt meine Schuhe also an. Ich nahm meinen Koffer und zog ihn hinter mir her. Die Alukante hinter der Wohnungstür hatte es schon mal in sich. Ich stolperte kurz und stützte mich an der Garderobe ab. Ganz schön viele Jacken für eine alleinstehende Frau jenseits der vierzig.
»Wohnt hier noch jemand außer dir?«
»Mein Kater Karlo. Tritt bitte nicht auf ihn drauf, er war früher immer so schreckhaft.«
»Habe ich nicht vor«, gab ich zurück und erkundete den Wohnungsflur. Es war genauso kühl wie draußen, aber die Luft roch abgestanden. Der Laminatboden führte nahtlos in einen großen Raum, der das Wohnzimmer sein musste. Davor aber war eine geschlossene Tür, die in einen eher kleinen Raum führen musste. Viele Zentimeter waren die Türen nicht voneinander entfernt. Die Tür fühlte sich billig, nahezu hohl an. Wie ein IKEA-Regal.
»Das ist dein Zimmer«, murmelte meine Tante. »Geh ruhig rein.«
Sie wirbelte herum und tat irgendwas, öffnete eine Tür und verschwand. Eine Tür schloss sich hinter ihr, meine Tante war also im Badezimmer verschwunden.
Ich öffnete die Tür und tastete nach dem Lichtschalter. Seine glatte Oberfläche wurde unterbrochen von Kleberückständen. Es ist nicht egal, ob ein Raum dunkel oder hell ist. Durch die Raumbeleuchtung konnte ich erahnen, wo sich etwas befand, bevor ich es vorsichtig durch Berührungen identifizierte. Zu meiner Rechten stand ein Sofa, daneben ein Nachttisch. Auf dem Boden lag ein ovaler Teppich mit langen Fasern. Der große Kleiderschrank stand frei an der gegenüberliegenden Wand und begrüßte meinen kleinen Zeh auf die eher unhöfliche Weise. Schon war ich dankbar für meine Schuhe.
Ein kleiner Schreibtisch mit einem Klappstuhl aus Plastik luden zur Produktivität ein. Zu schade, dass sich auf der Tischplatte Berge von Papierkram befanden.
»Da mache ich meine Steuer.«
Ich fuhr zusammen. Meine Tante stand im Türrahmen, ich hatte sie nicht kommen hören. »Es ist nicht viel, aber alles, was ich dir anbieten kann. Im Kleiderschrank habe ich dir drei Fächer freigeräumt. Stört es dich, wenn Karlo bei dir schläft?«
Ich schüttelte den Kopf, aber sie schien es nicht zu sehen, denn sie wartete einige Atemzüge ab.
»Nein«, ergänzte ich meine nonverbale Antwort.
»Er schläft immer da. Das ist sein Stammplatz, und er ist doch schon vierzehn.«
»Vierzehn?« Ganz schön alt für einen Kater.
»Ja. Das Mistvieh stirbt nie. Manchmal geht er auf den Balkon und verschwindet dann für ein paar Stunden. Er klettert seinen Weg nach draußen und macht die Umgebung unsicher. Ich habe schon von Frau Messerschmied Beschwerden gehört, dass er im Sommer bei ihr was vom Grill geklaut hat.«
Wir fingen gleichzeitig an zu lachen. Karlo gefiel mir schon jetzt.
»Ach, hab ich ganz vergessen!« Sie sog hörbar Luft durch die Zähne und schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn. »Ich habe da etwas für dich. Komm mal mit.«
Ich folgte ihr ins Wohnzimmer. Sie ließ sich auf das große Sofa fallen. Mein Knie begrüßte den viel zu niedrigen Fernsehtisch, bevor ich es ihr gleichtat.
»Schau mal.« Sie kramte in einer Kiste und drückte mir eine CD-Hülle in die Hand.
»Danke«, sagte ich perplex. Ich drehte die CD vor meinem Gesicht, als würde ich mir Cover und Rückseite genau ansehen.
Dann lachte die Fünfzigjährige und schlug sich schon wieder auf die Stirn. »Das ist von deinem Cousin. Er hat die CD letztes Jahr aufgenommen. Bevor er ausgezogen ist. Zu schade, dass er das Klavier mitgenommen hat. Ich hätte dich gerne spielen hören.«
»Macht nichts«, erwiderte ich. »Ich spiele eh nicht mehr.«
Mit einem geknickten »aha« wischte sie meine Aussage weg und fuhr fort: »Das ist Jazz-Zeug. Swing oder so. Ich kann da sicher nicht mit dir mithalten, aber die Musik habe ich gern beim Kochen gehört.«
»Warum jetzt nicht mehr?«
»Wenn man alleine wohnt, gibt es keinen Grund mehr, zu kochen. Ich mache mir schnell was warm und habe keinen Spaß mehr daran.«
»Das sollten wir ändern.« Energisch erhob ich mich, begab mich in den Flur und ging durch die Küchentür. Das wusste ich, da sie weder ins Badezimmer noch in meinen Schlafraum führte, noch die Tür war, aus der ich gerade kam. Ehe meine Tante mich einholte, hatte ich die kleine Anlage neben der Kaffeemaschine ertastet und legte die CD ein. Dann öffnete ich den Kühlschrank. Ein von Oktaven untermalter Blues füllte den Raum. Die rechte Hand spielte ein wahlloses Muster innerhalb der Blues-Tonleiter.
»Lass uns kochen«, lud ich sie ein. Ich konnte nicht sehen oder spüren, dass sie lächelte, aber ich wusste es.
Die linke Hand meines Cousins hämmerte einen C-Powerchord ohne Terz rhythmisch durch den ollen CD-Spieler. Das dissonante Fis der rechten Hand wurde zum F aufgelöst. Dann sagte meine Tante das Wort, das mir aus ihrem Mund das liebste war: »Ja.«
1 A-Level steht für: General Certificate of Education (GCE) Advanced Level. Ein allgemeines Bildungszeugnis auf fortgeschrittenem Niveau, das dem deutschen Abitur entspricht.
Spannhagengarten
Spannhagengarten
Scheiße.
Man soll nicht fluchen, wenn man irgendwo fremd ist. Schon gar nicht, wenn man in jedem Land, in dem man sich aufhält, als Ausländer gilt. Aber: Verdammte Riesenkacke!
Obwohl meine Eltern beide Deutsche sind, ein Elternteil sogar in diesem Land lebt und ich meine ersten Lebensjahre hier verbracht hatte, verstehe ich nichts von Ämtern. Das Einzige, was man mir über das Rechtssystem beigebracht hatte, war, dass man dort viel von Formularen hielt. Und wenig davon, dass eine arbeitslose Altenpflegerin einen verwandten Studienabbrecher mit einer ziemlich großen Summe auf dem Konto beherbergte. Als Mitglied der Bedarfsgemeinschaft wollte man ihr die Leistungen kürzen, bis meine Ersparnisse aufgebraucht waren. Ich besaß zu viel Kohle und musste mich theoretisch an ihrem Lebensunterhalt beteiligen, weil wir nicht wie in einer Wohngemeinschaft wohnten, sondern alles teilten. Eheähnlich. Mit meiner Tante! Igitt.
Dass ich mein Ausbildungsgeld für ihren Unterhalt dezimierte, wollte sie mir nicht antun, und deswegen befand ich mich auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch. Es war mehr ein Dinner. Muriel hieß die Dame, die mich eingeladen hatte.
Es gongte. »Spannhagengarten«, sagte die Stimme vom Band. Die Frau, die die Haltestellen eingesprochen hatte, musste dazu gezwungen worden sein, bei jedem Wort zu lächeln. Ich konnte förmlich sehen, wie sie ihre Zähne beim Aussprechen des Wortes »Garten« zeigte.
Die TW3000 bremste ab. Ich kenne jedes Stadtbahnmodell der Üstra. Es sind auch nur dreieinhalb und nicht schwer zu erlernen. Die TW3000 ist die modernste und ruhigste Bahn. Die Bahn hielt und ich sprang auf. Das niedliche Blubbern des Wagens zeigte mir, wo ich auszusteigen hatte. Da es warm war, trug ich die ausgelatschten Basketballschuhe. So war ich erst einmal nicht auf Rolli angewiesen und konnte durch die Sohle den gekennzeichneten Bereich am Hochbahnsteig erfühlen. Meine Schuhe trug ich regelmäßig so lange, bis die Sohle quasi nicht mehr existent war.
Muriel hatte ein Foto von mir erhalten. Im Selfie-Machen bin ich ziemlich schlecht, zumindest glaube ich das. Glücklicherweise hatte sie von Anfang an gesagt, ich müsse nicht selbst zur Adresse finden. Sie würde mich gern abholen. Sie hatte mir auch ein Foto von sich und ihrer Mitbewohnerin geschickt, damit ich sie an der Haltestelle erkennen konnte. Haha.
Tja. Vielleicht hatte ich ein wenig geflunkert, als ich sagte, ich würde sie schon erkennen. Und als ich ihr ein Kompliment zu ihrer Frisur gemacht hatte.
»Adam?«, fragte eine weibliche Stimme.
»Der bin ich!« Ich drehte mich zu einer kleinen Person um, die zierlicher nicht sein konnte. Die Flecken, die ihre Statur in meinem Gesichtsfeld darstellten, waren kaum vorhanden und wurden vom reflektierten Licht des hellen Bodens fast verschluckt.
»Schön, dich kennenzulernen«, begrüßte sie mich herzlich. Ich streckte ihr meine Hand hin, wurde aber sofort umarmt. Gastfreundschaft konnte sie.
Wir gingen die Podbielskistraße entlang. Offenbar eine Hauptstraße, an der sich hohe Häuser in den Himmel erstreckten. Neben Muriel zu laufen erforderte meine ganze Konzentration, denn unbekannte Wege konnte ich ohne Stock eigentlich kaum zurücklegen, ohne Kollateralschäden zu verursachen. Immer stand irgendwo etwas im Weg. Und seien es beschäftigte Menschen, die so sehr in ihre Smartphones vertieft sind, dass sie mich nicht wahrnehmen und einen Hieb mit dem Rolli gegen den Fuß abbekommen.
»Was studierst du?«, unterbrach Muriel die quälende Ewigkeit des Schweigens. Ich war etwas verwirrt, da ich ihr das schon im Chat geschrieben habe. Anscheinend war sie genau so angespannt wie ich. Fremde Leute erzeugten immer Nervosität, und mein Gehirn hatte dann plötzlich eine Funktionsweise wie ein Kaugummi.
»Gar nichts. Ich suche lieber einen Job. Festes Einkommen und so.« Klang ich jetzt cool und entspannt genug, um einen guten Eindruck zu hinter lassen?
»Aha. Was hast du studiert?«
»Schwachsinnologie«, wiederholte ich, was ich vorgestern in mein Smartphone gesprochen hatte. Mein Lachen über den eigenen Witz endete in nervösem Gekicher, da Muriel meine Antwort anscheinend nicht als Insider erkannte. Also zog ich die Schultern zu den Ohren und schämte mich ein bisschen. »BWL. In England. Hab’ ich dir doch erzählt, oder nicht?«