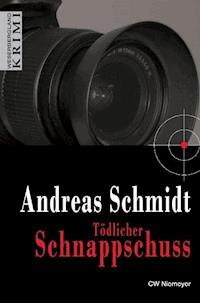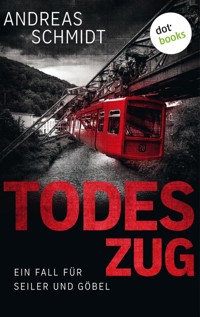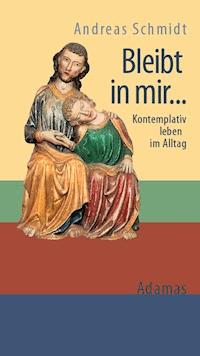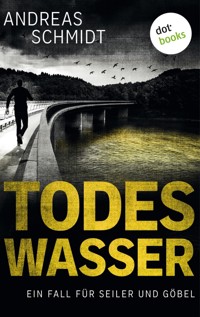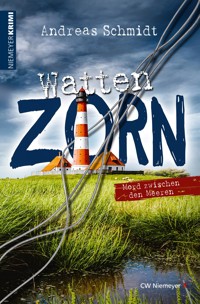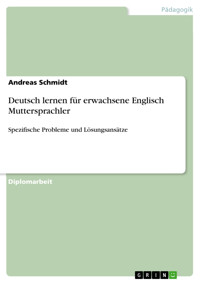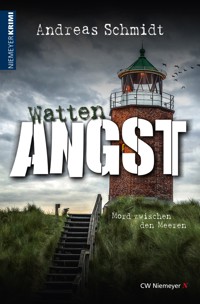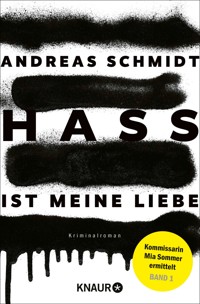
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Mia Sommer ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wenn aus Liebe Hass wird »Hass ist meine Liebe« ist der Auftakt einer Krimi-Reihe aus dem Bergischen Land: Die unkonventionelle Kommissarin Mia Sommer wird mit den Abgründen des schönsten Gefühls der Welt konfrontiert. Kopfüber und ertrunken liegt die angesehene Psychologin Tessa Winkler in einem Brunnen am Toelleturm, Wuppertals teuerster Wohngegend. Würgemale an ihrem Hals zeigen, dass sie unter Wasser gehalten wurde. Die Kommissare Mia Sommer und Björn Lassner haben zuerst den Exmann im Visier, der seine Trauer nutzt, um die Ermittler zu manipulieren. Und den Vater eines Mädchens, das bei einem Unfall starb, den Tessa verschuldet hat. Doch dann liegt eine weitere Frau tot auf der berühmten bunten Holsteiner Treppe, genau zwischen den beiden Stufen, die mit »Schlechtes Gewissen« und »Ehre« beschriftet sind. Zufall oder der Beginn einer Mordserie? Mia und Björn nehmen die Vergangenheit der beiden Opfer genauer unter die Lupe und entdecken unheimliche Ähnlichkeiten in deren Liebesleben … Harter Kriminalroman mit düsteren Thriller-Elementen für Leser*innen von Gisa Klönne oder Linus Geschke Der Krimi-Autor Andreas Schmidt konfrontiert seine Kommissarin Mia Sommer mit gesellschaftlichen Tabus. Dabei ergänzen sich die temperamentvolle Mia, die mit einer Frau zusammenlebt und auch mal einen Joint raucht, und der technikaffine Björn Lassner zu einem Ermittler-Team, das leidenschaftlich für Gerechtigkeit kämpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andreas Schmidt
Hass ist meine Liebe
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hüte dich vor meiner Liebe ...
In einem Wuppertaler Luxusviertel wird die angesehene Psychologin Tessa Winkler Kopf über in einem Brunnen gefunden. Würgemale und Druckstellen deuten darauf hin, dass sie unter Wasser gehalten wurde. Die Kommissare Mia Sommer und Björn Lassner haben zuerst den Exmann im Visier, der seine eigene Trauer nutzt, um die Ermittler zu manipulieren. Und den Vater eines Mädchens, das bei einem Unfall starb, der von Tessa Winkler verursacht wurde. Doch dann wird die Leiche einer zweiten Frau an der bunt beschrifteten Holsteiner Treppe in Elberfeld entdeckt, zwischen den Stufen »Schlechtes Gewissen« und »Ehre«. Zufall oder der Beginn einer Mordserie? Mia Sommer und Björn Lassner tauchen in die Vergangenheit der beiden Frauen ein und entdecken allmählich in ihrem jeweiligen Liebesleben unheimliche Ähnlichkeiten …
Ein furchteinflößender Kopfsprung in die Abgründe des schönsten Gefühls der Welt ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Danksagung
Prolog
Nichts. Da war ein tiefes Schwarz, das sie umgab, als sie zu sich kam. Ihr Schädel dröhnte, als hätte sie zu viel Alkohol getrunken. Sie kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit an und verspürte einen pelzigen Geschmack im Mund. Sie schluckte trocken, blinzelte träge zu der Stelle, an der sie die Decke vermutete. Doch auch da war nichts, nicht einmal ein graues Rechteck, das sich wohlwollend vom Schwarz des Raumes abhob, um ihr den Ansatz einer Orientierung zu ermöglichen. Kein Lichtstrahl drang durch die alles verschlingende Dunkelheit. Nur das leise Tropfen von Wasser in einer undichten Stelle irgendwo über ihr durchbrach die Stille. Eiskalte Wände umschlossen sie wie ein Sarg.
Vergeblich versuchte sie, sich an die letzten Stunden zu erinnern, doch auch in ihrem Kopf herrschte eine beängstigende Leere. Das Vakuum wurde von einer aufsteigenden Panik verdrängt. Ohne zu wissen, an welchem Ort sie sich befand, wie sie hierhergekommen war und was der Grund für ihren Aufenthalt an diesem Ort war, gewann die nackte Angst ums Überleben die Oberhand. Sie spannte die Muskeln an und registrierte erst jetzt, dass sie auf dem Rücken lag. Ein weicher Untergrund ließ auf eine Matratze oder eine dicke Isomatte schließen. Der plötzliche brennende Schmerz an ihren Hand- und Fußgelenken verriet, dass sie gefesselt war. Die groben Stricke schnitten in ihre Haut. Wenigstens hatte sie keinen Knebel in ihrem Mund. Als sie versuchte zu schreien, versagte ihre Stimme. Vielleicht, so dachte sie, war es besser, nicht auf sich aufmerksam zu machen. Fast regungslos lag sie auf der unbequemen Unterlage am Boden und starrte in die Finsternis.
In einer Endlosschleife fragte sie sich, warum sie hier war. Die Angst vor dem Unbekannten wurde unerträglich. Krampfhaft versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen. Ihr Gehirn war leer. Verzweifelt wurde ihr klar, dass sie so niemals Antworten auf ihre Fragen bekommen würde.
Die Erinnerung an das, was vor ihrem Blackout geschehen war, wäre sicherlich hilfreich. Doch da war nichts in ihrem Kopf. Es schien, als hätte man ihr Gedächtnis gänzlich ausgelöscht. So, wie man ein Smartphone auf seine Werkseinstellungen zurücksetzte und nur noch die Grundfunktionen vorhanden waren, während alle Daten im Nirwana verschwunden waren.
Ich funktioniere.
Mehr nicht.
Dieser Gedanke ließ erneut Panik in ihr aufsteigen. Obwohl eine feuchte Kälte herrschte, perlte Schweiß auf ihrer Stirn. Sie zwang sich, ruhig zu bleiben, und brachte ihren Atem unter Kontrolle. Dabei kroch ein muffiger Geruch in ihre Nase. Ihr Rücken schmerzte. Mühsam rappelte sie sich auf und war froh, sich trotz der hinter dem Rücken zusammengebundenen Hände in eine sitzende Position bringen zu können.
Immerhin, sie saß eher schlecht als recht in krummer Haltung und fühlte sich nicht mehr ganz so ausgeliefert. Erneut grub sie in ihrer Erinnerung, stieß aber wieder auf ein tiefes Vakuum. Panisch blickte sie sich um, doch sie sah nichts.
Nur das monotone Glucksen blieb. Wie ein Sekundenzeiger, der in Zeitlupe vor sich hin tickte, ertönte das gleichmäßige Tropfen des Wassers.
Fieberhaft überlegte sie, was passiert war. Man musste sie mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt haben.
Zum Wann und Wo gab es keine Antworten. Immer wieder versuchte sie, das Nichts mit ihren Blicken zu durchdringen, als in einer Ecke des Raumes ein winziges rotes Licht ihre Aufmerksamkeit erregte.
Ein schwaches, blinkendes Glühen, das jedoch nicht reichte, um die Konturen ihrer Umgebung zu erhellen. Wie das Zyklopenauge eines lauernden Ungeheuers war das winzige rote Licht auf sie gerichtet.
Eine Kamera, durchzuckte es sie. Man hat eine fucking Kamera aufgestellt, um mich zu beobachten. Arschlöcher!
Ihre Angst schlug in Wut um. Sie zerrte wieder an den Fesseln, fühlte erneut den Schmerz und ließ locker, als sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. Viel Zeit, um sich weitere Gedanken zu machen, blieb ihr nicht, denn ein Geräusch beanspruchte ihre Aufmerksamkeit. Von irgendwoher näherten sich Schritte. Schwere, gleichmäßige Schritte. Wer auch immer kam, er schien es nicht sonderlich eilig zu haben. Demnach fühlte er sich sicher. War es ein Er?
Ihr Puls beschleunigte sich, als ein Schlüssel in ein unsichtbares Schloss geschoben wurde. Kurz danach öffnete sich eine knarrende Eisentür. Quälend langsam, fast wie in einem schlechten Horrorfilm, bahnte sich ein Lichtstreifen den Weg zu ihr. Die Dunkelheit, in der sie gefangen war, wurde vom grellen Schein einer nackten Glühbirne im angrenzenden Raum durchbrochen. Ein Schatten trat in den Leuchtkegel, eine hochgewachsene Gestalt, die sie nur schemenhaft erkennen konnte. Regungslos stand der Unbekannte da und schien sie zu betrachten wie ein Stück Vieh auf einer Auktion.
Ihr Atem stockte bei seinem Anblick. Unter die Angst mischten sich Wut und eine verzweifelte Ohnmacht. Das Gefühl, ihm ausgeliefert zu sein, trieb sie an den Rand des Wahnsinns. Ihre Gedanken kreisten panisch um die Frage, was als Nächstes geschehen würde.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er sie gehen ließ, war gering, und so steigerte sich ihre Angst, als er einen Schritt in ihr Gefängnis machte. Nun fiel das Licht ungehindert in den Raum. Hastig blickte sie sich um und versuchte, sich ihre Umgebung einzuprägen. Sie befand sich in einem gewölbeähnlichen Keller mit niedriger kuppelförmiger Decke. Rostige Rohre verliefen an der Decke, führten quer durch den Raum und verschwanden rechts und links im Mauerwerk. Eine der Leitungen war undicht. Daher auch das Tropfen des Wassers. Der Putz blätterte von den feuchten Wänden, überall lag Unrat herum. Eine Matratze und ein Zinkeimer, in den sie offensichtlich ihre Notdurft verrichten sollte, waren die einzigen brauchbaren Gegenstände im Raum. Spinnweben spannten sich in den Ecken. Als sie im Augenwinkel einen huschenden Schatten erblickte, kam ihr ein spitzer Schrei über die Lippen. Fiepend suchte eine Ratte Unterschlupf unter dem Müll in einer Ecke. Dort entdeckte sie auch die Kamera, die sie beobachtete. Es gab ein Stativ, dessen drei Standbeine im Unrat steckten. Die Kamera schien ein extrem lichtempfindliches Modell zu sein, das auch bei völliger Dunkelheit brauchbare Aufnahmen lieferte. Es handelte sich um eine dieser winzigen Actioncams, mit denen Sportler ihre waghalsigen Stunts aufzeichneten und sie millionenfach im Internet verbreiteten. Kursierten die Aufzeichnungen, die man von ihr anfertigte, schon im Netz?
Ein kalter Schauer rieselte ihren Rücken herunter. Allein die Vorstellung, dass jede ihrer Bewegungen aufgezeichnet wurde, verstärkte in ihr das Gefühl der Ohnmacht.
Die Tür war ihre einzige Fluchtmöglichkeit. Allerdings rechnete sie sich ihre Chancen als gering, wenn nicht sogar als nicht vorhanden, aus. Sie saß gefesselt auf der Matratze. Bevor sie sich aufrichten konnte, würde ihr Entführer jeden Fluchtversuch im Keim ersticken. Breitbeinig baute sich der Fremde vor ihr auf.
Er demonstriert Stärke, durchzuckte es sie. Macht. Er zeigt mir, dass ich nicht den Hauch einer Chance habe.
Starr vor Angst betrachtete sie den Fremden. Im Gegenlicht erkannte sie schwarze Kleidung, schwere Stiefel, eine Hose mit aufgenähten Taschen und einen weiten Hoodie, dessen tief ins Gesicht gezogene Kapuze verhinderte, dass sie ihn identifizieren konnte. Jetzt fiel das Licht so, dass sie die totenbleiche Maske erblickte, die er trug.
Feiges Arschloch.
Es handelte sich um eine dieser hässlichen Clownsmasken, die mit einer verzerrten Fratze auf sie herabzublicken schien. Unter dem Plastik hörte sie den keuchenden Atem ihres Gegenübers, sie sah den unsteten Blick seiner Augen hinter den Sehschlitzen. Trotzdem ließ seine Haltung keinen Zweifel aufkommen, dass er ihr überlegen war. Sie war ihm ausgeliefert und spürte die Wut aufsteigen, die ihre Angst verdrängte.
»Was willst du von mir?«, keuchte sie heiser.
»Du würdest es nicht verstehen«, behauptete er. »Noch nicht.«
Beim Klang seiner Stimme erstarrte sie vor Schreck. Offensichtlich benutzte er einen Stimmenverzerrer, denn seine Worte klangen elektronisch verfremdet wie die eines Roboters.
Ihr war klar, dass sie seine Stimme nicht erkennen sollte. Dafür konnte es nur zwei Gründe geben. Entweder kannte sie ihn, oder er wollte ihr wirklich Angst einjagen. Er hielt ihr eine Plastikflasche hin. »Trink was.« Seine Stimme jagte ihr einen Schauer über den Rücken.
Energisch schüttelte sie den Kopf. »Vergiss es. Ich werde nichts trinken. Da sind sicher auch wieder K.-o.-Tropfen drin.«
»Wie kommst du darauf?«, fragte er. Ohne ihre Antwort abzuwarten, schraubte er den Verschluss der PET-Flasche mit seinen behandschuhten Händen auf. Das leise Zischen der Kohlensäure ließ ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Ich habe Durst, geisterte ihr durch den Kopf. Sie fühlte sich kraftlos. An Flucht war nicht zu denken.
Ich darf nicht davon trinken, beschloss sie schließlich mit einem Kopfschütteln. Angst, Wut und eine tiefe Ohnmacht überfluteten sie. Es lag auf der Hand, dass er sie mit dem Wasser erneut außer Gefecht setzen wollte – wieder ein paar Stunden, die sie nicht bei Bewusstsein erleben sollte, warum auch immer. Sie mochte gar nicht daran denken.
Er legte eine Hand so auf ihren Kopf, dass sie seinem Griff nicht entkam, während er mit der anderen Hand die Flasche brutal gegen ihren Mund presste. Dabei sprach er kein einziges Wort. In seinen Augen lag jetzt ein wütendes Funkeln, sein Atem beschleunigte sich.
Ein spitzer Schrei kam über ihre Lippen, kurz nur, doch lange genug für ihn, um ihr die Flasche in den Mund zu drücken.
Ihr Schrei erstickte mit einem Gurgeln. Eiskalt sickerte das Wasser in ihre Kehle. Panisch versuchte sie, den Kopf zur Seite zu drehen, hatte aber keine Chance. Gegen den Schluckreflex kam sie nicht an, und so nahm sie die Flüssigkeit auf. Sie hustete, doch er ließ nicht locker und flößte ihr das Wasser gegen ihren Willen ein. Dabei fixierte er ihren Kopf so brutal, dass er mit dem Rand der Flasche ihre Lippen aufriss. Der metallische Geschmack ihres eigenen Blutes vermischte sich mit dem Wasser. Erst als sie kurz davor war, sich zu übergeben, ließ er von ihr ab. Achtlos warf er die Flasche in eine Ecke. Das für sie so kostbare Nass sickerte heraus und bildete einen Wasserfleck auf dem staubigen Boden.
Er nahm den Zinkeimer in die Hände und schwenkte ihn bedeutungsvoll. Die kleinen Scharniere quietschten bei jeder Bewegung. Ein kalter Hauch kroch ihre Wirbelsäule hinauf.
Schweigend trat er vor sie und deutete auf ihren Schoß.
»Ich muss nicht pinkeln, ich muss hier weg«, keuchte sie. Eine Haarsträhne hing ihr wirr ins Gesicht, sie pustete sie aus ihrem Sichtfeld und sah mit wutverzerrter Miene zu ihm auf. »Was soll der Scheiß, warum bin ich hier?«
Er machte einen halben Schritt zurück, zuckte mit den Schultern und warf den Eimer in die Ecke. Das metallische Scheppern malträtierte ihren Schädel. Kurz verharrte ihr Kerkermeister, um sie zu betrachten. Einmal wieder fühlte sie sich machtlos, wie sie vor ihm auf der Matratze am Boden hockte und zu ihm aufsah.
Es war, als würde er in die Tiefe ihrer Seele blicken können. Täuschte sie sich, oder lag da etwas Nachdenkliches in seinem Blick?
Bevor sie sich darüber Gedanken machen konnte, spannte sie alle Muskeln an und versuchte aufzustehen. Sie taumelte, hatte kaum eine Chance, sich auf den Beinen zu halten, und drohte auf die Matratze zu sacken. Als er ihre Bemühungen wahrnahm, stieß er sie mit einem Arm zur Seite. Mit einem keuchenden Laut auf den geschundenen Lippen ging sie zu Boden, kam hart mit der rechten Seite auf der Schulter auf, schrie.
Zusammengerollt kauerte sie auf der Matratze und beobachtete ihn. Er trat an die Kamera und schien die Funktion überprüfen zu wollen.
»Du hast also alles im Blick«, stellte sie wütend fest.
»Worauf du dich verlassen kannst«, scharrte seine Roboterstimme.
»Was willst du von mir?«, fragte sie, diesmal energischer. Langsam drehte er sich zu ihr um. »Ich möchte ein Zeichen setzen.«
»Indem du mich hier festhältst?« Sie schüttelte den Kopf und ignorierte den Schmerz in ihrem Mund. Ein feiner Blutfaden rann aus ihrem Mundwinkel, die Lippen fühlten sich dick und geschwollen an.
»Es ist Teil der Nachricht, die ich rausschicken werde.« Er musterte sie einen Augenblick. »Also komm klar damit.« Ohne sich ein letztes Mal zu ihr umzudrehen, verließ er das Gewölbe. Auf dem Gang warf er die Eisentür mit einem ohrenbetäubenden Scheppern ins Schloss, drehte den Schlüssel und stapfte davon. Stille umfing sie. Nur das gleichmäßige Tropfen des maroden Wasserrohrs an der Decke war zu hören.
Als sie den Kopf hob, sah sie das rote Zyklopenauge der Kamera, deren Linse auf sie gerichtet war. Sie schloss die Augen und versuchte, sich zu entspannen. Doch je länger sie über ihre Situation nachdachte, umso aussichtsloser erschien sie ihr. Wimmernd brach sie zusammen. Tränen rannen über ihre Wangen, ihr Körper verfiel in unkontrollierte Zuckungen. Die Kraft, sich einen Plan zurechtzulegen, verlor sich mit jeder Stunde in der Dunkelheit im Nichts.
Kapitel 1
Eine feuchte Kälte umfing sie, als sie am späten Abend aus dem Bus stieg. Der Fahrer, ein junger Südländer mit säuberlich gestutztem Kinnbart, nickte ihr wortlos zu, bevor er den Türmechanismus betätigte und sich nach einem prüfenden Blick in den linken Außenspiegel in den Verkehr einordnete.
Sie schloss die Knopfleiste ihres Mantels und zupfte den cremefarbenen Schal zurecht. Sekundenlang blieb sie fröstelnd am Straßenrand stehen, um dem himmelblauen Linienbus nachzublicken, der sich mit röhrendem Dieselmotor talwärts schob. Wie eine gleißende Insel aus Licht wurde das schwere Gefährt schon bald vom dicken Novembernebel verschluckt. Die roten Rücklichter geisterten kurz durch die Nacht, dann verschwanden auch sie im Grau der Herbstnacht. Einsamkeit umschloss sie, als sie sich in Bewegung setzte. Den Rest des Weges musste sie zu Fuß zurücklegen. Im Gehen bildete der Atem winzige Wölkchen vor ihrem Gesicht. Überall im Unterholz irrlichterten Schatten, hervorgerufen vom Wind, der durch die Zweige des Geästs jenseits der verlassenen Straße strich. Nach einigen Metern hielt sie sich rechts. Jetzt führte eine kleine Straße leicht bergan durch den Grüngürtel, der das kleine Wäldchen umgab. Unheilvoll strich der Wind durch die Wipfel der alten Bäume, die längst ihr Laub verloren hatten. Nun bildeten die nassen Blätter auf dem Boden einen glitschigen Untergrund.
Wind kam auf und wehte die dichter werdenden Nebelschwaden über den feucht schimmernden Asphalt. Sie fühlte sich, als wandere sie durch eine bizarr anmutende Parallelwelt. Die Realität versteckte sich hinter einer Schallglocke und schien kilometerweit entfernt zu sein. Angst hatte sie keine, denn sie kannte sich hier aus. Nur der Gedanke, allein zu sein, bereitete ihr Unbehagen.
Als hinter ihr ein Ast knackte, blieb sie wie angewurzelt stehen. Ohne ihn zu sehen, spürte sie seine Anwesenheit, die etwas Gefährliches, etwas Bedrohliches ausstrahlte.
Er. Ist. Da.
Drei kleine, unbedeutende Wörter nur, die aber von einer Sekunde zur anderen ihr Denken und ihr Handeln beherrschten. Sie wagte es nicht, einen Blick nach hinten zu riskieren, wollte ihm keine Unsicherheit suggerieren und setzte ihren Weg fort. Er würde sie nicht einschüchtern. Mit jedem Meter, den er sie unbehelligt weiterkommen ließ, wuchs die Wahrscheinlichkeit auf Hilfe, denn bald würden die ersten Häuser des Villenviertels in Sicht kommen. Doch noch war es nicht so weit. Ohne es zu bemerken, beschleunigte sie ihr Tempo. Jetzt schien er aufzuholen, verringerte mit jedem Schritt seine Distanz zu ihr.
Er. Verfolgt. Mich.
Sie schob die Hände in die Manteltaschen und spürte das Smartphone, das ihr eine vermeintliche Sicherheit versprach. Verzweifelt strich sie mit den Fingerkuppen über das glatte Glas des Displays. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Notruf abzusetzen. Doch die Polizei würde zehn Minuten, vielleicht sogar eine Viertelstunde benötigen, um herzukommen. Zu lange für sie.
Du. Hast. Keine. Angst.
In einer nicht enden wollenden Schleife rasten diese vier Wörter durch ihren Kopf. Es fiel ihr immer schwerer, sich nicht zu ihm umzublicken. Sie bildete sich ein, hinter sich seinen rasselnden Atem zu hören. Immer schneller wurden ihre Schritte. Das Klackern der Absätze ihrer Lederstiefel übertönte die Tritte ihres Verfolgers. Für einen kurzen Augenblick glaubte sie, dass er den Abstand zu ihr wieder vergrößerte. Tatsächlich wurde er langsamer. Nun wagte sie einen flüchtigen Blick nach hinten. Da war ein gleitender Schatten, eine huschende schwarze Gestalt, die sich im Schutz der Bäume mit fließenden Bewegungen näherte.
Bloß keine Unsicherheit zeigen, ermahnte sie sich. Denn dann hat er sein Ziel erreicht, und diesen Triumph gönne ich ihm nicht. Doch es fiel ihr schwer, die aufsteigende Angst vor dem Ungewissen zu unterdrücken.
Die Vernunft schaffte es nicht, ihren Fluchtinstinkt zu besiegen. Hastig richtete sie den Blick wieder nach vorn. Womöglich handelte es sich bei dem Verfolger auch um jemanden, der zufällig den gleichen Weg hatte.
Kein Grund auszuflippen.
Inzwischen schien er wieder zu ihr aufgeschlossen zu haben. Der alte Baumbestand entlang des Weges bot ihm Schutz. So blieb er unerkannt. Sein Atem ging rasselnd, er schien körperliche Anstrengung nicht gewohnt zu sein.
Sie hingegen besuchte dreimal in der Woche das Gym und fühlte sich fit. Ob ihre Kraft und Kondition allerdings genügten, um sich gegen ihn zu wehren, bezweifelte sie, denn er war groß. In der Manteltasche umklammerte sie das Smartphone.
Sollte sie Hilfe holen?
Sei nicht hysterisch, schrie alles in ihr. Er tut dir nichts, will dich nur einschüchtern. Das geilt ihn auf, das braucht er. Nicht mehr. Erleichtert stellte sie fest, dass sich vor ihr der historische Brunnen aus dem Dunst der Nacht schälte. Das muntere Plätschern des Wassers war neben den Schritten das einzige Geräusch, das an ihre Ohren drang. Immer deutlicher erkannte sie das achteckige Bauwerk mit den drei darüberstehenden steinernen Schalen, aus denen sich das Wasser kaskadenartig in das große Becken ergoss. Die Straße umschloss das historische Bauwerk, führte rechts und links daran vorbei. Sie nahm den kürzesten Weg und lief mitten auf der Fahrbahn. Das Kopfsteinpflaster, das man rund um den Brunnen verlegt hatte, ließ ihre Schritte stakkatoartig klackern. Rechts reckte sich der Toelleturm wie ein mahnend erhobener Zeigefinger in den nebligen Nachthimmel, links lag der Spielplatz, tagsüber ein beliebter Treffpunkt, um diese Zeit verwaist. Die Klettergerüste erinnerten sie an Skelette von Urtieren, die man hier zur Schau stellte. Das Gelände grenzte an den Waldrand der Barmer Anlagen, dahinter tat sich ein grünes Nichts auf, das um diese Uhrzeit beängstigend und wie das Tor zu einer anderen Welt wirkte.
Fröstelnd richtete sie den Blick wieder nach vorn. Es waren nur noch ein paar Meter, bis sie den Anfang des Villenviertels erreicht hatte. Doch noch war es nicht so weit.
»Bleib stehen!«, gellte die Stimme ihres Verfolgers durch die Nacht.
Vergiss es, erwiderte sie in Gedanken. Letzte Hoffnungen, dass es sich um jemanden handelte, der zufällig den gleichen Weg ins Villenviertel hatte, waren damit passé.
»Du sollst stehen bleiben!«
Im Leben nicht, hämmerte es in ihrem Kopf. Ich bin doch nicht verrückt. Sie rannte los und zog im Laufen das Smartphone aus der Manteltasche. Die Gesichtserkennung entsperrte das Gerät.
»Handy weg!«, gellte seine Stimme durch die Nacht.
Das hättest du wohl gern, dachte sie und beschleunigte ihre Schritte. Sie sah zu, dass sie den Abstand zu ihrem Verfolger vergrößerte, doch er hielt mit. Es fiel ihr schwer, im Rennen die rote Notruftaste des Smartphones zu betätigen. Ihre Stiefel eigneten sich nicht für eine Flucht, und so musste sie darauf achten, nicht zu stolpern. Denn dann, so viel war ihr klar, hatte sie verloren. Sie mobilisierte alle Kräfte, um weiter voranzukommen. Als sie sich auf der Höhe des Brunnens befand, spürte sie seine schwere Hand auf ihrer Schulter. Brutal hielt er sie fest und nahm dabei in Kauf, dass sie stürzte. Wild ruderte sie mit den Armen und achtete darauf, das Handy nicht zu verlieren. Er packte die Enden ihres Schals und zog die Schlaufe an ihrer Kehle fest zu. Auf der Stelle blieb ihr die Luft weg. Panisch versuchte sie, die sich zuziehende tödliche Schlinge zu lockern.
»Lass los, du kranker Idiot«, röchelte sie.
Er lachte leise, während er ihr brutal die Hände auf den Rücken riss und ihr einen schrillen Schmerzenslaut entlockte. Sie fühlte sich, als hätte er ihr die Schultern ausgerenkt. Etwas in ihrem Kreuz knackte vernehmlich, ein brennender Schmerz strömte durch ihren Körper. Die Schlaufe um ihren Hals zog sich weiter zu, plötzlich explodierten Lichtblitze vor ihren Augen. Gleichzeitig spürte sie, wie die Kraft sie verließ.
»Wir sind noch nicht fertig«, zischte er hinter ihr. Der Geruch seines Atems widerte sie an.
»Du sollst mich loslassen!« Sie setzte alles daran, sich aus seiner Umklammerung zu befreien. Vergeblich, denn sein Griff glich dem einer Schraubzwinge. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er so stark war. Brutal presste er sie an sich. Ihr blieb die Luft weg. Um ein Haar wäre ihr das Smartphone aus der Hand geglitten, doch sie umklammerte es, so fest es ging. Ihr war, als hinge ihr Leben an dem Gerät.
»Handy weg«, flüsterte er gleich neben ihrem Ohr. Sein fauliger Atem schlug ihr ins Gesicht. Ekel packte sie.
»Das kannst du vergessen, ich werde die Bullen rufen!«, krächzte sie. »Und dann bist du am Arsch.«
Er lachte humorlos auf. »Bis die hier sind, hast du es schon hinter dir.«
Sie riss den Kopf zur Seite und versuchte, ihm ins Gesicht zu blicken, doch er wich geschickt aus.
Er will nicht, dass ich ihm in die Augen sehen kann.
Seine Kleidung war schwarz; als sie den Blick nach unten richtete, erkannte sie schwere Springerstiefel an seinen Füßen. Das Gesicht lag im Schatten der Kapuze, seine Hände steckten in Handschuhen. Und er trug eine dunkle FFP2-Maske, wie es zu Pandemiezeiten üblich gewesen war. Die Maske verdeckte große Teile seines Gesichts. Und sie verhinderte auch, dass er im Kampf seine DNA auf ihrer Kleidung verteilte, dachte sie. Gebannt starrte sie auf seine Handschuhe.
Und er will keine Fingerabdrücke hinterlassen, durchzuckte es sie panisch. Für den Bruchteil einer Sekunde lockerte er seinen Griff, doch sie hatte nicht den Hauch einer Chance gegen ihn, denn schon im nächsten Augenblick zog er die Schlinge ihres Schals enger zu. Röchelnd riss sie die Arme hoch und versuchte, sich aus der Umklammerung zu befreien. Das Handy in ihrer Hand behinderte sie, doch sie sie ließ es nicht los. Als sie um Hilfe schreien wollte, entrang sich nichts als ein heiserer Laut ihrer Kehle.
Fuck, dachte sie, der Notruf, ich muss Hilfe holen.
Ihr Angreifer schob sie weiter zum Brunnen. Wehrlos ahnte sie, was er mit ihr vorhatte. Brutal drückte er sie gegen den steinernen Rand des unteren Beckens. Kraftlos ging sie in die Knie. Unsanft kam sie auf und spürte den harten Untergrund durch den Stoff ihrer Hose.
Vor ihr lag jetzt das Wasser der Steinschale. Tief und bodenlos, der Grund des Beckens war nicht auszumachen. Mit einer Hand zog er die Schlinge weiter zu, während er mit der anderen ihren Hinterkopf fixierte und sie nach unten drückte.
Er will mich ertränken. Panisch traten ihre Augäpfel aus den Höhlen. Sie fühlte, wie ihr die Luft wegblieb, und kam dem Wasser bedrohlich nahe. Verzweifelt versuchte sie, den Kopf zur Seite zu drehen, doch er war stärker. Es folgte ein kurzer und ungleicher Kampf. Er hatte sich breitbeinig hinter ihr aufgebaut, um für einen sicheren Stand zu sorgen. Quälend langsam presste er sie der Wasseroberfläche entgegen. Als sie sich mit beiden Händen am Beckenrand festklammern wollte, um das Schlimmste zu verhindern, entglitt ihr das Handy. Mit einem glucksenden Laut tauchte es ins Wasser ein und taumelte im Zeitlupentempo auf den Boden des Beckens.
Sie sammelte ihre Kräfte, weigerte sich, ihm wehrlos ihr Leben zu überlassen, und stemmte sich nach hinten. Sie trat aus wie ein Pferd, doch er wich geschickt aus.
Lachend drückte er ihren Kopf in das Wasserbecken. Die Kälte brannte kurz in ihrem Gesicht. Wie winzige Stecknadeln, die sich in ihre Haut zu bohren schienen. Das eiskalte Wasser flutete ihren Kopf. Sie schloss den Mund und die Augen, wartete, bis es vorbei war, doch als sich die Schlinge weiter zuzog, schnappte sie instinktiv nach Luft. In dem Augenblick, als sich ihre Lippen voneinander lösten und sie den Mund nur einen Spaltbreit öffnete, wusste sie, dass das ein tödlicher Fehler war. Das Wasser drang im Bruchteil einer Sekunde in ihre Kehle und bahnte sich den Weg in die Luftröhre. Schwindel lähmte ihre Gliedmaßen, das Brennen in ihrem Körper wurde schlagartig von einer unbeschreiblichen Kälte abgelöst.
Du hast verloren.
Jetzt spürte sie, wie das Leben aus ihrem Körper entwich. Ihre Kräfte verließen sie, alle Abwehrversuche waren sinnlos, um sich aus der Gewalt ihres Peinigers zu befreien. Die Geräusche klangen verzerrt an ihre Ohren, wurden vom Wasser geschluckt. Ihr Vorsatz, nicht zu atmen, scheiterte kläglich. Immer mehr Wasser bahnte sich seinen Weg in ihren Körper, ohne dass die Schlinge um ihren Hals sich lockerte. Die eisige Kälte, die sie umfing, erzeugte ein unkontrolliertes Zucken ihrer Muskeln. Sie spürte, wie ihre Hände den Beckenrand losließen. Ihre Arme glitten kraftlos ins Wasser. Sie fühlte, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie starb. Das Ende hatte sie sich immer anders vorgestellt. Doch niemand hatte sie gefragt, wie sie ihren eigenen Tod erleben wollte. Ihre Gedanken geisterten zäh durch ihren Kopf, sie fühlte sich wie eine Puppe und schien in ihrem Körper gefangen zu sein, bereit zu sterben. Wäre da nur nicht diese verdammte Kälte. In dem Augenblick, als das Leben sie verließ, lockerte sich sein Griff. Doch es war längst zu spät für sie, um jetzt noch Gegenwehr zu leisten. Fast schon spürte sie Erleichterung, als sie sich dem Sterben hingab, dann umfing sie eine alles verschlingende Dunkelheit. Sie hatte den kurzen, ungleichen Kampf verloren und damit ihren Tod besiegelt.
Kapitel 2
Zufrieden ließ er von seinem Opfer ab. Er lockerte die Schlinge und betrachtete die Frau, deren Oberkörper sich im Wasser der Brunnenschale seicht wiegte. Während er sie betrachtete, massierte er sich die schmerzenden Hände. Die Knöchel knackten vernehmlich. Der Schal hatte tiefe Furchen in seine Haut gegraben. Es war schneller gegangen, als er gedacht hatte. Mit einem prüfenden Blick versicherte er sich, dass es keine Zeugen gab. Für ihn war es gut gelaufen. Er richtete sich auf und atmete tief durch. Der aufkommende Wind trieb Nebelschwaden über den Boden und ließ das Licht der wenigen Straßenlaternen milchig erscheinen. Die feuchtkalte Luft roch nach Morast und Verwesung. Nur der unheilvolle Ruf eines Käuzchens fehlte, um die Kulisse eines alten Gruselfilms zu vervollständigen.
Ihr Oberkörper trieb im Brunnenwasser. Das muntere Plätschern der Kaskaden überspielte das Grauen, das sich hier ereignet hatte. Sein Plan war aufgegangen.
Mit Genugtuung hatte er miterlebt, wie das Leben aus ihrem panisch zuckenden Körper gewichen war. Unter Krämpfen hatte sie versucht, Luft zu holen, und dabei das Wasser förmlich inhaliert. Vergeblich, denn gegen ihn hatte sie keine Chance gehabt.
Eigentlich hatte er gedacht, dass ihr Todeskampf länger dauern würde. Für ihn war es ein Leichtes gewesen, sie zu überwältigen. Für ihn war es ein Genuss gewesen, sie sterben zu sehen. Der Gedanke daran, dass er Macht über Leben und Tod hatte, versetzte ihn in eine freudige Erregung. Er hatte sie gerichtet und den Zeitpunkt ihres Ablebens bestimmt.
Befriedigt trat er einen Schritt zurück, klopfte sich den Schmutz von der Hose und verharrte auf der verlassenen Straße, um den Augenblick auszukosten.
Wie eine leblose Stoffpuppe kniete sie vor dem Brunnen, der Oberkörper dümpelte auf der Wasseroberfläche, das Gesicht nach unten gerichtet. Ihr Haarknoten hatte sich im Kampf geöffnet. Nun umgab das lange dunkle Haar ihren Kopf wie eine Gloriole. Die Hände trieben auf dem Wasser, es schien, als wiegten sie sich im Takt der Ströme, die aus den oberen Schalen in das Becken plätscherten. Kurz war er versucht, das Smartphone aus der Tasche zu ziehen, um die Szene zu fotografieren und ein Andenken an seinen Sieg für immer zu konservieren. Doch er widerstand der Verlockung und gab sich damit zufrieden, diesen Anblick in seiner Erinnerung zu verewigen.
Das Geräusch eines Autos riss ihn aus seinen Gedanken. Er richtete sich auf und stieß einen Fluch aus. Zeugen konnte er jetzt nicht gebrauchen. Das Motorengeräusch näherte sich bedächtig. Der Wagen schien sich aus dem Villenviertel auf den Brunnen zuzubewegen. Langsam und gemächlich, aber unaufhaltsam. In der nächsten Sekunde sah er die Lichtbahnen der Scheinwerfer, die sich tiefer in den Nebel bohrten.
Hau ab, bevor es zu spät ist!
Ohne sich ein letztes Mal nach seinem Opfer umzublicken, schlug er sich in die Büsche. Mit großen Schritten rannte er davon und erreichte den Schutz des kleinen Eiscafés, das sich wie ein schwarzer Quader am Rand des Spielplatzes aus dem Dunst schälte. Gerade im rechten Moment, denn jetzt erschien der Wagen, der sich dem Brunnen näherte. Es war ausgeschlossen, dass der Fahrer die tote Frau im Becken übersah.
Sie war von einem Geräusch erwacht. Orientierungslos blinzelte sie ins Schwarz ihrer Umgebung. Ein Knacken und Knistern, so als würde man eine alte Schallplatte auflegen, schwirrte in der Luft. Auf der Stelle raste ihr Herz, die flaue Müdigkeit war verflogen. War er zurückgekommen?
Hastig versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen. Sosehr sie sich auch anstrengte, vermochte sie nicht zu sagen, ob sie Stunden oder nur Minuten geschlafen hatte. Jetzt befand sich ihr Körper in völliger Alarmbereitschaft.
Das Knistern schien von der Decke zu kommen.
Brannte es?
Schwerfällig richtete sie sich auf und sog die Luft durch die Nase ein. Doch sie nahm keinen Brandgeruch wahr und redete sich ein, dass das ein gutes Zeichen war. Panisch warf sie einen Blick in die Ecke, in der sich die Kamera befand. Jetzt schien es, als hätte das rote Leuchten an Intensität zugenommen. Die Umgebung der Kamera war in ein tiefrotes Glühen getaucht. Was hatte das zu bedeuten?
Das Knistern wandelte sich in ein Rauschen, das den Meereswellen ähnelte. Als sie blinzelte, bildete sie sich ein, an einem Strand zu liegen, um mit geschlossenen Augen dem gleichmäßigen Brausen der Brandung zu lauschen. Auch das Pfeifen des Windes mischte sich unter die eigenartige Kakofonie.
»Was soll das?«, gellte ihre Stimme durch das Verlies. »Hör auf damit!«
Erst tat sich nichts. Dann erschallte ein hämisches Gelächter, das sie mit seinen Schallwellen zu umschließen schien. Sie warf den Kopf in den Nacken und erkannte im Glutrot einen winzigen Lautsprecher, der in einer rostigen Halterung unter der Decke klemmte.
»Du bringst mich nicht in die Klapse, also spar dir den kranken Psychoterror!«, rief sie. Wie gern hätte sie sich die Hände vor die Ohren gepresst, um dem Lärm zu entgehen, doch die Fesseln an den Handgelenken ließen das nicht zu. Sie war der Geräuschkulisse wehrlos ausgeliefert. Der Wind schwoll zu einem brausenden Sturm an, der nur hörbar, aber nicht zu spüren war. Es war ein perfides Spiel, das ihr Peiniger mit ihr trieb. Wahrscheinlich wollte er sie mürbe machen, doch sie nahm sich vor, sich von ihm nicht in den Wahnsinn treiben zu lassen. So gut es ging, blendete sie die allgegenwärtige Beschallung aus und ließ sich zur Seite fallen. Ewig konnten diese geisterhaften Geräusche ja nicht andauern. Und um sie weichzukochen, musste er früher aufstehen.
Als hätte er ihre Gedanken gelesen, verebbte der Sturm aus dem Lautsprecher. Stille kehrte ein, das Blut rauschte ihr in den Ohren, als sie ins Dunkel blinzelte. Auch das kräftige Glühen der Kamera war verschwunden. Nur die kleine Leuchtdiode sandte ihr kaum wahrnehmbares Licht. Der Spuk war vorbei. Doch erleichtert war sie nicht, denn der Gedanke daran, dass er sein morbides Spiel weiterspielen würde, bereitete ihr Angst. Was würde als Nächstes passieren?
Kapitel 3
Manfred »Manni« Böklund nippte an dem Thermosbecher und fluchte, als er sich an dem schwarzen Kaffee die Lippen verbrannte. Wütend schob er den Becher in den Halter der Mittelkonsole und beschleunigte das Taxi. Die herrschaftlich anmutenden Villen zogen beiderseits der Straße an ihm vorüber. Meist waren die prächtigen Häuser durch Mauern, hohe Hecken und blickdichte Zäune vor neugierigen Blicken geschützt. Die Reichen und Schönen der Stadt wollten ungestört sein.
Eben hatte Manni ein elegant gekleidetes Paar von Anfang dreißig nach Hause gebracht. Die beiden hatten es kaum erwarten können, sein Taxi zu verlassen. Schon während der Fahrt, die sie vom Opernhaus auf die Südhöhen der Stadt geführt hatte, waren die beiden auf der Rückbank in innige Zärtlichkeiten versunken. Sie hatten hemmungslos geknutscht, getuschelt, gekichert und gefummelt.
Einmal hatte er im Innenspiegel sehen können, wie die Hand des Mannes im Maßanzug unter den kurzen Rock seiner blonden Begleiterin gewandert war. Wenn Manni im Schein der Straßenlaternen richtig gesehen hatte, dann hatte die junge Frau kein Höschen getragen. Angesichts dieser Beobachtung hatte er an einer roten Ampel fast einen Auffahrunfall verursacht. Sie hatte das mitbekommen und ihm über den Spiegel einen lasziven und gleichermaßen schadenfrohen Blick zugeworfen. Schon in der Haustür waren die beiden förmlich übereinander hergefallen.
Manni verdrängte den äußerst appetitlichen Anblick aus seinem Kopf und konzentrierte sich auf die Fahrt. Seine Nachtschicht hatte eben erst begonnen, und er war gespannt, welche skurrilen Gestalten noch in seinen Wagen steigen würden.
Solange keiner kotzt oder mir ein Messer an die Kehle hält, ist alles gut, sagte er sich. Kurz warf er einen Blick auf das Foto seiner Frau Monika auf dem Armaturenbrett. Sie lag wahrscheinlich längst im Bett. In all den Jahren ihrer Ehe waren sie es gewohnt, sich an manchen Tagen kaum zu sehen. So auch heute. Tagsüber hatte er versucht zu schlafen, um in der Nacht fit zu sein. Der Kaffee, an dem er sich eben verbrannt hatte, sollte dazu beitragen. Manni Böklund hatte es nicht eilig. Mit einem Blick auf die Uhr im Armaturenbrett stellte er fest, dass der neue Tag vor einer halben Stunde begonnen hatte. Nachdem er sich in der Zentrale frei gemeldet hatte, war er angewiesen worden, den nächsten Taxi-Sammelpunkt anzufahren, um dort auf die kommende Tour zu warten. Durch das einen Spaltbreit offen stehende Seitenfenster drang die Kälte in den Wagen, doch er brauchte frische Luft. Das Nachtprogramm der ARD berieselte ihn mit leiser Musik in der äußerst unwirtlichen Nacht. Nebelschwaden geisterten im Scheinwerferlicht auf den Wagen zu, um vom Fahrtwind zerrissen zu werden und sich hinter dem Taxi zu neuen, surrealen Gebilden zu formieren. Manni war froh, dass er nicht aussteigen musste.
An dem kleinen Platz, an dem die Adolf-Vorwerk-Straße und die Hohenzollernstraße aufeinandertrafen, endete der Asphaltbelag. Jetzt rumpelte der Wagen über das Kopfsteinpflaster, das nach Ansicht der Stadtplaner besser zu diesem historischen Ort passte. Links lag weiter hinten der Toelleturm, rechts erstreckten sich die Barmer Anlagen, ein parkähnlich angelegtes Waldstück. Der Spielplatz sorgte dafür, dass auch Kinder ihre Freude an diesem Ort hatten.
Um diese Zeit wirkte die Umgebung wie die Kulisse eines düsteren Films. Er richtete den Blick auf den Toelleturm, der sich links aus dem Nebel schälte. Als er den Kopf nach rechts wandte, sah er im letzten Moment eine gleitende Bewegung. Ein hochgewachsener Schatten nur, der ins Dickicht verschwand und dann unsichtbar wurde. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, fand der Taxifahrer nicht. Jetzt lag der Vorwerk-Brunnen vor ihm. Dort erregte etwas seine Aufmerksamkeit. Er sah das leuchtende Senfgelb eines Mantels. Das Kleidungsstück gehörte zu jemandem, der in seltsamer Haltung vor dem Brunnen zu knien schien. Vom Lenkrad aus konnte Manni das Gesicht der Gestalt nicht sehen, es machte aber den Eindruck, als würde sie den Kopf unter Wasser halten. Der Umstand, dass sich die Person nicht rührte, bereitete ihm Angst. Erst beim zweiten Hinsehen erkannte er die bizarre Haltung der Gliedmaßen.
»Was zur Hölle …?«, entfuhr es dem Taxifahrer, während er sich den Kopf nach der Person im Brunnen verrenkte. »Was geht da ab?«, stieß er heiser hervor und brachte das alte Taxi zum Stehen. Mit zitternden Fingern betätigte er die Warnblinkanlage. Er löste seinen Sicherheitsgurt, wuchtete die Tür auf und sprang aus dem Wagen, um zu Hilfe zu eilen. Manni hechtete zu der Person am Brunnen und spürte, dass ihn die wenigen Schritte in Atemnot brachten. Er nahm sich vor, ein paar Kilo abzunehmen, so, wie Monika es ihm seit Jahren empfahl.
»Hallo?!«, rief er schon von Weitem und registrierte, wie geisterhaft seine Stimme im Nebel klang. »Hallo, geht es Ihnen gut?«
Was für eine unsinnige Frage, schalt er sich einen Narren. Jetzt erkannte er, dass es sich bei der Gestalt um eine Frau handelte. Sie liegt kopfüber im Brunnen, da wird es ihr wohl kaum gut gehen. Außer Puste erreichte er sie. Er beugte sich über sie.
»Kommen Sie da raus«, rief er atemlos und packte den Oberkörper der Unbekannten an den Schultern, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Dicke Tropfen rannen ihr aus der Kleidung und den langen, dunklen Haaren. »Hallo!«, wiederholte er verzweifelt und rüttelte an ihr, doch sie gab kein Lebenszeichen von sich. Als er sich zu ihr hinunterbeugte, stellte er fest, dass ihre Lippen blutleer waren und der Mund offen stand. Das Schlimmste aber waren die weit aufgerissenen Augen, mit denen sie ihn anzustarren schien.
»Scheiße«, flüsterte Manni. Die Angst, dass die Frau tot war, griff mit eiskalten Klauen nach ihm. Doch er wollte so schnell nicht aufgeben, legte seine Arme unter ihre Achseln und zog sie keuchend vom Brunnen fort. Das Wasser triefte ihr aus der Kleidung und den langen, dunklen Haaren.
Sein Pullover war auf der Stelle durchnässt. Auch wenn sie nichts mehr spürte, bettete er die Fremde behutsam neben seinem Taxi auf das Kopfsteinpflaster. Ohne zu zögern, begann er mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Innerlich fluchte er, weil sein letzter Erste-Hilfe-Kurs schon viel zu lange zurücklag. Vor den Auffrischungskursen, die ihm sein Chef immer ans Herz legte, hatte er sich jedes Mal erfolgreich gedrückt.
Ein Geräusch am Waldrand riss ihn aus seinen Überlegungen. Kurz erinnerte er sich an den geisterhaften Schatten, den er drüben beim Eiscafé bemerkt hatte. Er sah auf, suchte die Umgebung mit seinen Blicken ab, ohne im Nebel etwas erkennen zu können.
»Hallo!?«, rief er und wunderte sich über den eigenartigen Klang seiner Stimme. Vermutlich hatte ein Tier das Geräusch verursacht. Er war allein.
Mit einem Blick nach hinten vergewisserte er sich, dass die Frau von seinem Taxi geschützt war. Der Wagen stand mit Standlicht und eingeschalteter Warnblinkanlage mitten auf der Fahrbahn. So drohte trotz des Nebels keine Gefahr, dass sie von einem anderen Wagen überrollt wurde. Gleich würde Manni das Warndreieck aufstellen und die reflektierende Warnweste anlegen, doch jetzt galt es erst einmal, sich um die leblose Frau zu kümmern und einen Notruf abzusetzen.
Kapitel 4
Träge nur registrierte Björn Lassner das dumpfe Brummen seines Diensthandys, das, vom Vibrationsmotor im Innern des Gehäuses angetrieben, über die Nachtkonsole wanderte. Als er verschlafen blinzelte, erblickte er den bläulichen Schein des Displays. »Mia ruft an«, stand dort. Die Einrichtung des Schlafzimmers erschien in einem surrealen Licht.
»Dein Telefon«, murmelte Lena schlaftrunken neben ihm, während sie an seiner Schulter rüttelte. »Es klingelt.«
»Ich hör nichts«, brummte er widerwillig und zog sich die Bettdecke über den Kopf. »Wie spät ist es?«
»Gleich halb zwei.«
»Nee, oder?«
»Doch, Björn. Nun mach schon, umso schneller kann ich weiterschlafen.« Lena zog ihm die Bettdecke fort. Björn beschwerte sich, während er sich schwerfällig aufrichtete. Der eiserne Rahmen ihres französischen Ehebettes knarrte vernehmlich. Es war höchste Zeit für ein neues Bett, doch gerade hatte er andere Sorgen. Die Kälte kroch an ihm hoch, denn Lena legte Wert darauf, die Heizung in ihrem Schlafzimmer nur in Ausnahmefällen zu nutzen. Durch die Ritzen der Jalousie erkannte er den milchigen Schein der Straßenlaterne vor dem Haus, ansonsten herrschte tiefe Dunkelheit in der Siedlung. Nur er musste sicher gleich los – eine eher unschöne Vorstellung.
Björn Lassners Kollegin, Kriminalkommissarin Anna-Maria »Mia« Sommer, hatte Bereitschaft im Polizeipräsidium. Wenn sie mitten in der Nacht anrief, bedeutete das nichts Gutes.
»Einen wunderschönen guten Morgen«, flötete sie ihm gut gelaunt ins Ohr, nachdem er den Anruf angenommen hatte.
»Das seh ich anders, Mia«, knurrte er und rollte mit den Augen, was seine Kollegin am anderen Ende der Leitung natürlich nicht sehen konnte. »Schieß los – was ist passiert?« Er warf einen bangen Blick auf Lena, die neben ihm wieder eingeschlafen zu sein schien. Gut so, denn wenn sie erwachte, war die Laune seiner Frau üblicherweise denkbar schlecht.
»Leblose Person, aufgefunden im Vorwerk-Brunnen am Toelleturm«, antwortete Mia am anderen Ende der Leitung.
»In einem Brunnen?« Mühsam richtete sich Björn auf. »Ertrunken?«
»Sieht so aus. So, und jetzt spring in die Buxe, ich stehe in einer Viertelstunde vor deiner Haustür, die Kollegen vom Sechsten und der erste Angriffstrupp sind schon vor Ort.«
»Na toll«, brummte Lassner.
»Ich kann es nicht ändern. Du weißt ja – Tatort ist nicht nur sonntags.«
»Leck mich.« Lassner wusste, dass seine Partnerin einen Slogan des Bundes Deutscher Kriminalbeamter zitierte, der sich vor einigen Jahren kritisch mit der Attraktivität des Berufes auseinandergesetzt hatte. »Ich mach mich fertig.«
»Geht doch.« Mia unterbrach die Verbindung. Lassner streckte sich und gähnte herzhaft.
Lena erwachte unter seinem demonstrativen Gähnen. Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen und warf Björn einen vorwurfsvollen Blick zu.
Er murmelte eine Entschuldigung. »Es gibt Arbeit«, erklärte er zerknirscht.
»Fein.« Lena zog eine Grimasse, streckte den Arm zur Nachtkonsole aus und schaltete die kleine Lampe ein.
Er hielt das Smartphone noch in der Hand, während er seine Frau im fahlen Lichtschein betrachtete. »Ich fürchte, die Nacht ist vorbei.«
»Da lasse ich meinen Mann also zu nachtschlafender Zeit von einer anderen Frau abholen«, stellte Lena pikiert fest. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und starrte an die Schlafzimmerdecke.
»Lena, bitte – jetzt nicht.« Björn seufzte. Seiner Frau war es ein Dorn im Auge, dass Frank Thies, der Leiter des Wuppertaler KK11, ihrem Mann ausgerechnet eine Teampartnerin zur Seite gestellt hatte. Obwohl er ihr in ihrer sechzehnjährigen Ehe immer treu gewesen war, konnte sie ihre Eifersucht einfach nicht ablegen. Auch wenn er sich öfter nach leidenschaftlichem Sex mit ihr sehnte, während ihr Kuscheln und körperliche Nähe meistens genügten, hatte er ihr nie einen Grund gegeben, misstrauisch zu sein.
Trotzdem schwebte ihre Eifersucht ständig wie ein unheilvolles Damoklesschwert über ihnen. In dieser Situation zu streiten, lag ihm aber fern. »Ich bin kurz im Bad, dann muss ich los.«
»Ich weiß.« Hinter ihm stieß Lena die Bettdecke zur Seite und schlüpfte in Jogginghose und Hoodie.
Im Bad hörte er, wie sie die Treppe ins Erdgeschoss hinabstieg. Eilig warf er sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht und war auf der Stelle hellwach. Während er sich wusch, dachte er über das kurze Telefonat mit Mia nach. Ein wenig verärgert stellte er fest, dass er nicht viel von ihr erfahren hatte.
Missmutig betrachtete er sich im Spiegel über dem Waschbecken. Dunkle Bartschatten zeichneten sein Gesicht und ließen ihn deutlich älter wirken als Mitte vierzig, doch die Rasur musste warten. Nachdem er sich angezogen hatte, schob er das Smartphone in die Hosentasche und schlurfte hinunter in die Küche. Dabei achtete er darauf, keinen unnötigen Lärm zu veranstalten, um Leon nicht aufzuwecken. Der Junge brauchte seinen Schlaf, um in der Schule fit zu sein. Als Björn die Tür mit dem handgemalten Schild »Caution Teenager« passierte, hielt er kurz die Luft an, um zu lauschen. Doch hinter der Tür rührte sich nichts, und so setzte er seinen Weg nach unten fort.
Das grelle Licht der Küchenlampe blendete ihn, aber der aromatische Duft nach frischem Kaffee versöhnte ihn schnell. Lena saß mit übereinandergeschlagenen Beinen am kleinen Tisch, vor ihr stand eine Tasse mit dampfendem Kaffee.
»Wie ist sie so?« Sie legte das Handy, an dem sie gerade gespielt hatte, auf den Tisch und zupfte die Wachstuchdecke zurecht.
»Was? Wer?«
»Na, die Neue, deine Mia.«
Björn stöhnte auf. »Anna-Maria ist nicht meine Mia.«
»Aber deine neue Partnerin.«
»Das schon.« Björn zog es vor, stehen zu bleiben, und lehnte sich an die Arbeitsplatte. Erst vor einigen Wochen war Mia aus dem sechzehnten Kommissariat, der Kriminalwache, zum Elften gewechselt. »Sie ist wortgewandt, gebildet, interessiert sich für Kultur und die Geschichte der Stadt. Sie besitzt eine gute Auffassungsgabe, und sie ist …«
»Hübsch?«, unterbrach Lena ihn schnippisch.
»Lena, bitte«, entfuhr es ihm lauter, als er es beabsichtigt hatte. Er hoffte, dass ihr fünfzehnjähriger Sohn nichts von dem sich anbahnenden Streit mitbekam. »Sie sieht normal aus.«
»Normal ist relativ.«
»Eben.« Björn verspürte keine Lust auf eine Grundsatzdiskussion. Er wandte sich zu einem der Hängeschränke um und nahm einen Thermosbecher heraus. Schweigend trat er an die Kaffeemaschine und befüllte die große Tasse. Im Polizeidienst gehörte es zum Alltag, dass die Mitglieder eines Teams oft mehr Zeit miteinander verbrachten als mit ihren Lebenspartnern. Doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um mit Lena über ihre Befindlichkeiten zu sprechen. Mit dem Becher in der Hand betrachtete er seine Frau. Lena war zwei Jahre jünger als er, sie war schlank und trug die blonden Haare offen. Ihre strahlend blauen Augen sahen ihn anklagend an. Gerade als Björn sich zu ihr beugen wollte, um sie zu küssen, fuhr draußen ein Wagen vor. Björn trat ans Küchenfenster und schob das Plisseerollo nach unten, um in die Nacht hinausblicken zu können. Dichte Nebelschwaden waberten über den Boden, die von den Scheinwerfern eines silbernen Passat Variant angestrahlt wurden, der mit laufendem Motor vor dem Haus stand.
»Mia ist da«, bemerkte Björn, winkte der im Auto wartenden Kollegin zu und wandte sich vom Fenster ab.
Er seufzte, als er Lenas leidenden Blick sah, und blieb kurz stehen. »Mach dir keinen Kopf«, sagte er in sanftem Tonfall. Er beugte sich zu ihr herab und küsste sie. »Es besteht kein Grund zur Eifersucht.«
Als Lena zu ihm aufblickte, war ihre Miene versteinert. Schweigend nickte sie. Björn seufzte, drückte ihre Hand und begab sich in den Flur, um die Jacke vom Garderobenhaken zu nehmen.
»Drück Leon von mir«, rief er in die Küche, dann schloss er die Haustür auf und stand im nächsten Moment in der nebelverhangenen Nacht. Die feuchte Kälte kroch in wenigen Sekunden unter seine Kleidung und ließ ihn frösteln. Der Motor des Passats surrte im Leerlauf, als er die Beifahrertür öffnete und einstieg.
Mia wirkte im Gegensatz zu ihm fit und ausgeschlafen. »Guten Morgen, Herr Kollege«, säuselte sie.
»Leck mich.« Er schob den Thermosbecher in das Ablagefach in der Türverkleidung und schnallte sich an. Während Mia den Wagen rückwärts zur Straße lenkte, blickte er sich noch einmal zum Haus um. Lena stand mit regungsloser Miene am Küchenfenster. Er hauchte ihr einen Kuss zu, dann entschwand das Reihenhaus, in dem sie seit zehn Jahren lebten, seinem Blickfeld.
»So gut gelaunt?«, fragte Mia mit einem süffisanten Lächeln, ohne die Augen von der Fahrbahn zu nehmen.
Er knurrte etwas Unverständliches.
»Lena?«, fragte Mia. »Ist sie wieder eifersüchtig?«
»Jo. Es interessiert sie nicht, dass es um eine tote Frau geht.«
Die fast ausnahmslos dunkel daliegenden Häuser am Stadtrand von Elberfeld flogen an ihnen vorbei. Mia schien es eilig zu haben, sie legte einen zügigen Fahrstil an den Tag. Dabei kam ihr gelegen, dass auf den Straßen kein Betrieb herrschte und ein Großteil der Ampeln um diese Zeit abgeschaltet waren.
Mia lachte, als sie Björns verschlossene Miene sah.
»Mensch, Lassner«, rief sie amüsiert. »Wann willst du deiner Frau endlich sagen, dass ich mit Männern nichts anfangen kann?«
Er war geblieben. Die Neugier auf das, was gleich passieren würde, hatte ihn jede Vernunft vergessen lassen. Von seinem Versteck, zwischen dem Eiscafé und einem alten Ahornbaum, konnte er das Geschehen drüben beim Brunnen gut beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Die feuchte Kälte stieg in ihm auf, und er erschauderte. Doch wegzulaufen kam ihm jetzt nicht in den Sinn. Er atmete weiter in die Maske und tippelte von einem Bein auf das andere. Der Wagen, ein Taxi, war neben ihr stehen geblieben. Nun stand der alte Mercedes mit eingeschalteter Warnblinkanlage und Standlicht mitten auf der verlassenen Fahrbahn. Der Taxifahrer hatte gekeucht und geächzt, während er sie mühsam aus dem Wasser zog. Jetzt lag sie vor ihm auf der Straße und konnte sich gegen seine vergeblichen Wiederbelebungsversuche nicht verwahren.
Lass sie, dachte er in seinem Versteck. Sie hat es nicht verdient, sie hat es nicht überlebt, spar dir deine Mühe. Doch der Taxifahrer gab so schnell nicht auf. Dabei keuchte der Dicke wie nach einem Halbmarathon. Er ahnte nicht, dass er zu spät kam. Oder wollte es nicht glauben.
Ich habe über Leben und Tod entschieden.Bei diesem Gedanken schlug sein Herz ein paar Takte schneller.
Und ich habe ihr Leben beendet, weil ich es für richtig gehalten habe.
Immer wieder unterbrach der Taxifahrer seine Bemühungen und tätschelte der Frau die Wangen. »Hallo?«, rief er immer mit zitternder Stimme. »Kommen Sie zu sich!«
Er musste sich ein Lachen verkneifen. Sie hört dich nicht mehr. Mutig wagte er sich einen halben Schritt nach vorn, um besser sehen zu können. Als er sein Gewicht verlagerte, knackte ein trockener Ast unter ihm. Sein Herzschlag schien einen Moment auszusetzen. Er zerquetschte einen Fluch auf den Lippen und zog sich in den Schutz der Dunkelheit zurück. Drüben schien auch der Taxifahrer auf ihn aufmerksam geworden zu sein. Schwerfällig erhob er sich, um zu dem kleinen Waldstück zu blicken.
»Hallo?«, rief der Mann. Er wandte den Kopf und sah jetzt genau in seine Richtung.
Rückzug, gellte es in ihm. Er machte auf dem Absatz seiner Stiefel kehrt und stürmte in die Dunkelheit hinein, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Sein Voyeurismus wäre ihm fast zum Verhängnis geworden. Orientierungslos rannte er auf einen unbefestigten Weg zu, der geradewegs in den angrenzenden Wald und in die Barmer Anlagen führte.
Er hat mich gesehen. Gehetzt stolperte er weiter und wagte nicht ein einziges Mal, sich umzuschauen. Wenige Sekunden später wurde er vom Nebel verschluckt, und es schien, als hätte es ihn niemals gegeben.
Eine Viertelstunde später erreichten sie die Einsatzstelle. Der Fundort des Opfers war weiträumig abgesperrt. Sichtschutzwände sicherten die Tote vor den neugierigen Blicken der Schaulustigen, die sich trotz nächtlicher Stunde mit ihren Smartphones eingefunden hatten, um das Geschehen zu filmen und es so schnell wie möglich in den sozialen Netzwerken zu verbreiten.
»Ich werde mich nie an diese Aasgeier gewöhnen«, brummte Lassner schlecht gelaunt, als die Handykameras auf den Dienstwagen gerichtet wurden. Wütend klappte er die Sonnenblende herunter.
Mia ahnte, dass seine schlechte Laune noch am Streit mit seiner Frau lag, von dem er kurz berichtet hatte. Lassner war glücklich verheiratet – eigentlich. Sie wusste von ihm, dass er einen Sohn hatte, der mitten in der Pubertät steckte, und dass sie zu dritt in einem dieser spießigen, geklinkerten Reihenhäuser am Rand von Elberfeld lebten. Wäre da nicht die in Mias Augen krankhafte Eifersucht seiner Frau, dann wäre Björn Lassner wohl ein glücklicher Mann gewesen. Doch Lenas Beschuldigungen gingen ihm immer an die Nieren.
»Ich hasse diese Parasiten«, schnaubte er kopfschüttelnd und löste den Gurt des Beifahrersitzes.
»Und ich dachte immer, du bist der digitale Crack von uns beiden«, sagte Mia grinsend, nachdem sie den Passat vor der Absperrung zum Stehen gebracht hatte.
»Das da«, Lassner zeigte auf die Menschenmenge, »sind keine Digital Natives, das sind Gaffer, die sich am Leid der anderen aufgeilen.«
Insgeheim musste Mia ihrem Partner recht geben. Doch es war nicht ihre Aufgabe, die Schaulustigen auf Distanz zu halten. Dafür waren die Kollegen vom Streifendienst zuständig. Nachdem sie ausgestiegen waren, umfing sie die klamme Kälte der Novembernacht.
»Scheißwetter«, brummte Lassner.
»November halt.« Fröstelnd schlug Mia den Kragen ihrer gesteppten Jacke hoch und schob die Hände in die Jackentaschen. Sie gab ihrem Partner ein Zeichen. »Dann mal los.«
»Ja. Auf in den Kampf.« Nebeneinander stapften sie auf eine uniformierte Kollegin zu, die an der Absperrlinie auf sie wartete. Das schraffierte Plastikband flatterte im seichten Nachtwind.
Nachdem sie sich ausgewiesen hatten, durften sie passieren. Die Arbeit hinter den Sichtschutzwänden war bereits im vollen Gange. Die Kollegen der Kriminaltechnik hatten Stecknummern rund um den Fundort des Opfers aufgestellt, jemand in einem weißen Einmalanzug machte Fotos vom Geschehen, auch die 360-Grad-Kamera wurde gerade in Position gebracht.
Blaulicht zuckte gespenstisch durch die Nacht und geisterte über die umliegenden Bäume und die angrenzenden Häuser des kleinen Platzes. Rund um den Brunnen hatte man leistungsstarke Scheinwerfer aufgestellt, die auch die letzte Dunkelheit vertrieben. Der immer dichter werdende Nebel sorgte für eine surreale Stimmung. Ein offenbar herrenloses Taxi stand mit eingeschalteter Warnblinkanlage und offener Fahrertür auf Höhe des großen Brunnens mitten auf der Straße. Das Standlicht und das Taxizeichen auf dem Dach leuchteten milchig im Dunst. Mia hatte den Eindruck, als wäre das Fahrzeug fluchtartig verlassen worden.
Neben dem Taxi lag eine Gestalt, die mit einem schwarzen Tuch abgedeckt war, offenbar die tote Person.
Mia sah Kriminalhauptkommissar Peter Nohlen von der KTU neben dem Brunnen stehen. Die Kriminaltechnik gehörte zum fünfzehnten Kommissariat und arbeitete in vielen Fällen eng mit den anderen Abteilungen zusammen. Von der Leiterin des KK15, Elisabeth Völker, war nichts zu sehen. Mia vermutete, dass sie im warmen Bett lag, um ihren Schönheitsschlaf zu halten.
Nohlen wechselte gerade ein paar Worte mit dem Notarzt, der offensichtlich eben die erste Leichenschau vorgenommen hatte. Mia erkannte Dr. Dirk Rosengarten. Sie nickten sich zu. Als Nohlen, ein hochgewachsener Mann mit braunen Augen und dunklem Haar von Anfang fünfzig, die beiden erblickte, beendete er das Gespräch mit dem Arzt und trat auf sie zu. »Guten Morgen, Kollegen.«
»Gut ist anders«, brummte Lassner und rang sich ein müdes Grinsen ab. »Was ist passiert?«
Nohlen deutete mit dem Kinn auf das Taxi. »Der Fahrer, ein gewisser Manfred Böklund, kam gerade aus Fahrtrichtung Marpe, als er auf die Tote im Brunnen aufmerksam wurde. Der Zeuge gibt an, dass die Frau bei seinem Eintreffen mit dem Oberkörper im Wasser lag. Er hat sie umgehend herausgezogen und Reanimationsmaßnahmen eingeleitet – leider erfolglos.«
»Böklund?« Mia lachte. »Wie die Würstchen?«
Nohlen stöhnte auf. »Mitunter ist deine gute Laune etwas anstrengend«, attestierte er ihr.
»Also haben wir einen Zeugen«, stellte Lassner fest, ohne auf das Geplänkel der beiden einzugehen.
»Zeuge ist zu viel gesagt. Er kam ja zu spät.« Nohlen wandte sich ihm zu. »Zumindest hat er die Frau in ihrer misslichen Lage aufgefunden. Wie sie in den Brunnen gelangt ist, hat er nicht beobachtet.«
»Also ist sie ertrunken?«, mutmaßte Lassner.
»Rosengarten hat ›Todesursache ungeklärt‹ im Totenschein angekreuzt. Alles andere muss die Obduktion ergeben.« Nohlen nickte dem Mediziner zu, der gerade im Begriff stand, sich von den Polizisten zu verabschieden. Kurze Zeit später setzte sich sein Einsatzwagen in Bewegung.
Mia ging neben der abgedeckten Frauenleiche in die Hocke. »Ist sie denn ins Wasser gefallen? Stand sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, oder hat jemand nachgeholfen?«
Peter Nohlen überflog den Bericht des Arztes. »Hier steht was von Hämatomen im Halsbereich, möglicherweise Würgespuren. Kann sein, dass sie mit ihrem eigenen Schal erwürgt wurde.«
»Also hat zuvor ein Kampf stattgefunden.«
»Der oder die Täter haben die Frau überwältigt und ihren Kopf unter Wasser gedrückt, sodass sie ertrunken ist«, vermutete Lassner.
»Sieht so aus«, stimmte Nohlen ihm zu.
Lassner ließ den Blick über das Geschehen schweifen, bevor er sich an Nohlen wandte. »Wo ist der Taxifahrer?«
»Er sitzt mit den Kollegen im Bulli.« Nohlen zeigte auf einen Mercedes Vito des Streifendienstes. Die Innenbeleuchtung brannte, die Scheiben waren jedoch beschlagen und verhinderten, dass man in das Fahrzeug blicken konnte.
»Ich möchte mit ihm sprechen.« Mia wechselte einen Blick mit ihrem Partner, dann sah sie zu Nohlen auf. »Über die Identität der Frau ist nichts bekannt, nehme ich an?«
»Eigenartigerweise doch«, erwiderte der Kollege. »Wir haben ihr Schlüsselbund und ein Portemonnaie gefunden, das sie in der Jackentasche mitführte.«
»Trug sie kein Handy bei sich?«, wollte Mia wissen.
»Das ist der Hammer«, erwiderte Nohlen mit einem breiten Grinsen. Er hielt einen Asservatenbeutel hoch, in dem sich ein Smartphone befand, offenbar ein höherwertiges Modell. Der Klarsichtbeutel war von innen beschlagen.
»Das ist nass«, stellte Lassner fest.
Nohlen nickte. »Die Kollegen haben das Gerät aus dem Brunnen gefischt. Es muss ihr ins Wasser gefallen sein.«
»Vermutlich nicht zu retten«, schätzte Mia. »Und damit wertlos für uns, nehme ich an?«
Lassner schüttelte den Kopf. »Das ist ein iPhone 16«, stellte er mit Kennerblick fest. »Die Dinger haben eine IP68-Schutzklasse.«
»Bedeutet was?« Mia verstand nicht allzu viel von technischen Dingen.
»Dass das Gerät bis zu dreißig Minuten lang und bis zu einer Tiefe von sechs Metern keinen Schaden nehmen sollte«, erklärte Lassner. Er zwinkerte Nohlen zu. »Es besteht also Hoffnung.«
»Ich werde Basti gleich damit beauftragen, alles da rauszuholen, was noch zu retten ist«, versprach Nohlen. »Aber eines noch: Wir haben gesehen, dass das Opfer versucht hat, einen Notruf abzusetzen, das Gerät befand sich im entsprechenden Modus.«
»Sie wollte Hilfe holen«, murmelte Mia mit einem Schaudern.
»Leider kam es dazu nicht mehr«, bemerkte Lassner.
Während Nohlen das Smartphone in einen Koffer steckte, betrachteten Lassner und Mia die anderen Asservatenbeutel. Darin befanden sich eine hochwertig aussehende Geldbörse aus braunem Leder und ein Schlüsselbund. Mia erkannte die typische Kombination, die aus Haustür- und Briefkastenschlüssel bestand.
»Um wen handelt es sich?«, wollte sie wissen.
Nohlen warf einen Blick auf seine Dokumentation. »Die Tote heißt Theresa Winkler, zweiundvierzig Jahre alt. Wohnhaft hier in der Nähe, in der Adolf-Vorwerk-Straße.« Nohlen hantierte mit seinem Smartphone und rief das Bild des Personalausweises auf, dann nannte er ihnen die Hausnummer. »Am besten hört ihr euch an der Meldeadresse mal um. Möglicherweise gibt es Angehörige.«
Mia nickte. »Sonst noch was?«
»In ihrem Portemonnaie fanden wir Visitenkarten, aus denen hervorgeht, dass sie in Elberfeld eine Praxis für Psychologie führte.«
Lassner pfiff durch die Zähne. »Eine Seelenklempnerin«, sagte er. »Da kann es sich bei dem Täter um einen enttäuschten oder frustrierten Patienten handeln.«
»Deine Fantasie geht mit dir durch«, stellte Mia amüsiert fest.
»Hat es alles schon gegeben.« Lassner seufzte. »Was ich nicht verstehe«, überlegte er, »warum hat der Täter ihr die persönlichen Dinge gelassen?«
Mia wusste, worauf ihr Partner hinauswollte. Normalerweise nahmen Gewaltverbrecher ihren Opfern Gegenstände, die auf deren Identität hindeuteten, ab. »Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Dass es ein Unfall war, können wir aufgrund der Hämatome so gut wie ausschließen. Aber die zweite Möglichkeit wäre, dass der oder die Täter …«
»… auf frischer Tat ertappt wurden und das Weite gesucht haben«, beendete Lassner den Satz.
»Erwischt von dem Taxifahrer.« Mia nickte. »Wir sollten mit ihm reden.« Sie ging neben der Toten in die Hocke, streifte sich Gummihandschuhe über und sah zu Nohlen auf. »Darf ich?«
Der Kriminaltechniker hatte keine Einwände. Zaghaft zog Mia das Tuch zurück. Vor ihr lag eine dunkelhaarige, schlanke Frau. Das Gesicht war fein geschnitten, ihre Schminke zerlaufen. Die Haut war blass und wirkte bereits wächsern, die Lippen waren blutleer. Zu Lebzeiten musste Theresa Winkler eine hübsche Frau gewesen sein. Sie trug einen dicken senfgelben Mantel, um den Hals einen cremefarbenen Schal, helle Designerjeans und Sneaker einer namhaften Marke.
Auch wenn der Anblick von Toten Bestandteil ihres Berufes war, gingen Mia solche Momente immer noch nahe. Sie mahnte sich, professionell zu agieren, und fotografierte die Frau mit dem Smartphone.
»Was wissen wir von den Anwohnern?«, fragte Mia an Nohlen gewandt, ohne sich zu ihm umzusehen. »Hat niemand etwas Verdächtiges mitbekommen? Schreie, einen lautstarken Streit oder ein Auto, das sich schnell vom Tatort entfernt hat?«
»Vielleicht hat einer der Schaulustigen etwas gesehen«, fügte Lassner hoffnungsvoll hinzu. Nohlen zuckte mit den Schultern. »Die Befragung der Anwohner müsstet ihr organisieren, da bin ich raus.«
»Wird gemacht.« Mia zückte das Handy, um Verstärkung anzufordern.