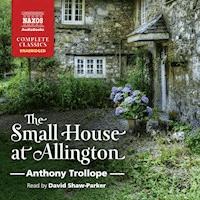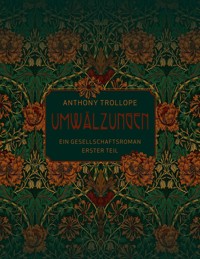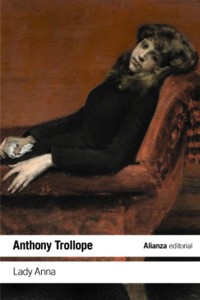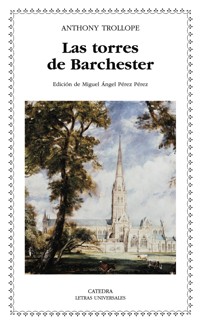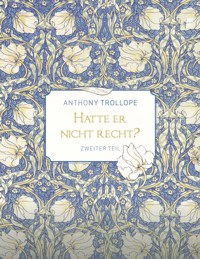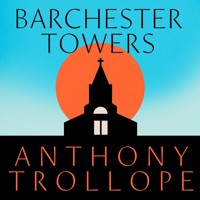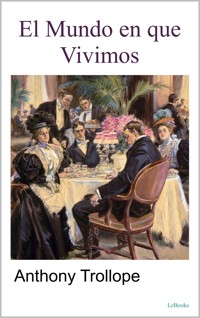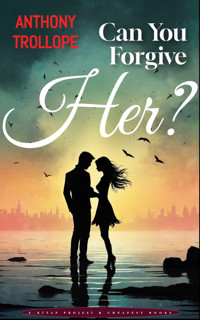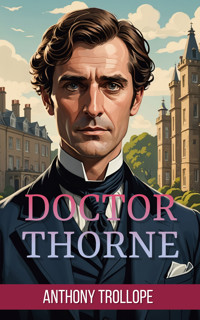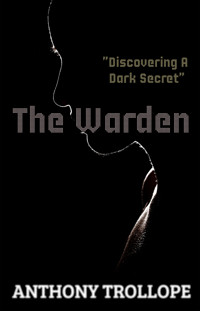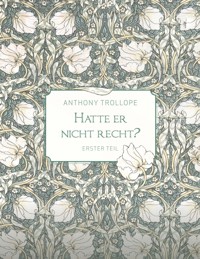
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hatte er nicht recht?
- Sprache: Deutsch
Der Roman: He Knew He Was Right / Hatte er nicht recht? Wie findet man einen passenden Ehepartner, eine passende Ehepartnerin? Welche Rolle spielen Liebe, Rang und Geld? Was geschieht, wenn ein Partner glaubt, Grund zu Eifersucht zu haben? Trollopes 1869 veröffentlichter Text verbindet Gesellschafts- mit psychologischem Roman. Er verstrickt seine Figuren in anrührende Probleme und verhängnisvolle Konflikte und vermittelt dabei überzeugend die Facetten des Frauenbildes seiner Zeit - das der Männer genauso wie das der Frauen selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 837
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Anthony Trollope (1815-1882), einer der erfolgreichsten englischen Schriftsteller, setzte sich in seinen Romanen mit der Gesellschaft seiner Zeit auseinander und entwarf dabei ein differenziertes und hellsichtiges Bild des Lebens in London genauso wie in der Provinz. Seine Romane zeichnen sich durch subtile Ironie und unterhaltsame Milieuschilderung aus. Er porträtiert seine Figuren, so unterschiedlich sie von Herkunft, gesellschaftlicher Rolle und Charakter auch sein mögen, stets empathisch und glaubwürdig.
Der Roman: He Knew He Was Right / Hatte er nicht recht?
Wie findet man einen passenden Ehepartner, eine passende Ehepartnerin? Welche Rolle spielen Liebe, Rang und Geld? Was geschieht, wenn ein Partner glaubt, Grund zu Eifersucht zu haben? Trollopes 1869 veröffentlichter Text verbindet Gesellschafts- mit psychologischem Roman. Er verstrickt seine Figuren in anrührende Probleme und verhängnisvolle Konflikte und vermittelt dabei überzeugend die Facetten des Frauenbildes seiner Zeit – das der Männer genauso wie das der Frauen selbst.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I: DER URSPRUNG DES ERBITTERTEN ZORNS
KAPITEL II: COLONEL OSBORNE
KAPITEL III: LADY MILBOROUGHS ABENDEINLADUNG
KAPITEL IV: HUGH STANBURY
KAPITEL V: WIE DIE AUSEINANDERSETZUNG SICH VERSCHÄRFTE
KAPITEL VI: WIE EINE VERSÖHNUNG ZUSTANDE KAM
KAPITEL VII: MISS JEMIMA STANBURY, IN EXETER ANSÄSSIG
KAPITEL VIII: »ICH WEISS – ES WIRD FUNKTIONIEREN.«
KAPITEL IX: WIE DIE AUSEINANDERSETZUNG SICH ERNEUT VERSCHÄRFTE
KAPITEL X: HARTE WORTE
KAPITEL XI: LADY MILBOROUGH TRITT ALS VERMITTLERIN AUF
KAPITEL XII: MISS STANBURYS GROSSHERZIGES ENTGEGENKOMMEN
KAPITEL XIII: DER EHRENWERTE MR. GLASCOCK
KAPITEL XIV: DAS CLOCK HOUSE IN NUNCOMBE PUTNEY
KAPITEL XV: WAS MAN AM CLOSE DAVON HIELT
KAPITEL XVI: DARTMOOR
KAPITEL XVII: EIN GENTLEMAN ZU BESUCH IN NUNCOMBE PUTNEY
KAPITEL XVIII: DER BRIEFWECHSEL DER FAMILIE STANBURY
KAPITEL XIX: BOZZLE, EIN EHEMALIGER POLIZIST
KAPITEL XX: COLONEL OSBORNES REISE NACH COCKCHAFFINGTON
KAPITEL XXI: COLONEL OSBORNES REISE NACH NUNCOMBE PUTNEY
KAPITEL XXII: MISS STANBURYS VERHALTEN GEGENÜBER IHREN NICHTEN
KAPITEL XXIII: COLONEL OSBORNE UND MR. BOZZLE KEHREN NACH LONDON ZURÜCK
KAPITEL XXIV: NIDDON PARK
KAPITEL XXV: HUGH STANBURY RAUCHT SEINE TABAKSPFEIFE
KAPITEL XXVI: EIN DRITTER BETEILIGTER IST VÖLLIG FEHL AM PLATZ
KAPITEL XXVII: MR. TREVELYANS BRIEF AN SEINE FRAU
KAPITEL XXVIII: SCHLIMMSTE QUALEN
KAPITEL XXIX: MR. UND MRS. OUTHOUSE
KAPITEL XXX: DOROTHY FASST IHREN ENTSCHLUSS
KAPITEL XXXI: MR. BROOKE BURGESS
KAPITEL XXXII: DAS FULL MOON IN ST. DIDDULPH’S
KAPITEL XXXIII: HUGH STANBURY RAUCHT WIEDER EINMAL SEINE TABAKSPFEIFE
KAPITEL XXXIV: PRISCILLAS WEISE WORTE
KAPITEL XXXV: MR. GIBSON HAT GLÜCK
KAPITEL XXXVI: MISS STANBURYS GROSSER ZORN
KAPITEL XXXVII: MONT CENIS
KAPITEL XXXVIII: DAS URTEIL DER GESCHWORENEN: »VERRÜCKT, MYLORD«
KAPITEL XXXIX: MISS NORA ROWLEY WIRD UNSCHÖN BEHANDELT
KAPITEL XL: »C.G.«
KAPITEL XLI: WAS SICH IN ST. DIDDULPH’S EREIGNETE
KAPITEL XLII: MISS STANBURY UND MR. GIBSON ENTZWEIEN SICH
KAPITEL XLIII: LABURNAM COTTAGE
KAPITEL XLIV: BROOKE BURGESS VERABSCHIEDET SICH AUS EXETER
KAPITEL XLV: TREVELYAN IN VENEDIG
KAPITEL XLVI: DER AMERIKANISCHE BOTSCHAFTER
KAPITEL XLVII: DAS ANGELN, DAS TAKTIEREN UND WELCHE ROLLE EIN KOPFPUTZ DABEI SPIELT
KAPITEL XLVIII: MR. GIBSON ERHÄLT SEINE STRAFE
KAPITEL XLIX: BROOKE BURGESS NACH SEINEM ABENDESSEN MIT HUGH STANBURY
KAPITEL L: CAMILLA TRIUMPHIERT
KAPITEL I
DER URSPRUNG DES ERBITTERTEN ZORNS
Als Louis Trevelyan vierundzwanzig Jahre alt war, stand ihm die ganze Welt offen, und so begab er sich unter anderem in ein Inselgebiet im Südpazifik, und dort verliebte er sich in Emily Rowley, die Tochter Sir Marmadukes, des Kolonialgouverneurs. Sir Marmaduke war zu diesem Zeitpunkt ein ehrbarer und geachteter britischer Beamter mittleren Alters, der es jedoch noch nicht zu einer gehobenen Position oder einem großen Vermögen gebracht hatte. Er war Gouverneur vieler Inseln gewesen und hatte immer ein Amt bekleidet; und jetzt, im Alter von fünfzig, befand er sich im Südpazifik, bei einem jährlichen Gehalt von 3000 Pfund, in einem Klima, in dem eine Temperatur von 80 Grad Fahrenheit im Schatten als gemäßigt gilt, war Vater einer Schar von acht Töchtern und hatte keinen einzigen Shilling angespart. Ein Gouverneur in einem Inselgebiet des Südpazifiks, der von seinem Wesen her gesellig und aus Prinzip gastfreundlich ist, kann bei acht Töchtern kein Geld ansparen, nicht einmal mit 3000 Pfund im Jahr. Zudem waren die Gentlemen an Sir Rowleys Tafel nicht gerade die Art von Männern, die er oder Lady Rowley ernsthaft als Schwiegersöhne willkommen heißen wollten, selbst wenn Gastfreundlichkeit verpflichtend war. Auch Emily Rowley, die älteste der Töchterschar, damals zwanzig, war bisher noch keinem Insulaner des Südpazifiks begegnet, der ihr sonderlich attraktiv vorgekommen wäre, als Mr. Trevelyan dort eintraf, um unbedingt alles zu sehen, was es auf seiner einigermaßen planlosen Reiseroute zu sehen gab. Da Louis Trevelyan ein bemerkenswert attraktiver junger Mann war, über gute Beziehungen verfügte, in Cambridge als neuntbester Mathematiker abgeschnitten hatte, jetzt schon Autor eines Bandes von Gedichten war und eine jährliche Summe von 3000 Pfund sein eigen nannte, die sich aus verschiedenen garantiert sicheren Anlagen speiste, brauchte er nicht lange vergeblich zu schmachten. Im Gegenteil, sämtliche Rowleys waren der Ansicht, die Vorsehung habe es sehr gut mit ihnen gemeint, als sie den jungen Trevelyan auf seiner Reise in diese Gegend geschickt hatte, denn er schien ihnen unter allen Männern geradezu ein Juwel zu sein. Sowohl Sir Marmaduke als auch Lady Trevelyan glaubten zu ahnen, dass es möglicherweise seitens der Familie Trevelyan Einwände gegen die ihnen vorgeschlagene Eheschließung geben könnte. Lady Rowley hätte es nicht gern gesehen, wenn ihre Tochter nach England gegangen und dort den frostigen Blicken von Fremden ausgesetzt worden wäre. Doch bald stellte sich heraus, dass es niemanden gab, der Einwände hätte erheben können. Louis, der Verehrer, hatte außer Vettern keine lebenden Verwandten. Sein Vater, ein renommierter Anwalt, war als Witwer verstorben und hatte das von ihm erwirtschaftete Vermögen seinem einzigen Kind vermacht. Das Oberhaupt der Familie war ein Vetter ersten Grades, der in Cornwall auf einem mittelgroßen Landgut wohnte, eine Seele von Mensch war, wenn auch, wie Louis formulierte, etwas beschränkt, und dem eine Eheschließung seines Vetters völlig gleichgültig wäre. Kein Mann konnte weniger abhängig sein oder mit mehr Berechtigung seine Entscheidungen frei treffen als dieser Verehrer. Zudem schlug er vor, dass die zweitälteste Tochter, Nora, mitkommen und bei ihnen in London wohnen sollte. Was für ein Verehrer, der da urplötzlich vom Himmel herab einen solchen Taubenschlag anflog.
»Ich habe keinen einzigen Penny, den ich Ihnen geben könnte«, sagte Sir Rowley.
»Ich bin nicht der Meinung, dass Töchter eine Mitgift haben sollten«, antwortete Trevelyan. »Jedenfalls bin ich der Überzeugung, dass Männer niemals auf Vermögen aus sein sollten. Wenn das Geld dem Mann gehört, fühlt er sich sicherlich weniger unwohl und ist wahrscheinlich umgänglicher.«
Sir Rowley glaubte an moralische Grundsätze und hätte sehr gern einige tausend Pfund aufgewandt, wenn er seine Töchter an jemand anderen abtrat; da er aber nun einmal keine tausende Pfund für solche Aufwendungen besaß, blieb ihm nur übrig, die Prinzipienfestigkeit seines Schwiegersohns in spe zu bewundern. Da es ohnehin Zeit für seinen Heimaturlaub war, reiste er mit Mr. Trevelyan und einem Teil der Töchterschar nach England, und die Trauung wurde von Reverend Oliphant Outhouse vollzogen, Pfarrer von Saint Diddulph’s-in-the-East und Ehemann von Sir Rowleys Schwester. Dann wurde ein kleines Haus in der Curzon Street in Mayfair bezogen und eingerichtet, und die Rowleys reisten zu ihrem Amtssitz zurück, während Nora, die Zweitälteste, in der Obhut ihrer Schwester in London verblieb.
Bei der Ankunft in London hatten die Rowleys festgestellt, dass sie in der Tat auf ein Juwel gestoßen waren. Über Louis Trevelyan wussten die Leute nur Gutes zu sagen. Wäre er nicht im Besitz eines Vermögens gewesen, so hätte er bereits an seinem College in Cambridge lehren können. Er hätte bereits – nach dem, was Sir Rowley erfuhr – Abgeordneter im Parlament sein können, wenn er es nicht für klüger gehalten hätte, sich noch etwas Zeit zu lassen. In der Tat war er in vielerlei Hinsicht äußerst klug. Er war als sehr junger Mensch auf Reisen gegangen – nicht auf der Suche nach Abenteuern, um Großwild zu jagen, oder wie immer geartete neue und unterhaltsame Erfahrungen zu sammeln, sondern um Menschen zu begegnen und die Welt kennenzulernen. Als der Zufall ihn in den Südpazifik führte, war er schon seit über einem Jahr auf Reisen. Was für ein überaus segensreicher Zufall! Überdies machte Sir Rowley ausfindig, dass sein Schwiegersohn in den Klubs bei den Menschen, die ihn von seiner Studienzeit her kannten, einen guten Ruf genoss, als jemand, der beliebt und doch klug war, kein Bücherwurm, kein vertrockneter Gelehrter oder Pedant. Er konnte bei allen Themen mitreden, war sehr großzügig, war jemand, der ausnahmslos mit Ehrfurcht behandelt und geachtet wurde; und zudem war er ein so attraktiver, männlicher Typ, mit kurzem braunem Haar, einer himmlisch geformten Nase, dem Mund eines Apoll, sechs Fuß groß, mit perfekten Proportionen von Schultern, Beinen und Armen – die Verkörperung eines Juwels! Allerdings legte er Wert darauf, seinen Willen durchzusetzen, was Lady Rowley als Erste erkannte.
»Aber was er will, ist doch absolut richtig«, sagte Sir Marmaduke. »Er wird den Mädchen deutlich zeigen, wie alles läuft!«
»Aber Emily legt ebenfalls Wert darauf, ihren Willen durchzusetzen«, erwiderte Lady Rowley.
Sir Marmaduke verfolgte das Thema nicht weiter, war jedoch zweifellos der Meinung, ein Ehemann wie Louis Trevelyan habe ein Recht darauf, seinen Willen durchzusetzen. Wahrscheinlich hatte er das Temperament seiner Tochter nicht so präzise wahrgenommen wie seine Frau. Bei acht Töchtern, die um ihn herum aufwuchsen, wie hätte er da ihr Temperament im Auge behalten sollen? Und schließlich – falls irgendetwas an Emilys Temperament auszusetzen war, dann wäre es angebracht, dass sie in einem Ehemann wie Louis Trevelyan ihren Herrn und Meister fände.
Nahezu zwei Jahre lang verlief das Leben der kleinen Familie in der Curzon Street ohne Schwierigkeiten, und wenn etwas schwierig war, so fiel es niemandem außerhalb der kleinen Familie auf. Und es gab ein Kind, einen Jungen, den kleinen Louis, und ein Kind lässt das Leben in einer solchen Familie stets harmonisch verlaufen.
Die Trauung hatte im Juli stattgefunden, und nach der Hochzeitsreise hatte man einen Winter und einen Frühling in London verbracht; anschließend reiste man für etwa einen Monat ans Meer, und dann war das Kind auf die Welt gekommen. Dann folgten ein weiterer Winter und ein weiterer Frühling. Nora Rowley wohnte bei ihnen in London, und um diese Zeit war bei Mr. Trevelyan der Wunsch aufgekommen, seinen Willen in vollem Umfang durchzusetzen. Das Kind zu haben war sehr nett, und seine Frau war klug, hübsch und voller Ausstrahlung. Nora war genau das, was man sich unter einer ledigen Schwägerin vorstellen wollte. Aber – aber dann waren Schwierigkeiten aufgekommen und man hatte gestritten. Lady Rowley hatte recht, als sie sagte, dass auch ihre Tochter Emily gern ihren Willen durchsetzte.
»Wenn ich verdächtigt werde«, sagte Mrs. Trevelyan eines Morgens zu ihrer Schwester, als sie im kleinen Salon zusammensaßen, »dann ist mein Leben nicht lebenswert.«
»Wie kommst du darauf, dass du verdächtigt wirst, Emily?«
»Was kann er sonst damit meinen, wenn er sagt, dass er Colonel Osborne lieber nicht hier zu Besuch hätte? Einen Mann, der älter ist als mein Vater, der mich von klein auf kennt!«
»Er hat nichts Derartiges gemeint, Emily. Du weißt, dass er das nicht gemeint hat, und du solltest es nicht behaupten. Es wäre zu schrecklich, um auch nur daran zu denken.«
»Richtig, und es war auch absolut schrecklich, es anzusprechen. Wenn er sich nicht bei mir entschuldigt, werde ich – werde ich natürlich des Kindes wegen weiterhin mit ihm zusammenleben, als hochrangige Angehörige des Personals. Aber er soll erfahren, was ich denke und wie mir zumute ist.«
»An deiner Stelle würde ich es vergessen.«
»Wie könnte ich es vergessen? Einerlei was ich tue, er ist nicht zufrieden. Er ist höflich und freundlich zu dir, weil er keine Macht über dich hat, aber du hast keine Ahnung, wie er mit mir spricht. Soll ich Colonel Osborne sagen, er solle uns nicht besuchen? Du lieber Himmel! Wie könnte ich noch jemandem in die Augen schauen, wenn ich dazu gezwungen würde? Bestimmt besucht er uns heute; und Louis wird unten in der Bibliothek sitzen und seine Schritte hören und nicht zu uns nach oben kommen.«
»Lass Richard sagen, du wärst nicht zu Hause.«
»Ja, und jeder wird wissen weshalb. Und aus welchem Grund sollte ich auf diese Weise auf den besten und ältesten Freund, den ich habe, verzichten? Wenn so etwas befohlen werden soll, soll er es selbst tun und dann sehen, was daraus wird.«
Mrs. Trevelyan hatte Colonel Osborne insofern wahrheitsgemäß beschrieben, als er sie tatsächlich von klein auf kannte und älter als ihr Vater war. Colonel Osbornes Alter überstieg das ihres Vaters um etwa einen Monat, und da er jetzt über fünfzig war, mochte er in dieser Hinsicht für eine junge, verheiratete Frau vielleicht als harmloser Freund gelten. Allerdings unterschied er sich in jeder anderen Hinsicht vollkommen von Sir Marmaduke. Sir Marmaduke, gleichzeitig gesegnet und geschlagen mit Frau und acht Töchtern, sowie dazu verurteilt, einen großen Teil seines Lebens in den Tropen zu verbringen, war mit fünfzig zu dem geworden, was man gewöhnlich als deutlich gealtert bezeichnet. Das soll heißen, dass ihm überschäumendes Temperament, Flexibilität und jugendlicher Schwung mittlerweile gänzlich abgingen. Er war übergewichtig und träge, machte sich viele Gedanken um seine Frau und die acht Töchter und war in Gedanken stets bei seiner nächsten Mahlzeit. Colonel Osborne dagegen war Junggeselle und außer durch seine Aufgaben als Abgeordneter im Unterhaus frei von jeder Last – ein Mann von Vermögen, dem alles im Leben in den Schoß gefallen war. Daher galt er im Unterschied zu Sir Marmaduke ganz gewiss nicht als deutlich gealtert, obwohl wahrscheinlich bereits zwei Drittel seiner Lebenszeit hinter ihm lagen. Für sein Alter sah er gut aus, zwar kahlköpfig und mit reichlich viel Grau in seinem buschigen Bart, doch aufrecht in seiner Körperhaltung und gut gekleidet und erkennbar entschlossen, die ihm noch verbliebenen Vorteile der Jugend bestmöglich zu nutzen. Colonel Osborne war stets so gekleidet, dass niemand jemals genau auf seine Kleidung achtete, da er sich zweifellos bewusst war, dass kein Mann über fünfzig es sich leisten kann, auf seinen Mantel, seinen Hut, seine Krawatte oder seine Hose besondere Aufmerksamkeit zu lenken; dennoch war dies eine Sache, der er Beachtung schenkte, und er war keinesfalls gleichgültig, was die Bemühungen seines Schneiders betraf. Wenn er ausritt, dann auf einem ansehnlichen Pferd, und sein Pferdeknecht ritt ein vergleichbar ansehnliches. Man wusste, dass er in der Provinz einen hervorragenden Zuchthengst sein eigen nannte, und er stand in dem Ruf, beim Jagen mit Hunden erfolgreich zu sein. Der arme Sir Marmaduke hätte ein Jagdpferd nicht einmal dann reiten können, wenn es um sein Amt als Gouverneur oder seine Kreditwürdigkeit gegangen wäre. Als Mrs. Trevelyan im Gespräch mit ihrer Schwester darlegte, Colonel Osborne sei ein Mann, den sie zu Recht mit den ehrfürchtigen Gefühlen einer Tochter gegenüber ihrem Vater betrachte, stellte sie daher einen Vergleich an, der dem Buchstaben nach stimmte, aber nicht den Tatsachen entsprach. Und als sie behauptete, Colonel Osborne habe sie von klein auf gekannt, beging sie wiederum denselben Fehler. Colonel Osborne hatte sie zwar gekannt, als sie noch ein Baby war, und er war in der damaligen Zeit ein sehr enger Freund ihres Vaters gewesen, doch er hatte sie seit jenen Kindertagen wenig oder gar nicht zu Gesicht bekommen, bis sie kurz vor ihrer Eheschließung stand; und obwohl es selbstverständlich war, dass ein so alter Freund sie aufsuchen und ihr gratulieren und die Freundschaft neu aufleben lassen würde, konnte man nicht behaupten, dass er im Haus ihres Mannes als alter Freund der Familie auftrat, der den Kindern silberne Becher schenkt und den kleinen Mädchen aus langjähriger Zuneigung gegenüber den Eltern einen Kuss gibt. Wir alle wissen, wie ein solcher alter Gentleman auftritt, welch ein angenehmer und liebenswürdiger Zeitgenosse er ist, wie gern man ihn an der Türschwelle willkommen heißt, wie gut er unserem Wein zuspricht, häufig etwas zu gut, wie er unsere älteste Tochter bittet, sich doch an ihn zu erinnern, wie er silberne Becher verschenkte, als die Mädchen auf die Welt kamen, und sie jetzt anlässlich ihrer Hochzeit mit einem Teeservice bedenkt; er ist ein Freund, der überaus nützlich, absolut ungefährlich und wirklich bezaubernd ist und kein Jahr jünger oder beweglicher, als wir selbst es sind, und ohne den das Leben trist und öde wäre. Wir alle kennen diese Art von Mann; doch Colonel Osborne im Haus von Mr. Trevelyans frisch angetrauter Ehefrau unterschied sich davon.
Als Emily Rowley vom Inselgebiet des Südpazifiks in die Heimat gebracht wurde, um Louis Trevelyan zu heiraten, war sie eine sehr attraktive junge Frau, groß, mit einem für ihr Alter recht umfangreichen Busen, dunkeläugig – mit Augen, die dunkel wirkten, weil ihre Brauen und Wimpern fast schwarz waren, die jedoch so viele Schattierungen aufwiesen, dass man ihre Farbe nicht erkennen konnte. Ihr braunes Haar war dunkel und seidig; ihr Teint war ebenfalls bräunlich, jedoch leuchteten ihre Wangen häufig so sehr, dass ihre Konkurrentinnen sie fälschlicherweise bezichtigten, sie würde sich schminken. Sie war sehr kräftig, wie dies bei manchen Mädchen der Fall ist, die in den Tropen aufgewachsen sind und denen das dortige Klima bekommen ist. Sie war imstande, den ganzen Tag im Pferdesattel zu sitzen, und auf den Bällen am Amtssitz des Gouverneurs ermüdete sie nie. Als sie Colonel Osborne als das Kind vorgestellt wurde, das er gekannt hatte, kam ihm der Gedanke, es wäre sehr angenehm, mit einer so angenehmen Freundin auf vertrautem Fuße zu stehen, wobei er niemandem schaden wollte, so wie nur wenige Männer in solchen Situationen tatsächlich jemandem schaden wollen; aber dennoch betrachtete er die schöne junge Frau, die er besuchte, nicht als Angehörige einer Generation, die nach ihm kam, der gegenüber es seine Pflicht wäre, ihr aufgrund der langjährigen Freundschaft mit ihrem Vater von Nutzen zu sein.
Überdies war in London bekannt – allerdings nicht Mrs. Trevelyan, nicht einmal in Ansätzen –, dass dieser in die Jahre gekommene Schwerenöter schon früher in mehr als nur einer Familie unangenehm aufgefallen war. Er liebte es, mit verheirateten Frauen auf vertrautem Fuße zu stehen, und war wohl nicht abgeneigt, ehelichen Zwist als aufregend zu empfinden. Es muss jedoch festgehalten werden, dass die Feindseligkeit, die hier angedeutet wird, nicht so beschaffen war, dass eine Pistole oder eine Pferdepeitsche zum Einsatz gekommen wäre, und es war im Allgemeinen auch nicht die Art von Feindseligkeit, die sich in verbal ausgedrücktem Zorn zeigte. Ein junger Ehemann mag das übertrieben freundliche Verhalten eines Freundes ablehnen und dennoch zurückschrecken vor dem Skandal, den eine laut ausgesprochene Verdächtigung für seine eigene Würde und die seiner Frau auslösen könnte. Louis Trevelyan, der gegenüber Colonel Osborne tiefe Abneigung hegte und dem es nicht gelungen war, seiner Frau verständlich zu machen, dass diese Abneigung sie dazu veranlassen sollte, die Freundschaft mit dem Colonel zu beenden, hatte sich eine Bemerkung durchgehen lassen, die er wahrscheinlich nur zu gern sofort wieder zurückgenommen hätte. Doch Worte lassen sich nicht zurücknehmen, und die meisten Männer und Frauen, die eine Bemerkung fallen lassen, die sie sofort bereuen, sind bei weitem zu stolz, dieser Reue anschließend Ausdruck zu verleihen. So war es bei Louis Trevelyan, als er seiner Frau sagte, er wünsche nicht, dass Colonel Osborne derart häufig zu Besuch kam. Er hatte dies mit Zorn in seiner Miene und seiner Stimme geäußert; und obwohl sie den Zorn in Miene und Stimme bereits kannte, hatte sie noch nie das Gefühl gehabt, ihr Mann hätte sie beleidigt. Sofort nach dieser Bemerkung hatte Trevelyan den Raum verlassen und sich ins untere Stockwerk zurückgezogen, zu seinen Büchern. Doch als er allein war, wurde ihm klar, dass er seine Frau beleidigt hatte. Er war sich durchaus bewusst, dass er behutsam mit ihr hätte umgehen sollen, dass er ihr – mit seinem Arm um ihre Taille – hätte erklären sollen, weshalb es besser wäre, wenn der Freundschaft dieses Freundes Grenzen gesetzt würden. Es hängt so viel von Miene und Stimme ab, wenn solche Dinge vermittelt werden müssen, es spielt so vieles eine größere Rolle als die Worte, die verwendet werden. Als Trevelyan darüber nachdachte und sich sein Verhalten und seinen Zornesausbruch ins Gedächtnis rief und auch, wie weit er von einer liebevollen Umarmung entfernt gewesen war, als er zu ihr sprach, war er fast entschlossen, sie aufzusuchen und sich zu entschuldigen. Er gehörte jedoch zu den Menschen, die es abstoßend finden, sich entschuldigen zu müssen. Es ging über seine Kräfte einzusehen, dass er im Unrecht gewesen war. Außerdem hatte seine Frau ihn über die Maßen provoziert. Als er sich abgemüht hatte, ihr seine Wünsche durch einige herabsetzende Andeutungen über Colonel Osborne verständlich zu machen, ihr zu vermitteln, er sei gefährlich, zeige nicht seinen wahren Charakter, sei wie eine Natter im Gras, sei prinzipienlos und dergleichen, da hatte seine Frau für diesen Freund eine Lanze gebrochen und frei heraus erklärt, sie glaube kein Wort von allem, was gegen ihn vorgebracht werde. »Aber es entspricht den Tatsachen«, hatte der Ehemann gesagt. »Ich habe keinen Zweifel, dass das deine Ansicht ist«, erwiderte die Ehefrau. »Männer neigen sehr häufig dazu, anderen Schlimmes zuzutrauen. Aber du musst mir erlauben zu sagen, dass du meiner Meinung nach im Irrtum bist. Ich kenne Colonel Osborne schon viel länger als du, Louis, und Papa hat immer sehr viel von ihm gehalten.« Darauf war Mr. Trevelyan in Zorn geraten und hatte jene Worte geäußert, die er nicht zurücknehmen konnte. Als er inmitten seiner Bücher auf und ab ging, war ihm beinahe, als müsse er seine Frau um Verzeihung bitten. Er kannte seine Frau gut genug, um zu wissen, dass sie ihm andernfalls nicht verzeihen würde. Er werde es tun, dachte er, aber nicht jetzt sofort. Es werde eine Zeit kommen, in der es vielleicht leichter fallen würde als jetzt. Er könnte ihr, wenn er sich oben für den Abend umzog, versichern, dass er nichts Schlimmes im Sinn gehabt habe. Sie gingen zu einer Abendgesellschaft im Haus einer Dame von Rang, der Witwe des Herzogs von Milborough, einer Dame, die sehr großes Ansehen genoss und seiner Frau Ehrfurcht einflößte; und er rechnete damit, dass dies seine Aufgabe zwar nicht leichter machen würde, ihr jedoch etwas von ihrer Schwierigkeit nähme. Emily wäre zwar nicht ausgesprochen eingeschüchtert durch die Aussicht auf eine Gesellschaft bei Lady Milborough, aber vielleicht nicht ganz so selbstbewusst wie üblich. Er würde beim Umziehen etwas zu ihr sagen und ihr versichern, es habe nicht im Mindesten in seiner Absicht gelegen, ihr persönliches Verhalten zu kritisieren.
Das Mittagessen wurde aufgetragen, und die beiden Damen begaben sich hinunter ins Speisezimmer. Mr. Trevelyan trat nicht in Erscheinung. Das war an sich nichts Außergewöhnliches, da er immer wieder kundtat, ein Mittagessen sei eine überflüssige Mahlzeit und ein Mann solle zwischen Frühstück und Abendessen allenfalls einen Keks zu sich nehmen. Doch zuweilen kam er herein und aß seinen Keks im Stehen, vor dem Kamin, und trank, wie er es immer nannte, ein halbes Viertelgläschen Sherry. Wahrscheinlich wäre es gut gewesen, wenn er das zu diesem Zeitpunkt getan hätte; doch er verharrte in seiner Bibliothek hinter dem Speisezimmer, und nachdem seine Frau und seine Schwägerin ins obere Stockwerk gegangen waren, wollte er unbedingt erfahren, ob Colonel Osborne an diesem Tag zu Besuch komme, und falls dem so sei, ob man ihn empfange. Er hatte erfahren, dass Nora Rowley von einer anderen Dame, einer Mrs. Fairfax, abgeholt werde, um mit ihr zusammen in einer Ausstellung Gemälde zu betrachten. Seine Frau hatte es abgelehnt, sich Mrs. Fairfax anzuschließen, mit der Begründung, sie wolle das Kind nicht den ganzen Tag über alleinlassen, da sie ja abends außer Haus sein werde. Obwohl Louis Trevelyan sich um Konzentration auf einen Artikel bemühte, den er für ein wissenschaftliches Vierteljahresmagazin verfasste, kam er nicht umhin, sich Sorgen um diesen von ihm erwarteten Besuch von Colonel Osborne zu machen. Er war nicht im Mindesten eifersüchtig. Er schwor sich zigmal, ein solches Gefühl von seiner Seite wäre ein monströses Vergehen gegen seine Frau. Dennoch wusste er, dass es ihn zufrieden stimmen würde, wenn man Colonel Osborne an diesem speziellen Tag mitteilte, seine Frau sei nicht zu Hause. Gleichgültig, ob dieser Mann empfangen würde oder nicht, er wollte seine Frau um Verzeihung bitten; doch konnte er das überzeugender und liebevoller tun, wenn sie die Neigung erkennen ließe, an diesem Tag seinem Wunsch zu entsprechen.
»Sag doch bitte Richard Bescheid«, flüsterte Nora ihrer Schwester zu, als sie nach dem Mittagessen nach oben gingen.
»Das werde ich nicht tun«, antwortete Mrs. Trevelyan.
»Darf ich es tun?«
»Ganz bestimmt nicht, Nora. Ich hätte das Gefühl, dass ich mich degradiere, wenn ich es zuließe, dass das, was auf diese Weise zu mir gesagt wurde, ein Wirkung auf mich hätte.«
»Ich glaube, dass du dich täuschst, Emily. Wirklich.«
»Du musst mir zugestehen, dass ich wohl am besten beurteilen kann, was ich in meinem eigenen Haus meinen Mann betreffend unternehme.«
»O ja, natürlich.«
»Wenn er mir etwas befiehlt, werde ich gehorchen. Oder wenn er seinen Wunsch anders formuliert hätte, dann hätte ich mich danach gerichtet. Aber wenn er mir sagt, er hätte Colonel Osborne nicht gern im Haus! Wenn du sein Verhalten gesehen und seine Worte gehört hättest, wärst du nicht überrascht, dass mir so zumute ist. Es war eine grobe Beleidigung – und nicht die erste.«
Als sie das sagte, blitzte es in ihren Augen auf, und die Röte auf ihren Wangen war ein Zeichen ihres Zorns, das ihre Schwester sehr wohl zu deuten wusste. Dann klopfte es, und beiden war klar, dass Colonel Osborne vor der Haustür stand. Louis Trevelyan, der in seiner Bibliothek saß, wusste ebenfalls, wessen Anwesenheit das Klopfen signalisierte.
KAPITEL II
COLONEL OSBORNE
Der Leser weiß bereits, dass Colonel Osborne Junggeselle war, ein Vermögen hatte, als Abgeordneter im Parlament saß und dass sein halbes Jahrhundert an Lebensjahren sich kaum bemerkbar machte. An weiteren Informationen muss nur noch erwähnt werden, dass er unter denen, deren Sphäre er teilte, beliebt war, als Politiker, als Sportsmann und als Mitglied der guten Gesellschaft. Seine Reden im Unterhaus waren gelungen, wenn auch rar, und man war zumeist der Meinung, er hätte es vielleicht zu etwas Bedeutendem bringen können, wenn es ihm nicht mehr zupassgekommen wäre, es zu rein gar nichts zu bringen. Angeblich war er Konservativer, und im Allgemeinen stimmte er zugunsten der Konservativen Partei ab; doch er brachte es auch fertig, sich zu brüsten, er sei ein vollkommen unabhängiger Abgeordneter, und zuweilen unterzog er sich der Mühe, sich als solcher zu erweisen. Er war von robuster Gesundheit, hatte alles, was die Welt ihm bieten konnte, liebte Bücher, Bilder, Architektur und edles Porzellan; er hatte ausgefallene Interessen und die finanziellen Mittel, ihnen nachzugehen; und er war einer der Menschen, die anscheinend mit allem Schönen reichlich beschenkt werden. Wie schon angedeutet, befleckte ein geringfügiger Makel seinen guten Ruf; aber die meisten Menschen, die Colonel Osborne wirklich gut kannten, bescheinigten ihm bereitwillig, dass er nicht in böser Absicht handelte und die negativen Auswirkungen stets auf irregeleitete Eifersucht zurückzuführen waren. Laut seinen Freunden war seine Art, mit Frauen umzugehen, ungezwungen und sympathisch, so, wie Frauen es mögen, in einer sympathischen Art von ungezwungener Freundschaft; es ging niemals darüber hinaus, und wenn Schaden angerichtet wurde, war er stets das Ergebnis falscher Verdächtigung gewesen. Doch es gab gewisse Damen in der städtischen Gesellschaft – wohlwollende, mütterliche, kluge Frauen –, die den Namen Osborne verabscheuten, die ihn nicht in ihrem Haus empfingen, die ihn in anderen Häusern schnitten und ihn durchweg als Schlange, Hyäne, Halunken oder Hai bezeichneten. Die alte Lady Milborough gehörte zu ihnen, da die Tochter einer ihrer Freundinnen die Schlange an ihrem Busen genährt hatte.
»Augustus Poole tat gut daran, mit seiner Frau ins Ausland zu gehen«, sagte die alte Lady Milborough, als sie zu etwa dieser Zeit mit einer anderen Klatschbase über Mrs. Trevelyans Situation sprach, »oder aber es hätte dort eine Trennung gegeben; und dabei gab es doch nie ein braveres Mädchen als Jane Marriott.«
Der Leser kann sich ganz sicher sein, dass Colonel Osborne keine bewusst böse Absicht verfolgte, als er sich erlaubte, der vertraute Freund der Tochter seines alten Freundes zu werden. Es gab in seinem Wesen nichts Unmenschliches. Er war keiner von den Männern, die sich mit ihren Eroberungen brüsten. Er war kein Wolf, der eine Beute aufzuspüren versuchte, die er verschlingen konnte, und der wild entschlossen war, alles zu verschlingen, was seinen Weg kreuzte; aber er mochte alles Angenehme, und die Gesellschaft einer hübschen, klugen Frau war ihm von allen angenehmen Dingen das angenehmste. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Frau, die so angenehm hübsch und auf so angenehme Weise klug war wie Mrs. Trevelyan.
Als Louis Trevelyan die Schritte dieses gefährlichen Mannes auf der Treppe hörte, stand er auf, als ob auch er in den Salon gehen wollte, und vielleicht hätte er gut daran getan. Wäre er dazu imstande gewesen und hätte er sich zudem gegenüber diesem Mann zu beherrschen vermocht, dann hätte er damit einer unkomplizierten Versöhnung mit seiner Frau den Weg gebahnt. Doch als er an der Tür stand und seine Hand schon die Klinke hielt, nahm er wieder Abstand von seinem Vorhaben. Er nahm Abstand, weil er sich nicht erlauben wollte, Eifersucht zu zeigen; in Wahrheit jedoch, weil er wusste, dass er sich nicht dazu durchringen konnte, zu diesem verhassten Mann höflich zu sein. Also nahm er wieder Platz, griff nach seiner Feder und zermarterte sich das Hirn über seinen wissenschaftlichen Artikel. Er plante, gegen eine gelehrte Koryphäe einen Disput über Schallwellen vom Zaun zu brechen, doch konnte er an keine andere Schallquelle als die leichten Schritte Colonel Osbornes auf seinem Weg nach oben denken. Er legte die Feder aus der Hand, ballte die Faust und leistete keinen Widerstand, als ein finsteres Stirnrunzeln sich auf seinem Gesicht einstellte. Welches Recht hatte dieser Mann, ohne persönliche Einladung seinerseits zu kommen und ihn in seinem häuslichen Glück zu stören? Und zudem, wie sollte seine arme Frau, die so wenig vom Leben in England wusste, die seit annähernd frühester Jugend in irgendeiner Kolonie gelebt hatte, die über so wenige der vorteilhaften Voraussetzungen verfügte, auf die er hätte achten sollen, als er nach einer Frau Ausschau hielt, – wie sollte dieses arme Mädchen sich korrekt verhalten können, wenn sie den Kniffen und routinierten Schurkereien dieser listigen Schlange ausgesetzt war? Aber dieses arme Mädchen war so widerspenstig, hatte sich in den Tropen eine solche Starrköpfigkeit angeeignet, dass ihn, Louis Trevelyan, das Gefühl beschlich, nicht zu wissen, wie er mit ihr fertig werden sollte. Auch er hatte davon gehört, dass Jane Marriott – Mrs. Poole – nach Neapel umgesiedelt worden war. Müsste auch er seine Frau nach Neapel bringen, um sie aus der Reichweite dieser Hyäne zu entfernen? Die Vorstellung, alles aufzugeben und vor jemandem wie Colonel Osborne zu fliehen, war schrecklich für ihn. Und selbst wenn er sich bereitfände, dies zu tun, wie könnte er es seiner Frau erklären, ausgerechnet ihr, derentwegen es geschähe? Sollte sie den Grund dafür ahnen, würde sie sich zweifellos weigern. Als er daran dachte und als der Besuch im oberen Stockwerk sich hinzog, war ihm fast, als wäre es das Beste, wenn er ihr die Leviten lesen würde! Wir alle wissen, was ein Ehemann meint, wenn er beschließt, seiner Frau die Leviten zu lesen. Als Erstes würde er sich keinesfalls für seine bisherigen Worte entschuldigen – sondern sie nochmals äußern, und zwar schärfer als zuvor. Ihr Zorn auf ihn wäre groß; es gäbe eine stumme, langanhaltende Phase der Empörung, die – wie ihm völlig klar war – unendlich viel schlimmer wäre als ein hitziger Redeschwall. Aber sollte er als Mann wirklich darauf verzichten, das zu tun, was er für seine Pflicht hielt, nur weil er sich vor dem Zorn seiner Frau fürchtete? Sollte er sich von ihrer Widerspenstigkeit davon abschrecken lassen zu sagen, was er für richtig hielt? Nein. Er würde sich nicht entschuldigen, sondern ihr mitteilen, dass jede Vertraulichkeit mit Colonel Osborne um seines und ihres Glücks willen ein Ende haben musste.
Zu dieser Entscheidung, die er als entschlossener Ehemann traf, brachte ihn die Dauer des derzeitigen Besuchs dieses Mannes und auch die Tatsache, dass seine Frau während der zweiten Hälfte des Besuchs mit Colonel Osborne allein war. Nora war zu Anfang des Besuchs zugegen gewesen, doch Mrs. Fairfax kam an, blieb in der Kutsche sitzen, und Nora war gezwungen, zu ihr hinunterzugehen. Einen Augenblick lang hatte sie gezögert, und Colonel Osborne hatte ihr Zögern wahrgenommen und in Grenzen auch richtig gedeutet. Hätte er nichts Böses im Schilde geführt, so wäre er ebenfalls gegangen, als er es wahrnahm. Aber wahrscheinlich hatte er sich gesagt, Nora Rowley sei albern, und in solchen Angelegenheiten genüge es vollkommen, wenn der Mann selbst wisse, dass er nichts Böses im Schilde führte.
»Nora, du solltest besser hinuntergehen«, sagte Mrs. Trevelyan, »Mrs. Fairfax wird sehr verärgert sein, wenn du sie warten lässt.«
Darauf war Nora gegangen, und die beiden waren allein. Nora war gegangen, und Trevelyan hatte gehört, dass sie ging, und wusste, dass Colonel Osborne mit seiner Frau allein war.
»Wenn Sie das einfädeln können – das wäre so schön«, sagte Mrs. Trevelyan, als sie das Gespräch wieder aufnahm.
»Meine liebe Emily«, sagte er, »Sie dürfen nicht erwähnen, dass ich es einfädeln könnte, sonst verderben Sie alles.«
Er hatte sie Emily und Nora genannt, als Sir Marmaduke und Lady Rowley vor der Hochzeit zugegen waren, und danach daran festgehalten und sich damit die Freiheit eines uralten Freundes der Familie herausgenommen. Mrs. Trevelyan war sehr wohl bewusst, dass er sie in Gegenwart ihres Mannes so angesprochen hatte – und dass dagegen kein Einwand erhoben worden war.
Doch seitdem waren einige Monate verstrichen, und das Kind war zur Welt gekommen; und sie war sich genauso bewusst, dass er sie seit längerer Zeit in Gegenwart ihres Mannes nicht mehr so angesprochen hatte. Sie wünschte sich dringend, sie wüsste, wie sie ihn bitten sollte, es generell zu unterlassen; doch die Sache war sehr schwierig, da sie eine solche Bitte nicht äußern konnte, ohne zu verraten, dass ihr Mann Bedenken dagegen hegte. Das Thema, um das es jetzt ging, war ihr zu wichtig, als dass ihr das Problem in diesem Augenblick präsent geblieben wäre, und daher ließ sie es zu, dass er das Gespräch fortsetzte.
»Wenn ich es einfädeln könnte, wie Sie es nennen – ich könnte das nicht –, wäre es eine ziemlich herausfordernde Aufgabe.«
,,Für uns ist das völlig belanglos, Colonel Osborne. Wir Frauen haben nichts dagegen, wenn Politiker aktiv werden, und wir finden, dass nur das die Politik erträglich macht. Doch wäre das gar keine große Aufgabe. Papa könnte sie besser meistern als jeder andere. Überlegen Sie, wie lange er schon im Geschäft ist!«
Das Thema, um das es ging, war die Aussicht auf eine Anordnung an Sir Marmaduke, auf Staatskosten seine Inseln zu verlassen und vor einem demnächst tagenden Ausschuss des Unterhauses Bericht darüber zu erstatten, wie es ganz allgemein um die Verwaltung der Kolonien stand. Die Ausschussmitglieder waren gewählt worden, und zwei Kolonialgouverneure sollten ins Mutterland bestellt werden, damit sie fundierte Auskunft erteilen konnten. Welche Art von Anordnung könnte einem Gouverneur auf einem Inselgebiet des Südpazifiks willkommener sein, der gerade Heimaturlaub gehabt hatte und es sich nur schlecht leisten konnte, auf eigene Kosten einen weiteren Heimaturlaub anzutreten? Colonel Osborne war Mitglied in diesem Ausschuss und verfügte zudem über gute Beziehungen zum Kolonialministerium. Es arbeiteten dort Männer, die Colonel Osborne gern einen Gefallen taten, und wenn dies eine Aufgabe darstellte, so war es doch eine wirklich sehr bescheidene! Vielleicht war Sir Marmaduke nicht der geeignetste Mann für diese Aufgabe. Vielleicht war die Kolonialregierung der südpazifischen Inseln nicht unbedingt ein Prachtexemplar des Kolonialismus, über dessen Zustand der Ausschuss sich gründlich informieren sollte. Aber es sollten ja zwei Gouverneure kommen, und es wäre wohl in Ordnung, einen sehr guten zu haben und einen etwas weniger guten. Niemand nahm an, der vortreffliche Sir Marmaduke sei der Inbegriff eines guten Gouverneurs, – aber was für eine unendlich große Erfahrung er doch hatte! Seit über zwanzig Jahren hatte er eine Insel nach der anderen angesteuert und es dabei vermocht, wenigstens die großen Klippen zu umschiffen.
»Jedenfalls versuchen wir es«, sagte der Colonel.
»Ja, bitte, Colonel Osborne. Mama würde natürlich mitkommen?«
»Das alles einzurichten, sollten wir ihm überlassen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er Lady Rowley dort lässt.«
»Das hat er niemals getan. Ich weiß, dass ihm Mama überaus wichtig ist. Man soll sich das nur vorstellen – wir hätten sie im Herbst hier zu Besuch! Ich nehme mal an, wenn er zum Ende der Sitzungsperiode käme, würden sie ihn nicht sofort wieder zurückschicken?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Kolonialbeamten im Ausland sich darauf verstehen, wie man einen Programmpunkt in die Länge zieht, wenn sie schon einmal in England sind.«
»Selbstverständlich, Colonel Osborne, und warum auch nicht? Stellen Sie sich nur vor, was sie alles aushalten müssen in diesen schrecklichen Gegenden. Würden Sie gern in einem südpazifischen Inselgebiet leben?«
»Ich würde London vorziehen, ganz klar.«
»Natürlich; und Sie dürfen Papa nicht einen oder zwei Monate missgönnen, wenn er da ist. Es war nie wichtig für mich, dass Sie Abgeordneter im Parlament sind, aber es würde mir so viel bedeuten, wenn Sie es fertig bekämen, dass Papa nach Hause kommt.«
Etwas noch Unschuldigeres war nicht vorstellbar – jedenfalls unschuldig in dem Sinn, dass es nicht als Vergehen gegenüber Mr. Trevelyan gewertet werden konnte. Doch in genau diesem Moment fiel eine Äußerung, die Mrs. Trevelyan etwas erschreckte und sie befürchten ließ, dass sie etwas Falsches tat.
»Ich muss eine Bedingung stellen, Emily«, sagte der Colonel.
»Welche?«
»Sie dürfen es nicht Ihrem Mann erzählen.«
»Du lieber Himmel! Warum nicht?«
»Ich bin sicher, dass Sie genug Scharfsinn besitzen zu wissen warum nicht. Der kleinste Hinweis, der in irgendeinem Klub darauf gemacht wird, würde Ihrem Wunsch sofort den Garaus machen und mir sehr schaden. Und außerdem hätte ich es nicht gern, dass er weiß, dass ich mich überhaupt eingemischt habe. Ich hüte mich davor, dass mein Name mit so etwas in Verbindung gebracht wird; und, ganz ehrlich, ich würde es für niemanden sonst auf der Welt tun als für Sie. Sie geben mir Ihr Wort, Emily?«
Sie versprach es, aber es gab in dieser Sache, wie sie sich derzeit darstellte, zweierlei, was sie überhaupt nicht mochte. Sie war sehr abgeneigt, mit Colonel Osborne ein Geheimnis vor ihrem Mann zu haben; und sie war alles andere als begeistert zu hören, dass er ihr einen Gefallen tat, den er niemandem sonst auf der Welt erwiesen hätte. Hätte er es ihr einen Tag zuvor gesagt, bevor ihr Mann jene anstößigen Worte gesprochen hatte, so wäre es nicht von großer Bedeutung für sie gewesen. Sie hätte die Freundschaft dieses Mannes zu ihr mit seiner uralten Freundschaft zu ihrem Vater in Verbindung gebracht und das Versprechen als Versprechen gegenüber allen Rowleys aufgefasst statt speziell ihr gegenüber. Doch jetzt, nach dem, was vorgefallen war, bereitete es ihr Pein, von Colonel Osborne zu hören, er opfere speziell für sie und für niemanden sonst auf der Welt seinen Stolz als Politiker. Und zudem hatte es, als er sie bei ihrem Vornamen nannte und als er das Versprechen von ihr verlangte, in seiner Stimme einen Unterton gegeben, der ihr eigentlich zu gefühlsbetont vorgekommen war. Aber sie gab ihr Versprechen; und als er beim Abschied ihre Hand drückte, erwiderte sie den Druck und demonstrierte damit ihre Dankbarkeit für seine Freundlichkeit gegenüber ihren Eltern.
Nach Colonel Osbornes Abschied blieb Mrs. Trevelyan allein in ihrem Salon. Sie wusste, dass ihr Mann immer noch unten war, und lauschte kurz, ob er jetzt zu ihr nach oben käme. Auch er hatte Colonel Osbornes Schritte vernommen, als dieser das Haus verließ, und einige Augenblicke lang war er unentschieden, ob er sogleich nach oben zu seiner Frau gehen sollte oder nicht. Obwohl er sich für entschlossen und zielbewusst hielt, schwankte er in der letzten Viertelstunde zwischen der einen Absicht, nämlich seiner Frau die Leviten zu lesen, und der anderen, ihre Verzeihung zu erbitten wegen der zuvor geäußerten Worte. Er glaubte, er komme seiner Pflicht am ehesten nach, indem er ihr die Leviten las; andererseits wäre es so viel angenehmer, oder jedenfalls so viel einfacher, sie um Verzeihung zu bitten. Doch einer Sache war er sich absolut sicher, er musste Colonel Osborne irgendwie von seinem Haus fernhalten. Er konnte nicht weiterleben und weiterhin die Gefühle ertragen, unter denen er gelitten hatte, als er im unteren Stockwerk an seinem Schreibtisch saß und wusste, dass Colonel Osborne oben mit seiner Frau Zeit in trauter Zweisamkeit verbrachte. Vielleicht war an der Sache gar nichts auszusetzen. Dass seine Frau keine Schuld traf, dessen war er sich völlig sicher. Trotzdem machte ihm ein Gefühl, das ihn in Bezug auf diesen Mann befiel, so sehr zu schaffen, dass es ihm alle Kraft raubte und er in seinem Denken und Handeln wie gelähmt war. Er konnte – und wollte – es nicht länger aushalten. Eher würde er Mr. Pooles Vorbild folgen und seine Frau nach Neapel bringen. Mit diesem Entschluss setzte er den Hut auf und verließ das Haus. Er würde den Nachmittag nutzen, um alles zu überdenken, bevor er in der einen oder anderen Richtung Schritte unternahm.
Sobald er gegangen war, ging Emily Trevelyan ein Stockwerk höher, zu ihrem Kind. Sie wollte sich nicht rühren, solange es eine Chance gab, dass er zu ihr käme. Sie wünschte sich sehr, er wäre gekommen, und hatte sich, entgegen ihrer heftigen Äußerung gegenüber ihrer Schwester, entschieden, den leisesten Hauch einer eventuellen Entschuldigung von seiner Seite zu akzeptieren. Zu dieser Gefühlslage war sie durch das Bewusstsein, ein Geheimnis vor ihm zu haben, getrieben worden, und durch das Empfinden, zwar nichts Ungehöriges getan zu haben, sich jedoch so verhalten zu haben, dass Teile der Gesellschaft ihre Art der Verabschiedung von diesem Mann – vor dem ihr Ehemann sie gewarnt hatte – als ungehörig bezeichnen könnten. Dieser warme Händedruck, der liebevolle Ton, in dem ihr Name ausgesprochen worden war, und das ihr gegebene Versprechen brachten ihr Herz gegenüber ihrem Mann zum Schmelzen. Hätte er sie jetzt aufgesucht und freundliche Worte gefunden – alles wäre ins Lot gekommen. Aber er suchte sie nicht auf.
»Wenn er sich entscheidet, verstimmt und beleidigt zu sein, soll er doch verstimmt und beleidigt sein«, sagte Mrs. Trevelyan sich, als sie nach oben zu ihrem Kind ging.
»War Louis bei dir?«, fragte Nora, sobald Mrs. Fairfax sie zu Hause abgesetzt hatte.
»Ich habe ihn nicht gesehen, solange du unterwegs gewesen bist«, sagte Mrs. Trevelyan.
»Er hat wohl vor Colonel Osborne das Haus verlassen?«
»Eigentlich nicht. Er hat gewartet, bis Colonel Osborne gegangen war, und hat dann das Haus verlassen; und bei mir hat er sich nicht blicken lassen. Er muss selbst wissen, wie er sich verhalten soll, aber ich muss sagen, dass er meiner Meinung nach sehr töricht ist.«
Die junge Ehefrau brachte dies in einem Ton vor, der deutlich machte, dass sie über das Verhalten ihres Mannes geurteilt hatte und es als wirklich absolut töricht empfand.
»Glaubst du, dass Papa und Mama wirklich kommen?«, fragte Nora und änderte damit das Thema.
»Wie kann ich das sagen? Wie soll ich das wissen? Nach allem, was passiert ist, fürchte ich mich davor, überhaupt etwas zu sagen, damit man mir nicht vorwirft, etwas Falsches zu tun. Aber Nora, denk daran, du darfst zu niemandem etwas darüber sagen.«
»Du sagst es doch Louis?«
»Nein, ich sage es niemandem.«
»Meine liebste Emily – bitte habe keine Geheimnisse vor ihm.«
»Was meinst du mit Geheimnis? Es gibt kein Geheimnis. Es ist nur so, dass es bei solchen Angelegenheiten – bei etwas Politischem – kein Gentleman schätzt, wenn man über ihn tratscht!«
Noras Gesichtsausdruck verdüsterte sich, als sie dies hörte. Für sie war es überaus schlimm, dass ihre Schwester und Colonel Osborne ein Geheimnis teilten, das ihrem Schwager vorenthalten wurde.
»Als Nächstes wirst du mich wohl verdächtigen?«, sagte Mrs. Trevelyan voller Zorn.
»Emily, wie kannst du so etwas Schlimmes sagen?«
»Du hast so gewirkt, als ob es so wäre.«
»Ich will nur sagen, es wäre klüger, das alles Louis zu erzählen.«
»Wie kann ich ihm etwas über Colonel Osbornes persönliche Pläne erzählen, wenn Colonel Osborne es ausdrücklich nicht wünscht? Für wen macht Colonel Osborne das? Für Papa und Mama! Ich darf doch annehmen, dass Louis nicht – eifersüchtig ist, weil ich gern hätte, dass Papa und Mama nach Hause kommen. Es wäre kein bisschen weniger widersinnig als das andere.«
KAPITEL III
LADY MILBOROUGHS ABENDEINLADUNG
Louis Trevelyan begab sich zu seinem Klub, dem Acrobats’ Club an der Pall Mall, und hörte dort ein Gerücht, das seinen Zorn auf Colonel Osborne noch verstärkte. Der Acrobats’ Club war ausgesprochen distinguiert; in ihm Mitglied zu werden war für einen jungen Mann inzwischen schwierig, und noch schwieriger war es für einen Mann, der nicht mehr ganz jung und daher weithin bekannt war. Der Klub war vor etwa zwanzig Jahren mit dem Ziel gegründet worden, Muskeltraining und Sportvergnügungen anzubieten; doch die Initiatoren waren fett und lethargisch geworden und die Akrobaten verbrachten ihre Zeit zumeist damit, Whist zu spielen und Gerichte zu bestellen und zu konsumieren. Angeblich gab es in einem abgelegenen Gebäudeteil gewisse Stangen und Stöcke und Barren, mit denen man sportliche Meisterleistungen anstreben konnte, aber in diesen Tagen erkundigte sich kein Mensch jemals danach, und wenn ein Mann Akrobat wurde, so entweder wegen Whist oder wegen der Küche, oder möglicherweise auch des gesellschaftlichen Ranges des Klubs halber. Louis Trevelyan war Mitglied – so wie auch Colonel Osborne.
»Der alte Rowley kommt also nach Hause«, sagte ein vornehmer Akrobat zu einem anderen, und zwar in Trevelyans Hörweite.
»Wie zum Teufel schafft er das? Er war doch erst vor einem Jahr hier?«
»Osborne setzt sich dafür ein. Er soll als Zeuge für diesen Ausschuss kommen. Er kann bequem die Füße hochlegen, jeder Shilling an Ausgaben wird ihm erstattet, bis hin zu seinen Fahrkosten für die Droschke, wenn er zum Essen ausgeht. Es gibt einfach nichts Besseres, als einen Freund an maßgeblicher Stelle zu haben.«
Soweit zu der Geheimhaltung von Colonel Osbornes Geheimnis! Er hatte die Verbindung seines Namens mit politischen Interessen so dringend zu vermeiden versucht, dass er seiner jungen Freundin vorsichtshalber aufgebürdet hatte, die Sache vor ihrem Ehemann geheim zu halten, und dennoch hörte der Ehemann die ganze Geschichte, wie sie noch an demselben Tag in seinem Klub erzählt wurde! Es gab keinen Grund, weshalb die Geschichte Trevelyan in Zorn versetzen sollte, wenn er nicht sogleich das Gefühl gehabt hätte, dass in dieser Angelegenheit ein Plan zwischen seiner Frau und Colonel Osborne geschmiedet worden war, der ihm vorenthalten wurde. Zwar hätte seine Frau, wie dem Leser bekannt ist, ihm noch nichts sagen können. Er hatte sie nicht gesehen, seit die Sache zwischen ihr und ihrem Freund besprochen worden war. Aber er war erzürnt, weil er etwas in seinem Klub erfuhr, das er seiner Ansicht nach eigentlich zu Hause hätte erfahren müssen.
Sobald er zu Hause ankam, ging er in das Zimmer seiner Frau; jedoch war ihre Zofe bei ihr, und nichts konnte unmittelbar in diesem Augenblick gesagt werden. Darauf zog er sich um und plante, Emily sofort aufzusuchen, wenn das Mädchen weg wäre, doch sie blieb – sie wurde, wie er glaubte, von seiner Frau bewusst im Zimmer behalten, damit er keine Möglichkeit zu einem privaten Gespräch hätte. Daher ging er nach unten, und dort traf er auf Nora, die am Kamin des Salons stand.
»Dann warst du als Erste mit dem Umziehen dran?«, fragte er. »Ich dachte, du wärst immer die Letzte.«
»Heute hat Emily Jenny zuerst zu mir geschickt, weil sie dachte, du würdest nach Hause kommen, und sie ist erst in letzter Minute zum Umziehen gegangen.«
Nora meinte es gut, aber es hatte nicht die gewünschte Wirkung. Trevelyan, der seine Mimik nicht beherrschte, runzelte die Stirn und zeigte, dass er verstimmt war. Er zögerte kurz und überlegte, ob er Nora eine Frage die Nachricht über ihre Eltern betreffend stellen sollte, doch bevor er das Wort ergriff, kam seine Frau herein.
»Wir sind leider alle spät dran«, sagte Emily.
»Du bist jedenfalls die Letzte«, sagte der Ehemann.
»Ungefähr um eine halbe Minute«, sagte die Ehefrau.
Dann stiegen sie in den gemieteten Brougham ein, der vor der Haustür wartete.
In den harmonischen Tagen früherer Vertrautheit hatte er seiner Frau angeboten, eine Kutsche für sie anzuschaffen; dabei hatte er hinzugefügt, dass dieser Luxus zwar kostspielig, aber nicht außerhalb seiner finanziellen Mittel sei. Sie hatte sich jedoch gegen eine Kutsche ausgesprochen, und sie vereinbarten, dass es statt der Kutsche jeden Herbst einen Urlaub geben solle. »Man macht Erfahrungen, wenn man auf Reisen geht, aber nicht, indem man eine Kutsche besitzt«, hatte Emily gesagt. Es waren glückliche Tage gewesen, und man war davon ausgegangen, dass immer alles in rosiges Licht getaucht bleiben würde. Jetzt zerbrach er sich den Kopf, ob es, anstatt eine Herbstreise anzutreten, nötig wäre, dass er mit seiner Frau dauerhaft nach Neapel übersiedeln würde, damit sie dem Einfluss entzogen wäre von – von – von –; nein, nicht einmal im Traum würde er Colonel Osborne für den Geliebten seiner Frau halten. Die Vorstellung war zu schrecklich! Und doch – wie schlimm es doch war, dass er sie aus gleichgültig welchem Grund dem Einfluss irgendeines Mannes entziehen musste.
Lady Milborough wohnte recht weit entfernt, am Eccleston Square, doch sagte Trevelyan kein einziges Wort zu seinen beiden Begleiterinnen. Er war verstimmt und verärgert, und es war ihm klar, dass sie wussten, dass er verstimmt und verärgert war. Mrs. Trevelyan und ihre Schwester unterhielten sich die ganze Fahrtdauer über, jedoch in der Art von Tonfall, die deutlich macht, dass das Gespräch künstlich ist, nicht geführt wird aus Interesse an Fragen, die gestellt, und Antworten, die gegeben werden, sondern weil es den Zweck erfüllt, Stille zu verhindern. Nora sagte etwas über Marshall und Snellgrove und versuchte vorzutäuschen, sie hätte an der Reaktion ihrer Schwester großes Interesse. Emily wiederum äußerte sich über die Oper am Covent Garden und wollte damit demonstrieren, dass sie vollkommen gelassen war. Beide scheiterten jämmerlich, und das war ihnen bewusst. Einmal oder auch zweimal dachte Trevelyan daran, der Form halber ein Wort des Bedauerns einzuwerfen. Wie ein unartiges Kind, das weiß, dass es unartig ist, versuchte er brav zu sein. Aber er konnte es nicht. Seine Besessenheit war zu intensiv. Sie musste gewusst haben, dass eine Rückkehr ihres Vaters in die Wege geleitet wurde, und zwar durch Colonel Osbornes Einfluss. Wenn dieser Mann im Klub davon gehört hatte, wie konnte sie es dann nicht gewusst haben? Als sie vor Lady Milboroughs Haus ausstiegen, hatte er zu keiner der beiden Schwestern etwas gesagt.
Es war eine große, öde Gesellschaft mit zum größten Teil älteren Gästen. Lady Milborough und Trevelyans Mutter waren enge Freundinnen gewesen, und Lady Milborough hatte es aus diesem Grund zu ihrer Aufgabe gemacht, sich intensiv für Trevelyans Ehefrau zu interessieren. Louis Trevelyan selbst hatte sich allerdings, als er mit Emily über Lady Milborough sprach, über die alte Freundin seiner Mutter lustig gemacht, und Emily hatte natürlich das Urteil ihres Mannes übernommen. Lady Milborough hatte ihr gelegentlich in einer unbedeutenden Sache einen Rat erteilt, ihr gesagt, die frische Luft da oder dort sei gut für ihr kleines Kind, und ihr bedeutet, eine Mutter solle sich in einer gewissen turbulenten Phase ihres Lebens mit einer gewissen Sorte von Malzbier stärken. Mrs. Trevelyan reagierte unduldsam auf alle derartigen Ratschläge zu häuslichen Themen – wie sie es von ihrer Natur her in Bezug auf alle Angelegenheiten war –, und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, sich über Lady Milborough hinter ihrem Rücken und sogar in ihrer Gegenwart lustig zu machen, da sie sich wegen der Äußerungen ihres Mannes über die Freundin seiner Mutter im Recht dazu fühlte. Lady Milborough, eine Seele von Mensch und ihrem Freundeskreis bis ins Letzte ergeben, hatte daran nie Anstoß genommen, befürchtete jedoch, Mrs. Trevelyan sei vielleicht etwas flatterhaft. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie es sich nie erlaubt, etwas Kritischeres über die Ehefrau ihres jungen Freundes zu sagen. Und stets fügte sie hinzu, Derartiges werde sich legen, sobald das Kinderzimmer gut bestückt wäre. Von daher ist es verständlich, dass Mrs. Trevelyan Lady Milboroughs Gesellschaft nicht gerade mit Vorfreude entgegensah und der Einladung als einer Pflichtaufgabe nachkam.
Unter den Gästen befand sich der Ehrenwerte Charles Glascock, ältester Sohn von Lord Peterborough, und dieser machte den Abend für Nora interessanter, als er für ihre Schwester war. Mehr als nur einmal hatte jemand angedeutet – darunter auch Lady Milborough, deren sämtliche Töchter schon verheiratet waren –, dass sie eventuell die Gattin des Ehrenwerten Charles Glascock werden könne, falls sie es als passend empfinde. Einerlei, ob sie dies als eventuell passend empfand oder nicht, machte die Gegenwart dieses Gentleman unter solchen Voraussetzungen den Abend, was sie anging, interessant. Und da Lady Milborough es einrichtete, dass Mr. Glascock Nora zur Tafel geleitete, war das Interesse ganz erheblich. Mr. Glascock sah gut aus, war knapp unter vierzig, Abgeordneter im Parlament, Anwärter auf einen Adelstitel, und verfügte dem Vernehmen nach über ein großes Vermögen. Lady Milborough und Mrs. Trevelyan hatten Nora Rowley nahegelegt, sie möge es sich erlauben, sich in Mr. Glascock zu verlieben, sollte in dieser Hinsicht eine Andeutung fallen. Es hatte eine Andeutung gegeben, aber noch hatte sie es sich nicht erlaubt, sich in Mr. Glascock zu verlieben. Es schien ihr, als wäre Mr. Glascock sich der Vorzüge seiner Stellung durchaus bewusst und als hätte er nur begrenztes Talent, sich mit anderen Angelegenheiten als den unmittelbar ihn angehenden zu beschäftigen. Sie glaubte durchaus, dass er ihr tatsächlich das Kompliment gemacht hatte, sich in sie zu verlieben, und dieses Kompliment lässt nur wenige Mädchen gleichgültig. Nora hätte vielleicht versucht, sich in Mr. Glascock zu verlieben, wenn sie sich nicht gedrängt gefühlt hätte, ihn mit jemand anderem zu vergleichen. Dieser andere war nicht in sie verliebt, was sie sehr wohl wusste; und sie hatte sich definitiv nicht in ihn verliebt. Jedoch kam sie nicht umhin, den Vergleich anzustellen, und er fiel nicht zugunsten von Mr. Glascock aus. An diesem Abend saß Mr. Glascock neben ihr und trug ihr etwas vor, das nahezu einem Antrag gleichkam.
»Sie waren noch nie auf Monkhams?«, fragte er. Monkhams war der Landsitz seines Vaters und ein sehr vornehmes Anwesen in Worcestershire. Natürlich war ihm bewusst, dass sie nie auf Monkhams gewesen war. Wie sollte sie dort hingekommen sein?
»In diesem Teil von England war ich noch nie«, antwortete sie.
»Ich würde Ihnen Monkhams so gern zeigen. Die Eichen dort sind die schönsten im ganzen Königreich. Gefallen Ihnen Eichen?«
»Wem sollten Eichen nicht gefallen? Aber auf den Inseln gibt es keine, und niemand hat noch weniger Eichen in seinem Leben gesehen als ich.«
»Eines Tages zeige ich Ihnen Monkhams. Soll ich das? Wirklich, ich hoffe, dass ich Ihnen eines Tages Monkhams tatsächlich zeigen darf.«
Wenn ein lediger Mann davon spricht, einer jungen Lady das Haus zeigen zu wollen, in dem er später nun einmal residieren wird, kann er selbstverständlich kaum etwas anderes damit meinen als eine Aufforderung an sie, dort zusammen mit ihm zu residieren. Zumindest muss es in seiner Absicht liegen, ihr zu bedeuten, dass er sie dazu auffordern wird, falls er entsprechend ermutigt wird. Aber Nora Rowley gab Mr. Glascock an diesem Abend nicht sehr viel Ermutigung.
»Ich fürchte, es ist unwahrscheinlich, dass mich jemals etwas in diesen Teil des Landes führt«, sagte sie. Es lag vielleicht etwas in ihrem Tonfall, das Mr. Glascock Einhalt gebot, sodass er die Einladung nicht erneut aussprach.
Als die Damen oben im Salon waren, schaffte Lady Milborough es, neben Mrs. Trevelyan auf einem Sofa Platz zu nehmen, das nur für zwei Personen gedacht war. Emily rechnete damit, einen Rat über den Konsum von Malzbier zu erhalten, und nahm sich vor, schnippisch zu reagieren. Allerdings war die Angelegenheit, um die es gehen sollte, schwerwiegender. Lady Milborough empfand Unbehagen über Colonel Osborne.
»Meine Liebe«, sagte sie, »Ihr Vater war doch ein sehr enger Freund von Colonel Osborne?«
»Er ist immer noch ein sehr enger Freund von ihm, Lady Milborough.«
»Ach ja; mir war, als hätte ich so etwas gehört. Das erklärt natürlich, dass Sie ihn kennen.«
»Wir kennen ihn schon seit unserer Geburt«, sagte Emily und vergaß dabei wohl, dass innerhalb ihrer Lebenszeit von dreiundzwanzig Jahren und einigen Monaten eine durchgängige Frist von mehr als zwanzig Jahren lag, in der sie diesem Mann, den sie seit ihrer Geburt kannte, niemals begegnet war.
»Das erklärt vieles, und ich will nichts gegen ihn vorbringen.«
»Das hoffe ich, Lady Milborough, denn wir haben ihn alle außerordentlich gern.« Dies wurde so entschieden vorgebracht, dass die gute Tat der bedauernswerten, lieben alten Lady Milborough unvermittelt ins Stocken kam. Sie kannte die schreckliche Zwangslage, in die Augustus Poole seiner Frau wegen geraten war, sehr genau, obwohl niemand vermutete, dass Pooles Frau in ihrem hübschen kleinen Herzen sich je etwas Schlimmes vorgenommen hatte. Trotzdem war er gezwungen gewesen, seine Zelte abzubrechen und seine Frau nach Neapel zu bringen, denn dieser abscheuliche Colonel Osborne hatte es sich angewöhnt, in Mrs. Pooles Salon in Knightsbridge sein Lager aufzuschlagen. Augustus Poole, der genügend Mut besaß, es mit jedem anderen aufzunehmen, war es nicht gelungen, den Colonel zu vertreiben. Er konnte es nicht – nicht ohne eine Auseinandersetzung, die für ihn eine Schande und für seine Frau rufschädigend gewesen wäre, und daher hatte er Mrs. Poole nach Neapel gebracht. Lady Milborough kannte die ganze Geschichte und meinte voraussehen zu können, dass sich dasselbe im Salon in der Curzon Street abspielen werde. Als sie versuchte, das Wort an die Ehefrau zu richten, musste sie feststellen, dass ihr das versagt blieb. An dieser Stelle konnte sie ihr Werk nicht fortsetzen, nicht nach der spontanen Reaktion auf ihre ersten wenigen Worte. Aber vielleicht hätte sie beim Ehemann mehr Erfolg. Schließlich war sie mit den Trevelyans befreundet, nicht mit den Rowleys.
»Mein lieber Louis«, begann sie, »Ich möchte mit Ihnen sprechen. Kommen Sie zu mir.« Und dann führte sie ihn in eine entfernte Ecke des Raums, während Mrs. Trevelyan sie die ganze Zeit beobachtete und erriet, weshalb ihr Mann auf diese Weise verschleppt wurde. »Ich möchte Ihnen einen kleinen Hinweis geben, wobei ich mir sicher bin, dass er absolut unnötig ist«, fuhr Lady Milborough fort. Dann schwieg sie, doch Trevelyan sagte nichts. Sie sah ihm ins Gesicht und bemerkte den finsteren Ausdruck. Aber dieser Mann war das einzige Kind ihrer liebsten Freundin, und sie blieb beharrlich. »Wissen Sie, ich mag es irgendwie nicht, dass Colonel Osborne so häufig bei Ihnen zu Besuch ist.« Das Gesicht ihres Gegenübers verfinsterte sich noch mehr, es fiel jedoch kein Wort. »Ich gebe gern zu, dass ich ein Vorurteil habe, aber ich mochte ihn noch nie. Ich glaube, als Freund ist er gefährlich – ich würde ihn als heimtückisch und hinterhältig bezeichnen. Und obwohl Emilys ausgeprägte Vernunft und ihre Liebe zu Ihnen und ihre Einstellung zu einem solchen Thema für einen Ehemann nichts zu wünschen übrig lassen – – Also, ich bin absolut sicher, dass der Gedanke an etwas Ungehöriges ihr völlig fremd ist. Aber die Gefahr lauert gerade in ihrer vollkommenen Lauterkeit und Unschuld. Er hat einen schlechten Charakter, und an Ihrer Stelle würde ich es zur Sprache bringen, damit sie versteht, dass sein vormittägliches Erscheinen bei ihr nicht wünschenswert ist. Ganz ehrlich, ich glaube, es macht ihm große Freude, weit herumzukommen und zwischen Männern und ihren Frauen Unfrieden zu stiften.«
So äußerte sie sich; und Louis Trevelyan war zwar verletzt und verärgert, konnte jedoch nicht umhin zu empfinden, dass sie sich in der Rolle einer Freundin geäußert hatte. Was sie gesagt hatte, stimmte ausnahmslos; was sie gesagt hatte, hatte er sich längst mehrfach gesagt. Auch er hasste diesen Mann. Er hielt ihn für heimtückisch und hinterhältig. Doch es war sehr schwer zu ertragen, dass er von einem anderen Menschen bezüglich des Verhaltens seiner Frau gewarnt wurde, dass er, dem die Welt so viel Glück und Erfolg beschieden hatte, dass er, der sich tatsächlich die Überzeugung zu eigen gemacht hatte, dass er dieses Glück und diesen Erfolg verdiente, zum Gegenstand wohlmeinender Fürsorge wurde, weil eine Krise zwischen ihm und seiner Frau drohte. Spontan fiel ihm keine Entgegnung ein. »Auch ich kann ihn nicht leiden«, sagte er.
»Louis, seien Sie einfach vorsichtig, das ist alles«, sagte Lady Milborough, und damit entfernte sie sich.