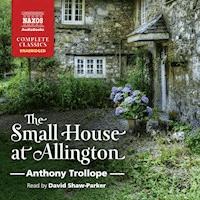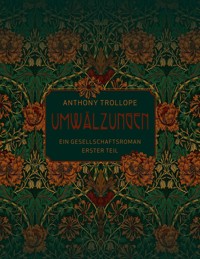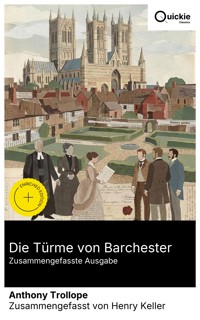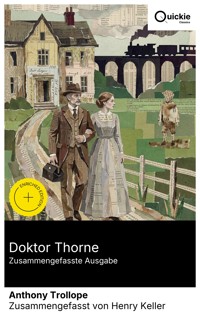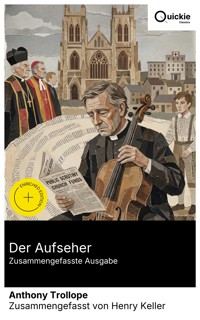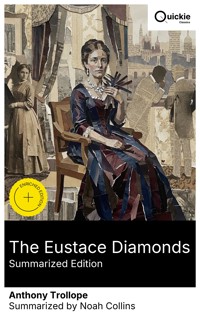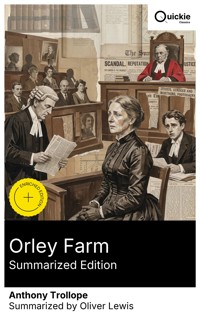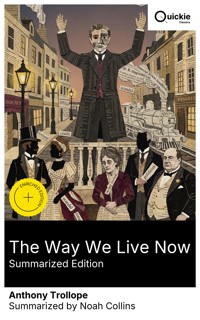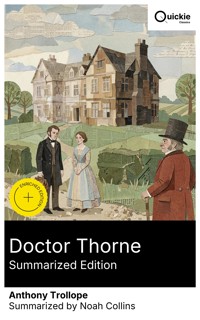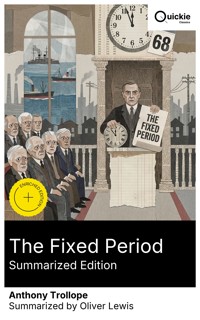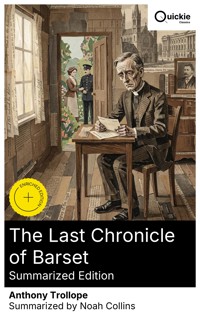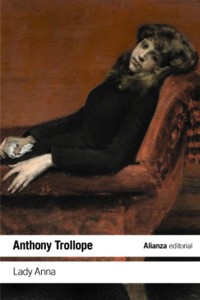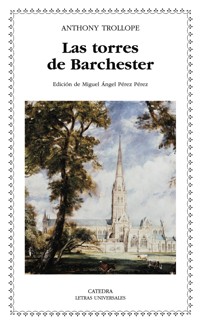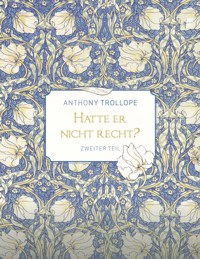
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hatte er nicht recht?
- Sprache: Deutsch
Der Roman: He Knew He Was Right / Hatte er nicht recht? Wie findet man einen passenden Ehepartner, eine passende Ehepartnerin? Welche Rolle spielen Liebe, Rang und Geld? Was geschieht, wenn ein Partner glaubt, Grund zu Eifersucht zu haben? Trollopes 1869 veröffentlichter Text verbindet Gesellschafts- mit psychologischem Roman. Er verstrickt seine Figuren in anrührende Probleme und verhängnisvolle Konflikte und vermittelt dabei überzeugend die Facetten des Frauenbildes seiner Zeit - das der Männer genauso wie das der Frauen selbst. Teil Zwei: Konflikte spitzen sich zu, doch es ergeben sich auch neue Chancen. Manche Figuren verharren in überkommenen Mustern, andere lernen dazu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Anthony Trollope (1815-1882), einer der erfolgreichsten englischen Schriftsteller, setzte sich in seinen Romanen mit der Gesellschaft seiner Zeit auseinander und entwarf dabei ein differenziertes und hellsichtiges Bild des Lebens in London genauso wie in der Provinz. Seine Romane zeichnen sich durch subtile Ironie und unterhaltsame Milieuschilderung aus. Er porträtiert seine Figuren, so unterschiedlich sie von Herkunft, gesellschaftlicher Rolle und Charakter auch sein mögen, stets empathisch und glaubwürdig.
Der Roman: He Knew He Was Right / Hatte er nicht recht?
Wie findet man einen passenden Ehepartner, eine passende Ehepartnerin? Welche Rolle spielen Liebe, Rang und Geld? Was geschieht, wenn ein Partner glaubt, Grund zu Eifersucht zu haben? Trollopes 1869 veröffentlichter Text verbindet Gesellschafts- mit psychologischem Roman. Er verstrickt seine Figuren in anrührende Probleme und verhängnisvolle Konflikte und vermittelt dabei überzeugend die Facetten des Frauenbildes seiner Zeit – das der Männer genauso wie das der Frauen selbst.
Teil Zwei:
Konflikte spitzen sich zu, doch es ergeben sich auch neue Chancen. Manche Figuren verharren in überkommenen Mustern, andere lernen dazu.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL LI: WAS SICH WÄHREND MISS STANBURYS KRANKHEIT EREIGNETE
KAPITEL LII: MR. OUTHOUSE KLAGT: DAS LEBEN IST HART.
KAPITEL LIII: HUGH STANBURY KOMMT AUCH OHNE ZAUBERKÜNSTE AUS
KAPITEL LIV: MR. GIBSONS DROHUNG
KAPITEL LV: DIE REPUBLIKANISCHE BROWNING
KAPITEL LVI: VERDORRTES GRAS
KAPITEL LVII: DOROTHYS SCHICKS
KAPITEL LVIII: DOROTHY IST WIEDER ZU HAUSE
KAPITEL LIX: MR. BOZZLE IM KREISE SEINER LIEBEN
KAPITEL LX: EINE WEITERE AUSEINANDERSETZUNG
KAPITEL LXI: PARKER’S HOTEL, MOWBRAY STREET
KAPITEL LXII: LADY ROWLEY UNTERNIMMT EINEN VERSUCH
KAPITEL LXIII: SIR MARMADUKE IM KREISE SEINER LIEBEN
KAPITEL LXIV: SIR MARMADUKE IN SEINEM KLUB
KAPITEL LXV: GEHEIMNISVOLLE MÄCH
KAPITEL LXVI: ES GEHT DARIN UM EINE LAMMKEULE
KAPITEL LXVII: RIVER’S COTTAGE
KAPITEL LXVIII: DER PARLAMENTARISCHE AUSSCHUSS UNTER MAJOR MAGRUDERS VORSITZ
KAPITEL LXIX: SIR MARMADUKE IN WILLESDEN
KAPITEL LXX: NORAS GEDANKEN ÜBER KUTSCHEN
KAPITEL LXXI: HUGH STANBURYS GEDANKEN ÜBER DIE PFLICHTEN EINES MANNES
KAPITEL LXXII: DIE LAMMKEULE WIRD ÜBERGEBEN
KAPITEL LXXIII: DOROTHY KEHRT NACH EXETER ZURÜCK
KAPITEL LXXIV: DIE GEREIZTE LÖWIN
KAPITEL LXXV: DIE ROWLEYS ÜBERQUEREN DIE ALPEN
KAPITEL LXXVI: »WIR WERDEN BETTELARM SEIN.«
KAPITEL LXXVII: DIE ZUKÜNFTIGE LADY PETERBOROUGH
KAPITEL LXXVIII: CASA LUNGA
KAPITEL LXXIX: »ICH KANN AUF DEM BODEN SCHLAFEN.«
KAPITEL LXXX: »WIRD MAN IHN VERACHTEN?«
KAPITEL LXXXI: MR. GLASCOCK IST HERR IM EIGENEN HAUS
KAPITEL LXXXII: MRS. FRENCHS TRANCHIERMESSER
KAPITEL LXXXIII: BELLA IST DIE SI
KAPITEL LXXXIV: TREVELYAN OPFERT SICH
KAPITEL LXXXV: DIE BÄDER VON LUCCA
KAPITEL LXXXVI: MR. GLASCOCK BETREUT DAS KIND
KAPITEL LXXXVII: MR. GLASCOCK HEIRATET
KAPITEL LXXXVIII: CROPPER & BURGESS
KAPITEL LXXXIX: »ICH WÜRDE ES NICHT TUN, WENN ICH SIE WÄRE.«
KAPITEL XC: LADY ROWLEY LÄSST SICH UMSTIMMEN
KAPITEL XCI: UM VIER UHR MORGENS
KAPITEL XCII: TREVELYAN PHILOSOPHIERT ÜBER DAS LEBEN
KAPITEL XCIII: »SAG MIR, DASS DU MIR VERZEIHST.«
KAPITEL XCIV: EINE WAHRE CHRIST
KAPITEL XCV: TREVELYAN IST NACH ENGLAND ZURÜCKGEKEHRT
KAPITEL XCVI: AUF MONKHAMS
KAPITEL XCVII: MRS. BROOKE BURGESS
KAPITEL XCVIII: MRS. BROOKE BURGESS
KAPITEL XCIX: ABSCHLUSS
KAPITEL LI
WAS SICH WÄHREND MISS STANBURYS KRANKHEIT EREIGNETE
Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde Sir Peter Mancrudy, im Westen Englands der angesehenste Mediziner für solche Fälle, an Miss Stanburys Krankenbett gerufen; und Sir Peter hatte bestätigt, dass es gar nicht gut aussah. Er nahm Dorothy beiseite und teilte ihr mit, Mr. Martin, der Hausarzt, habe in diesem Fall ohne Zweifel durchaus richtig gehandelt; dass man überhaupt nichts gegen Mr. Martin einwenden könne, dessen Erfahrung umfassend sei, dem man Scharfsinn nicht absprechen könne, dass Mr. Martin jedoch trotzdem – es kam Dorothy zumindest so vor, als ob dies die eigentliche Bedeutung sei, die man aus Sir Peters Worten herauslesen sollte – in der Behandlung dieses Falls den einen Kurs eingeschlagen habe, während er eigentlich den anderen hätte einschlagen sollen. Die Behandlungsmaßnahmen wurden grundlegend überarbeitet, Mr. Martin wurde sehr nervös und ordnete nichts ohne Sir Peters Plazet an. Miss Stanbury litt an Bronchitis und Komplikationen in Rachen und Lunge. In dem kleinen Salon an der Rückseite des Bankgebäudes verkündete Barty Burgess mehreren Bekannten, sie nehme entgegen Mr. Martins ausdrücklicher Anweisung täglich vier oder fünf Gläser Portwein zu sich. Camilla French hörte davon und gab es an ihren Verehrer und vielleicht noch einige wenige Personen weiter, wobei sie betonte, sie sei fest überzeugt, es könne nicht stimmen – jedenfalls nicht, was das fünfte Glas angehe. Mrs. MacHugh, die jeden Tag Kontakt mit Martha hatte, machte sich große Sorgen. Die Gefahr, in der eine so enge Freundin schwebte, brachte gleichermaßen die Ruhe und die Annehmlichkeiten ihres Alltags durcheinander. Mrs. Clifford begab sich häufig ans Krankenbett – und hätte dort Stunden mit Lektüre zugebracht, hätte Martha ihr nicht vermittelt, dass Miss Stanbury es vorzog, wenn Miss Dorothy ihr vorlas. Wöchentlich empfing die Kranke die Sterbesakramente – nicht durch Mr. Gibson, sondern ein anderes Mitglied des niederen Klerus; und obwohl sie nie zugab, ernsthaft in Gefahr zu sein, oder es zuließ, dass andere davon sprachen, war es allen bekannt, dass sie sich der Gefahr bewusst war, denn sie hatte – reichlich übellaunig – veranlasst, dass ihr Testament ein Kodizill erhielt. »Du hast diesen Mann ja nicht geheiratet«, sagte sie zu Dorothy, »daher muss ich es ändern.« Vergeblich bat Dorothy sie, sich nicht mit solchen Gedanken zu belasten. »Das ist Quatsch«, sagte Miss Stanbury zornig. »Wenn jemand etwas hat, muss er sich darum kümmern. Du glaubst doch nicht, ich hätte Angst vor dem Sterben – oder?«, fügte sie hinzu. Dorothy antwortete ihr mit einem Gemeinplatz – wie vollkommen überzeugt doch alle seien, dass sie wieder gesund und munter werde. »Ich habe keine Angst vor dem Sterben«, sagte die alte Frau, nach Luft ringend, mühsam ihre Stimme findend. »Ich habe keine Angst davor, und ich glaube nicht, dass ich dieses Mal sterbe, aber ich will keine Scherereien hinterlassen, wenn ich weg bin.« Inzwischen war es Silvester, und an demselben Abend bat sie Dorothy, an Brooke Burgess zu schreiben und ihn um einen Besuch in Exeter zu bitten. Und dies war Dorothys Brief:
Exeter, 31. Dezember 186–
Lieber Mr. Burgess,
vielleicht hätte ich schon früher schreiben und Ihnen sagen sollen, dass es Tante Stanbury nicht so gut geht, wie wir es ihr wünschen würden; da ich jedoch weiß, dass Sie Ihre Arbeit in Ihrem Amt nicht gut unterbrechen können, hielt ich es für das Beste, Sie nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Doch heute Abend hat unsere Tante selbst den Wunsch geäußert, Ihnen mitzuteilen, dass Sie von ihrer Erkrankung wissen sollten, und auch, dass Sie, wenn möglich, für einen oder zwei Tage nach Exeter kommen sollten. Seit Weihnachten ist Sir Peter Mancrudy täglich hier gewesen, und ich habe den Eindruck, dass er eine Genesung für möglich hält. Es betrifft vor allem den Rachen – etwas, das man als Bronchitis bezeichnet, – und sie ist dadurch extrem geschwächt, und gleichzeitig kann es zu einer Entzündung kommen. Ich gehe davon aus, dass Sie kommen, wenn es Ihnen möglich ist.
Sehr herzliche Grüße
Dorothy Stanbury
Vielleicht sollte ich Ihnen mitteilen, dass sie vorgestern ihren Anwalt kommen ließ; aber sie scheint nicht anzunehmen, dass sie ernsthaft in Gefahr ist. Ich lese ihr viel vor, und sie schläft wohl die meiste Zeit; aber wenn ich pausiere, wacht sie auf, und ich glaube nicht, dass sie ansonsten überhaupt zur Ruhe kommt.
Als sich in Exeter herumsprach, dass Brooke Burgess gerufen worden war, verbreitete sich allgemein die Ansicht, Miss Stanburys Tage seien gezählt. An jeder Straßenecke befragte man Sir Peter; aber Sir Peter war diskret und konnte solche Fragen parieren, ohne etwas mitzuteilen. Wenn es Gott gefalle, so werde seine Patientin sterben, aber es sei sehr wohl möglich, dass sie überleben werde. Das war der Tenor von Sir Peters Antworten – und sie wurden vielfältig interpretiert, je nach den Eigenheiten des Fragestellers. Mrs. MacHugh war überzeugt, die Gefahr sei gebannt, und spielte heimlich eine Runde Cribbage mit der alten Miss Wright – denn während Miss Stanburys bedrohlicher Erkrankung waren die Whistkarten in der Nachbarschaft des Close beiseitegelegt worden. Barty Burgess blieb kopfschüttelnd bei seiner Unversöhnlichkeit. Seiner Meinung nach werde man vielleicht bald seine Neugier befriedigen können und Zeuge sein, wie diese bösartigste aller alten Frauen ihrer Verderbtheit die Krone aufsetzte. Mrs. Clifford ließ wissen, es liege ganz in Gottes Hand, doch sehe sie keinen Grund, weshalb Miss Stanbury das Krankenlager nicht wieder verlassen könne. Mr. Gibson nahm an, es sei vorbei mit seiner vormaligen Freundin; und Camilla wünschte, in ihrer letzten Unterredung wäre mehr Wohlwollen zu spüren gewesen, von Seiten einer Frau, die sie in früheren Tagen respektiert und geachtet habe. Mrs. French, niedergeschlagen über alles, war auch darüber sehr niedergeschlagen. Martha war fast am Verzweifeln und überdies mit der Sorge um eine komplette Ausstattung mit angemessener Trauerkleidung belastet. Man sah sie, wie sie eine halbe Stunde lang durch die Schaufensterscheiben eines großen Geschäfts für Trauerkleidung spähte. Giles Hickbody sprach nie mehr als halblaut und nahm sein Bier im Stehen ein; Dorothy aber war optimistisch und glaubte wirklich daran, dass ihre Tante sich erholen werde. Vielleicht hatte Sir Peter sich ihr gegenüber weniger orakelhaft geäußert als in der Öffentlichkeit.
Brooke Burgess traf ein und hatte eine Unterredung mit Sir Peter, und ihm gegenüber war Sir Peter in gewisser Weise verpflichtet, sich offen zu äußern, denn er war derjenige, den Miss Stanbury als ihren Erben betrachtete. Daher erklärte Sir Peter, seine Patientin könne eventuell überleben, und sie könne eventuell sterben. »Um ganz ehrlich zu sein«, sagte Sir Peter, »ein Arzt weiß darüber auch nicht so viel mehr als andere Menschen.« Man kam überein, dass Brooke drei Tage in Exeter bleiben und dann nach London zurückreisen solle. Sollte etwas passieren, werde er selbstverständlich zurückkehren. Sir Peter hatte klar zu erkennen gegeben, dass man nichts Definitives vorhersagen könne – weder in die eine Richtung noch in die andere. Seine Patientin sei langfristig erkrankt; sie könne die Krankheit überwinden, sie könne ihr jedoch auch erliegen.
Dorothy und Brooke begegneten sich häufig in diesen drei Tagen. Zwar verbrachte Dorothy den Großteil ihrer Zeit am Bett ihrer Tante und versuchte sie durch Vorlesen einer bestimmten Predigtreihe, die Miss Stanbury sehr schätzte, zum Einschlafen zu bewegen; aber es gab einige Minuten, die Dorothy und Brooke zwangsläufig gemeinsam verbrachten. Sie nahmen ihre Mahlzeiten gemeinsam ein, und es gab am Abend – vor dem Beginn von Dorothys Nachtwache im Zimmer ihrer Tante – einen Zeitraum, in dem sie ihren Tee zu sich nahm, während Martha oben ihren Dienst als Krankenpflegerin versah. Zu dieser Tageszeit blieb sie immer etwa eine Stunde oder sogar länger bei Brooke; und es kann innerhalb einer Stunde zwischen einem Mann und einer Frau eine Menge gesprochen werden, wenn der Wille zum Gespräch vorhanden ist. Brooke Burgess hatte seine Meinung keineswegs geändert, seit er sich Hugh Stanbury gegenüber erklärt hatte – unter den Straßenlampen von Long Acre und ermutigt durch die Einwirkung von Austern und einem Whiskeycocktail. Der Whiskeycocktail hatte in diesem Augenblick Wahrheit statt Lüge hervorgebracht – wie es Whiskeycocktails und ähnliche gefährliche Stimulanzien immer tun. Es gibt kein wahrhaftigeres Sprichwort als das Sprichwort über die Wahrheit im Wein. Wein ist gefährlich und sollte nicht benutzt werden, um sich für die Wahrheit zu verkämpfen, und sei die Wahrheit noch so wünschenswert; doch er hat die gute Eigenschaft, einen Mann sein wahres Gesicht zeigen zu lassen. Einem Mann, der im Vollrausch ein Gentleman ist, kann man zutrauen, dass er stets ein Gentleman bleibt; und ein Mann, der seinem Freund im Vollrausch erzählt, dass er verliebt ist, tut dies nur, weil ihm diese Tatsache in seinen nüchternen und ruhigeren Augenblicken sehr bewusst ist. Brooke Burgess hatte Hugh Stanbury seit den Austern und dem Cocktail zwei oder drei Mal gesehen, dabei jedoch nicht erneut seine Gefühle für Hughs Schwester erwähnt; trotzdem war er entschlossen, sein Vorhaben zu verwirklichen und Dorothy zu heiraten, sollte sie seinen Antrag annehmen. Aber konnte er sie um ihre Hand bitten, während die alte Dame, was durchaus möglich war, in demselben Haus im Sterben lag? Diese Frage stellte er sich auf seiner Reise nach Exeter, und er sagte sich, er müsse sich in dieser Frage von den Umständen leiten lassen, wie sie sich ergäben. Hugh hatte sich vor der Fahrt nach Exeter am Bahnhof mit ihm getroffen, und sie hatten sich beraten, ob es mit den Regeln des Anstands vereinbar war, ein Gespräch zwischen Hugh und seiner Tante in die Wege zu leiten oder dies jedenfalls zu versuchen. »Tun Sie, was Sie für richtig halten«, hatte Hugh gesagt. »Ich würde mich augenblicklich zu ihr aufmachen, wenn sie zu erkennen gäbe, dass sie mich sehen will.«
Am ersten Abend nach Brookes Eintreffen war diese Frage zwischen ihm und Dorothy erörtert worden. Dorothy fühlte sich außerstande, einen Rat zu erteilen. Wenn eine Mitteilung ihre Tante erreichen solle, werde sie sie an ihre Tante weitergeben; aber sie glaube, dass alles Weitere zu diesem Thema besser von Brooke selbst kommen solle. »Sie sind ganz offensichtlich der Mensch, an dem ihr am meisten liegt, und sie würde Ihnen sogar zuhören, wenn sie niemand anderem ein Wort erlaubt.« Brooke versprach, es sich durch den Kopf gehen zu lassen; und dann begab Dorothy sich nach oben, um Martha abzulösen, und hätte sich niemals träumen lassen, dass die wichtige Persönlichkeit im unteren Stockwerk sich mit Zweifeln in einer weiteren Frage herumschlug. Dorothy hatte den neuen Freund, den sie gewonnen hatte, außerordentlich gern; es war ihr jedoch nie der Gedanke gekommen, er käme als Verehrer infrage. Ihr altes Selbstbild – sie sei es nicht wert, dass ein Mann sie auch nur bemerke, – war nur teilweise ins Wanken geraten, als Mr. Gibson ihr nachweislich den Hof machte. Inzwischen hatte sie von seiner Verlobung mit Camilla French gehört und sah darin den endgültigen Beweis, dass dieser törichte Mensch durch die Aussicht auf das Geld ihrer Tante dazu gebracht worden war, um ihre Hand anzuhalten. Falls es überhaupt eine Sekunde des Hochgefühls gegeben hatte – eine Zeit, in der sie sich den Gedanken erlaubt hatte, sie wäre in der Lage, einen Mann für sich einzunehmen, so wie andere Frauen auch –, dann war es wirklich nur eine Sekunde lang gewesen. Und jetzt war sie überaus glücklich, dass sie nicht den Wünschen eines Menschen nachgegeben hatte, der ganz offensichtlich nicht das Geringste für sie empfunden hatte.
Am zweiten Tag seines Besuchs wurde Brooke um die Mittagszeit ins Zimmer seiner Tante gebeten.
Der Arzt hatte ihr verboten, sich zu unterhalten, und während des Großteils des Tages konnte sie ohne große Anstrengung kaum ein Wort herausbringen; doch es gab hin und wieder eine halbe Stunde, in der sie zu Kräften kam und weder Martha noch Dorothy sie dazu bringen konnten zu schweigen. Als Brooke nun zu ihr ins Zimmer kam, saß sie aufrecht im Bett und hatte einen großen Schal um sich geschlungen; und sofort nahm er wahr, dass sie sehr viel mehr sie selbst war als am Vortag. Sie sagte ihm, es sei eine Torheit gewesen, ihn kommen zu lassen, sie habe ihm nichts Besonderes zu sagen, sie habe keine Veränderung in ihrem Testament vorgenommen, die ihn betraf, – »mit der einen Ausnahme, dass ich etwas für Dolly vorgesehen habe, das aus Ihrem Anteil kommen muss, Brooke.« Brooke beteuerte, für einen so guten, lieben, wunderbaren Menschen könne gar nicht genug getan werden, gleich, aus wessen Anteil es kommen mochte. »Ihnen bedeutet sie ja wohl nichts«, sagte Miss Stanbury.
»Sie bedeutet mir sehr viel«, sagte Brooke.
»Und was?«, fragte Miss Stanbury.
»Oh – eine Freundin, eine gute Freundin.«
»Nun gut. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Aber sie wird nichts erben, das ich nicht selbst angespart habe«, sagte Miss Stanbury. »Es gibt da zwei Häuser in St. Thomas; aber ich habe sie selbst gekauft, Brooke, – aus den Zinserträgen.« Brooke konnte nur anmerken, dass niemand ein Recht habe, Fragen zu stellen, wann oder wie Anteile des Vermögens zustande gekommen seien, da ihr das ganze Vermögen gehöre und sie damit tun könne, was sie wollte, genauso, als ob sie es von ihrem Vater geerbt hätte. »Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt schon sterbe, Brooke«, sagte sie. »Wenn es Gottes Wille ist, dann bin ich bereit. Es geht mir auch alles andere als gut, Brooke. Gott bewahre mich davor, etwas anderes anzunehmen. Ich habe meine Zweifel, ob es mir jemals wieder besser geht. Ich kann ohne Bedauern gehen, wenn Er beschließt, mich zu sich zu nehmen.« Darauf trat er an ihr Bett und legte seine Hand auf ihre, und etwas zögerlich fragte er sie, ob sie ihren Neffen Hugh sehen wolle. »Nein«, sagte sie entschlossen. Brooke fuhr fort und erwähnte, wie gern Hugh sie besucht hätte. »Ich halte nicht viel von Versöhnungen am Totenbett«, sagte die alte Frau grimmig. »Ich habe ihn sehr gern gehabt, aber er mich nicht, und ich wüsste nicht, was wir noch füreinander tun könnten.« Brooke beteuerte, Hugh möge sie sehr gern, aber er konnte sich nicht durchsetzen, und damit war diese Sache erledigt.
Um acht Uhr an diesem Abend kam Dorothy zum Tee nach unten. Sie hatte mittags an demselben Tisch zusammen mit Brooke das Mittagessen eingenommen, aber einer der Dienstboten war die ganze Zeit über im Zimmer gewesen, und daher hatte kein Gespräch zwischen ihnen stattgefunden. Sobald Brooke seinen Tee bekommen hatte, fing er mit der Geschichte über sein Scheitern in Bezug auf Hugh an. Er bedauere, sagte er, dass er das Thema aufgebracht habe, da es Miss Stanbury zu einem Ausbruch von Verbitterung provoziert habe, den er nicht erwartet hatte.
»Sie behauptet immer, er habe sie nicht gemocht«, sagte Dorothy. »Das hat sie x-mal zu mir gesagt.« »Es gibt Leute, die sich vorstellen, dass niemand sie mag«, sagte Brooke.
»Ja, die gibt es, Mr. Burgess; und es ist völlig natürlich.«
»Warum natürlich?«
»Es ist genauso natürlich, wie dass es Hunde und Katzen gibt, die gestreichelt und geliebt und geschätzt werden, und andere, die sich durchschlagen müssen, so gut sie können, und festgebunden und getreten werden und hungern müssen.«
»Das hängt vom Zufall ab, je nach dem, wem sie gehören«, sagte Brooke.
»So ist das auch in dem anderen Fall. Wie viele Menschen es doch gibt, die anscheinend niemandem angehören, – und wenn doch, sind sie nicht gut genug. Sie werden zwar nicht gerade festgebunden oder müssen hungern, aber – «
»Sie wollen sagen, sie bekommen nicht die Zuneigung, die sie brauchen?«
»Vielleicht bekommen sie so viel, wie sie verdienen«, sagte Dorothy.
»Weil sie widerspenstig oder miesepetrig oder unangenehm sind?«
»Nicht unbedingt.«
»Was dann?«, fragte Brooke.
»Weil sie keinerlei Bedeutung haben. Sie bedeuten niemandem etwas Besonderes, und so leben sie weiter, bis zu ihrem Tod. Sie wissen, was ich meine, Mr. Burgess. Ein Mann, der nichts darstellt, kann eventuell Bedeutung erlangen, zumindest kann er es versuchen; eine Frau jedoch hat nicht die Mittel, es zu versuchen. Sie ist ein Nichts, und sie ist dazu verurteilt, ein Nichts zu bleiben. Sie hat ihre Bekleidung und ihre Nahrung, aber sie ist nirgendwo erwünscht. Die Leute tolerieren sie, und das ist wohl das Äußerste, das sie erwarten kann. Bei ihrem Tod würde vielleicht jemand um sie trauern, aber sie würde niemandem fehlen. Sie erwirbt keine Verdienste, und es ist ihr nicht möglich, Gutes zu tun. Sie existiert, und nicht mehr.«
Brooke hatte sie noch nie so reden hören und noch nie erlebt, dass sie sich so ausführlich äußerte oder mit so viel Nachdruck ihre persönliche Meinung formulierte. Und Dorothy selbst bekam, als sie geendet hatte, Angst vor der eigenen Courage, errötete und zeigte sehr deutlich, dass es ihr etwas peinlich war. Brooke fand, sie habe noch nie so hübsch ausgesehen wie zu diesem Zeitpunkt, und freute sich über ihre Begeisterungsfähigkeit. Es war ihm vollkommen klar, dass sie an ihre eigene Lage dachte, obwohl sie keine Ahnung hatte, dass er das von ihr Vorgebrachte so deuten würde; und er hatte das Gefühl, dass es nun erforderlich war, ihren Eindruck zu korrigieren und sie wissen zu lassen, dass sie keine jener Frauen war, die »existieren, und nicht mehr«. »Hin und wieder begegnet man einer solchen Frau«, sagte er.
»Es gibt hunderte«, sagte Dorothy. »Es ist nun einmal so.«
»Zum Beispiel Arabella French«, sagte er und lachte.
»Nun, ja, sie gehört wohl zu ihnen. Es ist sehr leicht, den Unterschied zu sehen. Manche Leute sind nützlich und aktiv. Dann gibt es andere, zumeist Frauen, die nichts zu tun haben, die man aber auch nirgends unterbringt. Es ist traurig.«
»Sie jedenfalls gehören nicht zu ihnen.«
»Ich wollte mich nicht über mich selbst beklagen«, sagte sie. »Ich habe vieles, was mich glücklich macht.«
»Ich nehme nicht an, dass Sie sich als eine Arabella French betrachten«, sagte er.
»Miss French wäre überaus verärgert, wenn sie Sie hören könnte. Sie betrachtet sich als eine der amtierenden Schönheiten von Exeter.«
»Sie hatte eine lange Amtszeit, und eine vorherrschende Stellung in dieser Art von Karriere sollte befristet sein.«
»Das ist gehässig, Mr. Burgess.«
»Ich hasse sie nicht, diese arme Frau. Ich gebe zu, ich kann Camilla nicht leiden. Nicht, dass ich Camilla um ihre neue Errungenschaft beneide.«
»Ich auch nicht, Mr. Burgess.«
»Sie und Mr. Gibson werden sehr gut zueinander passen, meine ich.«
»Ich hoffe es«, sagte Dorothy, »und ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht. Sie kennen sich seit langer Zeit.«
»Seit sehr langer Zeit«, sagte Brooke. Er schwieg eine kurze Zeit lang und dachte darüber nach, wie er ihr am besten sagen könnte, was er bei dieser Gelegenheit unbedingt sagen wollte. Dorothy hatte ihre Mahlzeit beendet und erhob sich, als wollte sie sich auf den Weg zu ihrer Schicht im oberen Stockwerk machen. Sie war kaum eine Stunde im Speisezimmer gewesen, und ihre Pause vom Krankenzimmer war eigentlich noch nicht verstrichen. Aber es hatte sich in ihre Unterhaltung etwas Persönliches eingeschlichen, das sie unbewusst dazu brachte, sich von ihm entfernen zu wollen. Ohne direkt auf sich selbst zu verweisen, hatte sie sich in die Gruppe von alten Jungfern eingeordnet, die geboren werden und leben und sterben – ohne direkte Beteiligung an den Gegebenheiten des Lebens, die eine Frau nur durch familiäre Pflichten erlebt, die Sorge um Kinder oder zumindest einen Ehemann. Wenn sie dies auch nicht mitteilen wollte, so hatte sie es durchaus so empfunden. Er hatte verstanden, was sie dachte, oder zumindest, was sie empfand, und machte es sich zur Aufgabe, ihr zu versichern, sie gehöre nicht zu der Gruppe von Frauen, deren Beschränkungen sie versucht hatte zu beschreiben. Ihr Instinkt, nicht so sehr ihr Verstand, hatte sie sogleich dazu gebracht, auf der Hut zu sein, und sie wollte sich auf den Weg machen. »Sie gehen doch jetzt noch nicht«, sagte er.
»Ich glaube, das sollte ich. Martha hat so viel zu tun, und früh um fünf kommt sie wieder zu mir und löst mich ab.«
»Bitte gehen Sie noch nicht«, sagte er und zog seine Uhr heraus. »Ich weiß über den Zeitplan Bescheid, und es sind noch zwanzig Minuten bis zur richtigen Zeit.«
»Es gibt keine richtige Zeit, Mr. Burgess.«
»Dann können Sie doch einige Minuten länger bleiben. Die Sache ist die, ich möchte Ihnen noch etwas sagen.«
Er stand jetzt zwischen ihr und der Tür, sodass sie nicht von ihm wegkam; doch in diesem Augenblick ahnte sie absolut nichts von seiner Absicht und erwartete von ihm genauso wenig eine Liebeserklärung wie von Sir Peter Mancrudy. Während ihrer langen Rede war sie rot geworden, doch nun war davon nichts mehr übrig, als sie ihm antwortete. »Natürlich kann ich noch bleiben«, sagte sie, »wenn Sie mir etwas zu sagen haben.«
»Nun ja, das habe ich. Ich hätte es schon früher sagen sollen, aber dieser andere Mann war noch da.« Jetzt wurde er rot – bis zum Haaransatz, und er hatte das Gefühl, dass er sich in einer schwierigen Lage befand. Es gibt Männer, die solche Augenblicke in ihrem Leben als angenehm empfinden, doch Brooke Burgess gehörte nicht zu ihnen. Er hätte es gern hinter sich gebracht – sodass er es danach als angenehm hätte empfinden können.
»Welcher Mann?«, fragte Dorothy in ihrer Unschuld.
»Mr. Gibson natürlich. Ich wüsste nicht, dass es noch jemanden gibt.«
»Oh, Mr. Gibson. Er kommt jetzt nicht mehr, und ich glaube nicht, dass er noch einmal auftaucht. Tante Stanbury ist bitterböse auf ihn.«
»Mir ist es gleich, ob er kommt oder nicht. Was ich meine, ist Folgendes: Früher sagte man mir, Sie würden – ihn heiraten.«
»Aber das stimmte nicht.«
»Wie sollte ich das wissen – schließlich haben Sie es mir nicht gesagt. Bei meiner Rückkehr von Dartmoor wusste ich jedenfalls nichts davon.« Er hielt inne, als ob sie vielleicht etwas vorzubringen hätte. Sie hatte nichts vorzubringen und auch keine Ahnung, was auf sie zukommen würde. Sie war derart weit davon entfernt, die Wahrheit zu erahnen, dass sie gelassen und guter Dinge war. »Aber das alles spielt jetzt keine Rolle«, fuhr er fort. »Als ich noch hier war, wollte Miss Stanbury, dass Sie Mr. Gibson heiraten, und natürlich stand es mir nicht zu, dazu etwas zu sagen. Aber jetzt hätte ich gern, dass – Sie mich heiraten.«
»Mr. Burgess!«
»Dorothy, mein Schatz, ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Das ist die Wahrheit.« Nachdem er mit seinen Beteuerungen begonnen hatte, wurde er sogleich immer beredter und versuchte, seine Worte mit Handbewegungen zu unterstreichen. Doch Dorothy war langsam von ihm zurückgewichen, bis sie am Teetisch wieder an ihrem Stuhl ankam, und sie nahm wieder Platz – und war in Sicherheit, wie sie dachte; doch er setzte dicht hinter ihr stehend seine Beteuerungen fort, gab ihr sein Eheversprechen und flehte sie an, ihm zu antworten. Sie hatte ihm noch nicht geantwortet, sondern nur etwas erschreckt seinen Namen ausgerufen. »Sag mir wenigstens, dass du mir glaubst, wenn ich dir versichere, dass ich dich liebe«, sagte er. Das Zimmer drehte sich um Dorothy, die ganze Welt drehte sich um sie, und sie empfand so sehr, dass alles ein einziges Durcheinander war, dass sie in diesem Augenblick alles andere als glücklich war. Wäre es möglich gewesen, dass sich die vergangenen zehn Minuten als Traum herausstellen würden, dann hätte sie sich in diesem Augenblick gewünscht, dass sie geträumt hätte. Sie sah sich mit einem Problem konfrontiert, aus dem es keinen Ausweg zu geben schien. Sich in warmem Wetter ins Wasser zu stürzen ist sehr angenehm, ausgesprochen angenehm. Aber wenn ein Anfänger das erste Mal fühlt, wie er bei seinem Sprung rundum von Wasser umflossen ist, befällt ihn der dringende Wunsch, rasch wieder aufzutauchen. Er wird sich immer daran erinnern, wie erfreulich es war; doch jetzt, in diesem Augenblick, ist ihm nichts wichtiger, als wieder aufs Trockene zu kommen. Für sie war Brooke Burgess eine der Lichtgestalten der Gesellschaft, jemand, für den alles glücklich und bequem verläuft, den jeder sehr mag, der alles haben kann, was er möchte, dessen Geschicke ihn in angenehme Gefilde führen. Für sie war er ein Mann, der vielleicht eines Tages eine Frau zu einer sehr glücklichen Ehefrau machen würde. Die Frau eines solchen Mannes zu sein war nach Dorothys Einschätzung einer der glücklichen Zufälle des Lebens, die einigen wenigen Frauen zustoßen, für sie jedoch ausgeschlossen waren. Sie hatte zwar häufig an ihn gedacht, ihn aber niemals als mögliche Errungenschaft für sich selbst betrachtet; und nun, da er sich ihr antrug, war sie nicht sofort und umstandslos beglückt über seine Liebe zu ihr. Sie verlor jetzt den Boden unter den Füßen, was ihre Vorstellungen über sich selbst und ihr Leben betraf, und sie wollte dringend allein sein, um die Orientierung wiederzuerlangen, in sich zu gehen und zu sehen, ob sie zu sich zurückfinden konnte. »Sag mir, dass du mir glaubst«, wiederholte er.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, flüsterte sie.
»Ich sage dir, was du sagen sollst. Sag einfach, dass du meine Frau wirst.«
»Das kann ich nicht sagen, Mr. Burgess.«
»Warum nicht? Willst du sagen, du kannst mich nicht lieben?«
»Ich glaube, wenn es recht ist, gehe ich hinauf zu Tante Stanbury. Es ist Zeit für mich, wirklich, und sie wird sich Gedanken machen, und Martha wird verärgert sein. Wirklich, ich muss nach oben gehen.«
»Und du willst mir nicht antworten?«
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen mir etwas Bedenkzeit geben. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie es ernst meinen.«
»Verflixt!«, erwiderte Brooke.
»Und ich bin sicher, es würde nie gutgehen. Jedenfalls muss ich jetzt weg. Wirklich.«
Und so entkam sie und ging zum Zimmer ihrer Tante hinauf; sie hatte sich um zehn Minuten verspätet, und Martha war noch nicht verärgert. Sie war übertrieben höflich gegenüber Martha, als ob Martha Unrecht widerfahren wäre, und sie legte ihre Hand auf den Arm ihrer Tante, mit einer weichen, liebevollen, entschuldigenden Berührung, als wäre ihr bewusst, dass sie sich etwas zuschulden hatte kommen lassen. »Was hat er zu dir gesagt?«, fragte ihre Tante, sobald Martha die Tür hinter sich geschlossen hatte. Dies war eine Frage, die Dorothy schlicht nicht beantworten konnte. Miss Stanbury hatte sich nichts dabei gedacht – nichts, das über das Verlangen einer Kranken hinausging, dass ihr erzählt würde, worüber sich die Gesunden unterhielten; aber für Dorothy war diese Frage entscheidend! Wie hätte ihre Tante ahnen können, dass er etwas gesagt hatte? Sie setzte sich und wartete und antwortete nicht. »Ich hoffe, er bekommt etwas Anständiges zu essen«, sagte Miss Stanbury.
»Davon gehe ich aus«, sagte Dorothy und war unendlich erleichtert. Dann fiel ihr ein, wie wichtig Schlaf für ihre Tante war, und sie nahm Jeremy Taylors gesammelte Predigten zur Hand und las wieder aus der zweiten Predigt über die Bedeutung des Eherings vor, voller seelischer Qualen, aber gut hörbar. Sie bemühte sich tapfer, sich ganz auf die Frömmigkeit des Textes zu konzentrieren, sodass er sich vielleicht für sie selbst als nützlich erweisen könnte, und ihre Stimme so klingen zu lassen, dass sie ihrer Tante nützen mochte. Bald vernahm sie, wie ihre Tante dankenswerterweise zur Ruhe gekommen war, doch aus Erfahrung wusste sie, dass das Geräusch wie auch der Schlaf urplötzlich vorüber wären, sollte sie das Vorlesen unterbrechen. Eine ganze Stunde lang setzte sie das Vorlesen fort und trug die Predigt über den Ehering mit der ihr möglichen vollsten Konzentration auf die frommen Grundsätze des lehrreichen Textes vor – und das, obwohl diese schreckliche Bürde auf ihren Gedanken lastete.
»Danke – danke; das genügt, meine Liebe. Hör damit auf«, sagte die Kranke. »Jetzt ist Zeit für meinen Schlaftrunk.« Dorothy ging leise im Zimmer umher und erledigte ihre pflegerischen Aufgaben mit sanfter Hand, mit sanfter Berührung und leisen Schrittes. Danach gab ihre Tante ihr einen Kuss und bat sie, sich hinzusetzen und zu ruhen.
»Ich lese weiter, Tante, wenn Sie es erlauben«, sagte Dorothy. Aber Miss Stanbury, von ihrem Wesen her nicht zu Grausamkeit neigend, wollte nichts mehr hören, und Dorothy konnte ihren Gedanken über den ihr gemachten Antrag nachhängen. Sehr schnell kam sie zu einem Entschluss. Die Krankheitsphase ihrer Tante konnte nicht die geeignete Zeit für ein Ehegelübde oder die Freuden des Turtelns sein. Sie fand nicht, dass er als Mann etwas Falsches getan hatte; aber sie war vollkommen sicher, dass sie als Frau und Nichte einer so lieben Tante und als Pflegerin am Bett einer Kranken eines Verehrers absolut unwürdig wäre, sollte sie sich zu einer solchen Zeit auf Liebesdinge einlassen. Diesen ihren Entschluss empfand sie als sehr trostreich. Er würde ihr als Entschuldigung dafür dienen, dass sie zu dieser Zeit keine definitive Antwort geben konnte, und es ihr ermöglichen, in Muße zu überlegen, welche Antwort sie ihm gäbe, sollte es der Zufall wollen, dass er jemals seinen Antrag erneuerte. Wenn er das nicht täte – und wahrscheinlich war es ausgeschlossen –, dann wäre es umso besser, dass er nicht einer spontanen Aufwallung von Großzügigkeit zum Opfer gefallen war. Sie hatte über die Öde in ihrem Leben geklagt, und diese Klage von ihr hatte sein nobles, freundschaftliches, liebenswürdiges, enthusiastisches Anerbieten bewirkt. Als sie sich all das durch den Kopf gehen ließ – und allmählich bereitete es ihr große Freude –, hielt sie in ihren Gedanken alle möglichen Lobreden auf ihn. Einerseits konnte sie sich nicht überreden zu glauben, er liebe sie wirklich, und andererseits war sie ihm zutiefst dankbar, dass er ihr seine Liebe gestanden hatte. Und was sie anging – könnte sie ihn lieben? Wir als Zuschauer wissen selbstverständlich, dass sie ihn liebte – dass es an ihm vom Scheitel bis zur Sohle nichts gab, das sie nicht zärtlich liebte und ihr nicht Tränen der Rührung in die Augen trieb. Sie betete ihn längst an, obwohl es ihr nicht bewusst war. Sie verglich ihn mit Mr. Gibson und versuchte sich zu überzeugen, das Urteil, das immer sehr deutlich zu Brookes Gunsten ausfiel, sei nun gewiss nicht auf ihre Gefühlslage zurückzuführen. Während ihrer langen nächtlichen Schichten durchströmte sie daher ein Glücksgefühl, ohne dass sie sich darüber bewusst war, dass ihr ganzes Weltbild sich durch die wenigen Worte ihres Verehrers verändert hatte. Sie dachte nun, sie werde in Zukunft genügend Trost darin finden zu wissen, dass ein Mann wie Brooke Burgess sie einmal gebeten hatte, seine Partnerin fürs Leben zu werden, und es sei eigentlich undankbar von ihr, wenn sie die Gelegenheit ausnutzen und versuchen würde, ihn beim Wort zu nehmen. Außerdem gäbe es Hindernisse. Ihre Tante würde eine solche Heirat für ihn nicht gutheißen, und er musste ihrer Tante in einer solchen Angelegenheit gehorchen. Sie wollte sich nicht erlauben anzunehmen, sie könne jemals Brookes Frau werden, aber nichts konnte ihr das kostbare Geschenk nehmen, das er ihr durch diesen Antrag gemacht hatte. Um fünf Uhr kam Martha zu ihr, und sie ging zu Bett und träumte eine Stunde oder auch zwei von Brooke Burgess und ihrem zukünftigen Leben.
Beim Frühstück am anderen Morgen traf sie ihn wieder. Sie ging später hinunter als üblich, erst um zehn Uhr, weil sie sich eine Weile im Zimmer ihrer Tante aufgehalten hatte, in der Hoffnung, ihn dadurch fürs Erste zu meiden. Sie wollte warten, bis er ausgegangen wäre, und dann erst hinuntergehen. Sie wartete, doch sie hörte nicht, dass jemand die Haustür geöffnet hätte, und dann murmelte ihre Tante etwas über das Frühstück für Brooke. Sie solle hinuntergehen, und sie ging hinaus. Doch von der Treppe aus schlich sie sich in ihr eigenes Zimmer zurück und stand dort einige Zeit lang, ziellos, reglos, ohne Ahnung, was sie tun sollte. Dann kam eines der Dienstmädchen und sagte, Mr. Burgess warte mit dem Frühstück auf sie. Es fiel ihr keine Entschuldigung ein, und schließlich ging sie langsam hinunter in den kleinen Salon. Sie war überglücklich, aber sie wäre geflohen, wenn sie es hätte tun können.
»Liebe Dorothy«, sagte er sogleich. »Ich darf dich doch so nennen – ja?«
»Aber ja.«
»Und du wirst mich lieben – und meine liebe Frau werden?«
»Nein, Mr. Burgess.«
»Nein?«
»Ich meine – also – – «
»Liebst du mich, Dorothy?«
»Denken Sie doch nur daran, wie krank Tante Stanbury ist, Mr. Burgess, – womöglich todkrank! Wie kann ich jetzt an etwas anderes denken als an sie? Es wäre doch nicht richtig, oder?«
»Du darfst aber sagen, dass du mich liebst.«
»Mr. Burgess, bitte, bitte sprechen Sie jetzt nicht davon. Sonst muss ich gehen.«
»Aber du liebst mich doch?«
»Bitte, bitte lassen Sie das, Mr. Burgess!«
Den ganzen Tag über brachte er nicht mehr aus ihr heraus. Am Abend teilte er ihr mit, sobald es Miss Stanbury wieder besser gehe, werde er zurückkehren – auf jeden Fall werde er zurückkehren. Sie saß völlig reglos da, als er das sagte, mit ernstem Gesichtsausdruck – aber eigentlich war ihr nach Lächeln zumute, nach Lachen, vor lauter Glückseligkeit! Als sie sich zum Gehen wandte und ihm die Hand geben musste, zog er sie in seine Arme und küsste sie. »Das geht aber nicht, gar nicht«, sagte sie und schluchzte und rannte in ihr Zimmer – und war das glücklichste Mädchen in ganz Exeter. Am nächsten Morgen sollte er sich früh auf den Weg machen, und sie wusste, dass sie ihn nicht sehen musste. An ihn zu denken war so viel schöner, als ihn zu sehen!
KAPITEL LII
MR. OUTHOUSE KLAGT: DAS LEBEN IST HART.
In der Pfarrei von St. Diddulph’s schleppte sich das Leben während des Winters eintönig, mühselig und qualvoll dahin. Im November war ein Brief von Trevelyan an seine Frau eingetroffen, in dem er ihr mitteilte, er könne weder ihr noch ihrem Onkel vertrauen, was die Obhut für sein Kind betreffe, und er werde jemanden mit einem Schreiben an Mr. Outhouse schicken, das die gebotene rechtliche Befugnis enthalte, den Jungen in Obhut zu nehmen, und er verlange, dass der kleine Louis unverzüglich an den Boten übergeben werde. Natürlich war daraufhin Panik im Haus ausgebrochen. Sowohl Mrs. Trevelyan als auch Nora Rowley mussten inzwischen feststellen, dass sie keine willkommenen Gäste in St. Diddulph’s waren, soweit es den Hausherrn anging. Als man die bedrohliche Nachricht Mr. Outhouse zeigte, sagte er kein Wort darüber, ob das Kind übergeben werden solle. Er murmelte zwar etwas vor sich hin über einen aufgeblasenen Unsinn, was zu bedeuten schien, dass die Drohung ohne Folgen bleiben werde; aber es war ihm nicht die Art von Zusicherung zu entlocken, wie es ein festes Versprechen von seiner Seite gewesen wäre, den Kleinen jedem vorzuenthalten, der seinetwegen kommen mochte. Mrs. Outhouse wurde nicht müde, ihrer Nichte zu sagen, dass das Kind keinem Boten, gleichgültig welchem, übergeben werde; doch nicht einmal sie formulierte diese Zusicherung so eindeutig, wie die Mutter es sich gewünscht hätte. »Wenn sie ihn tatsächlich holen, entreißen sie ihn mir mit Gewalt!«, sagte die Mutter und knirschte mit den Zähnen. Ach, wenn doch nur ihr Vater käme! Einige Wochen lang ließ sie den Jungen nicht aus den Augen; doch als sich bis Weihnachten kein Bote gemeldet hatte, glaubten sie allmählich, dass es tatsächlich eine leere Drohung gewesen war – dass es zu dem Wüten eines Wahnsinnigen gehörte.
Doch die Drohung war nicht ganz leer gewesen. Eines frühen Januarmorgens wurde Mr. Outhouse gemeldet, es stehe jemand auf dem Flur und wolle ihn sprechen, und Mrs. Trevelyan, die beim Frühstück saß, während das Kind sich gerade oben befand, sprang auf. Das Hausmädchen beschrieb den Mann als »irgendwie so etwas wie ein Gentleman«, wollte jedoch nicht so weit gehen zu sagen, er sei tatsächlich ein Gentleman. Mr. Outhouse verließ den Frühstückstisch, ging zu dem Mann draußen auf dem Flur, und bat ihn in die kleine Kammer, die ihm jetzt als Arbeitszimmer diente. Es erübrigt sich vermutlich zu sagen, dass es sich bei dem Mann um Bozzle handelte.
»Ich vermute, Mr. Outhouse, dass Sie mich nicht kennen«, sagte Bozzle. Mr. Outhouse konnte anbiederndes Gerede nicht ausstehen und sagte, das treffe eindeutig zu. »Mr. Outhouse, mein Name ist Samuel Bozzle und ich wohne in 55 Stony Walk, Union Street, Borough. Ich war bei der Polizei, aber jetzt bin ich selbstständig.«
»Was wollen Sie von mir, Mr. Bozzle?«
»Es hat weniger mit Ihnen zu tun, Sir, als mit der Dame, die bei Ihnen Unterschlupf gefunden hat; und es geht weniger um die Dame als um ihr Kind.«
»Dann können Sie gehen, Mr. Bozzle«, sagte Mr. Outhouse ungeduldig. »Sie können jetzt sofort gehen.«
»Wenn Sie bitte diese paar Zeilen lesen, Sir«, sagte Mr. Outhouse. »Es ist Mr. Trewillians Handschrift und die Schrift ist ohne Zweifel bekannt – wenigstens Mrs. T., falls Sie mit der Klaue des Gentleman nicht vertraut sind.« Mr. Outhouse blickte eine Minute lang auf das Schreiben und rang um eine Entscheidung, was er in dieser Notlage am besten tun sollte, dann nahm er es und las es. Es lautete: »Ich bevollmächtige Mr. Samuel Bozzle, wohnhaft in 55 Stony Walk, Union Street, Borough, die Herausgabe meines Kindes, Louis Trevelyan, zu verlangen und zu erzwingen; und ich fordere jeden, der dieses Kind derzeit möglicherweise in Obhut hat, sei es meine Frau oder ihr Umkreis, auf, es unverzüglich an Mr. Bozzle zu übergeben, wenn er diese Vollmacht vorlegt. – Louis Trevelyan«. Es sollte vielleicht erläutert werden, dass es zwischen Bozzle und seinem Klienten über dieses Thema einen ausführlichen Briefwechsel gegeben hatte, bevor diese Vollmacht ausgestellt worden war. Gerechterweise muss man dem ehemaligen Polizisten zugestehen, dass er sich zunächst nicht in die Sache um das Kind einmischen wollte. Er hatte eine Ehefrau zu Hause, die sehr deutlich der energisch vorgebrachten Meinung war, der Junge solle bei seiner Mutter belassen werden und er, Bozzle, werde nicht wissen, was er mit dem Kind anfangen solle, sollte es ihm gelingen, es an sich zu nehmen. Überdies war Bozzle sich bewusst, dass es seine Aufgabe war, Tatsachen herauszufinden, nicht Maßnahmen zu ergreifen. Doch sein Klient hatte es sehr dringlich gemacht. Mr. Bideawhile hatte sich rundweg geweigert, in der Angelegenheit tätig zu werden; und Trevelyan, so wütend er auch war, wollte seine Angelegenheiten nur ungern unbedacht in die Hände eines Mr. Skint aus der Stamford Street legen, den Bozzle ihm als Anwalt empfohlen hatte. Trevelyan hatte zudem angedeutet, falls Bozzle die Forderung persönlich geltend mache, könne diese Forderung, falls ihr nicht Folge geleistet würde, als vorbereitender Schritt für weitere Maßnahmen benutzt werden, die er persönlich einleiten werde. Er habe vor, zu diesem Zweck nach England zurückzukehren, er wünsche jedoch, dass die Forderung, das Kind auszuliefern, sofort erhoben werde. Zu diesem Zweck war Bozzle erschienen. Er nahm seine Arbeit ernst und brachte in dieser Angelegenheit ein gewisses Maß an Tatkraft auf. Er liebte es, Macht auszuüben, und war besonders darauf erpicht, Gehorsam von den Menschen zu erzwingen, mit denen er in Kontakt kam, weil er der geheimnisumwitterten Autorität des Gesetzes zum Sieg verhelfen wollte. Insgeheim tippte er unaufhörlich Menschen an und teilte ihnen mit, nach ihnen werde gefahndet. Als er sein Dokument Mr. Outhouse präsentierte, hatte er sich daher vorgenommen, zumindest den Wunsch zu äußern, dass sein Inhalt befolgt würde.
Mr. Outhouse las das Schreiben durch und rümpfte die Nase. »Sie gehen jetzt besser«, sagte er, und drückte es Bozzle wieder in die Hand.
»Selbstverständlich gehe ich, wenn ich das Kind habe.«
»Ach was!«, sagte Mr. Outhouse.
»Was heißt das, Mr. Outhouse? Ich nehme nicht an, Sie wollen bestreiten, dass der Vater vor dem Gesetz die elterliche Gewalt hat?«
»Gehen Sie, Sir«, sagte Mr. Outhouse.
»Gehen!«
»Ja, hinaus – aus diesem Haus. Ich halte Sie für einen Schurken.«
»Einen Schurken, Mr. Outhouse?«
»Ja – einen Schurken. Nur ein Schurke würde dabei mithelfen, ein kleines Kind von seiner Mutter zu trennen. Ich glaube, Sie sind ein Schurke, aber ich glaube nicht, dass Sie so dumm sind anzunehmen, das Kind würde Ihnen übergeben.«
»Ich glaube, dass ‚Schurke’ strafbar ist«, sagte Bozzle – dessen Achtung für den Pfarrer sich indes gerade gewaltig steigerte. »Hätten Sie etwas dagegen, die Glocke zu läuten, Mr. Outhouse, und mich vor der jungen Frau nochmals als Schurken zu bezeichnen?«
»Gehen Sie«, sagte Mr. Outhouse.
»Wenn Sie keine Einwände haben, Sir, würde ich gern die Dame sprechen, bevor ich gehe.«
»Sie werden hier keine Dame sprechen, und wenn Sie nicht mein Haus verlassen, wenn ich es Ihnen sage, dann schicke ich nach einem echten Polizisten.« Bozzle hatte nun eine Niederlage erlitten, und als er ging, gestand er sich ein, gegen seine sämtlichen Lebensgrundsätze verstoßen zu haben, indem er versucht hatte, die Grenzen der Legitimität zu überschreiten. Nur wenn er sich darauf beschränkte, Tatsachen ausfindig zu machen, konnte man ihm nicht mit einem »echten Polizisten« drohen. Immerhin hatte er eine Tatsache erfahren. Der Pfarrer von St. Diddulph’s, der ihm als Schwächling und Dummkopf dargestellt worden war, war alles andere als das. Bozzle war tief beeindruckt von Mr. Outhouse und hätte diesem Gentleman gern einen Gefallen getan, hätte sich eine Gelegenheit ergeben.
»Was will er, Onkel Oliphant?«, fragte Mrs. Trevelyan, die am Fuß der Treppe den Weg zum Kinderzimmer bewachte. Gerade eben hatte sich die Haustür hinter Mr. Bozzle geschlossen.
»Das sollten Sie besser nicht fragen«, sagte Mr. Outhouse.
»Aber es geht um Louis?«
»Ja, seinetwegen war er hier.«
»Und? Onkel Oliphant, Sie müssen es mir einfach sagen. Denken Sie an meine Lage.«
»Er hatte ein albernes Schreiben dabei, von Ihrem Mann, aber es hatte nichts zu bedeuten.«
»Er war also der Bote?«
»Ja, er war der Bote. Aber ich glaube nicht, dass er erwartet hat, etwas zu erreichen. Egal. Gehen Sie wieder hinauf und kümmern Sie sich um das Kind.« Mrs. Trevelyan kehrte zu ihrem Sohn zurück, und Mr. Outhouse ging wieder an seinen Schreibtisch.
Es war sehr belastend für ihn, fand Mr. Outhouse, – wirklich sehr belastend. Man hatte ihm nun mit einer Klage gedroht, und höchstwahrscheinlich würde sie gegen ihn erhoben. Zwar war er in Gegenwart des Gegners recht beherzt gewesen, doch inzwischen hatte er gänzlich den Mut verloren. Er hatte sich zwar eingestanden, dass es seine Pflicht war, die Nichte seiner Frau zu verteidigen, jedoch hatte er die arme Frau nie ins Herz geschlossen und sich in selbstloser Zuneigung für sie verantwortlich gefühlt. Zwar wollte er das Kind nicht an Bozzle ausliefern, doch wünschte er sich dringendst, das Kind wäre aus seinem Haus verschwunden. Zwar hatte er Bozzle als Schurken bezeichnet und Trevelyan als Verrückten, doch er betrachtete Colonel Osborne als den hauptsächlich Schuldigen und war der Ansicht, Emily Trevelyan habe sich falsch verhalten. Fortwährend rief er sich das alte Sprichwort ins Gedächtnis, es gebe keinen Rauch ohne Feuer; und er beklagte das Missgeschick, das ihn in engen Kontakt mit Dingen und Menschen gebracht hatte, die so wenig nach seinem Geschmack waren. Er saß eine Weile da, die Feder in der Hand, an dem elend mickrigen Behelf, den man ihm als Schreibtisch beschafft hatte, und bemühte sich, seine Gedanken zu sammeln und seine Arbeit fortzusetzen. Doch er strengte sich vergeblich an. In seinen Gedanken war Bozzle wieder da, präsentierte das Schreiben und verlangte, dass das Hausmädchen geholt würde, damit sie hören könnte, wie er als Schurke bezeichnet wurde. Außerdem wusste er, dass seine Nichte ihm an diesem Tag Geld zahlen wollte, das er nicht ablehnen konnte. Welchen Nutzen hatte es schon, es jetzt abzulehnen, nachdem man es einmal akzeptiert hatte? Da er kein einziges Wort zu Papier brachte, erhob er sich und suchte seine Frau auf.
»Wenn das noch länger so weitergeht«, sagte er, »lande ich noch in der Irrenanstalt.«
»Mein Lieber, sag doch nicht so etwas!«
»Das ist alles schön und gut. Vermutlich sollte ich sagen, ich wäre beglückt. Ein Polizist war hier, der mich verklagen wird.«
»Ein Polizist!«
»Jemand, den ihr Ehemann geschickt hat, damit er das Kind abholt.«
»Der Junge darf nicht weggegeben werden, Oliphant.«
»Das sagt sich leicht, aber ich denke nun einmal, wir müssen das Gesetz einhalten. Das Pfarrhaus von St. Diddulph’s ist etwas anderes als eine Burg auf dem Apennin. Wenn es dazu kommt, dass ein Polizist geschickt wird, um das Kind irgendeines Mannes abzuholen, und er mir mit einer Klage droht, weil ich ihn aus dem Haus weise, dann ist das sehr belastend für mich, wo ich doch sehr wenig damit zu tun hatte. In der ganzen Gemeinde erzählt man sich, meine Nichte sei hier ohne ihren Mann untergebracht und ein Liebhaber komme sie besuchen. Die Sache mit dem Polizisten wird sich natürlich auch herumsprechen. Ich sage ja nur, es belastet mich, das ist alles.« Die Ehefrau bot alles ihr Mögliche auf, um ihn zu trösten, indem sie ihn daran erinnerte, dass Sir Marmaduke bald heimkehren und ihm die Last von seinen Schultern nehmen werde. Aber sie musste zugeben, dass es eine große Last war.
KAPITEL LIII
HUGH STANBURY KOMMT AUCH OHNE ZAUBERKÜNSTE AUS
Seit Hugh Stanburys Besuch in St. Diddulph’s waren inzwischen viele Wochen vergangen, und Nora Rowley hatte allmählich den Eindruck, dass die Zurückweisung ihres Verehrers so deutlich und entschieden ausgefallen war, dass sie ihn nie wieder sehen oder von ihm hören würde, – und sie hatte sich vor längerer Zeit schon eingestanden, dass ihr ihr Leben keinen Pfifferling mehr wert wäre, sollte sie ihn nicht bald sehen oder von ihm hören. Uns allen ist ein überraschender Anlass zur Freude sehr viel mehr wert, wenn die äußeren Umstände unseres Lebens öde, monoton und trist sind, als wenn unsere Tage angefüllt sind mit Vergnüglichem oder Abwechslung oder auch nur Geschäftigkeit. Für Nora Rowley war das Leben in St. Diddulph’s gegenwärtig ausgesprochen trist. Es gab kaum oder wenig Gesellschaft, die ihre Lebensgeister geweckt hätte. Ihre Schwester war zutiefst betrübt und erkrankte angesichts der Belastung durch ihre Probleme. Mr. Outhouse war missmutig und deprimiert; und Mrs. Outhouse versuchte zwar nach Kräften, ihr Haus für ihre mühsam geduldeten Mitbewohner wohnlich zu machen, konnte es aber nicht so wirken lassen, als wäre sie erfreut über ihre Anwesenheit. Besser als ihre Schwester begriff Nora, wie unangenehm das Arrangement ihrem Onkel war, und sie fühlte sich dementsprechend unbehaglich. Und inmitten dieser leidigen Verhältnisse sah sie sich zwangsläufig als eine junge Frau, die in einer elenden Lage und vom Pech verfolgt war. So geht es uns allen. Wenn der Kummer auf unserem Herzen lastet, mag es noch so stark sein, um die Last tragen zu können, aber es verliert seinen Elan und zweifelt an seinen Fähigkeiten. Es ist dann so wie mit den Sprungfedern einer Kutsche, die durch ein übergroßes Gewicht zusammengepresst werden. Da die Federn aber eigentlich in Ordnung sind, wird das Gewicht problemlos bewältigt, und letztendlich leisten sie noch bessere Dienste für den geforderten Zweck eben aufgrund der Belastung, die ihnen widerfahren ist.
Nora hatte ihrem Verehrer einen Korb gegeben, und mit Ablauf von nunmehr drei Monaten nach ihrer Absage war sie nun recht sicher, dass er auf keinen Fall zurückkäme. In der Tristesse ihres Lebens in St. Diddulph’s hätte die Gewissheit, den Besuch eines Verehrers erwarten zu können, sie sehr aufgemuntert. Je mehr sie an Hugh Stanbury dachte, desto überzeugter war sie, dass er als Verehrer, als Ehemann und als Gefährte in jeder Hinsicht nach ihrem Geschmack wäre. In ihrer Fantasie stattete sie ihn mit einer Vielzahl guter Eigenschaften aus, mit denen die Natur sehr viel sparsamer umgegangen war. Vor ihrem geistigen Auge entwarf sie ein überaus wohlwollendes Bild von ihm, das ihm mehr schmeichelte als alles, was von einem Hofmaler jemals auf Leinwand gebannt worden war. Sie schrieb ihm Eigenschaften zu wie Mannhaftigkeit, Ehrlichkeit, Treue und Elan, und sie betrachtete ihn als einen Paladin – einen Paladin der Gegenwart, nämlich unbezwingbar, erfolgreich, und in jeder Hinsicht für die hohe Stellung geeignet, die er mit Bestimmtheit erringen würde. Sie traute ihm jedoch nicht die Beständigkeit zu, die ihn dazu veranlassen würde, zurückzukehren und nochmals um ihre Hand anzuhalten. Hätte Nora zu dieser Zeit ihr Leben im Westend von London verbracht und drei oder vier Mal in der Woche Gesellschaften besucht, so hätte sie seiner Wiederkehr nicht ganz so sehr entgegengefiebert. Das Gewicht hätte nicht so schwer auf den Sprungfedern gelastet, und es wäre ihr leichter ums Herz gewesen.
Zweifellos hatte sie viele der näheren Umstände seines Besuchs und seines Abschieds vergessen. Unmittelbar nach seinem Aufbruch hatte sie ihrer Schwester mitgeteilt, er werde sicherlich erneut kommen, doch gleichzeitig hatte sie gesagt, sein Kommen werde nichts bewirken. Er war so schrecklich arm; und sie – trotz ihrer noch schlimmeren Armut – war so wenig an ein Leben in Armut gewöhnt, dass sie zu der Erkenntnis gelangt war, sie eigne sich nicht, seine Frau zu werden. Schritt für Schritt hatte sich ihre Haltung verändert, während die Wochen schleppend an ihr vorbeizogen. Sie nahm nun an, er werde nie mehr zurückkommen; aber wenn doch, so würde sie ihm gestehen, dass ihre Ansichten über das Leben sich verändert hatten. »Ich würde ihm ganz offen sagen, ich könnte mit ihm in irgendeiner Londoner Dachkammer hausen und von trockenem Brot leben.« Doch dies sagte sie nur sich selbst – nie ihrer Schwester. Emily und Mrs. Outhouse waren zusammen zu dem Schluss gekommen, es sei das Klügste, auf jegliche Erwähnung von Hugh Stanbury zu verzichten. Nora erkannte, dass ihre Schwester sich absichtlich zurückhielt, und diese Zurückhaltung hatte zu der auf ihr lastenden Verzweiflung zusätzlich beigetragen. Bei seinem Abschied hatte Hugh ihr allerdings nahegelegt zu erwarten, dass er zurückkäme. Damals war sie sich sicher, dass er zurückkäme. Sie war sich darüber sicher gewesen, obwohl sie ihm gesagt hatte, es sei zwecklos. Aber inzwischen ging sie davon aus, dass sie ihn das letzte Mal gesehen und von ihm gehört hatte, – nachdem diese qualvollen Wochen an ihr vorbeigezogen waren, nachdem sie während sich ewig lang hinziehender Stunden ewig langer Tage ununterbrochen an ihn gedacht und sich gesagt hatte, es sei ihr unmöglich, die Frau eines anderen Mannes außer ihm zu werden. Mit Sicherheit waren ihr seine leidenschaftlichen Worte und seine enge Umarmung entfallen.
Dann traf ein Brief an sie ein. In den verschiedenen Haushalten wird mit Briefen an junge Damen sehr unterschiedlich umgegangen. In einigen Familien ist die Post den jungen Damen genauso frei zugänglich wie den verehrten älteren Mitgliedern des Haushalts. In anderen wird es als Selbstverständlichkeit betrachtet, dass mit Erfahrung und Klugheit über den Briefwechsel der Töchter der Familie geurteilt wird. Als Nora Rowley noch mit ihrer Schwester in der Curzon Street wohnte, wäre sie zutiefst entrüstet gewesen, hätte man ihr vermittelt, dass ihre Schwester das Recht hatte, ihre, Noras, Briefe zu inspizieren. Doch nun, in den in St. Diddulph’s herrschenden Verhältnissen, war ihr vollkommen klar, dass kein Brief bei ihr ankam, von dem ihre Tante nicht wusste. All das war ihr verhasst – wie alle Einzelheiten ihres Lebens in St. Diddulph’s –, doch sie konnte nichts dagegen tun. Hätte ihre Tante ihr gesagt, sie dürfe niemals überhaupt irgendeinen Brief erhalten, so hätte sie das ertragen müssen, bis ihre Mutter ihr zu Hilfe gekommen wäre. Der Brief, den sie nun erhielt, wurde ihr von ihrer Schwester überreicht, doch Mrs. Trevelyan hatte ihn von Mrs. Outhouse entgegengenommen. »Nora«, sagte Mrs. Trevelyan, »hier ist ein Brief für dich. Ich glaube, er ist von Mr. Stanbury.«
»Gib ihn mir«, sagte Nora begierig.
»Natürlich gebe ich ihn dir. Aber hoffentlich hast du nicht vor, mit ihm in einen Briefwechsel zu treten.«
»Wenn er mir geschrieben hat, werde ich ihm selbstverständlich antworten«, sagte Nora und umklammerte die Kostbarkeit.
»Tante Mary findet, du solltest das erst tun, wenn Papa und Mama wieder hier sind.«
»Wenn Tante Mary Angst hat, ich würde mich falsch verhalten, soll sie es mir selbst sagen, und ich werde mich bemühen, eine andere Bleibe zu finden.« Die arme Nora wusste, dass diese Drohung nichtig war. Es gab keine andere Bleibe für sie.
»Sie hat überhaupt keine Angst, Nora. Sie sagt nur, ihrer Ansicht nach solltest du nicht an Mr. Stanbury schreiben.« Dann gelang Nora die Flucht in die kalte, aber ungestörte Abgeschiedenheit ihres Schlafzimmers, und dort las sie ihren Brief.
Vielleicht ist dem Leser noch in Erinnerung, dass Hugh Stanbury nach seinem Aufbruch von St. Diddulph’s nicht von den Albträumen eines verzweifelt Liebenden heimgesucht worden war. Er hatte sich Nora gegenüber freimütig geäußert und ging anschließend seiner Meinung nach mit gutem Grund davon aus, dass er nicht vergeblich gesprochen hatte. Er hatte sie umarmt, und sie hatte ihre Zuneigung zu ihm nicht leugnen können. Allerdings war sie fest entschlossen gewesen, ihn nicht zu ermutigen, wenn sie es vermeiden konnte. Sie hatte nichts gesagt, das seinerseits die Annahme gerechtfertigt hätte, sie seien verlobt. Tag für Tag dachte er darüber nach; einerseits sagte er sich, dass er nichts tun konnte, als auf ihre Treue zu hoffen, bis er in der Lage wäre, ihr ein angemessenes Zuhause zu bieten, und andererseits ging ihm durch den Kopf, dass er von einem Mädchen wie Nora Rowley nicht erwarten konnte, auf ihn zu warten, es sei denn, es gelänge ihm, ihr zu vermitteln, dass er auf jeden Fall auf sie warten werde. An dem einen Tag dachte er, dass Vertrauen und angemessene Rücksicht auf Nora von ihm Stillschweigen erforderten; am anderen sagte er sich, eine solche sentimentale, altmodische Höflichkeit, wie er sie sich vorstellte, wäre ein Schuss in den Ofen und werde weder belohnt noch auch nur bemerkt werden. Daher setzte er schließlich hin und schrieb den folgenden Brief:
Lincoln’s Inn Fields, im Januar 186–
Meine liebste Nora,
seit wir uns in St. Diddulph’s gesehen haben, versuche ich mir darüber klar zu werden, was ich in Hinsicht auf dich tun soll. An manchen Tagen glaube ich, dass ich mich zurückhalten sollte, weil ich arm bin. An anderen bin ich mir sicher, dass ich mich äußern sollte, weil ich dich so sehr liebe. Du kannst davon ausgehen, dass Letzteres in diesem Augenblick überwiegt.
Wenn ich schon schreibe, will ich auch mutig sein, so mutig, dass du, wenn ich falsch liege, gründlich empört sein wirst und mich freiwillig nie wieder sehen willst. Aber ich glaube, es ist das Beste, wenn ich ehrlich bin und sage, was ich denke. Ich glaube, dass du mich liebst. Die Tradition verlangt, dass ich schweige, aber ich bin fest davon überzeugt. Seit meinem Besuch in St. Diddulph’s hat diese Überzeugung mich aufrecht erhalten, obwohl es auch Augenblicke des Zweifelns gab. Wenn ich annähme, dass du mich nicht liebst, würde ich dich nicht mehr belästigen. Ein Mann mag in seinem Werben erfolgreich sein, wenn er und das Mädchen nach den gesellschaftlichen Regeln zueinander passen; dies jedoch trifft auf uns nicht zu; und wenn du mich jetzt nicht liebst, dann wirst du es nie tun.
– »Aber ich liebe dich doch!«, sagte Nora und drückte den Brief an ihr Herz. –
Wenn du mich liebst, dann musst du es mir sagen und mir die Freude und das Verantwortungsgefühl gönnen, die eine solche Zusicherung bei mir auslösen.
– »Ich werde es ihm gestehen«, sagte Nora bei sich. »Es ist mir gleichgültig, was sich daraus ergibt, aber ich sage ihm die Wahrheit.« –
Ich weiß – ging es in Hughs Brief weiter –, dass eine Verlobung mit mir zur Zeit tollkühn wäre, weil mein Einkommen gering und unregelmäßig ist; aber es scheint mir, dass man nie etwas unternehmen kann, ohne ein gewisses Risiko einzugehen. Es gibt vielerlei Risiken, ...
– Sie fragte sich, ob er an dieser Stelle an den Fels dachte, an dem die Barke ihrer Schwester zerschellt war. –
… und wir können kaum hoffen, alle zu umschiffen. Ich gebe gern zu, dass das Leben mir persönlich langweilig vorkäme, wenn es keine Schwierigkeiten zu überwinden gäbe.
Wenn du mich liebst und es mir sagst, werde ich dich nicht um deine Hand bitten, bevor ich dir ein angemessenes Zuhause bieten kann; aber das Wissen darum, dass mir eine Kostbarkeit gehört, die mir alles bedeutet, wird mir umso mehr Kraft verleihen und mir das Gefühl geben, dass ich, nachdem ich so viel errungen habe, nicht an dem vielleicht noch Ausstehenden scheitern werde.
Bitte, bitte – schicke mir eine Antwort. Außer durch Briefe kann ich nicht in Kontakt mit dir treten, denn deine Tante hat mir das Haus verboten.
Meine liebste Nora,
bitte glaube mir, dass ich auf immer nur der Deine bin.
Hugh Stanbury
Einen Brief an ihn zu schreiben! Natürlich würde sie ihm einen Brief schreiben. Natürlich würde sie ihm die Wahrheit gestehen. »Er sagt mir, dass ich es ihm schuldig bin, es zu sagen, und diese Schuld erkenne ich an«, sagte sie in ihrem Selbstgespräch. »Was das angemessene Zuhause angeht, so soll er das beurteilen.« Sie beschloss, keine feine Dame zu sein, keine Ansprüche zu stellen, sich nicht zu zieren, sich nicht davor zu fürchten, den ihr zustehenden Anteil an dem Risiko zu tragen, über das er wie ein echter Mann gesprochen hatte. »Er hat vollkommen recht. Er hat es geschafft, dass ich mich in ihn verliebt habe, und daher habe ich kein Recht, ihn auf Abstand zu halten, – selbst wenn ich es wollte.« Als sie bei ihrer Entscheidungsfindung noch im Zimmer auf und ab ging, kam ihre Schwester zu ihr herein.
»Nun, meine Liebe!«, sagte Emily. »Darf ich fragen, was er schreibt?«
Nora schwieg einen Augenblick lang und hielt den Brief fest in der Hand, und dann reichte sie ihn ihrer Schwester. »Hier. Du kannst ihn lesen.« Mrs. Trevelyan nahm den Brief und las ihn gründlich durch, während Nora am Fenster stand und hinaussah. Sie wollte den Gesichtsausdruck ihrer Schwester nicht beobachten, denn sie hatte keine Lust, auf äußere Anzeichen von Missbilligung reagieren zu müssen. »Gib ihn mir zurück«, sagte sie, als sie das Rascheln hörte, mit dem der Brief zusammengefaltet wurde und die Lektüre beendet war.
»Natürlich gebe ich ihn dir zurück, meine Liebe.«
»Ja, danke. Ich wollte es nicht anzweifeln.«
»Und was wirst du tun, Nora?«
»Den Brief beantworten natürlich.«
»Ich würde etwas darüber nachdenken, bevor ich ihn beantworte«, sagte Mrs. Trevelyan.
»Ich habe schon darüber nachgedacht – sehr viel sogar.«
»Und wie wirst du antworten?«