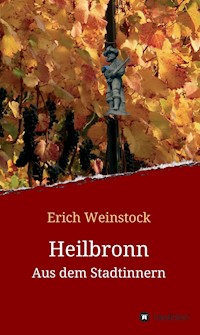
8,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ausgang und Eingang dieses Werkes war die sonst selten gestellte Grundfrage, was denn die Stadt ihrem Ursprung nach sei. Die bona, die zu erfassen sind, sind einzigartig an das Schicksalsband der einstigen Reichsstadt geschmiedet und bekommen von hier aus gewissermaßen ihre universale Bedeutung. Mit historischer Tatsächlichkeit allerdings haben diese bona, hat dieses Band zunächst nichts gemein. Was hier als geschichtliches Vermächtnis auferlegt wird, kommt von innen her. Eben auch aus dem Stadtinnern. Die Wahrheit, die hier ausgiebig bedacht wird, ließ sich nicht anders am Schopf zu fassen, denn durch das Bestehen auf Form. Dem Verlangen nach Form wurde denn Genüge getan; dementsprechend flossen die Inhalte ein. Zwingend war auch, daß zur Bergung des unbedingten „Innenlebens“ der Sache das Sonett als solches bzw. eine Kette von Sonetten nicht ausreichte. Es mußte ein Sonettenkranz sein, mit dem die verschiedenen Ansichten zum Wein bzw. zur Stadt zusammengebunden werden sollten. Nachdem die Gedichte Aus dem Stadtinnern diesen Blättern vorangestellt wurden, folgt eine Reihe kleiner Abhandlungen, die sich weiterhin in die Überlieferungen, die Wirklichkeiten und Unwirklichkeiten des Stadtinnern versenken und auch ein wenig erläuternd in die Gedichte des ersten Teils eingreifen. Die Erscheinung Robert Mayers, wie sie vom zuständigen Sonett aufgegriffen wird, gehört zum Bedenklichen, mindestens zum Nachdenkenswerten, was von der ehemaligen Reichsstadt auf uns herabgekommen ist. Es geht darum, daß wir den Begriff der Kraft und ihrer „Erhaltung“, der für immer untrennbar mit dem Namen des Heilbronner Bürgersmannes verbunden ist, noch einmal an Leib und Seele in Erfahrung bringen, also anders, als es uns von der mathematisch-physikalischen Weltsicht her bekannt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ανηρ περι γε την πατριδα ϕιλοστοργοτατος
„Ein Mann, der wie kein anderer seine Vaterstadt von Herzen liebte.“ Antikes Urteil über Alkaios
Erich Weinstock
HEILBRONN
AUS DEM STADTINNERN
Gedichte und Prosa
Zum 70. Jahrestag der Zerstörung
www.tredition.de
© 2014 Erich Weinstock
Umschlagbild: © Thomas Heim-Rueff
unter Verwendung gemeinfreier Bilder von www.pixabay.com.
http://pixabay.com/de/turm-kilianskirche-heilbronn-139642/
http://pixabay.com/de/wein-weinreben-reben-natur-340891/
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-8984-4 (Paperback)
ISBN: 978-3-8495-8985-1 (Hardcover)
ISBN: 978-3-8495-8986-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
A. ZUR EINFÜHRUNG
I.
DIE DEUTSCHE STADT
II.
HEILBRONN
B. IN VINO VERITAS
Ein Sonettenkranz
I
DAS WASSER
II
DER WEIN
III
ROBERT MAYER
IV
AUS DER GESCHICHTE DER REBE
V
DER WENGERTER
VI
DAS GÄREN UND WÄHREN
VII
DIE AUFKLÄRUNG
VIII
UT VINETA EGOMET CAEDAM MEA…
IX
DER BÜRGER
X
DAS KÄTHCHEN
XI
EIN WENGERTERTOD
XII
DER 4. DEZEMBER
XIII
PATRONE
XIV
VERWANDLUNG
XV
IN VINO VERITAS
C. DREI GESÄNGE
in antikisierenden Metren
I.
REICHSSTADT
II.
GARTENSTADT
III.
WEINSTADT
D. LIEDCHEN
E. PROSATEIL
VOM WEIN UND WENGERTER oder DIE STADT ALS GEISTIGER ORT
ROBERT MAYER DER GRÖßTE SOHN DER STADT
F. SCHLUßBESINNUNG
A. ZUR EINFÜHRUNG
Der Verfasser dieses dichterischen Versuchs mit der Geschichte kam 1948 in Heilbronn zur Welt und war im Erwachen zwangsläufig den Nachkriegszuständen des Stadt- und Bürgerlebens ausgesetzt, ohne daß er zu irgendeinem Zeitpunkt Anstoß an den Tatbeständen genommen oder sich Gedanken über den schwanken Weltstand gemacht hätte. Dem Aufbegehren seiner Generation vermochte er sich nicht anzuschließen, allerdings auch nicht ihrer Wiederanpassung. Als mit der Unbefangenheit der Jugend Schluß war, kehrte er der Stadt den Rücken. Doch als er sich ihr in ernsthafter Not nach Jahren wieder zuwandte, war nicht nur Befangenheit da, die die Verbindung erschwerte, - es waren mit einem Mal und mit unabweisbarem Nachdruck auch Erinnerungen eingekehrt, durch die sich die Geschichte und der Eigenwert der Stadt überraschend vor ihm auslegten. Er gab sich den Anforderungen hin, die ganz und gar aus ihm selber an ihn ergingen und tauchte ein in die wundersamen Eingeweide der Stadt. Wobei er gleichzeitig den fürs heutige Haruspizium so nötigen Abstand einhalten durfte. Material für die Betrachtung war genügend vorhanden, beherrschend war aber von vornherein die sonst selten gestellte Grundfrage, was denn die Stadt ihrem Ursprung nach sei. Ursprüngliches läßt sich nur schöpfen, niemals ermitteln, eine wissenschaftliche Arbeit war also nicht gefordert. Es ging ums Unerwartete und gleichzeitig Unverkennbare. Der Sucher erklärte sich einverstanden und überließ sich der Aufgabe. Nach und nach stellten sich, fast von allein, Idee und Bildgestalt ein und wurden zum Ausgangs- und Anhaltspunkt für die Expedition ins Stadtinnere, deren Ergebnisse auf den folgenden Seiten nachzulesen oder zu verifizieren sind.
Die Wahrheit, die hier so ausgiebig bedacht wird, ließ sich nicht anders am Schopf zu fassen, denn durch das Bestehen auf Form. Dem Verlangen nach Form wurde denn Genüge getan; dementsprechend flossen die Inhalte ein. Auch der Wein ist geistige Form, sonst wäre er ja nicht imstande, die Wahrheit aufzunehmen.
Zu beachten ist, daß während der Arbeit an dieser Schrift das Altertum unablässig seine Mitwirkung anmeldete und der Auffassung entgegenwirkte, es gehöre dem inneren Leben dieser Zeit nicht mehr an. Was die Stadt im Innersten ist, hat seit dem schöpferischen Altertum keine weitreichenden Veränderungen erfahren. Wie doch der einwohnende homo sapiens schon so lange keine inneren Fortschritte mehr gemacht hat! Auch das sei anhand unseres Exempels zeit- oder unzeitgemäß statuiert.
Schließlich muß noch inständig darauf aufmerksam gemacht werden, daß die dichterische Wahrheit sehr viel mit der Veritas im Wein, aber nur sehr wenig mit der wissenschaftlichen Korrektheit und der historischen Faktizität zu tun hat. Jene verkürzt sich umgehend zur Nichtigkeit, wenn nach dem Maß der beiden letzteren gemessen wird.
I. DIE DEUTSCHE STADT
„... am stürzenden Strom, Die Städte ...“
Fr. Hölderlin
Das stetig schwebende Gesicht der Blüte verdankt sich jener anfänglichen Kraft, die wachsen hieß, doch dazu nur den Saft der Morgenstunde in den Dienst bemühte.
Seitdem treibt immerhin in allen Gärten der Frühling aus die volle farb’ge Pracht; und selbst die Rodung einer Winternacht geht über in ein üpp’ges Blütenwerden.
Noch reicht die Stadt nicht hin zum Augenblick, der die besinnungslose Zier verwandelt in das bedeutendere Lebensglück
des echten Frucht- und ernsten Samentragens.
II. HEILBRONN
Für Dr. Walter Cantner
„Tränen sind der Seele herber Wein, Fließend aus des Leids uralter Trotte.“
Karl Wolfskehl, Hiob
Gesichter wandeln sich im Lauf der Zeiten, Antlitze nie.
Es veralten Welten träge oder heben überstürzt an,
aber die innere Welt kennt weder Hingang noch Wiederkehr.
Kein Unwesen schadet je dem, was wesentlich,
ans Unzerstörbare reicht Zerstörung nie.
Doch selten nur ordnet sich Vergängliches dem Ewigen zu, -
das wäre das Heilige.
Wird das Heilige zu Unzeiten versucht,
verkehrt sich’s ins Unheilige oder Heillose;
ins Begreifen übertragen,
kann’s nicht mehr versucht werden.
Im Zustand markloser Knochentrockenheit
bin ich durch den Schutt hindurch
in die Brunnentiefe hinabgestiegen:
Das Heil liegt ewig dort;
gelabt hat es mich nicht,
wohl aber Unheil die Fülle gebracht.
Nie hat der Brunnen den Durst gestillt,
sondern hier wurde das Naß aus mir selber herausgetrieben,
daß ich die Schatten kaum noch sah.
Von Tränen verführt grub ich in einem fort,
erbeutete indes selten mehr als Scherben, Trester und Unrat,
Zeugnisse des veränderlichen Todeslebens.
Sunt lacrimae rerum, ich mag die Dinge betasten, wo ich will.
Wenig Antlitz hat noch die Welt, wenngleich viele Gesichter;
aus Wiederholungen nur besteht die Vergänglichkeit,
nicht aus Einzigkeiten,
die allerdings des Kosmos Schmuck wären.
Und das wenige Einzige ihrer Welt fassen sie jetzt
in trostlosen Vereinheitlichungen zusammen,
häufen so immer mehr Kehricht und Blut auf die Seele.
Drunten aber laufen die Brunnen leer oder ins All ab.
Dabei sind unsere Tränen immer noch
ein ununterbrochenes Rinnsal des Heiligen,
das einst Welten und Städte bewässerte
und dem Wein Wahrheit zumaß,
uns aber den Wunsch benetzt,
daß im Trinken vielleicht wiedererwache
der Sinn des Einzigen
und sich verzehre das öde Schäumen der Zeit.
B. IN VINO VERITAS Ein Sonettenkranz
οινος γαρ ανϑρωπος διοπτρον.
„Ein Spiegel ist der Wein den Menschen.“
Alkaios
„Noch bleibst du im Glase; Bald in mir mächtig winkst du dem Geist Mit purpurnem Flügel, Als kennt’ ich dich langher.“
Max Kommerell
I. DAS WASSER
„... und es ward ihm der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben...“
Offenbarung 9,1
Die Wahrheit ist von Anfang an vorhanden:
Ein Quellgrund hält von Ewigkeiten her
den Sinn: der sucht die Weite, fließt ins Meer,
um Wolk’ zu werden oder neu zu stranden.
Was einst die Schöpfer als DIE STADT empfanden -
da drunten ward’s gezeugt und vielzusehr
geliebt. Nur fiel alsbald die Liebe schwer,
denn jeder Born hat einmal zu versanden.
Drauf wurden alle ursprünglichen Größen
- die sagenhaften Schöpfer, Ahnenreihen -
in ihrer Kraft und Wirklichkeit verkehrt.
Heut’ muß der Mut den Sinn nochmal erlösen
und dessen Bündelung zur Welt sich weihen ..., -
wenn auch der Mensch dies selten so erfährt.
II. DER WEIN
οινος, ω φιλε παι, και αλαθεα.
„Der Wein, mein Lieber, bedeutet denn auch Wahrheit.“
Alkaios
Wenn auch der Mensch dies selten so erfährt -
er hat zu seinem Ursprung rückzuwallen
und von den Sachlichkeiten abzufallen,
die ihm der Hang der Zeit zunächst gewährt.
Im Wein ist Wiederkunft. Schier unversehrt
beherbergt seines Sinnes stilles Schallen,
was unversehrbar angehört uns allen
und alle haben dennoch stets entbehrt.
Der Trinkende nimmt aus dem Kelch entgegen
Vergangenheit, Vergehen und die Kehre:
Der Wahrheit Eigenmacht wird ihn erregen,
daß er in sich das Eigentum vermehre,
nachdem der Geistbesitz ihm ward verheert,
weil die Erscheinung ihn zuerst belehrt’.
III. ROBERT MAYER
„Denn Gesetze existieren eben so wenig in den Erscheinungen, sondern nur relativ auf das Subjekt, dem die Erscheinungen inhärieren, so fern es Verstand hat, als Erscheinungen nicht an sich existieren, sondern nur relativ auf dasselbe Wesen, so fern es Sinne hat.“
Immanuel Kant
Weil die Erscheinung ihn zuerst belehrt’,
hat er sich unverseh’ns in sie verrannt,
hat von ihr Einheit und Gesetz begehrt,
damit ihm greifbar blieb der Gegenstand
der Wissenschaft: die Energie. Verkehrt
war’s doch, weil Sinnlichkeit den Sinn verbannt
und der Versuch das Phänomen entehrt...,
dies bracht’ den werten Mann um den Verstand.
Zum Teil gehorcht die Wirklichkeit der Zahl,
jedoch die Fügung wird von Mal zu Mal
der kalten Künstlichkeit des Zwanges gleichen
und muß daher der freien Schenkung weichen
des Sinns. Er soll aus unsern Seelen branden!
Die Welt indes ist wandelbar entstanden...
IV. AUS DER GESCHICHTE DER REBE
„... quia vitis ianua vitae.“ „...weil die Rebe eine Pforte zum Leben ist.“
Primas Hugo Aurelianensis
Die Welt ist gründlich wandelbar entstanden:
So war die Überführung dieses Reises
ins transmontane Reich des Erdenkreises
zielsich’res Werk von kosmischen Gesandten!
Jetzt war zu rechnen einmal mit den Banden
des großen Sternenlaufs und des Geheißes,
die Frucht zu haben als den Preis des Fleißes;
und weil die Boten auch das Licht entwanden
und ewig an den Rebenkultus schnürten,
gehört zum anderen der Durst nach Geist
zum ständigen Geleit des eingeführten
Gewächses in den Tälern hierzulanden,
wo es auch weiterhin zuallermeist
ein Rätsel bleibt, wie Hände Reben fanden.
V. DER WENGERTER
„Habitabat unusquisque sub Vite sua...“ 1. Könige 5,5
Ein Rätsel bleibt, wie Hände Reben fanden,
doch plötzlich gab’s ein Wohnen unterm Stock,
ein Plätzchen für den Kittel, für den Rock
und Hoffnung, daß die Herlinge entschwanden!
Da ja der Schößling gerne ging zuschanden
an Widrigkeiten längs der Berge Block,
war seine Lehnung an den deutschen Pflock
bestimmt von Härten, Schärfen, Krümmen, Kanten.
Die brach denn unnachgiebig übers Knie
das beinah bürgerliche, nie vermengte
Geschlecht, das, karg gewachsen, unverklärt,
dem strengen Leben seine Sorge lieh
und Lieblichkeiten aus dem Haus verdrängte,
auf daß zu reinem Wein die Wahrheit werd’.
VI. DAS GÄREN UND WÄHREN
„pinguiaque impressis despumant musta racemis.” ”Sind die Trauben gekeltert, dann verbrausen die unreinen Moste.“
Manilius
Auf daß zu reinem Wein die Wahrheit werd’
(und daß aufs neu’ der Sinn die Sinne nährt,
ist dieser Vorgang deutlich zu benennen!),
muß jeder Most entschieden aberkennen
der altgewohnten Fesseln Druck und Brennen,
bis sich der Eifer und die Hefe trennen,
die Süße sich zu Geistigkeit verzehrt
und das Gebilde eines Weins sich klärt.
Nun hat der Mensch ein Bleibendes am Ort.
Es einverleibend sich, baut er am Hort
der Wahrheit... Der verwandelt sich dann wieder
hinein in die erstarrten Leibesglieder.
Nichts lechzt nach Geist, den münd’ger Wein beschert,
wie sie, vom Brot der Mühsal ganz beschwert.
VII. DIE AUFKLÄRUNG
„tristis item vetulae vitis sator atque vietae temporis incusat momen saeclumque fatigat... nec tenet omnia paulatim tabescere et ire ad scopulum spatio aetatis defessa vetusto.“
„So klagt der Pflanzer der ältlichen und welken Rebe, betrübt, über den Charakter der Zeit und hadert mit seinem Jahrhundert... und er hat nicht bemerkt, daß sich allmählich alles zersetzt und vergeht, abgetragen vom langen Weltlauf.“
Lukrez
Wie sie, vom Brot der Mühsal ganz beschwert,
die Gläub’gen, lange ihre Tätigkeiten
bezogen auf ein hegendes Begleiten
des Jahreskreises der Natur, da fährt
den Menschen jäh das Wissen in den Herd.
Nachdem sie dieses ihrem Tag einreihten,
geschah es, daß sie ihren Tag entweihten.
Des Wissens bändigendes Walten währt
geraume Zeit. Jedoch die Zeiten bogen
die Nacht herbei: An den Verstand verloren,
hat man des Glaubens Welt nicht mehr verstanden;
das hat den Bürger nach und nach betrogen
ums Glück der Alten, die, dem Sinn verschworen,
zuguterletzt die Schwere überwanden.
VIII. UT VINETA EGOMET CAEDAM MEA...
(„Um den Karst einmal an den eigenen Wengert zu legen...“)
Zuguterletzt die Schwere überwanden
die Sänger, die gelobten Leidenserben
des Weingotts, da sie jegliches Verderben
und Weh in sich ertrugen und entbanden.
Worauf die Schicksalslose einst bestanden,
das war in Seelentafeln einzukerben;
das auferlegte Streben oder Sterben -
die Dichter waren’s, die es vorempfanden.
Auch heute folgen sie dem dunkeln Brauch:
Sie steigen darbend aus urbanem Bauch,
erziehen ihre Rank’ an fernen Stätten,
kehr’n haltlos wieder, seufzen in Sonetten:
„Selbst wenn uns mal gelingt ein schöner Schimmer -
der Wein ist ewig wahr - wir sind’s nicht immer!“
IX. DER BÜRGER
„Cognitor est urbis.“„Wahrheitszeuge der Stadt ist er.“
Manilius
Der Wein ist ewig wahr - wir sind’s nicht immer,
wir scheinen’s manchmal, doch wir suchen’s stetig.
Auf einmal blühte, für ein Wahres tätig,
der Bürger. Er, in der Erahnung schlimmer
Gewalten, festigte des Forums Zimmer.
Was er in bitt’rer Pflicht erwarb, fiel gnädig
ans allgemeine Wohl. Sprach er sich ledig
von seinen Ketten, ward sein Grimm noch grimmer.
Es fordert die Besorgung des zivilen Lebens
den einverleibten, nie erlernten Halt
in einer Ordnung brüderlichen Gebens.
Einmal erlischt’s, dann wird’s im Städtchen kalt:
ach, nur nach Art des Flackerns und Verschwebens,
zuweilen, teilen wir die Wahrgestalt!
X. DAS KÄTHCHEN
„Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne aneinander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt.“
J.W Goethe, Die Wahlverwandtschaften
Zuweilen teilen wir die Wahrgestalt
des nächsten Weltgeschickes: Keine reicht
geheimer in den Anfang, keine gleicht
der künftigen Natur an Sinngehalt
genauer als dies Gleichnis! Drängend wallt
das Mädchen zu dem Manne - und erbleicht...
Wenn nur dem Pol der Gegenpol nicht weicht
und nicht verborgen sich der Unmut ballt!
Es taumelt heut’ die Zweisamkeit ins Trübe,





























