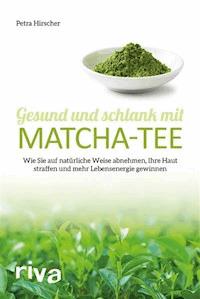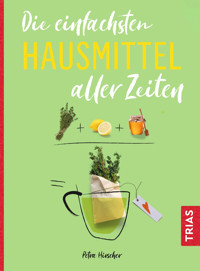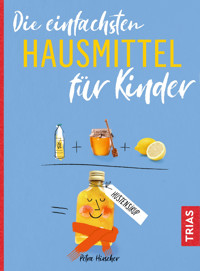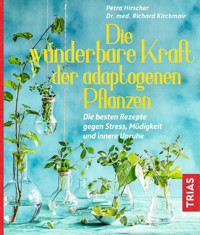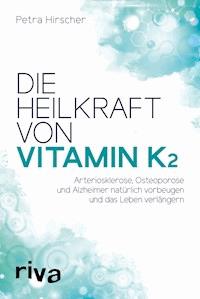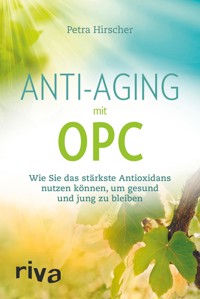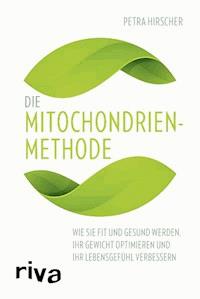2,99 €
Mehr erfahren.
Dimethylsulfoxid (DMSO) ist eine natürliche organische Schwefelverbindung, die in unserem Blut, im Plankton der Meere, in den Wurzeln und der Rinde von Pflanzen vorkommt. DMSO wirkt direkt in den Zellen des Körpers, denn es hat eine herausragende Eigenschaft: Es ist sowohl fett- als auch wasserlöslich und eignet sich daher hervorragend als Trägersubstanz für Arzneimittel, da es Körperbarrieren wie die Haut und Zellwände mühelos durchdringt. Es transportiert Arzneimittel schnell und direkt in die Körperzellen. DMSO kann bei Erkrankungen der Haut, bei Entzündungen und in der Schmerztherapie gezielt eingesetzt werden. Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften als Antioxidans schützt es vor freien Radikalen, stärkt die Zellen und macht sie widerstandfähiger gegen schädliche Umwelteinflüsse. Dieses Buch erklärt verständlich die Anwendung von DMSO als Hausmittel und bei der medikamentösen Behandlung von Krankheiten. Es gibt praktische Anleitungen zur wirksamen Dosierung, zur Kombination mit anderen Heilmitteln und zu Darreichungsformen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Wichtige Hinweise
Sämtliche Inhalte dieses Buchs wurden – auf Basis von Quellen, die die Autorin und der Verlag für vertrauenswürdig erachten – nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und sorgfältig geprüft. Trotzdem stellt dieses Buch keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und die Autorin haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Für Fragen und Anregungen
[email protected]
Originalausgabe
3. Auflage 2021
© 2017 by Pearl Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Dr. Manuela Kahle
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt
Umschlagabbildung: d1sk/Shutterstock.com
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-95760-009-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95759-015-2
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95759-014-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.pearl-verlag.de
Inhalt
Vorwort
DMSO – eine Substanz mit Geschichte
Der Weg zum Dimethylsulfoxid
Hamster und Eiskristalle: DMSO in der Kälteforschung
Dr. Jacobs Heureka-Moment und seine Folgen
Die natürliche Herkunft von DMSO
Ein »neues« Therapieprinzip
Der Penetrationsverstärker
Anwendungen von DMSO
DMSO als Hausmittel
Vorbereitung: Verflüssigen, verdünnen, aufbewahren
Verwendung Schritt 1: Mischen und testen
Verwendung Schritt 2: Richtig auftragen
Verwendung Schritt 3: Therapeutisch anwenden und dosieren
Verwendung Schritt 4: Beobachten, kontrollieren, vermeiden
Mögliche Neben- und Wechselwirkungen
Impulse für die Heilung
Linderung von Symptomen
Schützende Qualitäten
Radikalfang durch antioxidative Kraft
Effektives Schmerzmanagement
Hemmung von Entzündungen
Schlussgedanke
Vorwort
Die Geschichte des Dimethylsulfoxids (DMSO) ist lang und spannend, aber auch verworren. Immer wieder verschwindet es aus der Fachliteratur – in der Regel ähnlich schnell, wie es dort wieder auftaucht. Und der Einsatz wird kontrovers diskutiert.
Tatsächlich ist DMSO eine einfache organische Schwefelverbindung, die in der Natur und in unserem Blut vorkommt. Ursprünglich war diese erstaunliche Flüssigkeit ein Abfallprodukt aus der Holzverarbeitung, das faszinierenderweise bereits bei knapp 19 Grad Celsius gefriert und bei 189 Grad Celsius siedet. Als kosteneffizientes Lösungsmittel schätzt man DMSO in der Industrie und nutzt es zum Beispiel zum Entfernen hartnäckiger Rückstände von Wachsen, Ölen, Polyharnstoff und Polyurethan.
DMSO wird auch in der Medizin genutzt. Es hat den Vorteil, dass es leicht in die Haut dringt, schnell absorbiert wird und Wirkstoffe – so zum Beispiel Heparin – in den Körper transportieren kann. Zu den wichtigsten therapeutischen Funktionen von DMSO gehören seine antioxidativen Eigenschaften als potenter Radikalfänger hochreaktiver Moleküle, die unter anderem vorzeitiges Altern und das Auftreten von Krankheiten begünstigen. Aber auch bei der Beseitigung von Schmerzzuständen und Hemmung von Entzündungen entfaltet DMSO seine Wirkung. Als zurzeit gängigstes Kryoprotektivum (als Mittel zum Schutz vor Gefrieren) schützt es darüber hinaus biologisches Material: So behalten zum Beispiel Eizellen, die durch Einfrieren konserviert werden, dank DMSO ihre Lebens- und Funktionsfähigkeit.
Doch sehr oft im Leben kann ein Vorteil zum Nachteil werden – so auch bei DMSO. Denn DMSO befördert nicht nur erwünschte Wirkstoffe durch die Haut, sondern auch Giftstoffe: »Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei«1, schrieb Paracelsus, der berühmte Arzt von Hohenheim, in seinen Defensiones vor fast 480 Jahren. Eine Überdosis eigentlich erwünschter Wirkstoffe oder auch Gifte können somit via DMSO in den Körper gelangen. Und so sollten wir immer auch Respekt und Vorsicht beim Einsatz von DMSO walten lassen.
Entdecken Sie auf den folgenden Seiten das faszinierende DMSO, um ihm vielleicht als Mittel der Wahl beim Arzt, beim Heilpraktiker oder in der Eigenbehandlung wieder zu begegnen.
DMSO – eine Substanz mit Geschichte
Es war Sonntag, der 23. März 1980, und etwa 70 Millionen Zuschauer saßen in den USA vor ihren Fernsehapparaten. In der Woche danach legten etwa 100 000 Anrufe die Telefone der Universität von Oregon lahm.2 Was hatte einen derartigen Hype ausgelöst? Auf CBS News im populären US-amerikanischen Nachrichtenmagazin »60 Minutes« wurde ein Beitrag mit dem Titel »Das Rätsel DMSO« ausgestrahlt. Das für seinen investigativen Journalismus bekannte Magazin zeigte anhand von Erfahrungsberichten von Patienten die sensationellen Heilerfolge durch das Mittel DMSO. Als Gast hatte Moderator Mike Wallace den Arzt Prof. Dr. Stanley W. Jacob zu sich ins Studio geladen. Dr. Jacob, der zu dieser Zeit als Professor für Chirurgie an der medizinischen Fakultät der Universität von Oregon lehrte, stellte sich dessen Fragen. Mike Wallace wollte wissen, wie es denn möglich sei, dass eine Arznei derartig vielseitige Verwendungen fände: bei Arthritis oder Tennisarm, von Verbrennungen bis zu Rückenmarksverletzungen, bei geistiger Behinderung oder Glatzenbildung. Und er wollte wissen, ob ein solches Mittel nicht automatisch unter Verdacht gerate, ein Schwindel zu sein. »Keine Frage, natürlich«, lautete die prompte Antwort des Professors. Er gehe davon aus, dass genau diese Vielseitigkeit einer der Gründe sei, weshalb DMSO ein Problem habe, und zog sein desillusioniertes Fazit: Müsste er ganz von vorne beginnen, würde er nicht noch einmal denselben Fehler machen – den Fehler, diese Vielseitigkeit offen zu kommunizieren. Dr. Jacob vermutete, hätte er DMSO so beschrieben, dass es bei einem verstauchten Fuß helfen könne, aber nur, wenn sich die Verstauchung links befände, wäre DMSO problemlos zugelassen worden und heute offiziell anerkannt.3
Was war geschehen?
Der Weg zum Dimethylsulfoxid
Drei Forscher sind die Schlüsselfiguren in der Geschichte von DMSO:4 der Schwede Jöns Jakob Berzelius, der als Vater der modernen Chemie gilt, der Franzose Henri Victor Regnault, Professor für Physik am Collège de France in Paris, sowie der Russe Alexander Michailowitsch Saytzeff, der spätere Präsident der Russischen Physikalisch-Chemischen Gesellschaft.
Jöns Jakob Berzelius (1779–1848) war einer der bedeutendsten Naturforscher seiner Zeit und Professor für Chemie und Pharmazie am Karolinischen Medico-Chirurgischen Institut in Stockholm. Er verfasste ein Lehrbuch der Chemie, das in viele Sprachen übersetzt wurde und großen Einfluss auf die Entwicklung der Chemie im 19. Jahrhundert hatte. Darin beschrieb Berzelius 1839 erstmals die Verbindung Schwefelmethyl, einen der Bestandteile des späteren »Dimethylis sulfoxidum«: »Schwefelmethyl entsteht durch Destillation von schwefelsaurem Methyloxyd mit Schwefelkalium oder Schwefelcalcium. Es ist ein ölartiges, knoblauchartig stinkendes Liquidum, dessen Geruch an Allem, was es berührt, stark haftete. Es ist schwerer als Wasser, aber weiter nicht untersucht.«5
Henri Victor Regnault (1810–1878) stellte Schwefelmethyl 1840 in der Formel H3C.S.CH3. dar und beschrieb im Pharmazeutischen Central Blatt die Verbindung als Synonym für Schwefelwasserstoff-Holzäther, er erwähnt dabei, dass »sie sehr beweglich, von äusserst unangenehmen Geruch sei.«6 In seinem Lehrbuch Schule der Chemie widmete der vielfach geehrte Forscher, dessen Nachname in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Beiträge heute noch auf den Friesen der Südostseite des Eiffelturms zu finden ist, der Beschreibung des Schwefels rund drei Seiten. »Der Schwefel ist ein häufig in der Natur vorkommender Körper; man findet ihn bald in freiem Zustand, bald in Verbindung mit einer großen Zahl verschiedener Metalle. Der freie Schwefel begegnet uns bisweilen ganz rein und in vollkommen regelmäßigen Krystallen; häufiger jedoch ist er mit erdigen Substanzen innig vermengt.«7
Aus Schwefelmethyl und Salpetersäure synthetisierte schließlich 1866 der als Experimentator geschätzte Alexander Michailowitsch Saytzeff (1841–1910) das Dimethylsulfoxid. Saytzeff lehrte ab 1871 als Chemieprofessor an der Universität Kasan in der russischen Republik Tatarstan und wurde ein Pionier der Organoschwefel- und Organozinkverbindungen, und er galt als Entdecker der Sulfoxide und Sulfoniumsalze: Als Student gelang ihm 1860 die erstmalige Synthese und Charakterisierung eines Sulfoxids.8 Diesen spannenden Prozess beschreibt er in seinem Aufsatz Ueber die Einwirkung von Salpetersäure auf Schwefelmethyl und Schwefeläthyl:
»Lässt man Schwefelmethyl zu concentrierter Salpetersäure fließen, so erfolgt, unter reichlicher Entwicklung rother Dämpfe, eine äußerst heftige Reaktion. (…) Das Schwefelmethyl löst sich dabei in der Salpetersäure zu einer homogenen Flüssigkeit auf. Diese stark salpetersaure Flüssigkeit wird so lange auf dem Wasserbade eingedampft, bis sie beim Abkühlen zu einer krystallinischen Masse erstarrt. (…) Sie löst sich sehr leicht im Wasser. (…) Die Substanz schmilzt schon beim Erhitzen auf dem Wasserbade. (…) Das Dimethylschwefeloxid (…) ist eine farb- und geruchlose dicke Flüssigkeit (…).«9
Saytzeff konnte nicht ahnen, wie kontrovers die von ihm synthetisierte organische Schwefelverbindung in ihrer medizinischen Geschichte diskutiert werden würde. Sein Aufsatz in der von Justus von Liebig (1803–1873) und Emanuel Merck (1794–1855) herausgegebenen Fachzeitschrift blieb für die nächsten Jahrzehnte der einzige wissenschaftliche Aufsatz über DMSO.
Tatsächlich versank DMSO in einem fast hundert Jahre dauernden Dornröschenschlaf, denn während der folgenden knapp 90 Jahre fand sich keine Verwendung für Saytzeffs Entdeckung. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten Chemiker erneut reges Interesse an der Substanz. Nun begannen die Jahre des wirtschaftlichen Neuaufbaus. Verbesserte, umweltfreundliche Lösungsmittel wurden gebraucht, und die Beachtung von Abfallprodukten, die – wie DMSO – von Bäumen stammten, wuchs. 1948 erschienen in der Fachliteratur einige wissenschaftliche Publikationen, die DMSO als ausgezeichnetes handelsübliches Lösungsmittel beschrieben, das als Entfettungsmittel, Farbverdünner und Frostschutzmittel einsetzbar war. Und 1959 zeigte eine Gruppe englischer Wissenschaftler, dass das Lösungsmittel rote Blutzellen und organisches Gewebe vor Gefrierkälte schützen konnte.10