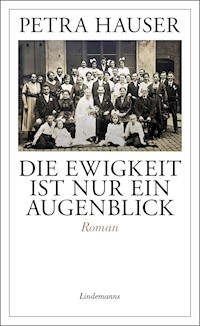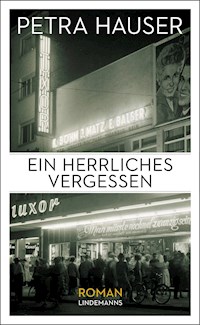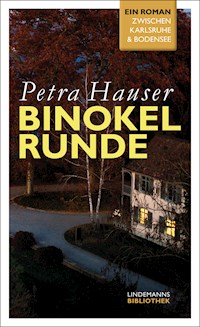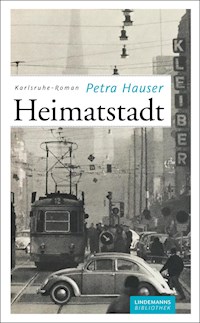
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lindemanns Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Annemarie kommt nach 40 Jahren zurück nach Karlsruhe. Eigentlich will sie nur das Haus, in dem sie aufgewachsen ist und das ihr immer noch gehört, zum Verkauf vorbereiten. Beim Aufräumen beginnt sie, sich an die 60er und 70er Jahre zu erinnern, die Zeit, in der sie hier erwachsen wurde. Dabei nähert sie sich dem schmerzlichsten Punkt ihrer Biografie, den sie bisher versucht hat, zu verdrängen und zu vergessen.Einstige Schulkameradinnen begleiten Annemarie auf ihren Streifzügen durch das Karlsruhe von heute. Sie betrachten den Wandel der Stadt und erinnern sich an die Aufbruchstimmung ihrer Jugendzeit. Dabei wird auch jenes Ereignis, welches damals zu Annemaries fluchtartiger Abreise führte, umkreist und nach und nach enthüllt sich dabei auch ihr persönliches Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Ehemann und
für meine drei Töchter
Petra Hauserwurde 1950 in Karlsruhe geboren. Sie studierte Germansistik und Anglistik in Heidelberg und war über 30 Jahre lang als Lehrerin vor allem in der Erwachsenenbildung tätig. Ihren ersten Roman „Das Glück ist aus Glas“ veröffentlichte sie 2009 (6. Auflage 2015). Es folgte die Novelle „Falsche Wimpern“ (2011), der Roman „Die Tage vor uns“ (2012) sowie der Krimi „Binokelrunde“ (2014).
Petra Hauser
Heimatstadt
Roman
Jeder Zustand ist nur auf Zeit
und der Wandel das einzig Verlässliche.
1
Karlsruhe. Es sollte ein kurzer Aufenthalt werden. Das ist nicht meine „Heimatstadt“, es ist nur die Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Ich habe länger anderswo gelebt als hier.
Damals vor vielen Jahren stieß mich diese Stadt von sich. So jedenfalls, mit dieser Formulierung habe ich meine Zeit hier ad acta gelegt. Trotzdem war mir immer klar, dass es hier ja immer noch das Haus gab. Das Haus meiner Familie. Mein Haus.
Nun bin ich in einem Alter, in dem man beginnt, aufzuräumen in seinem Leben. Deshalb bin ich zurückgekommen. Ich wollte nur so lange bleiben, bis das Haus geleert und verkauft ist. Wie es beim Aufräumen oft geht, ich bin unversehens darin stecken geblieben. So entschloss ich mich also, zunächst einmal auf unbestimmte Zeit hier zu bleiben, in dieser Wohnung unterm Dach, in diesem Haus, in dieser Stadt, wo ich meinen Ursprung habe.
Wann immer ich über den Begriff Heimat nachdachte, beneidete ich diejenigen, die eine hatten. Ich erinnerte mich an die Schilderungen von Hermann Hesse, der den nördlichen Schwarzwald pries, das Geplätscher der Nagold zwischen Weidesträuchern und Wiesenschaumkraut, die blühenden Obstbäume, Sommergewitter, die Schneeschmelze im Frühling.
Heimat, das ist ein unverwechselbarer Geruch, der alle Blumendüfte, jedes einzelne Aroma von überallher, aus den Blüten, von den Blättern, aus der Erde, dem Wasser aufnimmt und sich wie ein Umhang um dich legt, Geräusche, die man blind versteht, ein Orchester von vielen Stimmen, Käferpanzer, die über Erdkrümel kratzen, und Eulen, die nachts rufen, Bilder von Himmel mit Sternen, so weit das Auge reicht, von Bäumen, die sich der Jahreszeit gemäß verwandeln von hellgrün über graugrün bis hin zu den Rostgoldtönen des Herbstes. Verlässliche Kulisse für das, was wir tun und erleben, was uns verändert. Kann also Heimat nicht nur in einer naturnahen Umgebung sein? Auf dem Land, außerhalb der verwechselbaren Häuserschluchten oder auch der Stadtrand-typischen Mehrfamilienhäuser mit ihren Vorgärten und Gartenzäunen, den gefegten Gehwegen, den Gardinen, die sowohl das Hinein- als auch das Hinausschauen verschleiern, und die sich ähneln, egal, ob man nach Kassel, Köln oder Karlsruhe geht? Sicher, Heimat, das bedeutet auch Brauchtum, Essen und Trinken, mit historischen Fakten vermischte Mythen und fest gefügte Regeln, die Halt geben oder herausfordern dazu, sie zu sprengen. Darin allerdings unterscheiden sich Kassel oder Köln von Karlsruhe.
Es gab damals auch hier in der Stadt, in der ich aufwuchs, mir vertraute, heimelige Orte, die sich mit Erlebnissen verknüpften, sie gleichsam repräsentierten. Der heimeligste Ort war mir immer unser Garten. Es war ein eingewachsener Garten mit Blumen- und Gemüsebeeten. Ein Saum von Spalierobst auf der einen Seite, gegenüber Himbeerstauden und Johannisbeerbüsche, rote, schwarze, weiße Träubchen. Weißfleischige Pfirsiche und die mit grauem Pelz und dunkelrotem Fruchtfleisch. Alles war immer wohl gepflegt. Ich durfte in den Garten, wann immer ich wollte. Das Tor war meine Grenze. Hinaus sollte ich nicht. Nicht auf der Straße spielen, keinen Kontakt haben zu den Nachbarkindern. Darauf war meine Familie sehr bedacht, sich auf Abstand zu halten. Die einzigen Außenkontakte, die wir hatten, waren gelegentliche Betriebsfeiern im Vermessungsbüro, in dem mein Vater beschäftigt war. Meine Großmutter traf sich regelmäßig mit ihren ehemaligen Schulfreundinnen im Café Endle, eine sehr exklusive Unternehmung für sie, die sie allerdings immer tagelang zum Gesprächsthema mit meiner Mutter machte.
Die Welt außerhalb unseres Hauses und Gartens, so erklärte man mir immer wieder, sei gefährlich. Da ich ein gehorsames und schüchternes Kind war, hielt ich mich an die mir gesetzten Grenzen.
Weil es das Karlsruhe meiner Kindheit und die wenigen Menschen, die damals eine Rolle spielten in meinem Leben, nicht mehr gibt, fürchtete ich, von einem Gefühl der Fremdheit übermannt zu werden.
Es stellte sich jedoch bald heraus, dass diese Stadt mir so vertraut ist wie viele, gerade weil der allgemeine Wandel hier ebenso stattgefunden hat wie überall. Das typisch Städtische schafft ein Gefühl des Vertrauten, es ist meine eigentliche Heimat, nicht das Dörfliche, nicht die Natur. Hier gibt es die typische Einkaufsmall, in der man alles Notwendige bei jedem Wetter trockenen Fußes und ohne zu schwitzen einkaufen kann. Die typischen Filialen der großen Einkaufsketten, verschiedene Theater und Museen, Straßencafés. Es gibt das übliche ethnische Spektrum von Restaurants und dann das unerwartete Grün der Städte! Die Parks und vor allem die Bäume. Ein Open-air-Kino, ein Gefängnis und viel interessante Architektur aus den unterschiedlichen Epochen, Historismus, Jugendstil, hässliche Nachkriegsbauten, den Beton der frühen Siebziger und das ganz Neue, das die Meinungen spaltet. Es ist eine Stadt wie viele und als solche vertraut. Ich habe mich von der ersten Minute an wohlgefühlt. Mit dem Bau der Untergrundbahn wird die Stadt tauglich für das 21. Jahrhundert.
Und auch die andere Sorge, nämlich dass es die Menschen von damals hier nicht mehr gibt, ist unberechtigt, denn es fiel mir nicht schwer, in kurzer Zeit einige meiner ehemaligen Schulkameradinnen ausfindig zu machen. Unsere behutsame Annäherung über einen langen kontaktleeren Zeitraum hinweg geschieht auf der Basis höflich distanzierter Kommunikation.
Diejenigen, die immer hier gewohnt haben, beklagen sich darüber, wie hässlich die Innenstadt im Augenblick sei. Eine einzige riesige Baustelle mit vielen Löchern, die Kaiserstraße gleiche einem Fluss, den man nur unter Gefahr an einigen Stellen überqueren könne, die schönen alten Geschäfte seien alle eingegangen. Der K-Punkt-Pavillon beim Theater sei eine lächerliche Kopie des Berliner Kubus‘ am Potsdamer Platz, aber ja, das sei ja Karlsruher Tradition, man habe unter dem Großherzog auch immer nach Berlin geschielt und versucht, es zu kopieren, besonders als dann die Tochter des Kaisers hier einheiratete in immerhin noch glanzvoller Zeit.
Da beginne ich nachzudenken. Was sie so locker in Nebensätzen erwähnen, den Großherzog – welchen meinen sie eigentlich? – ist mir nicht geläufig. Nie habe ich mich für die Geschichte Badens oder der Stadt Karlsruhe interessiert. Ich war noch zu jung, als ich die Stadt verließ. Mit Mühe kann ich das Gründungsjahr 1715 nennen und damit die Stadt historisch ein bisschen einordnen. Und dann:
„Schöne alte Geschäfte?“, frage ich.
„Ja, weißt du nicht mehr, dass manche ihr Konfirmationskleid eben bei Kleiber, Pohl und Pfüller, Vetter oder Keller kaufen konnten und die anderen eben nur bei C&A?“
„Die Jungs bei Hiller, vergiss das nicht! Der ‚Herrenausstatter‘ von Karlsruhe.“
„Sportkleidung bei Sportmüller und Schulbücher bei der Braunschen oder bei Buch-Kaiser.“
„Gab’s da nicht noch Mende und Müller&Schlicht?“
„Du hast recht!“
„Schuhe bei Danger oder Salamander.“
„Aber Gabriela aus Durlach, die kaufte damals schon bei Bally. Wie habe ich die beneidet!“
„Und als ich heiratete, da gingen Klaus und ich zu Wohlschlegel in die Porzellanausstellung und fanden einfach nichts, was uns beiden gefiel, weil die Auswahl zu groß war.“
„Wir wollten etwas Besonderes haben und gingen ins Interno-Studio in der Amalienstraße. Meine Schwiegereltern rümpften die Nase über die rohen Kiefernholzmöbel und zehn Jahre später gab’s Ikea.“
„Hammer und Helbling, den vermisse ich, da bekam man alles –vom Schraubendreher bis zum Dampfdrucktopf.“
„Bei Wäsche-Schulz hatten sie an jedem Ausstellungsstück einen kleinen Zettel angesteckt mit der Anzahl der noch am Lager vorhandenen Exemplare. Wenn etwas gekauft wurde, strichen sie die Zahl durch und schrieben die neue daneben.“
„Erinnert Ihr euch, dass es damals, als wir unsere Kinder bekamen, noch Doering und Christmann gab? Die Konkurrenz belebte das Geschäft!“
„Jetzt kauft man halt gleich bei Amazon.“
Ich höre amüsiert zu und spüre, dass mir hier etwas entgangen ist, ich gehöre nicht dazu. Ich bin fast eine Reingeschmeckte, trotz des badischen Singsangs, den ich – wie man mir immer wieder bestätigt – nie verloren habe.
Nach und nach erscheinen verschiedene Orte wieder vor meinem inneren Auge: Die Tanzschule Vollrath, das Resi-Kino mit seinen Filmkunst-Tagen, das Regina-Nonstop-Kino, wo man regelmäßig damit rechnen musste, dass sich ein Kerl neben einen setzte und einem an die Oberschenkel griff. Ich denke an Hanno, meinen Freund aus dem Schwimmverein und schließlich auch an Frank-Arthur, den ich fast geheiratet hätte.
Ich räume also seit vielen Wochen hier im Haus auf, arbeite mich in kleinen Schritten vor, nehme alles in die Hand und entscheide, was ich behalten will und wohin ich das andere gebe, wenn es nicht in den Müll kommen soll. Ich genieße diesen Frühling, der im Winter schon begann und uns so sehr mit Licht und Wärme verwöhnt. Die Stadt und ich, wir wachsen auf behutsame Weise wieder zusammen, und es gefällt mir. Fast ein Jahr wohne ich schon hier.
Als ich im letzten Jahr einwilligte, an Weihnachten mit nach Kitzbühel zu gehen, hatte ich noch keine Ahnung, was mir bevorstand. Ich kam am Abend müde an und ging früh ins Bett. Am nächsten Morgen blickte ich aus meinem Fenster und sah die Berge vor mir. Etwas in mir erkannte die Silhouette sofort.
Vielleicht weil ich zu Hause kurz zuvor diese Schuhschachtel gefunden hatte mit Briefen, Postkarten und Fotos aus den sechziger Jahren. Noch lagen sie mit einer Schnur zusammengebunden dort. Ich scheute davor zurück, sie zu lesen, war mir gar nicht sicher, ob ich sie nicht besser einfach vernichten sollte.
Aus meiner derzeitigen Position, wo ich auf das, was ich erlebt und nicht erlebt habe, mit Gelassenheit blicken kann, wo ich ohne Bitterkeit Bilanz ziehen kann, weil ich Gott sei Dank noch bei Kräften bin, geistig und körperlich, und hoffe, noch ein paar gute Jahre vor mir zu haben, wuchs mir dann aber Mut zu, mich der Vergangenheit zu stellen, nach Zusammenhängen zu suchen, die bis in die Gegenwart hinein wirksam sind.
2
Vor mir liegen Postkarten, Briefe, Fotos. Ich habe sie auf meinem alten großen Tisch ausgebreitet und sie führen mich zurück ins Jahr 1961. In unseren ersten Sommerurlaub in einem kleinen Dorf in Tirol unmittelbar an der Grenze zu Deutschland. Dorthin fuhren wir viele Jahre immer wieder. Vieles, was ich dort erlebte, kann ich keinem Jahr zuordnen. Aber manches bleibt unverrückbar.
Da waren die Berge, so hoch, so unvertraut, bedrohlich oder friedlich, auch nach vielen Wanderungen voller Unwägbarkeiten, Rätsel, Herausforderungen. Ein Glücksgefühl blühte auf im Herzen, wenn man sich einen langen beschwerlichen Aufstieg abgerungen hatte und von oben die Welt betrachtete, die Häuser, die Menschen und Tiere. Sie erschienen klein und unbedeutend, als ob man sie mit den Fingern wegschnippen könnte. Doch gerade die Menschen, so anders und nah, sie rückten uns in den wenigen Ferientagen näher als unsere Nachbarn zu Hause.
Ich beschäftigte mich damals und dort in meinen Gedanken insbesondere mit der Liebe. Sie erschien mir wie das Eintrittstor zur Welt der Erwachsenen. Das hatte mit den Romanen von Ludwig Ganghofer zu tun, die meine Großmutter sich als Ferienlektüre auswählte, um sie erneut zu lesen, zu überprüfen, ob sie noch die gleiche Faszination auf sie ausüben könnten wie vor fünfzig Jahren, da hatte sie diese Bücher ihrer Mutter vom Nachttisch stibitzt. Als ich als Teenager den ersten Ganghofer-Roman las, brauchte ich mehrere Anläufe, musste mich erst vertraut machen mit dem Dialekt, der sich sperrig las, wenn man den Klang nicht im Ohr hatte. Es gelang mir nicht sofort, sie mit den Tränen und dem wohligen Erschauern zu genießen, die sie verdienten.
Wenn ich über die Liebe nachgrübelte, hatte ich das Bild von Jörg vor Augen. Er war der Sohn des Postwirts. Die allabendliche Einkehr in der „Post“, dem einzigen Gasthaus am Ort, liebte mein Vater. Den Rest des Jahres beschwor er solche Urlaubsrituale, sie symbolisierten die Kraftquelle der Bergferien, und diese Beschwörung brachte ihm die Gelassenheit und Zufriedenheit der Ferienstimmung zurück, wenn er sich zu Hause in seinen Alltag eingeklemmt fühlte.
Ich erinnere mich an verschämtes Beobachten, wie Jörg, wenn er bei Hochbetrieb an die Tische kommen durfte, Bestellungen aufnahm oder die Suppe aus den Stahltassen in die vor den Gästen stehenden Teller goss, nicht mit dem leichtsinnigen Schwung eines Jugendlichen, den der Ernst des Lebens wenig interessiert, sondern bedächtig, versunken in die Handlung als solche, unnahbar und würdevoll. Manchmal warf er mir dann einen Blick aus seinen grünen Augen zu, vielleicht weil er spürte, dass ich ihn neugierig betrachtete, seine sommersprossige Nase, die schwarze Locke in seiner Stirn, seine kräftigen Hände, seine Schultern, seine Knie, die merkwürdig altmodischen Sandalen, die nackten Zehen . Dort in der „Post“, wo es klar war, dass er arbeiten musste, lernen, was es zu tun gab, denn er war der Erbe, eines Tages würde er den Betrieb übernehmen, benahm er sich schon wie ein Erwachsener.
Jörg faszinierte mich schon, als ich ihn das erste Mal sah, da war ich elf. Diese Faszination blieb ungebrochen bis zu meinem letzten Tirol- Urlaub viele Jahre später, als mein damaliger Freund und dessen Mutter uns dort besuchten, diese wahrscheinlich in der Erwartung, es bahne sich so etwas wie eine Verlobung zwischen uns an.
In den Jahren zwischen meinem elften und meinem einundzwanzigsten Lebensjahr führte ich zwei Leben. Eines hier in der Stadt, in der ich geboren wurde, aufwuchs und eine Zeit lang lebte. Ein anderes dort in Tirol. Obwohl sich dieses zweite Leben in maximal drei Wochen abspielte und das andere über die vielen restlichen Wochen erstreckte, wogen sie gleich schwer. Das eine Leben, das Alltagsleben mit seinem Trott, der sich nur unmerklich veränderte, wurde durchdrungen von dem anderen, das sich in meinen Tag- und Nachtträumen aufblähte wie ein verheißungsvoll schwebender Ballon voller geheimer Möglichkeiten.
3
Das Vermessungsbüro, in dem mein Vater arbeitete, befand sich in einem Nachkriegsblock direkt an der Hauptpost, dem heutigen Europaplatz. Mein Vater, ein introvertierter und meist schweigsamer Mann mit angenehmen Umgangsformen und einem Sinn für Humor, mit dem er manche kritische Situation zu entschärfen verstand, genoss großes Ansehen bei seinen Kollegen und auch bei seinem Chef. Er wurde oft mit schwierigen Projekten betraut, zu schwierigen Kunden oder Verhandlungspartnern geschickt.
Einem jener Kunden, dem Besitzer eines Baustoffbetriebs in Baden-Baden, war mein Vater besonders zugetan. Ich glaube, er bewunderte ihn, genoss es, ab und zu mit ihm im Schwarzwald auf die Jagd zu gehen und sich in männlichem Schweigen mit ihm zu verbinden. Dieser Mann gab uns die Adresse einer neu eröffneten Ferienpension am Fuß der Berge dort in Tirol, wo er sich dann und wann adligen Jagdgesellschaften anschloss und meinem Vater in schillernden Farben davon erzählte.
Die Besitzerin war die Tochter des örtlichen Käsers, eine nicht mehr ganz junge Frau mit großen hervortretenden wasserblauen Augen und einem starken Unterbiss. Sie machte einen verschlossenen, mürrischen Eindruck. Meine Großmutter entlockte den Zimmermädchen nach und nach einige Informationen: Dass Mariannes Ehemann schon eine erwachsene Tochter habe. Dass der Chef – damit meinten sie Mariannes Vater, den Käser, er war der größte Arbeitgeber am Ort – den Franz eigentlich nicht gemocht hatte, aber ihm dann wegen dem Kind, das Marianne von ihm erwartete, geholfen habe, sich aus seiner ersten Ehe zu lösen.
„Zahlt hat der Chef“, habe die Kati gesagt. Meine Oma imitierte den Tiroler Dialekt und brachte uns zum Lachen damit. Sie freute sich über unseren Beifall, aber auch darüber, dass die Mädchen ihr so zutraulich begegneten.
Wir waren die ersten Gäste überhaupt in der Pension, denn offiziell sollte sie erst Mitte September eröffnet werden. Meine Eltern bekamen jahrelang das schönste Zimmer, nämlich das einzige mit einem angeschlossenen Bad. Meine Oma wurde älter, ich wurde älter. Diese beiden Entwicklungen liefen voneinander weg. Meine Eltern blieben die gleichen. Sie befanden sich in der Mitte ihres Lebens, wo man das Älterwerden nicht merkt und kaum sieht.
4
Die lange Autofahrt über die damals schon in den Sommerwochen verstopfte A 8 wurde unterbrochen in München, wo meine Eltern sich umsahen nach Trachtenkleidung, Lederhosen, mit Hirschhornknöpfen und Eichenlaubverzierungen versehenen Jankerl, aber auch nach Bergkleidung bei „Sportscheck“, mit dessen Sortiment sie durch das Studium seiner Kataloge bereits bestens vertraut waren.
So kamen wir verwandelt an der Grenze an. Wenige Kilometer hinter der Grenze lag Aschdorf am Fuß des Zahmen Kaisers. Am Dorfende, abgerückt von den letzten Häusern und durch einen Schotterweg anzufahren, befand sich die „Pension Marianne“.
Das Programm der Sommerfrische sah vor, dass Bergwanderungen und Besichtigungsfahrten einander abwechselten. Meine Mutter vermittelte die Wünsche meiner Großmutter an meinen Vater. Es galt, etwas zu erleben, womit sie später zu Hause bei ihren Klassenkameradinnen würde renommieren können: Irgendetwas, was an den Märchenkönig Ludwig erinnerte, oder etwas, was mit seiner unglücklichen schönen Cousine, der Kaiserin Sissi, in Verbindung stand, musste unbedingt dabei sein.
Es machte mich zufrieden, wenn ich sah, wie meine Eltern auf den ganztägigen Wanderungen nach und nach die Verkrampfungen ihrer städtischen Identität ablegten, sich einem Einfach-nur-Sein hingaben, das ihnen beiden gut tat. Zu Hause beherrschten oft Spannungen zwischen ihnen die Familienatmosphäre. Das hatte vor allem mit dem der Meinung meiner Mutter nach ungerechterweise schmalen Einkommen meines Vaters und den täglichen Eintragungen im Haushaltsbuch zu tun, mit dem Kampf um kleinere oder größere Veränderungen unseres Lebensstandards. Ein Kühlschrank, eine Waschmaschine, ein neues, repräsentativeres Auto, endlich Gasöfen, die das Kohleschleppen und das Anfeuern überflüssig machen würden, neue Vorhänge. Um all das wurde gekämpft, dafür wurde gespart.
Es bestand wenig Einigkeit zwischen meinen Eltern über diese Anschaffungen. Denn meinem Vater schwebten ganz andere Dinge vor. Er träumte davon, sich eine wirklich gute Kamera zu leisten, und dann wollte er auf langen einsamen Wanderungen die Natur „einfangen“, wie er es nannte. Er wollte in Konzerte gehen, ganz vorne in der ersten Reihe sitzen. Wahrscheinlich am liebsten allein, denn meine Mutter war nicht besonders musikinteressiert. Wenn überhaupt, hörte sie sich die gängigen Schlager an, und mein Vater verzog dabei das Gesicht, als ob er Schmerzen erleiden müsste. Sie tanzte zu dieser Musik vor ihm auf und ab und er drehte den Kopf weg oder schloss die Augen. Tanzen ginge sie gerne mal wieder, das sagte sie dann, nahm seine Hände und wollte ihn dazu zwingen, aufzustehen und sich mit ihr hin und her zu wiegen und zu drehen. Da konnte er unvermittelt sehr brüsk ihre Hände abwehren und „Lass das, um Gottes Willen!“ ausrufen.
Um mehr Spielraum für die Erfüllung dieser Wünsche zu bekommen, nahm meine Mutter, als ich acht Jahre alt war, eine Stelle als Sekretärin bei einem Anwalt an. Sie machte sich zwar oft über ihn lustig, über seine Rechtschreibefehler und seine mangelhafte Fähigkeit, sich knapp, verständlich und dennoch präzise auszudrücken, aber ihm gegenüber blieb sie immer zurückhaltend und liebenswürdig. Meine Mutter war stolz, dass sie eines der renommierten Mädchengymnasien der Stadt besucht, ein gutes Abitur gemacht und danach das Lehrerinnenseminar absolviert hatte. Ihr erstes Staatsexamen hatte sie noch abgelegt, sich dann aber nach ihrer Heirat „dem Haushalt gewidmet“, war schnell schwanger geworden, hatte sich ihrem Kind „gewidmet“ und auch ihrem Mann. Irgendwann fragte ich meine Großmutter, was genau eine solche „Widmung“ bedeute. Sie zögerte, dann erklärte sie mir, eine Widmung sei eine Art Opfer. Es dauerte lange, bis ich diese Deutung mit Hilfe eines Wörterbuchs verfeinerte.
Das Mysterium einer Ehe hat sich mir nie erschlossen, da ich selbst nie geheiratet habe. Meine Beobachtungen der Paare um mich herließen Spekulationen zu, aber unversehens konnte sich schnell das gegenteilige Bild ergeben. Meinungsverschiedenheiten sind ganz offensichtlich gerade bei langjährigen Ehepaaren nicht selten. Ich versuche, die Qualität ihrer Zweisamkeit nicht zu bewerten.
Als Kind, als Jugendliche wagte ich noch, die Ehe meiner Eltern zu bewerten. Meine Mutter ließ sich ihren Ärger deutlich anmerken. Mein Vater schwieg. Ich habe ihn niemals irgendetwas Negatives über meine Mutter sagen hören. War das Liebe? Oder waren es nur unterschiedliche Strategien für die schwierige tägliche Aufgabe, das Zusammenleben zweier sehr unterschiedlicher Menschen zu bewältigen?
Vielleicht hätte eine eigene Erfahrung mich darin klüger machen können, das alles besser zu verstehen. So wird es mir immer ein Rätsel bleiben. Damals träumte ich davon, selbst alles besser zu machen. Ich erfand mir einen Partner, der mich perfekt ergänzen sollte. Ich wollte zu ihm aufschauen können und gleichzeitig auch von ihm bewundert werden. Ich wollte, dass wir, wenn wir nebeneinander stünden, wie von einem unsichtbaren Strahlenkranz umgeben stets und ständig Einheit signalisierten nach außen. Ich wollte grenzenlose Harmonie, Vertrauen, Treue, Hingabe, Fürsorge.
Erst heute, aus dem Abstand und mit meinen eigenen Erfahrungen als Gepäck, verstehe ich, dass Liebe vor allem eines bedeutet, dass man den anderen möglichst weitgehend so sein lässt, wie er sein will, und daran Anteil nimmt. Dass man erst Einspruch erhebt, wenn es gefährlich wird in irgendeiner Form, für den anderen, für sich selbst oder für die Liebe. Dass man lernen muss, etwas gegen den eigenen Willen für den anderen zu tun, wenn es wichtig ist für diesen. Und ich weiß um die raffinierten Verflechtungen von Lust und Liebe, von Einseitigkeit und Gegenseitigkeit, vom Glück, wenn das Leben zu zweit gelingt, vom Schmerz, wenn die Liebe vergeht, von der Dankbarkeit, die einen erfüllen muss, wenn man sich verspricht, beieinander bleiben zu wollen, um all das immer wieder zu versuchen. Einer Ehe bedurfte es nicht, um diese Erkenntnisse zu gewinnen, das verbuche ich auf der positiven Seite meines Lebens.
5
In unserer Straße am Stadtrand von Karlsruhe, im ganzen Viertel ringsum standen stattliche Ein- und Zweifamilienhäuser in großen Gärten; alte Bäume verdeckten sie, hohe Gartenzäune mit verschließbaren Toren umgaben sie. Man kannte die Gesichter der Nachbarn, meine Großmutter wusste das ein oder andere über sie, das, was man so hörte, wenn man in der Metzgerei, der Bäckerei, dem Konsumladen warten musste. Meine Eltern hatten ihre Kollegen, ich hatte meine Mitschüler, meine Großmutter traf sich einmal im Monat mit ihren Klassenkameradinnen. Es gab keine Familienangehörigen, keine Freunde. Unsere Geburtstage feierten wir zu viert. Alle ausnahmslos. Ich wurde ab und an zu Kindergeburtstagen eingeladen, nicht immer durfte ich annehmen. Es wurde sorgfältig sortiert nach Gesichtspunkten, die mir verborgen blieben. Die Frage „Wo wohnt die Familie und was ist der Vater von Beruf?“, wurde gestellt, was sie aus meinen Antworten schlossen, erklärten sie mir nicht.
Wie anders verhielten sie sich dort in den Ferien! Sie legten ihr Misstrauen ab, wurden redseliger, wie befreit von einem Korsett, das sie sich zu Hause angelegt hatten. Auch für mich wurde die Welt interessanter. Die Menschen dort in der Pension, Marianne und die Mädchen, die ihr halfen, die anderen Feriengäste, die Dorfbewohner, Jörg und seine Eltern, die Wanderer und die Senner glichen so gar nicht den unscheinbaren Nachbarn von zu Hause. Sie schienen Ludwig Ganghofers Romanen entstiegene Wesen zu sein.
Meine Großmutter und meine Mutter suchten das Gespräch mit jedem, der sich dafür anbot, machten sich einen Spaß daraus, die Menschen einzuordnen in Kategorien, ergänzten, was man ihnen nicht offenbarte, erschufen Dramen und Romanzen, wo vielleicht keine waren. Mein Vater aber verlor manchmal die Geduld mit ihnen. Er mochte es nicht, wenn man die Menschen nicht das sein ließ, was sie seiner Meinung nach waren, gekapselte Rätsel, die man allenfalls berühren, niemals aber zu entschlüsseln wagen sollte. Er schloss von sich auf die anderen. Auch er wollte sich nicht in sein Innerstes blicken lassen. Wenn man ihm zu nahe trat, verzog er sich hinter den Rauch seiner Zigaretten oder hinter seine Bücher.
Unser erster Sommer in Tirol war wunderbar. Für die Oma wurde mit dieser Sommerfrische angeknüpft an die Ferien ihrer Jugendzeit, wo ihr Leben noch voller Verheißungen für eine glänzende Zukunft vor ihr gelegen hatte. Dass es sich dann anders für sie entwickelt hatte, dass sie viel hatte „durchmachen“ müssen, war eine der Formeln, die ich damals noch nicht entschlüsseln konnte. Aber gerade die Ferien dort in den Bergen machten alle drei Erwachsenen gesprächig und sie gaben das ein oder andere ihrer Geheimnisse preis. Ich musste die Episoden zusammensetzen, ganz allmählich entstand dadurch ein Bild, eines mit etlichen weißen Flächen allerdings. Glanz und Gloria der Kaiserzeit, wo es bei uns in Karlsruhe den Großherzog gab und den „Hof“, die Hofbeamten und ihre Familien. Dazu gehörte meine Großmutter. Sie hatten einen „gesellschaftlichen Rang“, eine Position weiter oben in der Hierarchie der sozialen Klassen. Das sind die Begriffe, die mir heute zur Verfügung stehen. Damals stellte ich mir vor, dass sie in rüschenbesetzten Kleidern mit Bändern am Hut durch den Schlosspark schritten und am Wegrand die grau gekleideten einfachen Leute standen und sie bewunderten. Mein Vater wurde böse, wenn er das bemerkte.
„Setzt dem Kind nicht diese Flausen in den Kopf. Sie soll doch lernen, worauf es wirklich im Leben ankommt.“ Aber er sagte mir nicht, was das wäre. Er nahm den Frauen meine Erziehung nicht aus der Hand. Lieber verzog er sich hinter den Nebel seiner Zigaretten und blieb dort unsichtbar.
Die größte Leerstelle im Geflecht ihrer Erzählungen, das waren die Jahre des Kriegs. Ich spürte, dass alles, was mit ihm zusammenhing, zu schrecklich war, um darüber zu sprechen. Drängte sich ihnen eine Erinnerung auf, dann konnten sie sich mühelos mit einem einzigen Schlüsselwort, das mich außen vor hielt, darüber verständigen, so als ob es eine Grenze gäbe, einen Graben, den ich niemals würde überwinden können.
In diesem ersten Sommer gingen meine Oma und ich täglich ins nahe gelegene Schwimmbad. Man hatte Wasser aus dem Bergbach in einem schmucklosen Betonbecken aufgestaut, ein paar Bretterbuden als Umkleidekabinen und einen hölzernen Turm für einen Bademeister daneben gebaut.
Mariannes Baby wurde täglich „gehütet“ von einem Mädchen aus dem Dorf, das ungefähr mein Alter hatte. Ermutigt durch die gelockerten Regeln im Umgang mit den Menschen dort, versuchte ich, mich diesem Mädchen zu nähern, lächelte ihr verschämt zu, winkte ihr, wenn ich sie auf der Terrasse sah, rief ihren Namen: „Monika“. Als ich sie das erste Mal im Schwimmbad sah, sprach ich sie an, ob sie mit mir Federball spielen wolle und verabredete mich für den nächsten Tag mit ihr.
Bald schon kannte meine Oma auch ihre Geschichte. Monikas Mutter war eine Deutsche. Gleich nach Kriegsende war sie mit einem Flüchtlingstreck aus Ostpreußen in den Süden gekommen. So wie etliche andere Vertriebene war sie im deutschen Ort direktüberder Grenze hängen geblieben. Beim Tanzen lernte sie in Rietdorf den Sohn eines Bauern aus Aschdorf kennen und heiratete ihn „schnell“ – ich sehe meine Großmutter bedeutungsvoll mit den Augen rollen. Monikas Bruder war also einiges älter als sie, Monika ein Jahr älter als ich.
Nachdem wir uns angefreundet hatten, trafen wir uns auch in der Pension, wenn sie die kleine Christine hütete. Sie ließ mich ein in MariannesKüche, wenn sie das Fläschchen zubereitete, das Baby fütterte, ihm eine frische Windel anlegte und die verschmutzte geschickt an einem Trog vorsäuberte, danach in einem bereitgestellten Eimer einweichte, ein mir fremdes „erwachsenes“ Verhalten. Noch nahm man mir zu Hause alles ab, was mit irgendwelchen Unannehmlichkeiten verbunden war, dazu gehörte auch Schmutz.
Monika war ernst und auf eine zurückhaltende Weise selbstbewusst. Ganz offensichtlich konnte sie frei über ihre Zeit verfügen. Sie bewegte sich nicht in einem Korsett von Dürfen und Müssen. Es umgab sie etwas Pipi Langstrumpfhaftes, das mich von Anfang an in ihren Bann schlug. Sie kam, wann sie gebraucht wurde. Auch am Abend. Fuhr dann mit ihrem Fahrrad bei Dunkelheit wieder nach Hause. Sie erhielt Geld für ihre Hilfe, das sie in einen kleinen Beutel steckte, den sie um den Hals trug. Manchmal trafen wir sie beim Kolonialwarenladen im Dorf, wenn sie sich dort etwas Süßes kaufte. Mit der Ernsthaftigkeit eines Händlers ließ sie sich die Preise nennen, wählte dann mit Bedacht, holte die Münzen aus dem Beutel und steckte ihn wieder unter ihr Kleid. Vor meinen Augen zerbiss sie die Schokolade, ungeniert, ohne mir etwas anzubieten. Das wäre für mich nie in Frage gekommen. Ich war so belehrt von meiner Großmutter, immer erst dem anderen etwas anzubieten, bevor man selbst etwas isst in Gegenwart anderer Leute. Aber an Monika beobachtet, erhielt dieses „So-etwas-tut-man-nicht“-Verhalten eine neue Dimension. Es war nicht ungezogen oder „ungebildet“ – das Lieblingsschlagwort meiner Mutter, mit dem sie sich erfolgreich gegen Leute abschottete, die sie nicht leiden konnte –, es erschien mir unglaublich kühn und beneidenswert unabhängig. Monika trug ihre eigenen Gesetze in sich, sie schützten sie wie ein Feenzauber.
Monikas Vater lag schon lange auf dem Dorffriedhof. Meine Großmutter liebte es, dorthin zu gehen, sich durch die kleinen, mit weißen Kieselsteinen gefüllten Beete zu schlängeln, die auf Emaille-Täfelchen abgebildeten Gesichter auf den Grabsteinen zu betrachten. Sie merkte sich Familiennamen und erkannte Zusammenhänge, die sich aus den Daten und aus den beigefügten Attributen ergaben. So fanden wir auch den „Veit Perlinger, Sohn des Acher Hofs“. Wir fuhren eines Tages vorbei am Acher Hof, er lag weit außerhalb ganz auf der anderen Seite des Dorfs, weit weg auch vom Haus, in dem Monika, ihr Bruder und ihre Mutter nun wohnten. Die Läden waren geschlossen, die Tür verrammelt. Monikas Mutter verdiente sich ihr Geld, indem sie die Orgel spielte und die Kirche auf- und zuschloss. Keiner außer dem Pfarrer wusste genau, was für ein „Schicksal“ sie vor ihrer Ehe gehabt hatte. Ihr Sohn verwilderte, weil die Mutter zu sanft und weltfremd war, um ihn zu bändigen. Der Pfarrer sorgte schließlich dafür, dass er in ein Internat kam. Monika stand mit beiden Beinen in ihrem eigenen Leben, in Sichtweite zur Mutter, für die sie sich verantwortlich fühlte. Sie lebte es zielgerichtet, forsch und mit einem Gespür für das, was ihr gut tat. Ihre ganze Haltung drückte aus, dass sie schaffen würde, was sie schaffen wollte.
6
Als wir zu unserem ersten Urlaub aufbrachen, ging ich in die Quinta. Nach heftigen innerfamiliären Diskussionen hatten meine Eltern mich im Gymnasium unseres Stadtteils angemeldet, obwohl es bei manchen Karlsruhern den Ruf genoss, eine „verdünnte Bildungsversion“ zu bieten und somit ein Sammelbecken für Sozialaufsteiger oder weniger belastbare Kinder zu sein. Wer etwas auf sich hielt, schickte sein Kind in die Stadt, in eines der beiden Mädchengymnasien oder eines der beiden Knabengymnasien oder eben gleich in „das“ Gymnasium, das Bismarck-Gymnasium, wo man eine „echte“ humanistische Bildung erwerben konnte, die im Schnellzug zu einer akademischen Karriere führen würde. Das nämlich war das erklärte Ziel bürgerlicher Eltern: das Kind sollte studieren. Mein Vater wollte das nicht. Er wollte nicht, dass seiner Tochter irgendein Dünkel anerzogen würde, er verehrte Willy Brandt und wählte SPD, glaubte an eine echte Demokratisierung der Bevölkerung. Er hielt mich für fleißig und gescheit und vertraute darauf, dass ich, wie auch immer, meinen Weg schon machen würde.
Ich bestand die Aufnahmeprüfung aufs Gymnasium auf Anhieb, das Probevierteljahr ohne Einschränkung und die erste Klasse, die Sexta, mit durchaus zufriedenstellenden Noten. Da ich keine Freundin hatte, beschränkten sich meine Kontakte zu anderen Mädchen auf die mit Strafarbeiten geahndeten Flüstergespräche während des Unterrichts, die Pausenklüngel und das, was man auf dem Schulweg verhandeln konnte, wenn man in Dreierreihen mit den Fahrrädern durch die engen Wohnstraßen fuhr.
Dort in Tirol hatte ich bald zwei Freunde, Jörg und Monika. Wir nutzten die gemeinsame Zeit intensiv und sie befriedigten meine Sehnsucht nach freundschaftlichen Kontakten so, dass ich die restlichen Monate davon zehren konnte.
Das Gasthaus „Post“ in Aschdorf am Inn verfügte über einen großen Saal mit Bühne, in dem allerlei Veranstaltungen stattfanden. In diesem Saal wurden an den Samstagen im Sommer auch Filme gezeigt. Wahrscheinlich vor allem deshalb, weil Jörgs Mutter filmnärrisch war und ihr Mann fast alles tat, um sie glücklich zu machen. Immer wieder sah ich so die „Sissi“-Filme mit Romy Schneider, die auch meiner Oma sehr gut gefielen und die meine Mutter als „unbedenklich“ einstufte. Monika wurde von uns eingeladen, mitzugehen. Jörg stand beim Vorführer an der großen sirrenden Filmrolle und half ihm beim Rollenwechsel, er wachte über die Beleuchtung, regulierte den Ton, wenn der Vorführer in den zwanzig Minuten, die eine Rolle dauerte, auf ein Bier in die Gaststube auswich. So sah auch Jörg diese Filme und unser Interesse, unsere Bewunderung für Sissi, oder besser für Romy Schneider, war das erste uns einende Gefühl.
Was uns auch verband, waren die Aufenthalte im Schwimmbad. Wie wir einander dort gegenseitig anstachelten, um die Wette schwammen, tauchten, dann, als in einem nächsten Sommer ein Dreimeterbrett aufgebaut wurde, schließlich von dort ins Becken sprangen, zuerst mit Fußsprung und schließlich alle mit Kopfsprung. Wenn wir blaue Lippen bekamen und schrumpelige Haut, setzten wir uns auf unsere dicken grellbunten Badetücher in die Sonne, aßen die mitgebrachten Äpfel und schließlich gab es die ersten ernsthaften Gespräche zwischen uns.
Monika erzählte uns vor allem davon, wie Marianne die jeweiligen Mädchen behandelte, die sie beschäftigte. Die Mädchen hießen Kati, Resi, Nanni, Vreni. Sie waren gewöhnlich scheu im Umgang mit den Feriengästen, bis auf die kesse Kati mit ihrem perlenden Lachen, die jeden Scherz schlagfertig erwiderte und freigiebig alles an Klatsch und Tratsch weitergab, worüber sie verfügte. Eines Morgens war sie plötzlich nicht mehr da. Monika wurde gerufen, um beim Reinigen der Zimmer zu helfen.
„Der Franz hat ihr am Abend aufgelauert und ihr in die Bluse fassen wollen“, erzählte Monika, und ich bin ganz sicher, dass mir das als Entlassungsgrund damals ein Rätsel war.
Jörg grinste, Monika grinste zurück. Die beiden wussten „alles“, das wurde mir nach und nach klar. Ihr enges Zusammen-leben mit den Tieren hatte ihnen Kenntnisse verschafft in einem Alter, als für mich der physiologische Unterschied zwischen Jungs und Mädchen noch tabu war. Sie entwickelten eine natürliche und unverkrampfte Sicht auf Sexualität. Ab und zu wurde kichernd vom „Fensterln“ und den „Freuden im Heu“ gesprochen. Wenn ich solche Geschichten weitererzählte, verhandelten meine Mutter und Großmutter diese Art von Gerüchten mit dem für Frauen üblichen Interesse an Liebschaften aller Art. Meine Großmutter glaubte, dass die einfachen Menschen auf dem Dorf, deren Lebensenergie sich in einem engen Kreis entladen musste, weil sie kaum kulturelle Interessen entwickelten, vor allem mit Essen und Trinken, Schlafen und Arbeiten und mit der Befriedigung ihrer Lüste beschäftigt waren. Sublimation von Trieben kam nicht vor in ihrem Lebenskonzept, meinte sie. Meine Mutter erwog andere Zusammenhänge. Sie glaubte nicht an die übersteigerte Sinnenlust der Dorfmenschen. Sie meinte, dass den unkontrollierten Vereinigungen der Wunsch der Frauen nach Anerkennung zugrunde läge, Anerkennung in einer von der männlichen Körperkraft dominierten Welt. Die weibliche Klugheit galt nichts. Wenn sie zu sehr zur Schau gestellt wurde, machte sie die Frauen unberührbar. Wenn die Frauen akzeptiert werden wollten, mussten sie sich den Männern unterwerfen.
„Die Marianne ist eine ganz tüchtige Person. So tüchtig wie ihre Mutter. Jammerschade, dass diese Frauen nichts aus sich machen können.“
Vielleicht sah sie sich in diesen tüchtigen Frauen gespiegelt. Heute würde ich gerne mit ihr über all das sprechen, heute am Ende eines Lebens voller eigener Erfahrungen und Erkenntnisse.
Auch wir Kinder unterhielten uns also über die Menschen, die wir beobachteten. Frei und ungehemmt, so wie es Freunde tun. Monika berichtete vor allem über die gerade laufenden Techtelmechtel, ich erzählte von den Gestalten aus meinen Büchern und Jörg schilderte, was er bei den Einsätzen mit der Bergwacht erlebte, die er begleiten durfte. Riskante Bergungsmanöver und immer wieder, was der „Jost“ alles kann und wagt. Er war sein Idol.
„A, geh“, erwiderte Monika, „naaaa, der ...“ mit einer gewissen Verachtung.
„Magst du den Jost denn nicht leiden?“, fragte ich sie.
„Ach der, das ist ein Bankert.“
Der voreheliche Sohn vom Käser sei das, ein Nichts und ein Niemand. Die Käserei könne er nicht erben, weil sie von „der Frau“ kam.
Der Jost war in der Tat ein Paria. Er lebte außerhalb des Dorfes in einem stabilen Steinhaus auf halber Höhe. Man kam dort vorbei bei einer der Lieblingstouren meines Vaters. Es war ein schönes, altes Haus mit Schnitzereien an den Fensterläden und Butzenscheiben. Das ehemalige Jagdhaus eines Grafen, behauptete Monika. Und war er denn verwandt mit der Grafenfamilie? Gar das Kind einer Grafentochter, Frucht einer unstatthaften Liebesgeschichte? Das wusste auch Monika nicht genau, sie hatte niemanden gefunden, der es ihr hätte sagen wollen, und den Jost selber wagte sie nicht zu fragen.
Jost tauchte regelmäßig auf, um Marianne Eier, kuhwarme Milch und ab und zu etwas aus seiner Schnitzwerkstatt zu bringen, mit Christinchen zu spielen und vor dem Gehen noch Monika durchs Haar zu zauseln oder ihren Schürzenbändel aufzuziehen, sie einfach zum Lachen zu bringen.
Rietdorf, das deutsche Gegenüber, war damals noch verschlafen, aber doch schon touristischer als sein hinterwäldlerisches österreichisches Gegenüber. Es hatte eine beachtliche Infrastruktur. Schöne Geschäfte, einen Dorfplatz mit Brunnen, alten Bäumen und Bänken für die Kontemplation der Feriengäste. Es gab auf dem Dorfplatz auch ein sehr schönes Hotel mit städtischer Atmosphäre. Die Speisekarte bot Königinpastetchen, Boeuf Stroganoff oder Filet Mignon mit Reis, Nudeln, Petersilienkartoffeln an. Pfirsich Melba und Birne Helene als Desserts. Meine Großmutter liebte gutes Essen in feiner Umgebung. Mindestens einmal in jedem Urlaub kehrten wir dort ein, auch das würde die Oma zum Erzählstoff runden. Danach schlenderten wir an den Geschäften entlang, warfen einen Blick auf die Trachtenmoden, die Edeldirndl aus schimmernden Seidenstoffen, die Schnallenschuhe.
Äußerlichkeiten, Kleidung, Schmuck, Kosmetika, spielten für meine Mutter und Großmutter von jeher eine große Rolle. Sie statteten mich aus wie ein Püppchen und erzogen mich zum Bewusstsein, das Äußere als zweite Haut zu betrachten. Eine Haut, auf die man achtete und die man verwandeln konnte, wenn man etwas „darstellen“ wollte.
Die Vertrautheit mit den Orten und den Menschen unseres Urlaubsparadieses, die allmählich entstand, war eine Schimäre. Darauf wurden wir gestoßen, als wir eines Abends zurückkamen aus der „Post“ und vor uns eine Kuh auftauchte. Ein einzelnes schwarzes Rindvieh. Mein Vater war schon vorausgegangen, das löste bei meiner Mutter eine erhöhte Alarmbereitschaft aus und versetzte sie in die Lage zu erkennen, dass es sich nicht um eines der geduldigen Muttertiere handeln konnte, für die wir nach und nach eine Art von Sympathie entwickelt hatten.
„Das ist ein Stier“, flüsterte meine Mutter und packte mit der einen Hand mich, mit der anderen meine Großmutter grob am Arm, zog uns von der Straße weg auf ein Lagergebäude der Käserei zu, die Augen hypnotisierend auf den Stier gerichtet, der den Kopf senkte, als ob er seine spanischen Vettern nachmachen wollte. Mutter schubste uns auf die Rampe hinauf, kurz bevor der Stier uns erreicht hatte.
„Es ist vielleicht ein junger Stier“, versuchte meine Oma einzuwenden.
„Es ist ein Stier. Ein Stier ist unberechenbar, impulsiv und sehr gefährlich.“
Die Reaktionen meiner Mutter waren immer übertrieben, deshalb hatte ich mir angewöhnt, sie erst einmal nicht ernst zu nehmen. Ich blieb ruhig. Aber wohl fühlte ich mich dennoch nicht.
„Hallo!“ Kein Mensch auf der Straße, weit und breit. Aus der „Post“ drang das Geschnatter von Stimmen, man würde unsere zaghaften Rufe nicht hören.
Meine Mutter änderte ihre Strategie, sie trat an den Rand der Rampe und brüllte den Stier an:
„Weg! Geh, du Vieh, geh heim! Fort! Sch-sch!“
Der Stier war bisher ruhig geblieben. Er hatte neugierig nach uns Ausschau gehalten und versucht, seinen Kopf so nach oben zu recken, dass er uns sehen konnte. Die schrille Stimme meiner Mutter allerdings führte nun dazu, dass er sich anspannte, den Kopf senkte und die Hörner aufrichtete. Dann löste sich aus seinem Innern ein Urlaut, der uns Gänsehaut machte. Er trappelte, stampfte, schließlich setzte er sich in Bewegung Richtung „Post“.
Wir beschäftigten uns noch damit abzuwägen, wer was tun könnte, um uns aus dieser misslichen Lage zu befreien, da kam der Stier wieder zurückgerannt und hinter ihm her schlenderte plötzlich Jörg herbei. Er sah uns und grinste, ging auf den Stier zu, griff ihn am Ring, den er in der Nase trug, drehte ihn um und zog ihn die Straße entlang zu seiner Weide zurück.
Nach diesem Vorfall avancierte Jörg zum strahlenden Helden für mich.
7
Dass ich jetzt noch täglich hier oben unterm Dach sitze, aus dem Fenster hinausschaue auf die Gärten und den Lärm der Autobahn höre, die Motoren der auf Baden-Airport zusteuernden Billigflieger und immer wieder das Martinshorn, wenn die Ambulanzfahrzeuge vom nahen Krankenhaus zur Autobahn hin rasen, hätte ich mir vor rund einem Jahr, als ich hier ankam, niemals gedacht. Es war nicht die Heimkehr oder besser die Rückkehr hierher, die den Erinnerungsprozess auslöste, der mich jetzt hier festhält, sondern die Einladung nach Kitzbühel. Der Blick auf den Kaiser. Mehr noch ein Déjà-vu-Gefühl beim Schlendern über den kleinen Weihnachtsmarkt, als ich dort an einer Bude mit Holzschnitzarbeiten vorbeikam und mich plötzlich Gesichter anstarrten, riesengroße Holzmasken. Die Augen sahen nicht direkt nach vorne, sondern am Betrachter vorbei etwas an, was hinter ihm zu sein und sie zu beunruhigen schien. Man hatte Baumscheiben auf sie montiert und so dienten sie als Auslagen für kleine zum Verkauf angebotene Objekte. Ich nahm mir vor, bei meinem nächsten Spaziergang nachzufragen, wie der Schnitzer wohl hieße, der diese Dinge hergestellt hatte, aber dann reisten wir ab, ohne dass es dazu gekommen wäre.
Im zweiten Urlaubsjahr ging Monika regelmäßig mit meiner Großmutter und mir zum Schwimmen. Ab und zu tauchte Jörg auf. Wenn er nicht da war, sprachen wir über ihn.
„Grad aufgemacht haben sie die ‚Post‘ wieder. Sie war geschlossen wegen dem Onkel und dem Opa vom Jörg. Dem Vater von der Frau.“
Die beiden seien Bombenleger. Vielleicht jedenfalls. Man habe sie gesucht und eingesperrt und jetzt warteten sie bei Wasser und Brot auf einen Prozess. Die Polizei hatte die Frau im Verdacht, ihren Verwandten Schutz zu gewähren. Die Frau sei eine gute Kraxlerin, gehe gern auch mal alleine auf den Berg. Und wohin ging sie da? Wahrscheinlich hinauf zum Versteck der beiden Bombenleger, um sie mit Proviant zu versorgen. So was redete man jedenfalls im Dorf.
„Aber Kind, Monika, warum nur sollten sie eine Bombe gelegt haben? Und die Wirtin der ‚Post‘ ist doch eine sehr nette und anständige Frau ...“
Meine Oma wölbte ihre Augenbrauen auf die ihr eigene Art und schüttelte ganz leicht den Kopf.
„Die Frau kommt aus Bozen.“
Damit konnten wir nichts anfangen.
„Das Gasthaus ist doch jetzt wieder geöffnet, Monika, alles war sicherlich nur ein böser Verdacht!“
Meine Großmutter hatte inzwischen wirklich genug von Bomben und allem, was sie an den Krieg erinnerte. Sie wollte endlich, endlich ein friedliches Leben in Sicherheit und bescheidenem Wohlstand führen. Ich konnte ihr ansehen, dass sie Monika für ein überspanntes und geltungssüchtiges kleines Mädchen hielt und dass sie gewillt war, ihre Phantasien einfach zu ignorieren.
Ich schätzte Monika anders ein. Mir erschien sie clever. Sie beobachtete scharf. Sie musste so sehr auf sich selbst aufpassen, dass sie bereits als Dreizehnjährige ein vitales Sensorium entwickelt hatte, mit dem sie auf ihren Vorteil zugehen konnte, wo auch immer der läge. Sie war auf der Hut. Ich traute ihr zu, die Situation der Wirtin richtig zu beurteilen.
Monikas Stellung in der Aschdorfer Gesellschaft glich der von Jost. Beide gehörten nur begrenzt zu den echten Einheimischen. Doch ihre Zähigkeit, ihr Selbstwertgefühl machten sie immun gegen alle Abwehrhandlungen der anderen Dorfbewohner, gegen Kränkungen, gegen Zurückweisungen.
Auch Jörg, der Sohn des Wirts und der Südtirolerin, gehörte nicht unumstritten zu den Einheimischen. Ich musste vieles beobachten und Vermutungen wagen, sie kombinieren zum Wahrscheinlichen, bis mir das klar wurde. Meine heimliche Neigung zu Jörg machte mich zunächst blind dafür, dass die anderen Burschen des Dorfes Jörg mieden. Deshalb hatte er sich wohl Monika zugesellt. Sie waren Schicksalsgenossen und Vertraute.
Auf eine unserer Bergwanderungen durfte Monika uns begleiten. Es zeigte sich aber, dass sie nicht gerne wanderte. Sie ging nur mit uns, weil sie uns zu Jost bringen, uns Einlass in sein Atelier verschaffen wollte. Zögernd, fast widerwillig öffnete er die Tür seines Anbaus, zog sich dann in den hinteren Teil des Gebäudes zurück, drehte uns den Rücken zu, als wir stumm und voller Bewunderung entlangschritten an den Regalen, auf denen sich seine Schnitzereien drängelten. Die üblichen Figuren lagen da, viele dünne, ans Kreuz genagelte Jesusfiguren mit Dornenkrone und Leidensmiene, Mariengestalten mit zarten Gesichtern, zwischendrin plötzlich märchenhafte riesige Köpfe, ein Frauengesicht, umrahmt von wilden Haaren, mit weit auseinander stehenden, aufgerissenen Augen, vor denen man sich fürchten konnte, weil der farblose Blick befremdete. Die Augen blickten zur Seite, das verlieh ihnen eine groteske Natürlichkeit, man glaubte, die Augäpfel würden zucken wie von geheimem, unerwartetem Leben im toten Holz.
Mein Vater näherte sich schließlich dem gebeugten Rücken von Jost. Er legte ihm eine Hand auf die Schulter und sagte dann:
„Danke, dass Sie uns Ihre Tür geöffnet haben.“
Jost nickte stumm.
„Alsdann!“ Vater griff sich kurz mit zwei Fingern an einen unsichtbaren Mützenrand und stapfte an uns vorbei aus dem Gebäude hinaus. Der anschließende Marsch auf den Berg hinauf geschah lange Zeit stumm. Ich denke, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter Monika grollten, die sie in diese unangenehme Situation gebracht hatte. Beide wagten jedoch nicht darüber zu sprechen, denn ihre Einstellung zu Monika war von Mitleid mit dem vaterlosen Kind geprägt, von dessen Mutter man keine große Meinung hatte.
Im Schwimmbad sprachen wir nun immer öfter über Sissi und Kaiser Franz Josef. Eigentlich über Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. Jörg interessierte sich sehr für den Ungarnaufstand, für die Möglichkeiten des Kaisers, seinem Land Frieden zu sichern und den Menschen dennoch Freiheit zu gewähren. Monika und ich spekulierten über eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Würde Karl-Heinz Böhm seine Frau für Romy verlassen? Da brachte Monika eines Tages eine „Bunte“ mit, die sie aus der Praxis des Doktors genommen hatte, dessen Hund sie ab und zu ausführte. In dieser Illustrierten fanden wir ein Interview mit Romy Schneider, das uns unserer Illusionen beraubte. Romy hasste die Sissi-Rolle. Längst lebte sie in Frankreich, zusammen mit ihrem Verlobten Alain Delon, und sie spielte Theater, feierte Erfolge mit einem Stück mit dem merkwürdigen Titel „Schade, dass sie eine Dirne ist“.
Der Altersunterschied zwischen uns und Romy Schneider wurde uns nun ganz und gar bewusst. Längst war sie nicht mehr das Mädchen aus den Sissi-Filmen. Sie hatte uns mehr als zehn Jahre voraus. In diesen zehn Jahren hatte sich das Mädchen zur Frau verwandelt. Eine Entwicklung, die noch vor uns lag. Unsere Bewunderung kühlte ab. Jörg tat so, als ob ihn Romy nie interessiert hätte, er zog uns auf, indem er uns mit dem Satz begrüßte:
„Na, was macht eure Freundin, die Romy, jetzt gerade?“
Wenn wir uns im Schwimmbad trafen, schwammen wir um die Wette, sprangen vom Sprungturm und danach, wenn Jörg sich gnädig dazu herabließ, spielten wir Karten.
Mehr brauchte ich damals auch nicht. Ich wollte ihm eigentlich nur immer wieder nah sein, ihn verstohlen beobachten, mir sein Bild einprägen, von dem ich den Rest des Jahres über würde träumen können. Ich wollte, ich könnte mit Worten dieses Gefühl der Seligkeit beschreiben, das sich allein aus der Nähe zum anderen nährte, damals, als wir uns noch in jenem vergänglichen Zwischenreich zwischen Kindheit und Erwachsensein befanden. Kein Blick, keine Berührung waren nötig, das Glück brauchte nur das Wissen, dass der andere da war. Das stumme Verharren in einem solchen schweigenden Moment des Beisammenseins war wie eine Versicherung, dass auch der andere dieses selbe Glück der Nähe fühlte.
8
Zu Hause ging das Leben weiter wie bisher. Schule, Klavierunterricht, Konfirmandenunterricht. Eine so genannte „beste“ Freundin hatte ich immer noch nicht, aber ich kam gut aus mit fast allen meiner Schulkameradinnen, fühlte mich nie ausgeschlossen oder einsam. Wir experimentierten mit unserem Äußeren, kauften uns Modemagazine, Nagellack, Hautcremes, probierten Frisuren aus, ich ließ mir die Haare wachsen. Wir hörten Schlager und sangen sie vor uns hin, wenn wir zu dritt und viert nebeneinander von der Schule nach Hause radelten. Wir gingen ins Kino, in Filme ab sechs, ab zwölf. Wir versuchten, so zu gehen und so zu lächeln wie Audrey Hepburn in „My Fair Lady“ und träumten davon, einen älteren Mann, einen Professor Higgins, auf uns aufmerksam zu machen. Allein durch die Verwandlung ihres Äußeren, ihrer Kleidung, ihrer Manieren, ihrer Sprache verwandelte Eliza Dolittle sich selbst. Das beeindruckte mich.
Unsere Lehrer waren nun nicht mehr nur neutrale Respektspersonen, sie waren Frauen, deren Attraktivität wir kritisch bewerteten, und Männer, an denen man möglicherweise Maß nehmen konnte für einen zukünftigen – ja, was eigentlich? Ehemann oder eben einfach nur Mann, denn es rumorte in uns die Sehnsucht nach der Liebe, von der wir immer noch keine Ahnung hatten.
In diesem Zusammenhang sahen wir uns auch um bei den Jungs in den höheren Klassen; wer uns gefiel, darüber tuschelten wir. Und wir verglichen sie mit den fernen bewunderten Männern, vor allem den Filmhelden. Wir schwärmten für Bernhard Wicki, weil wir „Die Züricher Verlobung“ gesehen hatten. Einige von uns bevorzugten Paul Hubschmidt, fanden die glatte Schönheit dieses Mannes nicht so beunruhigend wie Wickis gebrochene Figur, seine scheinbar derbe Männlichkeit. Wir verliebten uns in Rock Hudson und natürlich in Clark Gable, als wir „Vom Winde verweht“ sahen. Es war uns nicht bewusst, dass wir Männer anschwärmten, die schon unsere Mütter bewundert hatten.
Im Vergleich mit den Helden der Leinwand oder den Bildern, die wir uns schufen aufgrund unserer Lektüre, hatten es die Jungs aus unserer Umgebung schwer. Vielleicht waren ihre Bedürfnisse realer. Ihre Blicke jedenfalls verharrten bald länger als angemessen auf uns, vor allem unseren Rücken wagten sie versonnen anzustarren, wenn wir uns durch die langen Gänge des Schulgebäudes bewegten. Und keine von uns Mädchen, ich erinnere mich jedenfalls an keine, konnte sich dabei ihre Unbefangenheit bewahren. Eine Mischung aus Unbehagen und Koketterie ergriff Besitz von uns und verwandelte uns in Kunstfiguren, wir entfremdeten uns von uns selbst, beurteilten uns wie mit den Augen anderer und waren meist unzufrieden mit dem, was wir dabei sahen.
Ich beschäftigte mich mit mir selbst mehr als mit dem Lernstoff. Meine Leistungen ließen nach, meine Energie vertrocknete, die Apathie der Pubertät nahm Besitz von mir. Ich verkroch mich mehr und mehr in die Welten meiner Bücher. Inzwischen verschlang ich die Fortsetzungsromane der Tagespresse, die Kurzgeschichten der Illustrierten, die meine Oma sich ab und zu kaufte, ich las, was mir unter die Finger kam.
In mir brannte der Wunsch, erwachsen zu werden, und die Sehnsucht, die Welt zu verstehen, einen Platz in ihr zu finden, an dem ich etwas würde tun dürfen und können. Ich träumte auch von der Ferne, vor allem von Amerika, vom Meer, von Großstädten, in die man eintauchen könnte wie in ein Meer. Diese Träume blieben jedoch abgerückt irgendwo in der Luft hängen. Sie in Wirklichkeit zu verwandeln, lag mir fern. Der einzige Traum, der immer wieder mit Realität verschmolz, war die Ferienwelt, dort am Rand der Tiroler Berge.
9
Was ich jetzt begonnen habe aufzuschreiben, ist zu heikel, um es in der belanglosen Runde mit den Schulkameradinnen zu thematisieren. Sie sind keine Freundinnen, sie sind Menschen, die zufällig neben mich gewürfelt wurden, irgendwann einmal vor langer Zeit. Dass ich jetzt an die gemeinsame Zeit anknüpfe und dass sie mich anknüpfen lassen, hat sicherlich verschiedene Gründe. Einer davon ist der, dass wir Zeit haben füreinander. Ruhestand heißt das Schlagwort. In jeder von uns ist jedoch auch der Wunsch, das, was wir damals waren und wollten, mit dem zu vergleichen, was nun aus uns geworden ist.