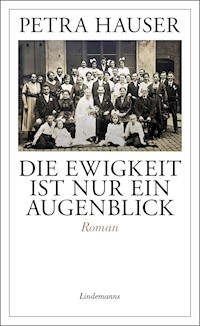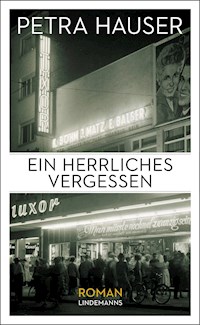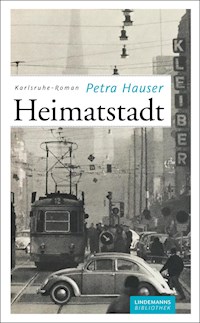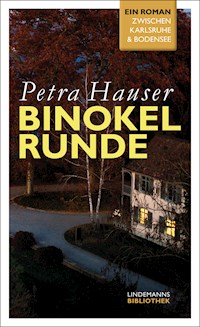Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lindemanns Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Der große Karlsruher Roman-Erfolg jetzt in der 5. Auflage. Von drei Generationen Karlsruher Leben zwischen 1890 und 1950 erzählt Petra Hauser in ihrem Roman - vom angenehmen Leben inmitten der feinen Gesellschaftskreise, vom schönen Haus in der Karl-Friedrich-Straße, den Sommerfrischen auf dem nahen Dobel ... Der großherzogliche Theatermaler Albert Wolf und seine Frau Lise sind in der Welt der Oper zuhause, mit der immer härter werdenden Realität können und wollen sie sich nicht abfinden. Die Töchter Elisabeth und Karola verleben eine traumhafte Kindheit, doch allmählich ändern sich die Zeiten auch für sie. Während Karola in die Durlacher Gesellschaft einheiratet, muss sich Elisabeth in den 1930er Jahren mit aller Kraft gegen den "deutschen" Zeitgeist stemmen, um den Mann heiraten zu können, den sie liebt. In atmosphärischen Bildern schildert die Karlsruher Autorin - deren erfolgreicher Debütroman in kürzester Zeit bereits in der dritten Auflage vorliegt - das Schicksal einer Familie, die vom Strudel der historischen Ereignisse erfasst wird und beinahe darin untergeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für Isa,
die mir ihre Erinnerungen geschenkt hat,
& für Max, Leo und Victoria Sophia
Petra Hauser,geb. 1950 in Karlsruhe, hat in Heidelberg Germanistik und Anglistik für das Lehramt an Gymnasien studiert. Sie unterrichtet heute in verschiedenen Institutionen der Erwachsnenbildung Englisch und Literatur.
Petra Hauser
Das Glück
ist aus Glas
Ein Karlsruhe-Roman
Dass sie einander haben,
einander in den Armen halten können,
ist wie ein Panzer um ihre verwundeten Seelen;
trübe Gedanken prallen ab
und fallen in das Loch einer Nacht,
die sie wie viele überleben.
Erster Teil
1
„Nein, Vater, ich will nicht zu den Soldaten!“
Im August 1877 sitzt der Lehrer Andreas Wolf am großen Esstisch in seiner Wohnung in der Karl-Friedrich-Straße 4, bei ihm nur noch sein dritter Sohn, der vierzehnjährige Albert.
„Maler will ich werde! Die Louis’ sagt, ich hab Talent. Sie hebt alles auf, was ich zeichne und male und guckt es immer und immer wieder an, grad, als ob es sie glücklich machen würd’.“
Louise ist die älteste Tochter von Andreas Wolf. Sie wurde nach seiner Frau benannt. In jener Zeit benennt man älteste Kinder nach dem Vater oder der Mutter. Einmal deshalb, weil man während der Schwangerschaft viel zu abergläubisch ist, um sich Gedanken über Namen zu machen, und dann deshalb, weil man nach den Hausgeburten so erschöpft ist, dass man einander nur noch selig in die Augen blicken kann, dann auf das Kindchen, und jeder den Namen des anderen haucht, voll Dankbarkeit, dass alles vorbei ist. Das erste Kind heißt also Louise.
Beim zweiten ist das Wunder nicht mehr so groß und der Verstand hat sich leise eingeschaltet. Es mag sogar zu Gesprächen gekommen sein zwischen den Eheleuten. „Emil würde mir gefallen“, sagt der Vater. Seit Wochen liest er wieder in dem französischen Roman, der Frau Wolf gar nicht gefällt; viel zu schwierig ist er für sie. Aber sie liebt ihren Mann und stimmt zu. Der dritte Sohn heißt Friedrich, weil es in jeder Karlsruher Familie mindestens einen Karl oder einen Friedrich gibt. Dann kommt wieder ein kleines Mädchen an. Es heißt Ida. Der Name ist in Mode. Und warum nicht. Andreas Wolf kann zustimmen. Immerhin ist der Berg Ida die Geburtsstätte des Gottesvaters Zeus. „Andreas!“, schimpft Frau Louise und schüttelt den Kopf über ihren Mann, der vor lauter Gelehrtheit so manches Mal vergisst, dass er ein Christ ist!
Dann kommt ganz zum Schluss noch ein kleiner Junge an. Er heißt Albert, nach dem Lieblingsdichter des Herrn Andreas Wolf, Adelbert von Chamisso. Frau Louise erinnert sich an damals, an ihren Hochzeitstag, an dem sie nach den Reden des Brautvaters und des Bräutigams aufgestanden ist und auswendig zitiert hat: „Ich werd ihm dienen, ihm leben, ihm angehören ganz, hin selber mich geben und finden verklärt mich in seinem Glanz.“ Als Anerkennung an ihn, ihren Ehemann, als Dank für die vielen schönen Zeilen, die er gedichtet hat für sie in der Zeit der Werbung. Und als trotzigen Schutz gegen ihren Bruder und den Vater, die statt einem Gelehrten lieber einen Kaufmann gehabt hätten in der Familie.
Albert sagt also dem Vater, dass er nicht Soldat werden wolle. Der Vater ist nicht sehr traurig darüber. Es war ihm nicht ernst, als er seinem jüngsten Sohn vorschlug, zu den Soldaten zu gehen, nachdem er gerade von der Einweihung des Kriegerdenkmales am Ettlinger-Tor-Platz gesprochen hatte. Wenn er es recht bedenkt, war dieser Hinweis auf den Soldatenberuf in der Tat nicht besonders klug gewählt. Die Ehre der Namensnennung auf einem solchen Denkmal setzt schließlich den Tod voraus. Einen gewaltsamen, vorzeitigen Tod.
Heute hat die Badische Zeitung die 266 Namen der gefallenen Soldaten abgedruckt und dem Stolz der Stadt, dieser kleinen Provinzhauptstadt, Residenzstadt, Ausdruck verliehen, ihren Beitrag geleistet zu haben zu jenem einmaligen großen Sieg, dem die Gründung des deutschen Reiches folgte, das nun blüht und gedeiht von seiner Hauptstadt Berlin bis hierher ins badische Ländle.
Herr Wolf drückt seinen Kneifer auf die breite Nase und greift in die kleine Seitentasche an seiner Weste, um mit dem Daumen den Ring zu fühlen, der die silberne Kette in einer Schlaufe hält. Das hätte ich mir denken können! Der Albert ist anders. Kein Kaufmann, kein Gelehrter. Er ist ein sehr sensibles Kind und hat ein schönes, in sich ruhendes „Ich“. Aber es fehlt ihm die Energie seiner Brüder und deren schnelles Mundwerk. Sein Bedürfnis nach Liebe und Beachtung ist dennoch mindestens ebenso groß wie das ihre, wahrscheinlich aber um einiges größer. Seit er entdeckt hat, dass er ein anerkennendes Lächeln auf die Gesichter zaubern kann mit seinen Zeichnungen, die er, im Winkel eines Zimmers sitzend, in wenigen Sekunden verfertigt, strichelt und zeichnet er den ganzen Tag. Man muss dem Einhalt gebieten, sonst wird er in diesem Jahr das Klassenziel nicht erreichen.
Herr Wolf ist ein lieber, sanfter Mann. Einer, der seine Kinder nicht schlägt, sondern sie an die Hand nimmt, mit ihnen in den nahen Schlosspark geht und sie dort auf die prächtigen Rosenblüten in den Rabatten hinweist, sich hinunterbeugt mit ihnen zu den Gräsern und Kleeblättern am Wegrand, ein Blättchen abzupft, es nah ans eigene Auge führt, dann den Kindern überlässt und mit ihnen zusammen den Bauplan der Natur bewundert, wie er es nennt. Andreas Wolf ist ein selbstbewusster Bürger seiner Stadt, auch ein ergebener „Sohn“ seines Landes, der den Großherzog mit gezogenem Hut grüßt, wenn er in seiner Kutsche vorüber fährt, und seinen Söhnen erklärt, dass auch sie einen „Diener“ machen sollen, denn das ist unser Landesherr, der die väterliche Hand über uns hält. Andreas Wolf weiß, dass Güte und Milde weiter bringen als Zwang. Die beste Taktik bei der Kindererziehung ist Geduld und stille Wachsamkeit, das ist seine Meinung. Er ist ein Schöngeist, der an seinem Schreibtisch sitzt, die Korrekturen zur Seite schiebt und Gedichte auf lose Blätter kritzelt. Der diese Blätter heftet mit einer Kordel und sie seiner Frau zum Geschenk macht, obwohl er weiß, dass sie seine Poesie aus Liebe zu ihm lesen wird, nicht aus Interesse, obwohl er weiß, dass sie sich von ihrem Bruder ab und zu Sticheleien einhandelt, die auf ihren reimenden, sanften Mann zielen.
Sie ist eine kluge Frau. Sie weiß, dass sie auf ihren Bruder zählen kann, wenn es ernst wird. Immerhin, der Bruder ist „Kommerzienrat“, Firmengründer der „weltberühmten“ Kosmetikherstellung „Kaloderma“, wie Louise ihn ab und zu stolz verteidigt. Aber er ist Kaufmann, das Künstlerische ist ihm fremd. Er verwaltet den Teil ihres Geldes, den sie vom Vater geerbt hat, und er hat mit einer gewissen Großzügigkeit verfügt, dass sie dieses Haus allein besitzen soll, zum Ausgleich wurden ihre Geschäftsanteile gekürzt, aber in einem kunstvoll gedrechselten Vertrag steht es auch schwarz auf weiß, dass der Kommerzienrat Wolff dereinst seinen Neffen Friedrich, genannt Fritz, in seine Firma aufnehmen wird und neben seinen eigenen Söhnen am sich vermehrenden Vermögen beteiligen wird.
Durch Heirat hat Frau Louise eines ihrer „f“ eingebüßt. Aus Louise Wolff wurde Louise Wolf. Sie ist in die zweite Reihe gerückt, aber immer noch gehört sie und damit ihr Mann und ihre Kinder zu jenem Zirkel wohlhabender Familien, die der Stadt ihr Profil geben, zu denen man aufschaut, weil sie sichtbarer sind als der Adel und interessanter als die Kleinbürger, die mit vorsichtigen Schritten durch die Hauptstraßen huscheln, schnell wieder dem Osten, dem Süden der Stadt zustreben, wo sie sich in hohen Stadthausblöcken eingerichtet haben mit ihren Kohldüften, ihrem Kindergeschrei, den stinkenden Toiletten im Hof, mit ihrer derben Aussprache und den schwelenden Protestgelüsten vergangener Tage.
„Warum nicht“, kommentiert Andreas Wolf also die Ankündigung seines jüngsten Sohnes und denkt, wir werden schon sehen. Die halbherzige Zusage und der verschwiegene Zweifel kommen bei seinem Sohn an wie ein Segen für seine Zukunft. Eines Tages wird er sich darauf berufen.
2
Major Spoerin steht in seinem Arbeitszimmer, hat den Uniformrock noch an, aber aufgeknöpft, den Kragen abgenommen. Die Hände hat er auf dem Rücken ineinander gekrampft, er starrt aus dem Fenster. Er war dabei, er hat vor dem Denkmal gestanden, als es enthüllt wurde, direkt neben seinem Duzfreund, dem Prinzen Wilhelm und dessem kleinen Sohn Max.
„Sorgen?“, fragte der Prinz seinen „Babbel“- und Zechkameraden, denn der Major sah abgespannt aus und verstört.
Dass der Major vor wenigen Wochen seinen um einiges älteren Bruder begraben hatte, hätte dem Prinzen geläufig sein müssen, wenn er etwas mehr Interesse aufbrächte für diese Stadt, zu der er gehörte, denn immerhin war der Bruder des Majors der Leiter des örtlichen Bahnhofs gewesen und als solcher durchaus auch ab und zu vorstellig im Schloss. Aber der Prinz ist ein Prinz von Gottesgnaden wie in alten Zeiten vor den Revolutionen, also ein Prinz von Geburt an, nicht aus Überzeugung, und als Berufung betrachtet er seinen Stand schon gar nicht. Als dritter Sohn steht er im Schatten anderer und kann dort ein ganz behagliches Leben führen. Sich auch mit bürgerlichen Militärs durch die Kneipen trinken und dabei schwadronieren über die Jagd, die Berliner Etablissements, die er regelmäßig und gerne aufsucht und die, wie ganz Berlin, Welten – wirklich, mein Lieber, Welten! – entfernt sind von Karlsruhe, diesem verschlafenen Operettennest mit all seiner bürgerlichen Behaglichkeit, seinem lobenswerten Mittelmaß, seiner Provinzialität.
„Ja, in der Tat! Sorgen.“ Aber will der Prinz wirklich wissen, was ihn bedrückt?
Der Tod des Bruders hat ihm vom einen auf den anderen Tag eine Familie beschert. Diese brüderliche Familie, diese Hinterlassenschaft, die Witwe und die beiden Kinder, ein Mädchen und ein Junge, liegt nun auf den gestrafften Schultern des Majors. Er hat seine Schwägerin immer bewundert für ihre heitere Ausgeglichenheit, mit der sie gegen das schwere Blut seines Bruders und gegen dessen düstere Skepsis anhielt. Nun aber scheint sie ihm unerreichbar. Sie schlägt die Augen nieder, wenn er sie um ihre Meinung bittet, errötet gar wie eine Jungfer, sie spricht nur das allernötigste mit ihm und mit ihren Kindern. Stundenlang sitzt sie am Klavier. Bach-Präludien perlen wie romantische Elegien durch die verschlossene Tür. Ganz selten auch singt sie mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme „Ach, ich habe sie verloren“ oder singt sie „ihn verloren“? Hat sie ihn geliebt? Den um vieles älteren Mann, diesen ein bisschen sturen, fadengeraden Beamten?
Jetzt jedenfalls lebt sie in seinem Haus, in seiner Wohnung. Die Kinder sind für zwei Wochen bei Verwandten in Mannheim. Das Mädchen hat seinen freien Tag. Er öffnet das Fenster und lässt die milde, warme Sommerluft ins Zimmer wehen. Dann setzt er sich und windet seine Füße am Stiefelknecht aus den engen Lederschäften, wirft den Uniformrock auf eine Stuhllehne, wechselt Hemd und Hose. Mit festem Griff öffnet er die Tür, schnell hinüber über den Flur, ein kurzes Klopfen, dann betritt er das Wohnzimmer.
„Gertrude, wollen wir spazieren gehen?“
Sie gehen oft spazieren. Sonst mit den Kindern zusammen. Aber heute nur zu zweit.
Schnell erreichen sie den Stadtrand. Obstbäume säumen den Erdweg, das Gras ist gelb, die Wiesenblumen lassen schon die Köpfe hängen. Es hat schon viele Tage nicht mehr geregnet. Die Luft ist eine warme Hülle, die die innersten Impulse nach außen lockt.
„Bist du zufrieden mit deinem Leben, Gertrude? Vermisst du ihn?“ Ruhig geht sie neben ihm her. Wird sie ihm antworten?
Sie hat ihm geantwortet, ein erstes Wort gefunden als Brücke zum Schwager. Es ist ein Liebespaar aus ihnen geworden. Für eine gewisse Zeit. Und nach etlichen Jahren soll sie ein Kind erwartet haben von ihm. Damit war der Schein gesprengt, die Wohlanständigkeitsfassade zerbrochen. So machte sie sich eines Tages auf, nahm nur ihre Handtasche mit und einen Schirm und fuhr mit dem ersten Zug am frühen Morgen zurück in ihre Heimatstadt Mannheim. Dort wusste sie einen Ort, den sie geliebt hatte als Kind, dorthin zog es sie, sie packte sich Steine in die Manteltaschen und überließ sich langsam dem grauen Wasser, ohne oder mit Gewissensbissen, denn ihre Tochter hätte die Mutter noch gebraucht. Sie war jung und schön und musste sich doch einen Mann wählen, oder sich wählen lassen. Wer also konnte sie nun beraten, welcher der richtige für sie wäre?
Der Sohn vermisst sie, die Tochter vermisst sie. Dann fordert das Bewusstsein der eigenen Lebendigkeit seinen Tribut, das Leben geht weiter.
Zwei Waisen sind nun also zurückgeblieben. Gertrude Annas Sohn hatte gerade auf Anraten des Majors, seines Onkels, die Schule mit dem Einjährigen beendet, um eine kaufmännische Lehre bei einem angesehenen Betrieb zu beginnen. Der Onkel hatte seine Beziehungen spielen lassen. Gertrude Annas Töchterchen war bereits als junges Mädchen eine Schönheit, ihr Haar hatte einen warmen Goldschimmer, die Augen etwas Kesses, sie war schlank und doch rundlich dort, wo es gebraucht wird, sie war intelligent genug, zu schweigen, wenn sie nichts wirklich Wichtiges zu sagen hatte, und zu reden, was den anderen gefiel, sie konnte sticken, häkeln, stricken, sie war musikalisch, spielte Klavier, besser als all ihre Freundinnen, und sie hatte eine schöne, warme Sopranstimme. In der Tanzstunde folgten ihr die Blicke der am Rande aufgereihten Mütter mit Respekt, der schon fast in Neid umschlug, es sei denn, diese Mütter hatten auch noch einen wenige Jahre älteren Sohn, für den man Vorschau halten musste. Immerhin, sie war eine Waise, aber doch die Tochter des Bahnhofsvorstehers und Nichte des Majors, den man im Dunstkreis des Hofes gesehen hatte.
3
Die 48er-Revolution des 19. Jahrhunderts wirkte in Karlsruhe kaum nach. Ein paar Gesetzesretuschen ergaben sich, aber wer sprach darüber? Das Heer der Armen, die klagend durch die Straßen zogen, passte nicht hierher. Die Bevölkerung, auf die es ankam, das satte Bürgertum, blieb dem Hof treu, und diese Treue prägte das Klima in der Stadt.
Die Karlsruher Bürger sahen auf die großherzogliche Familie mit Stolz und Achtung, sie kopierten manches und distanzierten sich von vielem, was sie dort sahen, das war der Bürgerstolz, das war auch das Selbstbewusstsein der Handwerker, mit ihrer Hände Arbeit und gekrümmtem Rücken das Leben der hohen Damen und Herren wesentlich mitgestalten zu können, wenn es vielleicht auch nur um das Funktionieren der Wassertoilette oder des elektrischen Lichtes ging.
Die Karlsruher Bürger schielten auch nach unten, bestaunten das wachsende Proletariat, welches sich in den schnell aufschießenden Häuserblöcken der „Bahnhofsvorstadt“ einrichtete und rasch vermehrte.
Man sah auch auf die „Künstler“, das Theater mit den Schauspielern und Musikern. Man sah auf die Maler und Bildhauer, die Schriftsteller. Viele von ihnen kamen in Anzügen, mit Hut und Spazierstock daher, gerade so wie die Beamten und die Herren Fabrikbesitzer. Bürgerlich.
Karl Spoerin und seine Schwester Elisabeth, die beiden Kinder der durch Selbstmord geendeten Schwägerin des Majors Spoerin, essen, trinken, leben.
Karl findet mühelos Zugang zur Jeunesse dorée der Stadt. Da treffen sich Bürgersöhne, der heranwachsende Adel, Geldadel und die Söhne und Töchter jener Handwerker, die schon kleine Unternehmer sind. Beamter zu sein ist eine gute Sache, Beamtenwaisen haben keine goldenen Betten, aber sie besitzen alles, um sich weiterhin selbstbewusst in ihrer Schicht zu bewegen: die richtige Erziehung und den äußeren Schein.
Karls Charme, sein gutes Aussehen, die Tatsache, dass er um sich Fröhlichkeit und gute Laune verbreitet, machen ihn zum gern gesehenen Gast bei vielen „Gesellschaften“ in Privathäusern und halbprivaten Zirkeln. Er kann Klavier spielen, singt dazu, auch eigene Vertonungen frivoler oder frecher Verse, und besitzt den Takt, seine Darbietungen exakt der Stimmungslage seines Publikums anzupassen, ihrem Alkoholpegel, der Wärme ihrer Wangen, ihres Blutes. Er hat ein Gespür dafür, wie viel er wagen kann, und seine Wagnisse liegen immer gerade so viel vor dem Mut der anderen, dass diese ihn dafür bewundern.
Oft nimmt er seine hübsche kleine Schwester mit, hält ihr die Ohren und Augen zu, wenn es einmal allzu toll zugeht, bringt sie nach Hause, bevor er mit seinen Zechkameraden noch einem „Etablissement“ zustrebt, wo man einen angeregten Abend in eine Nacht münden lässt, in der sich alle bürgerlichen Vorbehalte in blauen Dunst auflösen.
Irgendwann einmal treffen die Spoerin-Geschwister auf Albert Wolf. Auch er hat inzwischen den Vater verloren. Die Familie hat heiße Tränen um den geliebten, sanften Andreas Wolf geweint, seine Witwe hat dafür gesorgt, dass er einen guten Platz bekommt auf dem neuen Friedhof.
Albert sollte nach dem Einjährigen in die Fabrik zum Onkel.
„Nein“, hat Albert gesagt, „ich will Maler werden. Der Vater war damit einverstanden. Er hat’s mir zugesagt.“
Keiner weiß davon, aber man hält für wahrscheinlich, dass es stimmt, denn erstens hingen die zwei aneinander wie Zucker und Zimt, zogen immer Hand in Hand miteinander aus, um die Natur zu bestaunen, und lasen sich gegenseitig Gedichte vor; und zweitens ist der Albert ein grundanständiger und ehrlicher Bursche, er würde nicht lügen; und drittens wirft die Fabrik inzwischen so viel ab, dass man sich einen Künstler in der Familie durchaus leisten kann.
Also darf Albert zuerst die Kunstgewerbeschule besuchen und lernt dort Technik, Perspektive, zeichnen, malen, drucken, Gipsmodelle fertigen und Umgang mit Holz, mit Stein, alles von Grund auf wie ein Handwerk. Seine runden Hände, die kräftigen, biegsamen Finger schmiegen sich um den Werkstoff, packen ihn, um ihn zu formen; den Stift und den Pinsel hält er, indem er Zeige- und Mittelfinger auf den Stift stützt und ihn sich damit sichtbar unterwirft.
Er besteht mühelos die Aufnahmeprüfung der Akademie. Jetzt hat er einen Ruf ans Hoftheater erfahren und wird dort in den Theaterwerkstätten als rechte Hand des technischen Direktors Ludwig Dittweiler für das Herstellen der Kulissen mitverantwortlich sein. Eine feste Stelle! Jetzt fehlt ihm nur noch eine Frau.
Als er Karls Schwesterchen das erste Mal sieht, ist sein Schicksal besiegelt, so drückt er es aus. Sie ist wunderschön, sie ist lieb und sie lächelt wie ..., nicht wie ein Engel, eher wie Susanna in Figaros Hochzeit oder Adina im Liebestrank, so ein ganz kleines bisschen kess, herausfordernd. Aber wenn ihr einer nahekommt, das hat Albert schon bemerkt, dann schlägt sie die Augen nieder, weil sie ein anständiges Mädchen ist. Neben der Arbeit im Theater, den Entwürfen für die nächsten Opernpremieren, neben den Dekorationen für den Hof und seine große Neujahrsgesellschaft wälzt Albert nun Möglichkeiten, wie er sich ihr nähern kann.
Die Tochter der Gertrude Anna fühlt sich wohl in ihrer Haut, das sieht man ihr an, aber nicht immer in Gesellschaft. Einmal hat sie da gestanden und auf die Freundin gewartet, die sich noch einmal pudern musste, da hörte sie hinter vorgehaltener Hand zwei Matronen tuscheln.
„Das Schennerle hat ja einen Verehrer. Ist das nicht der Sohn vom Bahnhofsvorsteher Spoerin? Der soll sich doch ...“
„Nein, das ist anders. Sie, seine Frau, soll sich ... ist ins Wasser gegangen. Mein Gott, als ob‘s keine dezentere Lösung gegeben hätte. Das ist doch was für Dienstmädchen, das Wasser.“
„Wo kam sie eigentlich her, seine Frau? Nicht von hier.“
„Nein. Eine Fremde. Von Mannheim, glaub’ ich.“
„Ach so! Aber der Sohn ist ein hübscher, netter Kerl. Intelligent, strebsam. Arbeitet bei ‚Junker und Ruh‘. Und soll sich schon einen Namen dort gemacht haben.“
„Also glaubst du, er hat Chancen bei der kleinen Printz?“
„Das glaub ich sicher. Die Jenny ist die dritte Tochter. Und die Brauerei geht sowieso an den Sohn.“
„Aber das Mädchen, die Schwester vom Karl. Sie muss darauf schauen, dass man ihre Mutter ganz vergisst. Sonst sehe ich ziemlich schwarz für sie.“
Plötzlich steht sie da vor den beiden Matronen, macht einen Knicks und schlägt die Augen dabei nieder. Die Musik hat gerade aufgehört, alle sind ein bisschen erschöpft vom Tanzen, vom Schwätzen, vom Trinken.
„Guten Tag“, sagt sie. „Ich bin Lise, die Tochter von Gertrude Anna Spoerin, geborene Mayer, aus Mannheim.“ Dann rafft sie ihre Röcke, greift nach dem Fächer, der an einem rosa Seidenband lose an ihrem Handgelenk baumelt, und öffnet ihn geschickt mit einer schnellen Wendung der Hand. Sie eilt durch den Raum und hält da und dort an, wo andere Frauen und Männer beieinander stehen, sie knickst und sagt ihr Sprüchlein auf, und irgendwann steht sie auch vor den jungen Burschen, die sich um denFlügel scharen, um ihren Bruder Karl. Albert steht auch bei ih-nen,hat gehofft, dass die Schwester die Nähe des Bruders suchen würde und er im allgemeinen Gewimmel auf sie stoßen könnte. Wie zufällig. Er sieht die Röte in ihrem Gesicht, er sieht ihre Augen schimmern, sieht, dass die zierliche Hand, die mit überschnellem Geflatter den Fächer führt, im ellenbogenlangen Glacéhandschuh zittert. Da tritt er an sie heran, greift ganz zart ihren Ellbogen, und bevor sie zu Ende gesprochen hat, zieht er sie weg, hinaus auf den Balkon, stellt sich neben sie, schweigt, wartet, bis sie sich wieder gefasst hat.
„Schenken Sie mir den nächsten Tanz?“
Sie sieht ihn an, ihr Blick kommt wie von weit. Sie sieht ihn das erste Mal, sein Lächeln mit geschlossenen Lippen, die Augen, die humorvoll blitzen. Sie spürt seine Konzentration auf ihre Wünsche, spürt, wie er alles, was er will, zurückhält und nur auf ihre Zustimmung wartet.
„Ja!“, lächelt sie zurück.
Das ist der Anfang. Sie hat das Startsignal gegeben.
Jetzt kann Albert mehr wagen, kann ein Kuvert abgeben in ihrem Haus. „Das muss das Fräulein sofort erhalten.“ Die alte Mina nickt und tut, was ihr der junge Herr sagt.
Die Tochter der Gertrude Anna öffnet das Kuvert und sieht ein großes Blatt, darauf mit Feder in schwungvoller Schrift ein Gedicht. Um die Zeilen ranken sich Maiglöckchen und Vergissmeinnicht, winzig kleine Blütenblättchen. Lise berührt sacht mit den Fingern die Farbe, die sich ihr spürbar entgegenkräuselt, sie nimmt das Blatt näher ans Auge und sieht, was schimmert, ist nur ein Tupfer Grau, ein Tupfer Weiß, winzige Farbpünktchen, es können höchstens zwei oder drei Pinselhaare gewesen sein, die das vollbracht haben. Er ist verliebt in mich, denkt sie, und er ist wirklich ein Künstler, dazu noch ein lieber, freundlicher Mensch, ein sanfter Mann, nicht gerade ein Adonis, doch mit diesem breitrandigen Hut und dem Anzug aus bestem Tuch macht er eine gute Figur. Außerdem gehört er zu einer der angesehensten Familien der Stadt. Lise, die Tochter der Gertrude Anna, lächelt in sich hinein, ist stolz und vergnügt. Es gibt keine Mutter, keinenVater, denen sie das beichten müsste, damit sie auf das Wohl ihrerTochter schauen könnten, denn was zwischen einem Mann und einer Frau passiert, muss bestimmte Formen einhalten, und Eltern denken immer gleich an Heirat. Lise will erst einmal die Anbetung all ihrer Verehrer genießen und sich dann den besten aussuchen. Der Onkel ist so abgerückt in seinem Studierzimmer, er wird lange nicht merken, dass es hier einen ernsten Bewerber gibt, wenn der Karl mich nicht verrät, denkt sie. Sie nimmt die Karte und legt sie zwischen ihre Wäsche in den Schrank.
Schöne Menschen stehen anders im Leben. Bevor sie „ich“ sagen oder denken können, erfahren sie so viel Zuwendung, dass sie in eine Hülle von Anspruchsdenken und Erwartung verpackt daher kommen.
Lina Schuberg, die beste Freundin der Lise Spoerin, erfährt als Einzige von Albert Wolf. Da gesteht sie Lise in einem traulichen Gespräch beim Spaziergang unter duftenden Bäumen, wie sehr verliebt sie sei in Karl, Lises Bruder. Das wäre doch schön, wenn sie in einer Doppelhochzeit vereinigt werden könnten.
„Ach Gott Lina, sei nicht so romantisch! Schlag dir den Karl aus dem Kopf. Der passt überhaupt nicht zu dir. Er ist in die Jenny Printz verliebt und die wird er auch heiraten. Sie sind schon heimlich verlobt.“
Lina beißt sich auf die Lippen. „Aber er hat ja noch nie richtig mit mir gesprochen. Er kennt mich doch nicht wirklich.“
„Eben, siehst du. Er bemerkt dich nicht und sein Kopf ist voll von Jenny, der ‚Printzessin‘.“ Für die schöne, stolze Tochter von Gertrude Anna ist das Thema damit erledigt. Vielleicht zieht sie die Freundin ab und zu noch auf: „Na, immer noch Liebesschmerz wegen meinem Bruder oder hast du inzwischen ein anderes Herz erobert?“
Lina schweigt und leidet – die Freundinnen sind entzweit. Wenn sie einander begegnen, zufällig, haben sie einander nichts mehr zu sagen. Höfliche, kurze Briefe, die in Kenntnis setzen über die großen Veränderungen in ihrem Leben, sind alles, was die beiden noch verbindet. Lina begräbt ihren verletzten Stolz, ihren Schmerz über die Aussichtslosigkeit einer innigen, einseitigen Liebe tief in ihrem Herzen. Ihre Freundin macht sich keine Gedanken darüber. Irgendwann, viel, viel später wird Lise herabfinden von ihrem hohen Ross.
Für Lise Spoerin und Albert Wolf beginnt die Zeit der Werbung. Billets werden einander zugesteckt, worauf man sich verschlüsselt Hinweise gibt, wo man sich das nächste Mal treffen kann, und man trifft sich in Begleitung all der anderen jungen Leute, die Feste feiern, die zusammen durch die öffentlichen Gärten der Stadt promenieren, den Tiergarten, den Stadtgarten. Sie spazieren zum Schützenhaus in den Hardtwald, trinken dort Apfelmost und singen Lieder, haken sich ein und schunkeln im Takt der Musik hin und her. In der Dämmerung kann man auch mal richtig nah zusammenrücken, und verstohlen findet eine kleine Hand in eine große, warme mit kräftigen, biegsamen Fingern, die diese kleine Hand packt, um sie zu besitzen.
Für Albert war es eine ernste Sache vom ersten Blick in Lises Augen, für Lise war es noch ein Spiel, sie war gerade achtzehn geworden.
Karl mag den Albert, weil ihn jeder mag, man muss ihn einfach mögen. Karl wäre der Albert lieber für die Lise als jeder andere seiner Spießgesellen, denn von den anderen weiß er zu viel, hat sich zusammen mit ihnen rumgetrieben dort in plüschigen Hinterzimmern der Stadt und hat ihre zotigen Witze mit angehört. So einen will er sich nicht mit der Schwester im Tête-á-tête vorstellen; deshalb macht Karl dem Onkel Spoerin, dem Major, schließlich eine Andeutung, und der richtet es ein, dass sein Spaziergang ihn wie zufällig am Haus in der Karl-Friedrich-Straße vorbeiführt, wo die Schwestern Alberts eine Niederlassung der Parfümeriefabrik führen, ein schönes Geschäft mit den edelsten Accessoires aus aller Welt und dazwischen Kaloderma-Seife, der Verkaufsrenner der eigenen Produktion. Der Major betritt das Geschäft, kauft einen Schildpattkamm und lässt sich die neuen Nagelpolierpolster zeigen. „Aus dem Leder ungeborener Ziegen, mein Herr“, sagt die nicht mehr ganz junge Frau; das muss wohl eine der Besitzerinnen sein. Sie bedient ihn, ohne dabei dienstbar zu sein. Stolz trägt sie den Kopf, die Schultern sind gestrafft und ihr Blick sagt: Du und ich auf gleicher Ebene.
Also gut. Der Albert Wolf darf kommen, sich beim Major vorstellen.
Lange sprechen die zwei im Studierzimmer miteinander. Lise ist nicht da, sie erfährt es erst später, als der Onkel sie zu sich ruft und die Stirn in Falten wirft, lange herumdruckst, bevor er herausrückt mit seinem Anliegen.
„Den Albert Wolf, magst du den?“
„Ja sicher. Der ist lieb. Er malt so schön. Und tanzen kann er auch gut.“
„Lisele, der Albert will dich heiraten. Ich sag dir was. Du bist noch jung und es gibt viele Burschen mit schönen Augen und einem strammen Rücken hier. Ich sehe schon, dass sie um dich schwirren wie die Motten ums Licht. Aber das sag ich dir, der Albert, das ist ein ganz besonderer Mensch. Und wenn so einer will, dann soll man nicht lange überlegen. Es könnte sein, dass man nur einmal im Leben so eine Chance hat!“
Also sagt sie Ja und es wird die Verlobung der Lise Spoerin mit Herrn Albert Wolf angezeigt auf schönem Büttenpapier mit Reliefdruck, der ein Maiglöckchen und ein Vergissmeinnicht darstellt, die sich ineinander schlingen.
Jetzt können die beiden sich auch ohne die Eskorte der anderen jungen Leute in der Öffentlichkeit zusammen zeigen und bewegen und können auch hinaus ziehen in die Wiesen vor der Stadt, wo Albert seine Staffelei aufbaut und Lise malt, wie sie ihn anschaut; das rote Sonnenschirmchen hält sie schräg über den Kopf.
Zu Hause hat Lise jetzt viel zu tun. An ihre Aussteuer war bisher nur sporadisch gedacht worden, da fehlt wirklich die Mutter! Aber jetzt, unter Anleitung ihrer zukünftigen Schwägerinnen, die sie sofort ins Herz geschlossen haben und die sich freuen auf diese Hochzeit, füllt Lise ihre Truhe mit Bett- und Tischwäsche, mit Geschirr und Silberbesteck, Messerbänkchen, Zuckerzangen, Eislöffeln und Etagèren. Dann gehen die Brautleute zu Julius Weinheimer, dem Möbelladen, und betrachten dort die Schränke und Betten. Aber nichts gefällt Lise. Die Betten hätte sie gern anders, lieber mit diesen und jenen Schnörkeln, und den Sekretär für ihr Boudoir natürlich in Mahagoni, glänzend, mit vielen kleinen Schubladen und einem Geheimfach. Sicher, das versteht Albert, er kennt sich aus in solchen Dingen. Oft genug hat er mit dem Dittweiler zusammen die Kulissen für die nächste Festvorstellung so geplant, dass die großherzogliche Familie ihren Spaß beim Wiedererkennen von einzelnen Requisiten haben kann, das heißt, er kennt das fürstliche Mobiliar in- und auswendig. Bei solchen Aktionen muss man mit äußerster Vorsicht handeln. Die Anspielung muss eine Huldigung sein. Also darf zum Beispiel der Sekretär der Gräfin in Figaros Hochzeit, an dem sie das Schreiben verfasst – „Wenn die sahanften A-habendlü-hü-hüfte ...“ –, natürlich nicht, das ist ja klar, dem Sekretär Ihrer Hoheit auch nur im Entferntesten gleichen, sonst könnte man ja vermuten, dass der Großherzog wie der Graf gern auf fremden Weiden grast, nein, das geht natürlich nicht, und das weiß der Albert Wolf. Er erzählt seinem „Bräutchen“ alles, was er weiß und was er erlebt. In ihr sammelt sich Stolz über ihren zukünftigen Mann, der so eng mit dem Hof verbunden ist. Bei diesen Gesprächen kann sie auch seinen Humor kennenlernen, seine Empfindsamkeit, auch seine Empfindlichkeiten, seine zarte Seele. Und wenn sie sich verabschieden, küsst sie ihn auf den Mund, atmet dabei den Duft seiner Haut ein, ein bisschen Farbe, ein bisschen Eau de Toilette aus der Familienfabrik und das bisschen Albert darunter, das sie sehr mag, obwohl es fremd ist für sie.
Schließlich ist der Hochzeitstermin festgesetzt und die Wohnung in der Karl-Friedrich-Straße eingerichtet. Jedes Möbelstück ist von Albert entworfen, Hölzer, Stoffe von ihm persönlich ausgesucht, und dann haben die Arbeiter der Theaterwerkstätten in vielen von ihm bezahlten Überstunden die Möbel gefertigt.
Am Tag vor der Hochzeit hat Albert das Gesicht und den Hals voller roter Flecken und ein Kopfweh, dass er meint, er muss sich übergeben. Nicht aus Angst vor dem ernsten Schritt, der vor ihm liegt, sondern weil das Geschenk für seine Braut noch nicht geliefert wurde. Am Morgen nach der Hochzeit sind Alberts rote Flecken und das Kopfweh verschwunden. Das Geschenk ist da: ein Thürmer Klavier, das der Hoflieferant Schweißgut noch gerade rechtzeitig aus Sachsen hat kommen lassen.
Stolz führt Albert seine junge Frau von Zimmer zu Zimmer bis in ihr Boudoir. Sie setzt sich an den Sekretär aus Mahagoni und öffnet die kleinen Schubladen. Albert nimmt ihre Hand und führt ihre Finger an eine geheime Stelle, bis sich mit einem leisen Klick ein Schlitz öffnet und eine Vertiefung freilegt.
„Au!“, schreit sie leise auf, etwas hat wehgetan. Noch mal greifen sie vorsichtig zusammen hinein und holen eine rote Rose heraus. Lise ist selig, so sagt sie später den Schwägerinnen. Selig, wirklich! Und hochzufrieden. Und sie sagt es nicht nur, sie glaubt auch daran und vor allem glaubt sie, dass sie einen guten Mann gefunden hat.
4
Das junge Paar hat im Haus in der Karl-Friedrich-Straße 4, in dessen Innenhofwerkstatt Alberts Großvater einst seine ersten Kaloderma-Seifen und -Cremes herstellte, die Wohnung im „dritten“ Stock bezogen, in Spucknähe zum Schloss und zum Marktplatz.
„Guck, Lisele, wenn Karlsruhe ein Mensch wäre und sein Kopf der Schlossturm von Karlsruhe, dann wohnten wir da, wo man den Herzschlag fühlen kann“, sagt Albert und fasst Lise an die warme, weiche Stelle am Hals, unterm Ohr, wo die Hauptschlagader im Takt ihres Herzens pocht.
Das Leben als verheiratete Frau gefällt ihr. Sie hat ein schönes großes Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Boudoir, die Küche, das geräumige Badezimmer und eine Toilette daneben, dazu kommen das Bügel- und Nähzimmer, Alberts Bureau und das Gästezimmer. Der lange Flur verbindet alle Räume miteinander. Mina hat eine Nichte aus ihrem Heimatdorf mitgebracht, die nun eingelernt wird von dem Mädchen der Schwägerinnen. Diese Nichte heißt Lina. Sie stellt sich gut an, ist fleißig und genügsam, stolz, hier in der Stadt zu sein, dort oben unterm Dach bei den anderen Mädchen zu wohnen, wo es zwar kalt, aber doch meist lustig ist.
Lises Schwägerinnen, Louise und Ida, freuen sich über jede Frage, die Lise ihnen stellt, und auch ihre Schwiegermutter, die alte Louise, die bei ihren beiden unverheirateten Töchtern lebt, ist ihr sehr zugetan. Lise ist klug. Sie lächelt und schaut den Leuten direkt in die Augen. Sie ist glücklich, jetzt eine richtige Familie zu haben, und diese Familie ist groß. Da sind die Brüder ihres Mannes, Emil, der Studienrat, Humanist wie der Vater, aberanders, versichert der Albert, „so ein richtiger Lehrer halt, weißt du! Einer, der dekliniert und erklärt, aber der keine Gedichte schreibt.“ Seine beiden kleinen Mädchen, Gertrud und Ilse, sehen aus wie Puppen, so hübsch werden sie von ihrer Mama ausstaffiert. Dann Fritz, der beim Onkel in der Firma eingestiegen ist, noch vor dem Bau des schönen neuen Fabrikgebäudes am Ostrand der Stadt, mit seiner Emma und den beiden Buben. Emmas verkniffene Lippen und die zögerlichen Antworten, die sie gibt, sind Lise noch ein Rätsel, das sie sich zu lösen vorgenommen hat. Schließlich sind da, ein wenig abgehoben, aber gnädigst doch immer auch zugehörig, die Cousins aus der Seifenfabrik, der Georg und der Friedrich. Der Georg, der Schorsch genannt wird, hat in die Färberei Printz eingeheiratet, die aber nichts mit der Brauerei Printz zu tun hat, leider, sonst hätte Lise jetzt als verheiratete Frau vielleicht ihrem Bruder behilflich sein können, der in seiner Werbung um die schöne, zarte, lichthellblonde Jenny nicht so recht vorankommt. Was hat man denn gegen ihn? Man spürt ihm an, wie ihn diese Kälte und Abweisung versteinert, sein Lächeln ist wie angeknipst, manchmal jedenfalls. Am Schennerle liegt es nicht. Man kann sehen, wie sie nach ihm schmachtet, was soll sie aber machen gegen den Vater und all die Brüder? Es kommt bald noch schlimmer, Jenny wird in ein Pensionat geschickt, in die Schweiz, da ist sie erst mal weg. Jetzt werden Karls Lieder immer frivoler und er wartet nicht mehr, bis die anderen sie hören wollen, er singt sie laut, sie dröhnen durch die Zimmer und Festräume, er greift in die Tasten dabei, als ob er das Klavier zertrümmern wollte, und oft kommt er erst im Morgengrauen nach Hause, riecht nach Rauch und billigem Eau de Cologne. Das vertraut der Major a. D. seiner Nichte an beim Mittagessen, das er nun täglich bei ihr und ihrem Mann einnimmt.
Lise freut sich, dass diese beiden sich so gut verstehen. Der Major nimmt Anteil an Alberts Sorgen und Verstimmungen, die von seiner Arbeit kommen. Es eröffnet sich dem alten Soldaten eine ganz unbekannte Welt, die Ähnlichkeiten mit seiner eigenen hat. Er hat sich eine Broschüre gekauft mit dem Titel „Das Karlsruher Hoftheater“ von Wilhelm Harder, einem Zugewanderten aus Leipzig, „Mit einem Anhang: Die Karlsruher Oper“ von Joseph Siebenroth. Er zieht sie aus seiner Westentasche hervor, umständlich und mit spitzen Fingern, als ob es etwas Kostbares oder Fragwürdiges wäre, setzt den Kneifer auf und liest dem neuen Neffen daraus vor: „In Herrn Dittweiler besitzt unsere Bühne einen ungewöhnlich begabten Dekorationsmaler; unvermeidlich scheint es, dass bei den in dieser Richtung hochgehenden Ansprüchen die maschinellen Einrichtungen manchmal hinter den Erwartungen zurückbleiben.“
„Der hat gut schreiben. Wenn sie uns keinen Ingenieur bezahlen, müssen sie halt mit dem zufrieden sein, was sie kriegen! Und dann kommt der Mephisto halt nicht auf den ersten Schwung aus dem Hades rauf, sondern beim zweiten!“ Albert ist erbost über die „Schreiberlinge“, die mit einer dicken Zigarre und einem Cognac im Café sitzen und sich’s gemütlich dort machen, sich einen Heldenmut antrinken und dann über die hart arbeitenden Spaßmacher am Theater herziehen.
„Albert, das musst du denen auch mal mitten ins Gesicht hinein sagen. Darfst es nicht immer schlucken!“
„Ach, Onkel, das würde meinen Kopf kosten. Nein, das geht nicht. Von oben runter kommt das Sagen, und unten muss gebuckelt und gehorcht werden.“
Ja, das versteht der Onkel gut, so läuft das, Befehle von oben, Gehorsam von unten.
„Und schließlich, wenn’s sogar unserm Großherzog nicht anders ergeht! Der muss doch auch nach der Berliner Pfeife tanzen. Stimmt’s nicht?“
Es stimmt. Das badische Ländle hat viele Privilegien aufgegeben, um das deutsche Reich noch hervorragender mitzugestalten. Man muss bedenken, Politik ist nicht für den Bürger da, der Bürger ist für die Politiker da, für alle, für die, die den Fürsten einflüstern, was sie zu wollen haben, und auch für diejenigen, die sich als Gesangs- oder Turnverein in den Gasthäusern treffen, um sich einzuschwören auf „Veränderungen“.
Lise streichelt ihrem Albert den Ärger weg, sie baut einen Zaun aus Zärtlichkeit und Schmeicheleien um ihn, wenn sie allein sind in ihrem schönen, nach ihren Wunschvorstellungen gefertigtem Schlafzimmer, für dessen Herstellung der Albert einen dicken Batzen gebraucht hat, sich einen Kredit geben ließ vom Cousin, den er jetzt abstottern muss, und das noch ein paar Jahre lang.
Bald nach der Hochzeit sitzt Lise das erste Mal in der Loge, die den Angehörigen der Bühnenleute vorbehalten ist. Sie spürt die neugierigen Blicke von unten und genießt sie.
„Es hat mir so gut gefallen, Onkel, wie die Elisabeth ihre Liebe auf ihrem Gesicht zeigen kann.“ Wagners „Tannhäuser“ hat man gegeben.
Tagelang noch singt Lise „... der Seele, die nach jenen Höh’n verlangt ...“ und von nun an will sie, dass man sie Elisabeth nennt, so wurde sie getauft. Lise, das ist für Kinder, aber sie ist jetzt eine Frau.
Lise besinnt sich gerade rechtzeitig auf ihren richtigen Namen, um dem Kind, das sie nach kurzer Ehe auf die Welt bringt, diesen Namen weitergeben zu können. „Elisabeth“, haucht Albert, als er an ihr Bett eilt und den Schweiß auf ihrer Stirn sieht, die vor Erschöpfung glänzenden Augen.
„Ja, sie soll Elisabeth heißen.“
Am 21. September 1894 wird Elisabeth geboren, Alberts und Lises erstes Kind.
Sie wird geboren in eine heile Welt, sie wird geboren einer Mutter und einem Vater, die sich und sie lieben, in einer Stadt, die gerade begonnen hat aufzublühen, im neuen Kaiserreich, in einem Land, das eine blendende Karriere vor sich zu haben scheint, in Europa, das sich wie eine Schöne zum Ball schmückt, auf einer Welt, die sich noch ein allerletztes Mal durchsortiert hat nach dem alten Muster feudaler Systeme und die gerade in rasender Fahrt auf einen Abgrund zutreibt.
5
Wenn die Exzellenz Bürklin, der oberste Herr des großherzoglichen Theaters, Hof hielt, wurden Albert und Lise eingeladen. Im schönen Palais in der Kriegsstraße, die damals noch eine prächtige Allee war mit stabilen Villen auf Sockeln, jede in ihrem eigenen Gepräge, das spielerisch auf den Geschmack der Herrschaft und des Baumeisters verwies, trifft sich vor allem das Bildungsbürgertum. Dort werden Meinungen geäußert und abgefragt. Man hat eine eigene Meinung, muss sie sich nicht erst von Spezialisten schustern lassen wie im Schloss, oder kann sie sich gar nicht leisten wie im „Eisenbähnlervierdel“ in der Südstadt oder „im Dörfle“.
Albert ist ein sehr geschätzter, charmanter Zuhörer. Jeder meint, dass er ganz einer Meinung mit ihm sei, weil er seine eigene Meinung niemals laut äußert, und hat er denn wirklich eine? Wenn ja, dann ist er überall verständnisvoll, für die Rechten und die Linken, fürs Kapital und die Arbeiter. In Wirklichkeit liegt ihm nur eins am Herzen, das ist seine Arbeit, sind seine Kulissen, die neuesten technischen Raffinessen, Lichtinstallationen, „echtes“ Feuer auf der Bühne, ein „echter“ Wasserfall, und einmal sogar ein echtes Pferd! Phänomenal! Enorm! Der Dittweiler hält nicht viel von „Echtheiten“, aber er wird allmählich alt und müde und gesteht Albert immer mehr Freiheiten zu.
Lise lässt sich nicht kleinreden von den „affigen“ Ehefrauen der Honoratioren, sie macht zu Hause ihrem Albert nach, wie die von Sowieso oder die andere, wie hieß die noch mal, dasaßund wie sie die Zigarettenspitze abspreizte. „So, siehst du, Albertle,und dabei ist ihr die Asche in ihr Dekolleté getröpfelt. Huch da ist sie aber aufgeschreckt, so …“
Albert kugelt sich vor Lachen und freut sich an dem komödiantischen Talent seiner Frau. Sie fühlt sich noch ermutigt dadurch, und bald sagt man im familiären Kreis oder auch in der um gute Freunde erweiterten Runde gern: „Lise, wie sieht der Soundso aus, wenn er einen Handkuss gibt? Wie muss der Gabelsberger sich zu seiner Frau hinaufstrecken, wenn er sie küssen will?“ Lise magnetisiert dann alle Aufmerksamkeit, man lacht sich die gebotene Hochachtung, den erforderlichen Respekt nach oben, unten, neben sich weg von der Seele, bis man selber gut und glänzend da steht. Maden im Speck des Karlsruher Bürgertums. Das ist alles nicht böse gemeint, man will ja nichts als glücklich sein.
Lise ist zwanzig und gerade haben die zehn besten Jahre ihres Lebens begonnen. Es sind auch die zehn besten Jahre im Leben ihrer Tochter Elisabeth, die eben erst geboren wurde. Lise hat sich gewünscht, dass das Kind seinem Vater ähnlich sehen und vielleicht ein bisschen was von ihrem eigenen nüchternen Sinn für das Leben geerbt haben möge. Bald schon stellt sich heraus, es ist anders, das Kind hat die Schönheit der Mutter geerbt und die Liebenswürdigkeit des Vaters, auch dessen Feinnervigkeit, dessen Weichheit, Verletzlichkeit. Man darf das Kind nicht laut ansprechen, dann füllen sich die großen, hellbraunen Augen mit Tränen, über das Gesicht legt sich wie ein Schatten ungläubiges Staunen und der kleine Körper macht sich steif vor Abwehr. Lise kümmert sich um das Kind mit großer Zärtlichkeit, vor allem aber schmückt sie Elisabeth wie eine Puppe, staffiert sie aus mit feinstem Batist und hellrosa Schleifen, Spitzen, wo immer sie hinpassen, auf jeden Fall sind sie raffinierter und auffälliger als die der beiden Cousinen, Gertrud und Ilse, „dem Emil und der Gertrud ihre Mädle“. Stolz führt Lise ihre Tochter spazieren, präsentiert sich und nimmt die Bewunderung der Passanten huldvoll entgegen. Das Kind sitzt in seinem Wagen, schaut mit großen, ängstlichen Augen in die Welt und traut sich nicht zu reagieren auf die vielen fremden Bewunderer. Lises Kinn rundet sich zum Hals hin. Sie hat jetzt eine Tournüre umgeschnallt, der hält sie die voller gewordenen Schultern und den aufgeschnürten Busen entgegen. Die Hüte trägt sie schräg ins hochgesteckte Haar gedrückt, natürlich immer noch Glacéhandschuhe. Die Handschuhe sind eng und schwer an- und auszuziehen, deshalb ist es ihr auch recht, wenn sie jemand auf den Spaziergängen begleitet, der dann dem Kind den Mund säubern kann oder die abgelutschten Fäustchen. Aber ein Kindermädchen braucht sie nicht, sie will ihr Kind selber erziehen. Also wandeln die Schwiegermutter, die Schwägerin und ab und zu auch Lina, das Mädchen, mit raschelnden Röcken neben ihr auf den staubigen Wegen des Schlossgartens oder durch die Karl-Friedrich-Straße bis hin zur Festhalle und wieder zurück.
Lise ist keine Frau, die sich im Muttersein erschöpft. Sie lebt ihre Tage auf die Abende zu, wo sie im Theater in der Loge sitzt und sich anschaut, was aus den Entwürfen ihres Mannes schließlich geworden ist, denn sie nimmt lebhaft Anteil an der Planung, wenn er ihr am Mittagstisch oder beim Abendessen erzählt. Und am Wochenende haben sie immer „eine Gesellschaft“, das heißt, sie haben Freunde und Verwandte zu Besuch oder sie sind eingeladen. Man isst und trinkt, der Tisch wird mit raffinierten zusätzlichen Scharnieren versehen und erlaubt jetzt, mit bis zu 24 Personen besetzt zu werden. Auch ihr Geschirr und die Gläser sind auf diese Personenzahl aufgestockt. Lise weiß genau, was sie will. Albert erfüllt ihr jeden noch so kapriziösen Wunsch, wenn sich auch sein Beutel leert, sein Konto auch und er wieder mal Geld borgen muss beim Cousin aus der Seifenfabrik.
Nach dem Essen geht’s dann ans Klavier. Man hat „Musik für Alle“ abonniert, Potpourris der gängigen Opern und Operetten, Duette und Quartette für mehrere Stimmen. Lises Sopran beginnt mit einem sicheren Ton: „Bei Mä-ännern, we-elche Lie-iebe fühlen, fehlt a-auch ein gu-u-tes He-erze nicht.“ Alberts samtiger Bariton antwortet: „Die sü-üßen Trie-ie-be mi-i-i-i-it zu fühlen, ist dann der Weiber erste Pflicht“ und schließlich zusammen: „Wir wo-ollen uns, der Li-iebe freun, wir leben durch die Li-ieb allein...“
Die Liebe – die Liebe ist eine Himmelsmacht! Operette ist Lise doch noch das Allerliebste. Das Leichte, Unbeschwerte. Sie ist ja noch so jung und das ganze Leben liegt vor ihr.
Zunächst zwingt es sie wieder zum Einhalten, denn ein zweites kleines Mädchen kommt an. Elisabeth ist jetzt schon groß, drei Jahre alt, sie trägt kürzere Röcke und geschnürte Stiefelchen aus Ziegenleder, weil sie selber gehen kann, springen, tanzen, allerliebst. Sie ist eine Freude für die vielen Erwachsenen im ganzen Haus, wird von Hand zu Hand gereicht, immer gibt es einen, dessen Aufmerksamkeit ihr ganz und gar zugewandt ist.
Albert kann nun „Elisabeth“ hauchen am Wochenbett seiner Frau, das hilft nicht mehr, der Name ist vergeben. Lise ist auch längst nicht so gerührt wie bei der ersten Geburt, die immer und für jede Frau doch das größte Wunder ist, das sie erlebt. Ihr praktischer Sinn setzt sich durch. Sie hat Sorgen um ihren Bruder Karl, der allzu sehr abgedriftet ist in lockere Gesellschaft, der nach der fernen Jenny schmachtet, die man jetzt auf eine Weltreise geschickt hat, damit sie möglichst lang abwesend sein muss und damit sie sieht, dass es auch noch andere und ebenso nette Männer gibt. Lises zweites kleines Mädchen wird mit dem Namen Karola dem unglücklichen Bruder als Patenkind ans Herz gelegt. Es wirkt! Karl Spoerin ist vernarrt in die kleine, süße Nichte. Dieses Mal hat sich auch Frau Lises Wunsch erfüllt, das Mädelchen hat den sanften Kinnschwung des Vaters geerbt, seine dunklen Haare, sein rundes Gesicht. Nur die Nase ist vielleicht mehr nach der mütterlichen geraten, gerader Rücken, geblähte Flügel und an ihrem knubbeligen Ende ein kleiner Aufwärtsschwung.
Bald schon schiebt Lise wieder ihren schönen Kinderwagen auf hohen Rädern durch den Schlosspark, an der Hand der begleitenden Schwägerin geht brav die kleine Elisabeth.
6
Elisabeth sitzt in ihrem Zimmer, dem wunderschönen Kinderzimmer, in das man das vormalige Bügelzimmer verwandelt hat durch das Anbringen von Blümchentapeten mit umlaufenden Girlanden ganz oben unter dem Stuckrand der Wände, ein eisernes Kinderbett steht darin, von der Decke fließt „Voile“ herab, ein Spitzenvorhang, spinnwebenfein. Das hochbeinige Gestell ist mit kleinen und größeren Kissen reichlich aufgemöbelt, üppige Volants fehlen daran ebenso wenig wie eingenähte Stickbilder, auf denen Puppengesichter, aber auch Hasen und Katzen, Fische, sogar ein Löwe mit lockiger Mähne deutlich zu erkennen sind; das Schaukelpferd hat Albert von Frankfurt kommen lassen, es ist nicht nur schön, sondern auch stabil.
An Weihnachten tauft Pfarrer Fischer Karola, die dabei auf dem Arm von Onkel Karl selig schläft, der ein so „aufgeräumtes Gesicht“ macht, das hört Elisabeth später, als sie unter dem großen Esszimmertisch sitzt, nach dem Essen; Papa und Mama fühlen sich allein, sie sprechen viel und lang und ganz andere Sachen miteinander als in Elisabeths Gegenwart.
Dann sitzen die Eltern immer wieder lange am Bett der Schwester in ihrem Schlafzimmer, und keiner darf dort hinein, vor allem sie nicht. Die kleine Karola ist krank, sie hustet, sie läuft dabei ganz blau an und erst gestern hat sie wirklich aufgehört zu atmen, war steif wie ein Teddybär, das hat Elisabeth gesehen, hat die Mama gerufen, die kam und riss die kleine Lola aus der Wiege heraus, schüttelte sie, schrie dann laut um Hilfe: „Hilfe, Louise, Mutter, Albert, ist denn da niemand! Hilfe, das Kinderstickt, es stirbt, es ist schon tot, hilft mir denn keiner.“ Elisabeth wurde von der Panik der Mutter ergriffen, rannte ans Fenster, kletterte auf einen Stuhl und drehte und drückte an dem Knauf, bis es sich öffnete. Die Mutter rannte auch dorthin, riss Elisabeth mit einer Hand zurück vom offenen Loch und hielt mit der anderen die kleine Schwester an die kalte Luft, die hereinströmte.
Der Hilfeschrei fiel hinunter zwischen die Passanten, wurde weitergereicht und kam bei einem Mann an, der gerade mit seiner Ledertasche unterwegs war zu einem seiner Patienten. Doktor Homburger eilte dem Hilferuf entgegen zum Haus in der Karl-Friedrich-Straße, in den Parfümerieladen rein und mit der alarmierten Besitzerin die drei Treppen hoch zu der verzweifelten Lise. Er nahm ihr das Kind ab und rettete es. Schicksal, dass ein Kinderarzt um den Weg war, um Karola zu retten. Vorsehung! Die Götter! All solche Beschwörungen werden geraunt im Familiengespräch, man ist dankbar, alle sind dankbar, und nach und nach wird der Kinderarzt Doktor Homburger der Hausarzt für Kinder, Frauen und Männer in der Karl-Friedrich-Straße 4.
Dieser Rettung kann Lise Wolf lange Zeit – eigentlich nie so richtig – trauen. Das kleine Mädchen wird immer ihr besonderes Kind bleiben, ein Kind, das sie dem Tod aus den Armen gerissen hat, das all ihre sorgfältige Zuwendung, den größeren Batzen ihrer Liebe braucht und erhält. Die kleine Elisabeth, versteht das sehr gut, sie ist schon groß und so vernünftig, verständig, und sie liebt doch das Schwesterchen genau so wie jeder in der Familie.
So gruppiert sich die Familie neu nach diesem spektakulären Ereignis, und das Zentrum ist die kleine Karola. Sie tut einen Pieps, und alle wenden sich ihr zu, da lächelt sie, lacht und freut sich und gewöhnt sich daran, der Mittelpunkt zu sein mit jedem ihrer Atemzüge und ohne dass sie sich zu irgendetwas besonders anstrengen muss.
Die Verwandtschaft zerreißt sich die Münder, sie ist hysterisch, die Lise, macht ein Tamtam, will immer was Besonderes sein und haben, und so soll nun auch eine ganz normale Kinderkrankheit eine Todesgefahr gewesen sein. Wer will darüber befinden, heute noch, und auch damals war es schwer, wie es immer schwer ist, eine objektive Tatsache wörtlich zu machen. Es geht nicht. Und dennoch bleibt etwas zurück, das Gefühl für eine Veränderung, die Weichen gestellt hat für das ganze Leben danach.
Elisabeth ist nicht zur Nebenfigur geworden, nur zur zweitwichtigsten Hauptfigur im Leben der Familie Albert Wolf eben. Daran gewöhnt sie sich allmählich, sie lernt geduldiges Warten, wenn es auch schwerfällt, sie übt sich darin, ihren Kopf zu gebrauchen, wagt sich vorsichtig hinein in die Freiheit, die ihr erwächst hinter den elterlichen Rücken, die sich über das kränkelnde Schwesterchen runden.
Das Schwesterchen wird gesund, aber es ist ganz wichtig, dass es eine Luftveränderung bekommt, deshalb beschließt man, in den Theaterferien in die Sommerfrische zu gehen. Auf einer der Samstagsgesellschaften wird das Thema angesprochen, der Emil und seine Liesel, der Fritz und seine Emma, die eine Schwester von Liesel ist, die Louise und die Ida, alle Wolf-Geschwister finden die Idee so gut, dass sie mit von der Partie sind.
Es geht nach Schrunz im Montafon. Dorthin geht es jahrelang immer wieder. Man mietet sich ein in einem oder zwei Hotels, je nachdem, wie viele Familienangehörige mitgehen. Man frühstückt, isst zu Mittag, hat eine Brotzeit oder einen Nachmittagskaffee und abends auch noch mal Kaiserschmarrn mit heißen Kirschen, dazu Schampus, ganz oft, denn man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Zu Hause isst man genau so gern und man versucht jetzt auch die herrlichen Mehlspeisen aus Schrunz nachzukochen, sogar Lise hat inzwischen mehr Interesse am Geschehen in der Küche, werkelt dort herum und hat sich einmal selbst eine Schürze umgebunden und mitgeholfen, weil die Lina das einfach nicht verstanden hat, „die dumme Gans, aber kein Wunder, die weiß noch nicht mal, wo Schrunz liegt, also, was will man eigentlich von der!“ Man wird rund und schwerfällig dabei, bürgerlich gesetzt.
Zu dieser Zeit gab es Erdbeeren nur im Mai und Trauben hatten dicke braune Kerne, aber sie schmeckten nach Trauben, so sehr, dass man sich diesen Geschmack ein Leben lang merken konnte. Das Jahr verging schnell, nur diese vier Wochen imSommer, die dehnten sich schier ins Unendliche. Das Altbekannte,das man jedes Jahr wieder fand, war das Schönste an ihnen.
Man geht hinaus in die herrlichen Bergwiesen, der Albert stellt seine Staffelei auf und skizziert mit zusammengezwickten Lippen, was er später im Atelier fertig malt. Er lässt das Sonnenlicht durch die Blätter eines alten Baumes sickern, so dass man den Lufthauch des Windes zu spüren glaubt, der in der Mittagsstille die Gesichter streichelt und den Mädchen bis unter die Röcke weht. Und dann schenkt er seine Bilder seiner liebsten, allerliebsten Lise zu allen möglichen Gelegenheiten
Ja, Schrunz – die Sommerfrische! Was für eine glückliche Zeit!
Manchmal nimmt Albert seine beiden Mädchen an die Hand und zieht mit ihnen hinaus, zeigt ihnen, dass die Bienen ganz fleißige und nützliche Tiere sind, dass man sie achten und schützen muss, auch wenn ihr Stich unangenehm sein kann, geht mit ihnen zu den Pferden, und Karola sagt: „Mhm die riechen richtig gut! Ho, hü, komm, du Alterle, komm her.“ Sie klettert auf das Gatter und beugt sich weit hinüber, damit sie den wilden Hengst des Schirlhubers richtig am Hals tätscheln kann, das macht sie so gut, dass der nicht genug kriegen kann davon, aber Lise ist auch um den Weg und schreit: „Albert, du bist verrückt! Das Kind!“ Sie reißt Karola vom Gatter und führt sie an der Hand zurück in Sicherheit. Das kesse Lolale dreht den Kopf um und zieht ein Gesicht. Es wird bestimmt nicht von Dauer sein, das mütterliche Sicherheitsregiment. Der von seiner Frau gemaßregelte Albert wischt sich den Schweiß von der Stirn und macht ein bockiges Gesicht. Tagelang kann er einen Kopf hinhängen, wenn man ihn auf dem falschen Fuß erwischt hat, er redet nicht darüber, aber er leidet. Elisabeth schmiegt ihre Hand in die des Vaters und zieht ihn weiter auf die Wiese hinaus zur Bank beim Marterl, wo man sehen kann, wie Wolken die bleichgrauen Gipfel streicheln. Sie bleibt bei ihm, setzt alles daran, ihn aus der Reserve zu locken, geht auch mit ihm am frühen Morgen runter zum Bergsee und steigt ins Wasser rein, bittet und bettelt, bis der Vater ihr das Schwimmen beibringt. Aus Trotz gegen die Übervorsicht seiner Ehefrau tut er das, denn bezweifelt sie etwa, dass er ein guter und fürsorglicher Vater ist?
Elisabeth hat einen Ort gefunden, den nur sie ausfüllen kann, an der Seite des Papas als seine kleine Begleiterin beim Schwimmen. Später nehmen sie das Fahrrad der Wirtin und der Papa springt neben ihr her, sie lehnt sich ganz auf ihn drauf, aber dann rollt das Fahrrad schneller, und plötzlich kann der Papa nicht mehr mit, das Rad rollt trotzdem weiter, rollt, und sie tritt die Pedale und fühlt den Wind ihre Haare aus dem Gesicht zausen. Herrlich! Freiheit! Sie beginnt ein eigener Mensch zu werden, der etwas kann, was viele andere nicht können und der vieles darf, was Karola nicht darf.
Zwischen all diesen geschwisterlich ähnlichen Jahren beginnt ein neues Jahrhundert.
Irgendwann darf Elisabeth zum ersten Mal mit ins Theater und die Oper „Hänsel und Gretel“ sehen. Wie schön hat der Papa das Haus eingerichtet, in dem die arme Häuslerfamilie wohnt. Elisabeth staunt und ihre Wangen glühen, wenn sich das Haus wegdreht, die Kinder durch eine Tür in den Wald treten, der immer dunkler und immer dichter, immer gruseliger wird, sie zittert mit den beiden Geschwistern, bis sie wieder zurück sind in der väterlichen Stube, und ist froh, wenn das Licht angeht und man sieht, dass alles Unheimliche weg ist, verschwunden hinter den dichten, dicken Samtvorhängen.
Zu Weihnachten wünscht Elisabeth sich ein Puppenhaus, das aussieht wie das Haus von Hänsel und Gretel. Da lächelt der Papa und macht etwas ganz anderes, er lässt von seinen Leuten die Möbel aus der elterlichen Wohnung en miniature nachbauen, denn „wir sind doch keine armen Leute, das soll man auch sehen“, auch so ist der erfüllte Wunsch noch eine wundervolle Weihnachtsüberraschung. Damit schießen die Wölfchen vom Albert an Weihnachten den Vogel ab. Bei der Verwandten-Tour von Haus zu Haus, die den Höhepunkt jedes Jahres markiert, werden die weihnachtlichen Geschenke bestaunt. Es besteht der unausgesprochene Wettbewerb, wer wohl das schönste und beste Geschenk bekommen hat. Elisabeth und Karola sind Sieger und lachen sich kugelrund über das langweilige Spiel, das „die Mädle vom Emil gekriegt haben, wo sie was lernen sollen dabei. Buh, schlau sein macht so hässlich, gell, Isale, des stimmt doch, oder?“ Sie liegen im dunklen Kinderzimmer, in dem es noch nach Zimt und Kerzengeflacker riecht, hören draußen das Gemurmel der Erwachsenen, fühlen sich glücklich und geborgen, freuen sich auf den nächsten Morgen, auf das Spielen mit dem Puppenhaus, das endlose Unterhaltung verspricht, bis zum sechsten Januar, das wissen sie, bis die Sternsinger kommen und ihr KMB mit der Jahreszahl über die Eingangstür stricheln, den Weihrauchkessel schwenken, dass sich das ganze Treppenhaus mit dem ungewohnten, merkwürdigen Gewürzduft füllt. So lange wird das Puppenhaus bleiben, dann wird die Lina alles wieder sorgfältig in Wachspapier einwickeln, in eine große Holzkiste legen, die auf dem Speicher landet.
Die kleine Lola hängt sehr an der großen Schwester und erkennt sie ohne Einschränkung als Autorität an, aber die pfiffigen Ideen hat sie selber. Elisabeth staunt über ihre Einfälle, und manchmal ist die große Schwester der Karola zu ernst, dann muss die Kleine sie ein bisschen reizen und sticheln, damit sie wieder lacht und fröhlich ist mit ihr zusammen.
Karola ist ein lustiger, immer zu Possen aufgelegter Irrwisch, Elisabeth eine „brave, ernste Madame“, so nennt sie der Onkel Karl.
Und dann passiert in einem Jahr etwas Wunderschönes. Eine Hochzeit findet statt. Ein rauschendes Fest, von dem man sogar in der Zeitung lesen kann: Das Schennerle und der Karl finden zusammen. Endlich! Jahrelang war der Karl immer unsteter geworden, er war auch noch in seiner Freizeit ständig auf Reisen gegangen, fuhr am Rhein entlang in die Schweiz; schließlich rückte er mit dem Grund heraus, indem er bei Schwester und Schwager ein dickes Buch auf den Wohnzimmertisch legte: „Da! Da können sie sehen, was die Spoerins für Leute sind. Keine Nichtskönner, keine hergelaufenen Rumzieher. Vielleicht sogar vornehmer als die ganze Printzenblase zusammen.“ Mit Hilfe eines Historikers hat er recherchiert, wochen-, monate-, jahrelang und eine Chronik der Familie Spoerin verfasst, die zurückgeht bis in die Zeit der Hugenottenkriege, hat das Werk drucken und in weiches, hellbraunes Leder binden lassen. „Schau mal, da steht dein Name und dort deiner!“, sagt er zu den beiden kleinen Mädchen, den staunenden Nichten. Als die Jenny von ihrer Weltreise zurückkam, brachte er ihr diesen Wälzer als Geschenk, es war aber eher für ihre Eltern und die hochnäsigen Brüder gemeint. Er erschrak bis ins Herz hinein. Wie sah sie bloß aus? Nicht schön und glücklich, sondern ganz blass und schrecklich dünn. Sie hatte sich lagenweise Tüll um den ausgemergelten Körper geschlungen, damit man nicht sah, dass sie nur noch aus Haut und Knöchelchen bestand. Krank war sie. Richtig sterbenskrank. Hatte die Sehnsucht nach dem Karl nicht ertragen, genauso wenig wie er sie ertragen hatte, nur er, der Mann, fand andere Heilmittel, hat die Sehnsucht in Wut verwandelt, in Selbstverachtung, in Lust auf Verlorensein, Verruchtsein, ist wieder sehr oft an Tischen in Hinterzimmern gelandet, hat dort Karten geklopft, Geld verloren, viel getrunken und sich schließlich von ihm unbekannten Händen, von denen er sich erträumte, sie könnten Jennys sein, die Wut wegstreicheln lassen. Für die Jenny aber gab es – so wie im Märchen – nur ein Mittel gegen diese Krankheit, nämlich, dass sie endlich ihren Karl heiraten durfte. Der Doktor redete den alten „Printzen“ ins Gewissen, das erfährt Elisabeth auf ihrem Horchposten unterm Esszimmertisch und bespricht dann alles mit Karola, die neugierig zuhört, wenn die Schwester ihre Weisheiten weitergibt.