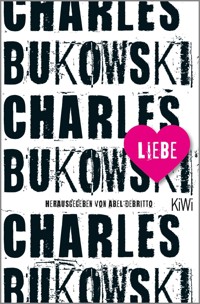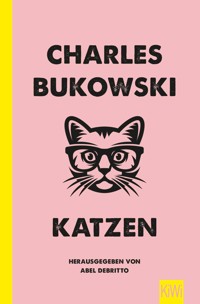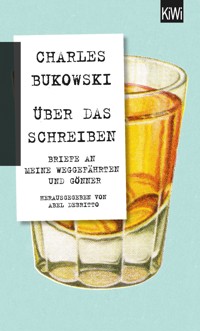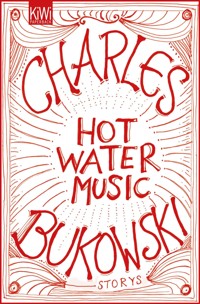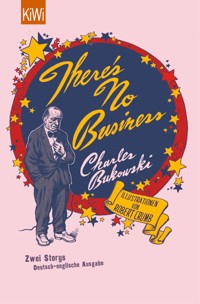9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Der abschließende Band aus dem Nachlass von Charles Bukowski - jetzt als Taschenbuch Der Ausstoß des »Maulwurfsgenies« (Tom Waits) war zu Lebzeiten so eruptiv, dass selbst die zahllosen Untergrundmagazine ihn nicht fassen konnten: Nun begleicht er posthum seine Wettschulden in Sachen Ruhm und Nachleben – mit Geschichten von Exzess und Pferdewetten, mit überbordenden Berichten von seinen berüchtigten Auftritten und von der Anstrengung, »einen auf Dichter zu machen«. Schließlich verläuft er sich sogar in Utah und steht allein im Wald.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Charles Bukowski
Held außer Betrieb
Stories und Essays 1946 – 1992
Aus dem Amerikanischen von Malte Krutzsch
FISCHER E-Books
Inhalt
Held außer Betrieb
Hinter der Vernunft
Chelaski (Center Fielder, .285AB-246 H-70) fühlte sich ein wenig … ein wenig … anders auf dem Spielfeld. Es gibt Tage, an denen das so ist. Es läuft nicht rund. Selbst die Sonne sah jetzt ein wenig krank aus, das Grün der Umzäunung zu grün, der Himmel viel zu hoch, und das Leder seines Fanghandschuhs zu … ledrig.
Er ging ein paar Schritte vor und schlug mit der Faust in den Handschuh, um alles zurechtzurütteln. Hatte er Kopfweh, oder was? Er spürte Potential, als wäre er kurz davor zu schreien, in die Luft zu springen oder sonst was zu tun, was daneben war.
Chelaski hatte ein bisschen Angst und sah hinüber zu Donovan (Left Fielder, .296AB-230 H-68), aber Donovan schien ganz bei sich zu sein. Er musterte Donovan eingehend, als könnte ihm das Kraft geben. Donovans Gesicht war sehr braun, und zum ersten Mal fiel ihm sein Bierbauch auf. So ein Wanst, und so unbefangen. Auch Donovans Beine wirkten massig, wie Baumstämme, und noch verunsicherter als vorher sah Chelaski wieder geradeaus.
Was war los?
Der Batter schlug, und es war ein Outfield-Ball … für Donovan. Donovan trat ein paar Schritte vor, schwang lässig die Arme und fing den Ball. Chelaski hatte den Ball auf seiner langen, weiten Flugbahn durch Sonne und Himmel beobachtet. Ein durchaus angenehmer Anblick, aber irgendwie witzlos, von allem losgelöst. Der Nächste schlug einen Single ins Infield, um den er sich nicht zu kümmern brauchte. Einer aus. Einer vor. Wie stand das Inning? Er drehte sich zur Anzeige um und sah das Publikum. Sein Blick konzentrierte sich nicht darauf. Sie waren bloß Bewegungen, Kleider und Geräuschkulisse.
Was wollten sie sehen?
Er fragte es sich nochmals: Was wollten sie sehen?
Plötzlich hatte er eine Scheißangst, und er wusste nicht, warum. Sein Atem ging schwer, Speichel lief ihm aus dem Mund; ihm war schwindlig, flau.
Donovan … stand da. Er blickte noch einmal zum Publikum und sah sie alle, alles an ihnen, alle zusammen und jeden für sich. Brillen, Krawatten; Frauen in Röcken, Männer in Hosen; Lippenstift … und Glut an etwas, das in Mündern steckte … Zigaretten. Und alle gluckten seltsam einvernehmlich zusammen.
Und dann kam’s … ein Ball ins Outfield … für ihn. Ein leichter. Er war nervös. Er musterte den Ball grimmig, und der schien förmlich in der Luft stehenzubleiben. Der Ball schwebte, die Zuschauer brüllten, die Sonne schien, und der Himmel war blau. Und Donovan sah zu, und Donovans Augen beobachteten Chelaski. War Donovan gegen ihn? Was wollte Donovan wirklich?
Der Ball landete in seinem Handschuh. Er passte genau, und Chelaski spürte die Wucht und die angenehme Stoßkraft des Fangs. Er warf den Ball zum zweiten Base und hielt den Runner am ersten. Chelaski staunte über den guten Wurf; es sah aus, als hätte ihm der Ball gehorcht. Seine Angst legte sich ein wenig; keiner merkte was.
Der nächste Mann war aus, kurz vorm ersten Base, und Chelaski machte sich auf den langen Weg zum Dugout. Das Laufen tat gut. Er kam an mehreren gegnerischen Spielern vorbei, aber sie sahen ihn nicht an. Das störte ihn ein wenig, und dieses Gefühl bildete ein Knötchen in ihm, als er Donovans Stiernacken in den Dugout folgte. Dort angelangt, kam sich Chelaski irgendwie nackt oder ertappt vor oder so etwas, und in dem Bemühen, so zu tun, als wäre alles in Ordnung mit ihm, ging er zu Hull hinüber und grinste ihn an.
»Willst du einen Kuss? Dann denkst du nicht mehr dran«, sagte er zu Hull.
Hull hatte einen Schnitt von 182 Schlägen und war zugunsten von Jamison, dem Studenten, auf die Bank verfrachtet worden. Hull sah Chelaski an. Er guckte ihn an, als hätte er ihn noch nie gesehen. Er antwortete nicht mal; er stand auf und ging zum Wasserspender. Chelaski verdrückte sich schnell ans Geländer, mit dem Rücken zur Bank.
Corpenson erreichte durch einen Hit das erste Base. Donovan erreichte das zweite und lief mit hochschnellenden Knien die First Base Line hinunter, so dass man seine knallbunten Socken sah.
Chelaski ging zur Platte. Der Umpire war da, der Catcher, der Pitcher, die Fielder, das Publikum. Alles wartete, alles wartete. Draußen überfiel vielleicht gerade jemand eine Bank, oder eine vollbesetzte Straßenbahn kam um die Ecke, aber hier war es anders: geregelt, vorgesehen … nicht wie da draußen – die Straßenbahn, der Bankraub. Hier war alles … anders, festgelegt, vorherbestimmt.
Er holte aus und verfehlte den ersten Pitch, und es gab Geschrei. Der Catcher rief etwas und warf den Ball zurück. Ein Vogel sauste durch die Luft, auf und ab, wollte schnell irgendwohin. Chelaski spuckte aus und sah auf den Rotzfleck am Boden. Der Boden war staubtrocken. Ball Nummer eins.
Der nächste kam von außen, wie es ihm lag. Schnell und wie von selbst schwang er den Schläger, und das Publikum schrie. Es war ein langer Ball, hoch über den Kopf des Centerfielders hinweg. Chelaski sah zu, wie er von der Wand beim Fahnenmast abprallte. Die Zuschauer brüllten lauter denn je; so laut hatte er sie in der ganzen Spielzeit noch nicht brüllen gehört. Dann schrie ihn Jamison an, der als nächster Batter bereitstand.
»Lauf! Lauf! Lauf!«, schrie er.
Chelaski drehte sich um und musterte Jamison. Weit aufgerissene Augen, aus denen Blitze schossen, heiß und gehetzt. Sein Gesicht war verzerrt, die Lippen vorgestülpt, und besonders die geschwollenen Adern an seinem roten Hals fielen Chelaski auf.
»Lauf! Lauf! Lauf!«, schrie Jamison.
Von der Tribüne kam ein Sitzkissen geflogen. Dann noch eins. Die Zuschauer waren so laut, dass er Jamison nicht mehr hören konnte. Der Vogel von vorhin kam im Wippflug zurück, nur noch ein bisschen schneller. Der Centerfielder hatte den Ball gefangen und zurückgeworfen. Der Lärm war fast unerträglich. Chelaski wurde von einem Sitzkissen getroffen und sah ins Publikum. Viele Leute sprangen auf und fuchtelten mit den Armen. Kissen, Mützen, Flaschen, alles kam geflogen. Ganz kurz erblickte er ein Mädchen in einem grünen Rock. Ihr Gesicht, ihre Bluse, ihre Jacke bekam er nicht mit. Er sah einen grünen Rock und eine Falte in einem grünen Rock, die wie ein Schatten tanzte. Dann traf ihn das nächste Sitzkissen. Hart, stechend, warm. Einen Moment lang war er wütend.
Der Wurf kam zum zweiten Baseman, der ihn zum Ausmachen an den ersten weitergab. Der Lärm war ein Vulkanausbruch, lähmend, zum Verrücktwerden. Jamison packte Chelaski am Arm und zog ihn von der Batter’s Box weg. In Jamisons Gesicht fielen ihm rote und weiße Flecke auf, und es sah dick aus, als wären etliche Hautschichten dazugekommen.
Chelaski ging in dem anhaltenden Getöse zum Dugout. Die Mannschaft postierte sich, Hull nahm seine Stelle im Outfield ein.
Es war kalt im Dugout, kalt und dunkel. Er sah den Wassereimer mit dem drübergehängten Handtuch. Auf dem Weg dahin sah er, wie jemand auf der Bank nervös die Hände bewegte, jemand anders die Beine übereinanderschlug.
Dann stand Chelaski vor dem Manager, Hastings. Er sah Hastings nicht an, sah nur auf das Hemd unter dem V des Kragens.
Dann hob er den Kopf. Er sah, dass Hastings etwas sagen wollte, die Worte aber nicht herausbrachte.
Chelaski drehte sich rasch um und lief zur Umkleide hinunter. Dort angekommen, sah er sich einen Moment lang die grünen Spinde an.
Draußen tobte das Publikum immer noch, und ein paar Reporter befanden sich schon auf dem Weg zu Chelaski, um ihn zu fragen, was los war.
Liebe, Liebe, Liebe
Ich höre meinen Vater baden. Er planscht und spritzt ungeheuer, spuckt Wasser, schlägt mit den Ellbogen gegen die Wannenwand.
»Ist dir aufgefallen, dass ich den ganzen Tag die Zähne drin hatte, Mutti?«
»Nein, wusste ich nicht.«
»Sie fühlen sich an wie meine eigenen, als hätte ich sie schon immer gehabt.«
»Bald kannst du sicher auch wieder Nüsse und alles essen.«
»Nüsse. Ha!«
Mein Vater geht die Einfahrt entlang, bleibt stehen, bückt sich und sagt zu meiner Mutter, die noch im Haus ist:
»Die Möhre hier lebt immer noch.«
»Ich weiß. Oh, was ist das denn … dein Ärmel …«
»Bitte?«
»Du hast da einen Riss. Unterm Arm. Guck mal unter die Achsel …«
Ich finde eine Nachricht auf meinem Bett. In der dicken Krakelschrift meines Vaters auf die Rückseite eines Kuverts geschrieben:
½ Flasche Whiskey
2,00
1 Flasche Whiskey
3,65
½ Flasche Gin
1,90
2 Ginger Ale
0,30
Wäsche & Putzen
3,25
Unterwäsche
8,25
1 Hemd
4,00
Kost und Logis
10,00
33,35
Mein Vater läuft durch den Flur. Er trägt Lederschlappen, die am Boden aufklatschen. Er geht ins Bad. »Mensch, wieso ist denn der ganze Boden nass? Hast du das ganze Wasser verschüttet?«
»Welches Wasser?«
Er macht die Tür auf und kommt in mein Zimmer. »Hast du das ganze Wasser im Bad verschüttet?«
»Ja«, sage ich. »Ich hab’s mit beiden Händen geschöpft und durch die Gegend geschmissen.«
Er fängt an zu schreien …
Mein Bruder George erzählt von seinen Kriegserlebnissen: »Es gab Fallschirmjägeralarm, und ich dachte, mein Gott, die Japsen kommen. Aber dann sagte ich mir, ich hab meine C-Ration, meine 45er, meine Dum-Dums, ich hab eine Flasche Stateside – ich bin startklar. Ich geh zum Flugplatz, schnapp mir eine C-47 und schau, dass ich hier rauskomme …«
Mein Bruder George bleibt die ganze Nacht weg und ruft mich am Morgen an: »Chuck, Chuck, mich hat es schwer erwischt. Ich habe ein dicke Narbe über dem rechten Auge. Ich habe ein Veilchen. Bin ganz voll Blut. Meine Jacke ist hinüber. Ich hab mit einem Mann gesoffen, der lauter Narben im Mund hat, weil er sich immer Nadeln reinsteckt. Er sagt, Schmerzen sind bloß eine Frage der Selbstbeherrschung. Filmriss, ich weiß nicht, was gewesen ist. Ich bin in Hollywood. Was für ein Tag ist heute?«
Wir sitzen am Esstisch, ohne George. Meine Mutter hat ihren weiten Morgenmantel an und schiebt sich eine Kartoffel in den Mund.
»Chucky, deine Wangen sind so hohl. Ich möchte, dass du Pausbacken bekommst, Hamsterbacken. Es ist schlimm, wie du aussiehst. Dabei hast du so ein schönes Profil.«
»Das stimmt«, sagt mein Vater.
»Zugenommen hast du ja schon«, sagt meine Mutter. »Wenn du nur aufhören würdest zu trinken … Warum guckst du immer auf den Teller? Warum siehst du die Leute nicht an? Sieh mich an … Möchtest du noch Kartoffeln?«
»Nein.«
»Noch Fleisch?«
»Nein.«
»Noch Sellerie?«
»Nein.«
»Möchtest du noch Kaffee?«
»Nein.«
»Erbsen?«
»Nein.«
»Ein Stück Brot vielleicht?«
»Nein. NEIN, verdammt nochmal! Wenn ich was will, dann sag ich’s schon!«
»Was ist denn mit dir los?«, brüllt mein Vater. Er wirft seine Serviette über den Tisch, stößt seinen Stuhl zurück und läuft mit klatschenden Schlappen ins Wohnzimmer.
»Chucky«, sagt meine Mutter, »du ahnst ja nicht, wie weh du uns tust. Du hast keine Ahnung, wie wir uns um dich bemühen. Dein Vater liebt dich. Du kommst hierher. Du verleitest George zum Alkoholtrinken. Du bist fünfundzwanzig. Noch ist Zeit. Dein Vater möchte dir das Autofahren beibringen. Du sagst nein. Einen Leseausweis für die Bibliothek, eine Kinokarte willst du auch nicht. Nur immer trinken, trinken, trinken und auf den Teller gucken. Hast du noch Geld?«
»Nein.«
»Was willst du machen?«
»Chucky, ich bin deine Mutter, antworte mir.«
Cacoethes scribendi
Ich hörte die Schreibmaschine und klingelte. Er kam zur Tür.
»Ich hab Ihre Schreibmaschine gehört«, sagte ich.
Er war ein Hüne – großknochig, lang, breit, wehrhaft irgendwie. Sein Gesicht fand ich nicht sonderlich eindrucksvoll. Ein ungestutzter kleiner Schnurrbart mit ungleichmäßig vorstehenden Haaren, großer ovaler Kopf mit flacher, niedriger Stirn; rechts von dem zu kleinen Mund ging eine Narbe aus, und an den Augen war nichts Ungewöhnliches.
Seine Sachen waren meist im landläufigen Stiel geschrieben, wobei er im Gegensatz zu den anderen im Land manchmal zu Abstraktionen griff, was seinen Storys eine klare, frische Note verlieh, auch wenn er mir manchmal zu sehr den kühnen Experimentator hervorkehrte. Aber was soll’s, er bemühte sich wirklich.
Ich folgte den breiten Schultern und dem großen Kopf in das kleine Haus. Die vorderen Räume waren dunkel, und auf dem Weg nach hinten kamen wir an einer Rothaarigen vorbei, die auf einer Couch lag. Ich nahm an, es war seine Frau, doch er stapfte weiter, ohne uns miteinander bekanntzumachen. Ich lächelte die Dame an und sagte guten Tag. Sie erwiderte das Lächeln und den Gruß. Ihre Augen funkelten sichtlich amüsiert aus dem Halbdunkel, und sie war mir auf Anhieb sympathisch.
Wir kamen durch eine Schwingtür in die Küche. Er wies mit der Pranke auf einen winzigen gelben Tisch. »Nehmen Sie Platz. Ich mache uns Kaffee.«
Das Licht war unangenehm hell, und ich kam mir in meinem gebügelten Anzug, dem sauberen Hemd, den engen, blanken Schuhen ganz entblößt vor. Sein Hemdkragen stand offen, und er trug eine speckige graue Hose. Auf dem Tisch stand eine Schreibmaschine; die Schrift auf dem eingelegten Blatt war klein und tiefschwarz. Ein Stapel Blätter lag daneben, und ein Berg von Brezeln in einer hohen weißen Schale stand bereit. Unwillkürlich dachte ich, ich sei zum Schinkenessen eingeladen, aber davon konnte zum Glück keine Rede sein. Die hintere Wand der Küche war mit Regalen bestückt, ein Wandschrank ohne Türen. Voll mit Literaturzeitschriften, die den Trends und Highlights der Branche nachgingen. Sie waren fein säuberlich nach Größe und zweifellos auch nach Erscheinungsdatum sortiert. Diese Regalwand in der Küche verriet mir alles über den Suzerän des kleinen Hauses.
Er setzte den Kaffee auf und pflanzte sich mir gegenüber hin, hinter die Schreibmaschine. Er warf einen quasirituellen Blick auf seinen Text, wobei er runde Augen wie ein Hund bekam; ein ganz aufs Lesen konzentriertes kleines Glitzern. Dann kam sein runder Kopf hoch.
»Nehmen Sie sich eine Brezel«, sagte er.
Ich streckte die Hand nach der hohen weißen Schale aus, spürte, dass er mich dabei genau beobachtete, und ließ mir Zeit. Ich führte die Brezel zum Mund und biss die Hälfte ab.
»Ich dachte, Sie wären jünger«, sagte er.
»Ich bin fünfundzwanzig«, antwortete ich, »aber ich hatte es schwer.«
»Trotzdem sehen Sie so aus, wie ich Sie mir vorgestellt habe. Ich weiß immer, wie ihr Burschen ausseht.«
Düster und kultiviert, angespannt bis in die Haarspitzen meinte er damit. Ich stand auf, zog meine Jacke aus, warf sie über einen Stuhl und lockerte meinen Schlips. Das Hemd hätte ich auch ausgezogen, aber ich hatte kein Unterhemd an. Ich setzte mich und aß noch eine Brezel. Der Kaffee fing an zu kochen.
»Wo finde ich das Bad?«, fragte ich. Er sagte es mir, und ich stand auf. Es war ein erstaunlich großes Bad für die kleine Hütte … ein russischer Architekt wahrscheinlich, oder ein akephaler Ire … aber das sollte mich nicht kümmern. Ich hörte ein Geräusch und drehte mich um: Die Tür hatte sich einen Spalt weit geöffnet, und eine große Hand hielt ein Handtuch herein. Ich nahm es mir.
»Danke«, sagte ich. Es kam keine Antwort. Die große Hand verschwand, und die Tür schloss sich.
Als ich wieder herauskam, war der Kaffee fertig, und er schlug vor, in sein Zimmer zu gehen. Wir nahmen unsere Tassen und passten auf, dass wir nichts verschütteten. In dem Raum gab es keinen Tisch, nur einen Schreibtisch, und an den setzten wir uns. Er hielt die Untertasse in Taillenhöhe, hob die Tasse, neigte den eirunden Kopf mit dem struppigen gelben Schnurrbart und trank einen Schluck. Dann setzte er die Tasse auf dem Schreibtisch ab und ging raus.
Die Wände waren mit Zeitungsausschnitten und Fotos gepflastert. Auf dem Fußboden stand eine Holzkiste mit leeren braunen Briefumschlägen, frankiert, gestempelt, die Messingclips herausgedreht. Auf dem Schreibtisch lag ein Manuskript. Eine Bleistiftzeichnung, nichts Besonderes, schmückte den Umschlag, und der Titel war K_M_, Gesammelte Erzählungen. Ich blätterte durch die maschinegeschriebenen Seiten, stieß das Heft dann aber weg. Ich fühlte mich in dem Raum beobachtet, wie zur Vorbereitung eines Attentats.
Er kam mit seiner hundert Brezeln fassenden weißen Schale wieder und stellte sie vor mich hin. Ich griff zu und trank einen Schluck Kaffee. Er trat in die Zimmermitte.
»Wer das ist, wissen Sie, oder?« Er wies auf einen Illustriertenausschnitt, ein Foto an der Wand. Ich stand auf, um es mir anzuschauen.
Es war eine Frau mit sehr klaren, intelligenten Augen hinter dicken Brillengläsern. Sie sah wie eine Dozentin für höhere Algebra aus.
»Wer denn?«
»Es steht drunter.«
Martha Foley, las ich.
Ich kehrte zum Schreibtisch zurück, setzte mich und aß noch eine Brezel.
»Dieses Jahr hab ich’s nicht geschafft«, sagte er. »Nächstes Jahr klappt’s. Sie hat Glück gehabt, dass sie dieses Jahr ein Buch rausbringen konnte … Umzug … da sind ihr etliche Sachen verlorengegangen. Zweimal musste ich ihr die Zeitschrift nachschicken – die mit Ihrer Story. Ich habe Briefe von ihr. Wollen Sie mal sehen?«
»Das muss nicht sein … Kommen Sie, wir gehen was trinken.«
»Ich trinke nicht«, sagte er.
»Auch kein Bier?«
Ich hörte ihn in den Regalen wühlen, und als ich mich auf dem Drehstuhl umdrehte, sah ich die graue Hose über seinen Hinterbacken spannen, während er gebückt im unteren Fach nach etwas suchte. Einer Flasche Wein vielleicht?
Ich stand auf und trat ans Fenster. Blickte auf einen graslosen Garten mit zahlreichen leeren Parzellen ringsum. Zumindest hatte er hier seine Ruhe. Ich sah einen Reifen, einen Abfallverbrenner, eine Kiste mit Dosen. Mehr war im Mondlicht nicht zu erkennen, doch es genügte mir.
Er holte einen Schuhkarton aus dem Regal. Kam zu mir und nahm den Deckel ab. Dabei lächelte er mich zum ersten Mal an, sprang über seinen ernsten Schatten, und ich war ihm dankbar dafür. Wenn er lächelte, war sein Gesicht viel ehrlicher; der kleine Mund wurde breiter, und die Narbe zupfte ein kleines bisschen an seinem Kinn.
»Briefe«, sagte er.
Ich sah in den Schuhkarton. Er nahm erst einen, dann noch einen Brief heraus. »Accent, Circle, alles da. Die knapp abgelehnten Sachen meine ich. Die gehen darauf ein.«
Ich sagte irgendwas dazu, und er schloss den Karton und stellte ihn zurück ins Regal. Danach sah er wieder ernst aus. Ich saß am Schreibtisch vor der hohen weißen Schale. Einen Moment lang stand er in seiner ganzen Größe stumm vor mir, ein Zebu.
»Ich bin zu dem Schluss gekommen«, sagte er, »dass ich Sie als Mitherausgeber nicht gebrauchen kann. Sie glauben vielleicht nicht an so was – nein, wohl kaum –, aber manchmal spricht Gott zu mir, und gestern Abend hatte ich eine Erscheinung, und die Stimme sagte mir, dass es mit Ihnen nicht geht.«
Kurz darauf verabschiedete ich mich, und er bestand darauf, mich die zwei Meilen bis zur Straßenbahnlinie zu fahren, mit der Begründung, dass so spät wahrscheinlich kein Bus mehr fuhr oder höchstens noch jede Stunde einer.
Ich stand mit der Rothaarigen, die vermutlich seine Frau war, auf der Veranda, als er den Wagen aus der Garage holte.
»Er ist wirklich nett«, sagte ich.
Sie stand da mit verschränkten Armen und ihrem schönen, sichtlich amüsierten Lächeln.
»Wir sind seit fast fünfundzwanzig Jahren verheiratet.«
»Und?«
»Und es war okay, bis er mit der Schreiberei anfing.«
Der Wagen kam rückwärts die Einfahrt hoch … Baujahr 28 schätzungsweise; dickes Blech und riesige Scheinwerfer wie die Augen eines Monsters, eines Monsters aus Stahl, das nicht sterben wollte.
Er stieß die Wagentür auf und sah mich an. Die Rothaarige öffnete die Haustür.
»Auf Wiedersehn«, sagte ich.
»Auf Wiedersehn«, antwortete sie.
Er brachte mich zur Endstation der Straßenbahn, und wir unterhielten uns über Sherwood Anderson. Als wir ankamen, gaben wir uns die Hand, sagten auf Wiedersehen, und er half mir, die Tür aufzukriegen. Das Monster ruckte, blieb beinah stehen und brauste in die Dunkelheit …
Jetzt bin ich in einer anderen Stadt, aber er hat mir geschrieben. Es war ein kurzer Brief, getippt auf ein kleines gelbes Blatt Papier. Wenn ich ihn richtig verstehe, hat er das Abstrahieren aufgegeben. Auf dem Gebiet bleibt ihm nichts mehr zu tun, schreibt er. Er hat Agenten in New York und London. Und die Zeitschrift, schreibt er, hat er eingestellt, um sich ganz seiner Kunst zu widmen.
Die Geschichte des Vergewaltigers
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einer werde.
Und ich komme mir auch immer noch nicht wie einer vor. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, wie die sich vorkommen. Ich weiß nur, wie ich mir vorkomme.
Ab und zu hab ich mal was über einen in der Zeitung gelesen, und das war’s.
Wenn, dann dachte ich kurz, warum um Gottes willen macht einer so was? Es passiert andauernd.
Bloß mich hab ich damit nie in Zusammenhang gebracht.
Aber so kann’s gehen: Man läuft herum und ist ein Mensch, und plötzlich wird man bezichtigt, ein Vergewaltiger zu sein, ein Gewalttäter, ein Schänder, und überall schlagen die Leute die Zeitung auf und bekommen das zu lesen.
Und irgendwer denkt (aber diesmal auf mich bezogen), warum um Gottes willen macht einer so was?
Es passiert andauernd.
Unter einem Vergewaltiger stellt man sich wahrscheinlich einen Typ vor, der heimlich in Fenster guckt und einen Stoß dreckiger Bilder in der Hosentasche hat. Dann kommt die Gelegenheit, auf die er immer gewartet hat, und er macht Ernst mit der Vergewaltigung.
So hatte ich mir das vorgestellt.
Ich kann ja nur von mir ausgehen.
Aber wie ich so in die Klemme geraten bin, ist damit noch nicht erklärt.
Ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Wenn man einfach auflistet, was passiert ist und was man gemacht hat, kommt es nicht richtig rüber. Damit meine ich das Frage-und-Antwort-Spiel, das vor Gericht abläuft. Das kommt nicht hin. Die stellen einen in die Ecke. Die ziehen die Summe aus ein paar Antworten, die du gegeben hast, und unterm Strich fällst du durch. Das läuft zu mechanisch.
Vor Gericht sollte man Gelegenheit bekommen, sich zurückzulehnen und alles in Ruhe zu schildern, wenn man dazu in der Lage ist.
Jeder weiß, wie steif es da zugeht im Saal, unterm Auge des Richters. Man sitzt da ein, zwei Minuten – vielleicht auch nur 30 Sekunden –, und schon spürt man, wo die Schnürsenkel sich überm Spann kreuzen und wie der Kragen um den Hals liegt.
Man kann nicht richtig atmen und ist übernervös.
Und warum?
Weil man weiß, dass Gerechtigkeit hier keine Rolle spielt. Man sieht vielleicht ein paar Typen mit Schriftstücken in der Hand herumlaufen. Auch sie sind nervös. Selbst der Richter ist nervös, obwohl er sich dagegen wehrt und das jeden Tag mitmacht.
Einige lächeln ein bisschen und machen Witze, besonders bei kleineren Fällen. Die tun mir am meisten leid, auch wenn ich selbst ein kleiner Fall bin.
Ja, ich geb’s zu, ich war schon oft vor Gericht.
Meistens allerdings nur wegen Trunkenheit und Stadtstreicherei.
Der springende Punkt dabei ist, man kann sich nicht verteidigen.
Sie waren betrunken? – Okay, schuldig.
Sie waren Stadtstreicher? – Okay, doppelt schuldig.
Man wird nicht gefragt, warum man sich betrunken hat und warum man Stadtstreicher war. Wer trinkt oder Stadtstreicher ist, hat einen verdammt guten Grund dafür. Damit macht man sich nicht »schuldig«.
Genauso wenig wie damit, dass man braune Haare oder acht Finger und zwei Daumen hat.
Es heißt also, ich bin ein Vergewaltiger.
Ein Gewalttäter.
Ein Schänder.
Genau gesagt wird mir Vergewaltigung in zwei Fällen, Kindesmissbrauch, Hausfriedensbruch und alles, was es sonst noch gibt, vorgeworfen.
Aber wie sagt man so schön – eins nach dem anderen.
Angefangen hat der ganze Schlamassel so: Ich war im Keller, um die alte Pappe herauszuholen, die Mrs Weber (das ist die Frau, die ich vergewaltigt haben soll) mir abgetreten hatte.
Ich wusste, wo ich die Pappe für etwas Kleingeld verkaufen konnte, vielleicht für ein bisschen Wein – dafür war Kleingeld bei mir meistens bestimmt.
Die Pappe hatte ich mal gesehen, als die Kellertür offen stand und ich hinterm Haus langkam.
Irgendwann später fragte ich dann Mrs Weber (die angeblich von mir Geschändete), ob ich die Pappe haben könnte, die da sinnlos im Keller rumlag.
»Gern, Jerryboy«, sagte sie, »jederzeit, was soll ich da dagegen haben? Sie nützt mir ja doch nichts.«
Ohne jedes Zögern kam das von ihr, einfach so.
Dabei hatte es mich ganz schön Mut gekostet, sie zu fragen. Es ist ja so, dass ich vom Saufen ziemlich nervös bin, und ich wohne auch einigermaßen ärmlich da in dem Schuppen hinterm Haus. Ich bin immer allein und denke viel nach. Das Denken drückt mir irgendwie aufs Gemüt, und ich kann nicht mehr locker sein. Ich komme mir so dreckig vor, meine Sachen sind alt und zerschlissen.
Vor ein paar Jahren ging mir das noch nicht so. Ich bin erst 32, fühl mich aber wie ein ausgestoßenes Tier.
Gott, so furchtbar lange ist es für mich noch gar nicht her, dass ich in einem sauberen blauen Pullover mit Mathe-, Geometrie-, Wirtschafts- und Sozialkundebüchern und so weiter unterm Arm zur Highschool gegangen bin.
Daran dachte ich irgendwie, als ich Mrs Weber um die Pappe bat, und es half ein bisschen. Sie war eine kräftige Frau, sauber und kräftig, aber nicht gerade dick. Jeden Tag trug sie ein anderes Kleid in hellen, frischen Farben, und sie ließ mich an Seifenwasser und Flauschiges und Kühles denken.
Ich dachte an meine Ehe zurück, die vier Jahre mit Kay, die verschiedenen Wohnungen, die miesen Fabrikjobs.
Diese Fabrikarbeit zog mich runter, und ich fing an, nach Feierabend zu trinken – erst nur ab und zu, nach einer Weile dann fast durchgehend.
Ich verlor eine Stelle nach der anderen und schließlich auch Kay, und an all das dachte ich, als ich Mrs Weber nach der Pappe fragte.
Ich bin nicht immer ein Säufer und Stadtstreicher gewesen.
Als Mrs Weber davonging, sah ich von hinten auf ihre Beine, ihre sonnenglänzenden Nylons. Die Arme und die Haare so schön, dass man hätte singen können.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, was mir vorgeworfen wird. Aber ich bin ehrlich und, wie ich meine, auch keiner Vergewaltigung schuldig, und ich weiß, dass es hier kreuz und quer geht, aber ich möchte, dass Sie das Ganze so sehen, wie ich es erlebt habe. Ich möchte nichts auslassen.
Vergewaltiger werde ich genannt.
Als Mrs Weber im Haus war, sah ich auf meine schmutzigen, ungepflegten Hände.
Die Nachbarschaft war mich und meine Pappbude gewöhnt, ich tat den Leuten leid und amüsierte sie auch ein bisschen.
Aber ich war harmlos.
Ich bin harmlos.
Ich bin kein Vergewaltiger, das schwör ich auf die Bibel oder auf was Sie wollen.
Ich hätte nicht gewagt, Mrs Weber anzufassen – sie stand so hoch über mir, war von so ganz anderem Wesen, dass weder ich noch sie noch sonst jemand auf die Idee gekommen wäre.
Es war unmöglich …
Eines Tages latschte ich dann draußen herum und sah, dass die Kellertür offen stand. Ich war ein bisschen verkatert und hatte nichts zu trinken und dachte, na, tu doch was, vielleicht vertreibt das deine Sorgen. Es war so ein verhangener Tag, wo es nach Regen aussieht, aber kein Regen fällt und man fast verrückt wird, weil es nicht endlich zu schütten anfängt, und man denkt, jetzt komm schon, Regen, komm schon, aber er kommt nicht. Er hängt fest.
Ich ging da runter und machte Licht. Den Kellergestank knipste ich gleich mit an. Bei dem Geruch dachte man an nasse Jutesäcke und Spinnen und vielleicht auch einen Arm, der irgendwo in dem Moder steckte, ein Arm mit etwas Stoff drumherum, und wenn man ihn rauszog, flitzte ein Haufen Wasserwanzen daran hoch und runter, ein konzentriertes mehrspuriges Gesause, nur dass hier und da eine Wanze aus der Konstellation ausbrach.
Konstellation! Das hätten Sie mir nicht zugetraut, dass ich so ein Wort kenne. Ich bin eben kein normaler Penner. Bloß der Wein macht mich fertig.
Na, jedenfalls war die Pappe ganz nass, und es sah nicht so aus, als ob ich dafür was bekäme, aber ich dachte, ich schaff sie trotzdem raus, dann gibt Mrs Weber mir vielleicht was fürs Entsorgen.
Allerdings habe ich Angst vor Spinnen. Ich hatte schon immer Angst vor Spinnen. Da bin ich komisch. Ich habe seit jeher Angst vor ihnen und hab sie immer gehasst. Wenn ich eine Spinne sehe, die eine Fliege im Netz hat und darum herumwuselt, das Tier im Nu einspinnt wie etwas ganz Durchgedrehtes, Böses und Finsteres, also diese Bewegung – ich kann’s nicht erklären. Herrgott, ich schweife ab. Vergewaltigung wird mir vorgeworfen. Ich soll ein zehnjähriges Mädchen vergewaltigt haben, ich soll ihre Mutter vergewaltigt haben, und ich rede hier von Spinnen.
Mit der Pappe in dem Keller fing alles an. Das müssen Sie mir schon glauben. Ich wusste nicht, dass die Kleine von Mrs Weber auch da im Keller war. Das merkte ich erst, als sie etwas sagte. Da sprang ich vor Schreck in die Luft wie ein Sandfloh.
»Was machst du denn hier unten im Keller?«, fragte ich sofort. Ich konnte ein rotes Kleid und die weißen Beine ihres Pluderhöschens ausmachen. Wie gesagt, sie war neun oder zehn. Ein Abbild ihrer Mutter: sauber und drall, eine richtige kleine Dame, ein Apfeltörtchen. Aber ich hatte vor ihr fast genauso viel Angst wie vor ihrer Mutter, allerdings noch mehr Angst, mich nicht wie ein Erwachsener zu benehmen, und da ich mich mit kleinen Mädchen nicht auskannte, spielte ich ihr den Erwachsenen eben vor, so gut ich konnte.
Sie gab mir keine Antwort. Sie saß nur da in ihrem roten Kleid und der weißen Unterwäsche und sah mich an. Wie Kinder so sind. Mich machte das nervös. Die Erwachsenenschau zog nicht.
»Ich hab dich gefragt, was du hier unten machst!«, wiederholte ich.
»Gar nix.«
»Nichts? Hast du denn keine Angst vor Spinnen?«
»Nee. Ich bin ja größer als die.«
Darauf wäre ich nicht gekommen. So lassen Leute mich oft dumm aussehen: Ich sage etwas, das mir sinnvoll erscheint, sie erwidern etwas, das meinem Spruch den Sinn entzieht, und mir fällt keine Antwort ein.
Da es mir bei der Kleinen auch so ging, machte ich mich daran, die Pappe an der Treppe zu stapeln, damit ich sie dann rausschaffen konnte. Allerdings wollte ich da nicht zu viel auf einmal stapeln, sonst wären die Kleine und ich ganz allein in dem Keller eingesperrt gewesen. Das wollte ich schon wegen der Spinnen nicht.
»Sie sehen gut aus, aber Sie sind furchtbar dreckig. Haben Sie nichts, wo Sie sich waschen können?«
Ich sage Ihnen, da kam ich mir schon komisch vor. So etwas hatte schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Es gab mir echt einen Stich, das zu hören.
Natürlich war ich schon immer der Meinung, dass ich auf meine Art gut aussehe, und das hatte auch die Kleine erkannt.
»Ich habe keine Waschgelegenheit. Ich wohne ja nur in einem Pappverschlag.«
»Dann waschen Sie sich doch bei uns.«
»Das geht nicht, Mädchen. Man wäscht sich immer zu Hause, und ich hab zu Hause kein Wasser.«
»Ich kann Sie doch bei uns reinlassen. Wir haben Wasser oben. Und Seife. Grüne Seife, rosa Seife, weiße Seife, Handtücher, Waschlappen, alles.«
»Vielen Dank, Mädchen, aber ich muss dein Angebot leider ablehnen. Und außerdem wäre das deiner Mutter nicht recht.«
»Meine Mutter ist in die Stadt gefahren.«
»Heißt das, du bist ganz allein, Mädchen?«, fragte ich sie.
Auch wenn ich sie Mädchen nannte – sie sah wie eine kleine Frau aus. Eine kleine Frau im kurzen Kleid mit sauberen weißen Beinen und sauberer weißer Unterwäsche. Sie war ein Abbild ihrer Mutter.
»Wann ist deine Mutter denn weg?«
»Gerade erst.«
»Und wie lange bleibt sie normalerweise in der Stadt?«
»Immer den ganzen Tag.«
»Und du bist wirklich ganz allein?«
»Natürlich.«
»Das ist ja gut und schön, aber ich darf nicht einfach so bei deiner Mutter ins Haus.«
»Sie erfährt ja nichts davon. Und Sie sind so schmutzig, dass Sie mir leidtun, Mister.«
»Und du verpetzt mich auch nicht, egal was passiert?«
»Egal was passiert.«
»Versprochen? Ehrenwort?«
»Versprech ich. Ehrenwort.«
»Du bist nett«, sagte ich ihr. »Ein richtig nettes kleines Mädchen …«
Wir gingen also nach oben, und ich ging ins Bad und zog mein Hemd aus und ließ warmes Wasser ins Waschbecken laufen. Es war ganz eigenartig, mal wieder Kacheln zu sehen. Ich fühlte mich gleich viel besser und stärker.
Es gab keinen Grund, warum ich so etwas nicht wieder haben sollte. Keinen Grund, warum ich nicht alles haben sollte, was ich mir wünschte. Vielleicht war heute mein Glückstag.
Ich fing an, »Happy Days Are Here« zu singen. Wasserdampf stieg aus dem Waschbecken, und ich hielt mein Gesicht hinein, als wäre der Dampf eine große Hand, die den Schmutz aus mir rauszieht, mir das verpfuschte Leben auswäscht. Es war noch nicht zu spät. Ich war erst 32.
Einige fanden sogar, dass ich gut aussah.
»Wollen Sie nicht in die Wanne gehen?«, fragte mich das Mädchen.
»In die Wanne?«
»Ja, klar! Alle Leute baden! Los, legen Sie sich in die Wanne!«
»Na gut«, sagte ich. »Warum nicht?«
Ich stöpselte die Wanne zu, ließ Wasser einlaufen und zog schon mal meine Schuhe und Kleider aus. Ich stand da und sah auf das warme, saubere Wasser. Es war mein Glückstag.
»Oh«, schrie das kleine Mädchen. »Da ist ein Wurm, Sie haben einen Wurm!«
So verdreckt ich auch war, Würmer hatte ich noch nie gehabt, und auch jetzt merkte ich nichts von Würmern.
»Ach was«, sagte ich.
»Aber ja! Ich seh ihn doch!«
Es schien ihr ernst damit zu sein. Ich bekam ein bisschen Angst. »Wo ist er denn?«
»Vor Ihnen! Da, vor Ihnen!«
»Ach so«, sagte ich. »Das ist kein Wurm.«
»Was denn dann?«
»Damit geh ich Pipi machen.«
Mehr brauchte ich dazu nicht zu sagen. Sie fragte nicht weiter, sondern stand nur da und sah mich an.
Ich stieg in die Wanne und setzte mich ins Wasser. Das tat gut. Es war mein Glückstag. Konnte man nicht anders sagen. Ein komisches, aber gutes Gefühl. Ich fing gerade an, mich zu entspannen, da schrie die Kleine wieder los.
Sie war ein Schreihals.
Das möchte ich klarstellen. Die Nachbarn haben später behauptet, sie hätten das Mädchen fast die ganze Zeit schreien gehört, die ich offiziell da im Haus war.
Damals wussten sie natürlich nicht, dass ich dort war.
Aber sie haben das Geschrei nachträglich damit zusammengebracht und daraus geschlossen, dass ich sie die ganze Zeit missbraucht hätte.
Ich erzähle Ihnen hier, wie es wirklich war, also geben Sie nichts auf die.
Ich hätte das Mädchen so wenig angerührt wie ihre Mutter, das können Sie mir glauben. Sie war genau wie ihre Mutter, nur eben in klein, mit einem kurzen Kleidchen und blitzweißer Unterwäsche.
Das Mädchen fing also wieder an zu schreien, und offensichtlich hatte ich ihr nichts getan. Wie denn auch, wenn ich in der Badewanne lag? Von Mann zu Mann, Bruder, ich wollte sauber werden. Kinder interessieren mich nicht. Wenn man auch hört, dass sie in Mexiko ziemlich früh anfangen. Das liegt an der Hitze.
»Was ist los, Kind?«, fragte ich sie. »Du darfst nicht schreien, sonst hören dich die Nachbarn und kommen dahinter, dass ich hier bei euch bin, und das willst du doch nicht, oder?«
Das Mädchen schrie wieder. »Sie lassen den Wurm ertrinken!«, rief sie. »Sie lassen den Wurm ertrinken!«
»Geh doch bitte in ein anderes Zimmer und hör auf zu schreien und lass mich in Ruhe baden«, sagte ich zu der Kleinen. »Es war ja schließlich deine Idee.«
(An der Art, wie ich mit dem Mädchen geredet habe, wird hier deutlich, dass ich überhaupt nichts von ihr wollte.)
»Aber so ertrinkt doch der Wurm.«
»Der ertrinkt nicht«, versicherte ich ihr. »Er fühlt sich wohl im Wasser.«
»Tut er nicht! Kein Wurm mag Wasser, schon gar nicht so heißes. Sie bringen ihn um!«
»Glaub mir, Kleines«, sagte ich, »den Wurm würde ich für nichts auf der Welt umbringen.«
Anscheinend glaubte mir das Mädchen nicht. Sie fing an zu heulen. Sie veranstaltete einen Heidenlärm. (Und der ist wohl in die spätere Aussage der Nachbarn eingegangen.)
Allmählich machte ich mir auch Gedanken um die Nachbarn. Ich wusste bei aller Unschuld, dass es schlecht aussehen würde, wenn man mich hier fand, deshalb wollte ich sie unbedingt beruhigen.
»Hör mal«, sagte ich, »der ertrinkt nicht. Ich halte ihn aus dem Wasser. Siehst du?«
Sie kam gucken und beruhigte sich wieder. Ich kam mir beim Waschen mit einer Hand zwar etwas blöd vor, aber das war es mir wert.
»Gut«, sagte sie, »jetzt halte ich ihn aus dem Wasser, damit Sie beide Hände zum Waschen frei haben.«
»Kommt nicht in Frage!«, sagte ich.
Die Kleine trat einen Schritt zurück, stemmte die Hände in die Hüften und fing wieder an zu schreien.
Ich bekam Angst. Das hielt ich nicht aus. Ich musste immer an die Nachbarn denken.
»Okay«, sagte ich.
Also hielt sie ihn hoch, und ich wusch mich beidhändig weiter. Ein bisschen peinlich war es schon, aber es war mein erstes Bad seit Jahren, und die Kleine war still, da nahm ich das in Kauf. Doch noch mein Glückstag.
Gerade fing ich an, mich wieder zu beruhigen, da stieß die Kleine erneut einen Schrei aus: »He, der bewegt sich!«
»Würmer bewegen sich eben«, sagte ich.
Ich wusch mich weiter.
»Ich wasch den Wurm«, sagte das kleine Mädchen, schnappte sich ein Stück Seife und fing auch schon an.
Ich wünschte mir, ich hätte nie auf die Kleine gehört. Eigentlich fing alles damit an, dass sie gesagt hatte, ich sähe gut aus. Ich dachte an ihre Mutter, wie sie in der Stadt durch schummrige Kaufhausgänge lief, Sachen anfasste, Sachen kaufte, sich umschaute. Ich war nur so etwas wie ein Tier, ein ausgestoßenes Tier. Ich hatte keine Rechte. Frauen wie Mrs Weber waren nicht für mich bestimmt. Trotzdem musste ich an sie denken.
»He, der wächst!«, schrie das Mädchen. »Der wird ja richtig groß!«
Ich brauste mir die Seife ab, zog den Stöpsel und stieg aus der Wanne. Ich fing an, mich abzutrocknen, und die Kleine trocknete den Wurm ab, als, Gott steh mir bei, Mrs Weber das Badezimmer betrat. Ich hatte sie überhaupt nicht kommen gehört.
Sie hatte mich natürlich noch nie so gesehen. Und ich hatte keine Zeit, etwas zu erklären.
Sie stand bloß da und schrie los wie die Kleine, nur besser – soll heißen schlimmer: lauter und mit einem Triller, der mir durch Mark und Bein ging.
Ich lief hin und hielt ihr den Mund zu, damit sie mich erklären ließ. Ich spürte den Stoff ihres neuen Kleids auf meiner Haut. Ein komisches Gefühl. Ich kam mir wie ein fremdes Tier vor oder so was.
Aber unter dem Stoff war Mrs Weber, und ich hatte Angst. Sie biss mich in die Hand, mit der ich ihr den Mund zuhielt, und fing wieder an zu schreien.
Ich musste sie schlagen. Ich schlug sie nieder.
Mrs Weber tat mir wirklich leid, wie sie da mit ihrem Kleid auf dem nassen, beschlagenen Boden lag. Ich sah, wo ihre Strümpfe endeten und die Haut anfing.
Ich wollte ihr hochhelfen, aber da schrie die Kleine wieder los. Ich lief zu ihr hin, packte sie und versuchte sie zu beruhigen.
Prompt fing Mrs Weber an. Da konnte ich nur noch hin und her laufen, von einer zur anderen, sie packen, schlagen, packen, schlagen, ohne eigentlich zu wissen, was ich tat.
Und jetzt sitze ich hier in U-Haft, und Essig war’s mit meiner Pappe.
Noch nicht mal einen Schluck Wein hat mir das Ganze eingebracht.
Ich soll wegen zweifacher Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Hausfriedensbruch und sonst noch was verknackt werden.
Die Ärzte sagen, sie sind beide vergewaltigt worden. Mag sein. Ich wusste kaum, was ich tat, als ich sie ruhigzustellen und vom Schreien abzuhalten versuchte.
Ich sage, nicht schuldig. Ich konnte nichts dafür. Ich habe weder meine Pappe noch auch nur etwas zu trinken bekommen. Ich habe Ihnen dargelegt, dass es nicht meine Schuld war. Glauben Sie mir? Oder glauben Sie mir nicht?
Ich muss immer wieder an mich in meinem sauberen blauen Pullover an der Highschool denken. Da hatte ich einen Freund namens Jimmy. In der ersten Stunde haben wir uns in der Aula öfter das Schulorchester angehört. Später sind wir dann rumgelaufen und haben die vom Orchester gespielten Lieder gesungen. Sachen wie »Ave Maria« und »When the Deep Purple Falls Over Sleepy Garden Walls« und »God Bless America«.
Glauben Sie mir nicht? Glaubt mir denn keiner?
Auch 80 Flieger reißen dich nicht raus
In jungen Jahren habe ich meinem Freund Baldy beim Saufen immer Richard Aldingtons gesammelte Gedichte vorgelesen. Im grellen Licht meines billigen Zimmers vom Wein beschwingt seine Werke vorzutragen, schien mir die größte Ehre, die man Aldington erweisen konnte. Baldy teilte meine Begeisterung nicht, und das habe ich nie ganz verstanden: Aldington schrieb Klartext: klar, gefühlvoll und direkt. Ich glaube, er hat mich mehr beeinflusst als die höher bewerteten Lyriker, aber mein Freund Baldy fand nie ein Wort des Lobes oder der Kritik für R.A. Er saß nur da und trank mit Bacchus.
Er lobte nicht Aldington, sondern (auch wenn er es nicht einsah) mich. »Herrgott«, sagte er am nächsten Tag, »Hank war gestern Abend sternhagelvoll. Er hat wieder den Gedichtband hervorgeholt. Und er kann die Sachen wirklich lesen! Hab noch keinen gesehen, der Gedichte so lesen kann wie Hank!«
Genau das sagte Baldy auch eines Tages zu Helen, der Frau, die die Zimmer saubermachte.
»Schluck zu trinken vielleicht, Helen?«, fragte ich nach diesem zwanglosen Auftakt.
Sie gab keine Antwort. Die Leute da konnten echt stur sein. Sie machten nie an den richtigen Stellen den Mund auf.
Ich goss ihr eine gute Portion ein, und sie nahm das Glas von der Kommode und kippte es runter.
»Ich muss wirklich die Zimmer saubermachen«, sagte sie.
Darauf trank ich einen Schluck. »Aldington kannte Lawrence«, sagte ich. »D.H. Lawrence. Das war ein Typ. Der Hundesohn konnte wirklich erzählen!«
»Ja«, meinte Baldy, »Lawrence.«
»Aus den Kohlebergwerken«, sagte ich. »Hat die Tochter von Manfred von Richthofen geheiratet. Dem Kerl, der 80 Flugzeuge abgeschossen hat. Kann auch sein, dass er ihr Bruder war. Und Lawrence kam auch nicht direkt aus den Kohlebergwerken. Sein Vater war Bergmann.«
»Hast du noch ein Schlückchen für mich?«, fragte die Putzfrau.
Ich schenkte ihr ein wenig nach.
»Was ist das für ein Zeug? Es schmeckt so anders.«
»Port.«
»Portwein?«
»Ja«, sagte ich. »Früher hab ich Muskateller getrunken, aber davon trocknet man aus. Zu viel Schwefel drin.«
Sie kippte ihr Glas. »Ihr seid mal zwei nette Jungs. Mit euch trink ich gern was. Ihr seid anders.«
Das ging mir so glatt runter, dass ich mir und Baldy und ihr noch ein Glas vollschenkte, so zur Feier des Tages.
»Lawrence und Aldington haben viel zusammengesteckt«, kam ich aufs Thema zurück.
In dem Moment hämmerte es gewaltig an die Tür. Wie eine Beethoven-Klimax. »Hank! Hank!«
»Komm rein, Lou.«
Es war der ehemalige Knastler und Bergarbeiter dieses Namens. Er hatte eine Flasche dabei. Portwein. Magenfreundlich.
»Setz dich, Lou. Wir haben uns gerade über einen unterhalten, dessen Verwandter 80 Flieger abgeschossen hat.«
»Ich sehe, du hast Gesellschaft, Hank.«
»Siehst du richtig, Lou.«
»Kann ich euch was von meinem Zeug anbieten?«
»Schenk ein, Lou!«
»Ich müsste ja wirklich putzen, aber wenn ihr Jungs so nett seid …«
»Was macht dein Mann, Schätzchen?«
»Ach, der war mit der Handelsmarine auf Fahrt, und als er wiederkam, konnte man ihn nur noch wegschmeißen. Er hatte sich mit zig Weibern eingelassen und war mit nichts mehr zufrieden.«
»Aber du hast ja noch mich, Helen«, sagte Lou und legte ihr die Hand aufs Knie. »Wie wär’s, wenn du und ich –« Er neigte sich zu ihr und flüsterte ihr den Rest des Satzes ins Ohr. Hätte ihn genauso gut aber auch laut sagen können.
»Sie Schweinigel, nehmen Sie sich doch ein Beispiel an den anderen Jungs. Die zwei sind nett! Warum können Sie nicht auch so sein?«
»Ich bin nett, Baby. Du kennst mich nur noch nicht. Mich und meine Vorzüge!«
»Um Gottes willen, Lou«, rief ich. »Lass deinen Hosenstall zu!« (Damals war ich noch sensibel.) »Wir unterhalten uns hier über Literatur!«
Alle kriegten sich wieder ein, und ich stand auf und füllte die Gläser nach.
»Einmal wollte Lawrence eine Kolonie gründen, und zwar eine, die nur aus seinen Freunden bestand. Irgendwo eine neue Welt ins Leben rufen. Ich fand die Idee ziemlich stark. Hätte ich gekonnt, wäre ich gleich mit ihm losgezogen und hätte das als große Ehre betrachtet. Aber alle haben ihm einen Korb gegeben. Einen nach dem anderen hat er gefragt: ›Kommst du mit mir auf die Insel oder nicht?‹ Und alle sind abgesprungen. Bis auf Aldington. Nein, vielleicht war es auch Huxley. Jedenfalls war Lawrence empört und hat sich betrunken und bekotzt, und das Ganze fiel ins Wasser.«
»Wo war denn diese Insel?«, fragte der Ex-Knacki. »Vielleicht gab’s da nichts zu essen. Oder sie durften keine Frauen mitnehmen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht war mit diesem Lawrence irgendwas nicht astrein.«
»Doch, doch«, sagte ich. »Das war schon sauber. Sie wollten eine Kolonie gründen, eine neue Welt erschaffen.«
»Und das Futter? Und die Weiber?«
»Alles geregelt«, sagte ich. »Alles im Voraus geklärt.«
»Und trotzdem wollten sie nicht?«
»Nein.«
Der Ex-Knacki wandte sich an die Putzfrau, die Hand auf ihrem Knie. »Würdest du mit mir auf eine Insel gehen? Ich könnte dir etwas zeigen, was du nie vergisst.«
»Lou«, sagte ich, »reiß dich bitte am Riemen.«
»Genau, Hank, halt mir dieses Ferkel vom Leib! Ich trink doch hier nur ein Glas unter Freunden.«
»Aber freundlich sein will ich ja gerade!« wandte der Ex-Knacki ein.
»Mach halblang, Lou.«
»Okay, Hank, okay.«
»Hank«, tauchte Baldy aus der Versenkung auf, »wer ist für dich der größte Schriftsteller aller Zeiten?«
»Shakespeare«, sagte der Ex-Knacki.
»Entweder Robert Louis Stevenson oder Mark Twain«, sagte die Putzfrau.
»Was meinst du, Hank?«
»Ich weiß nicht, Baldy.«
»Ganz ohne Zweifel Shakespeare«, beharrte der Ex-Knacki und trank aus. »An Old Shakey kommt keiner ran, keiner.«
»Einige behaupten, Shakespeare sei bei einer Kneipenschlägerei umgekommen«, erklärte ich.
»Na, sicher doch! Shakey war ein Mann!«
»Schätzchen«, fragte mich die Putzfrau, »krieg ich noch einen Schluck Portwein?«
»Singen wir was!«, regte Baldy an. »Den Zigeunersong. Ihr wisst schon: Sing, Zigeuner, lach, Zigeuner, lieb, solang du kannst. Das gefällt mir.«
»Nein«, sagte ich. »Wegen dem Zigeunerlied bin ich schon mehrfach verwarnt worden.«
»Nehmen Sie die Pfoten weg, Sie Ferkel!«
»Lou!«, rief ich. »Noch einmal, und ich schmeiß dich raus!«
»Dazu bist du nicht Manns genug!«
»Ich hab dich gewarnt, Lou.«
»Ich war Bergarbeiter. Einmal sind ein Typ und ich mit Pickelstielen aufeinander los. Mit dem ersten Schlag hat er mir den linken Arm gebrochen, und trotzdem hab ich die Sau mit einer Hand gekillt. Los, schlag du zuerst! Du hast den ersten Schlag! Na los, Hankieboy! Ich mag dich, Hank! Du bist noch ein echter Mann! Komm schon! Lass uns kämpfen, Hank.«
»Komm runter, Lou. Ich will dich ja gar nicht rauswerfen.«
»Vielleicht solltest du lieber ein paar Gedichte vorlesen«, regte die Putzfrau an.
»Dieser Lawrence, worüber hat der denn geschrieben?«, fragte Baldy.
»Der hat eine Menge herumprobiert. Wie viele von uns wollte er seinen inneren Mann möglichst rein erhalten. Die meiste Zeit hatte er Sex im Kopf.«
»Ja, wer denn nicht?« Der Ex-Knacki erhob sich. »Das geht uns doch allen so, stimmt’s, Baby?« Schwankend stand er da und sah auf die Putzfrau runter. »Stimmt’s, Baby? Hm? Stimmt’s?«
»Hören Sie, Lou, die Jungs unterhalten sich über Literatur. Haben Sie kein Anstandsgefühl?«, fragte die Putzfrau.
»Mir macht dieser Lawrence nichts vor! Ich weiß, warum er mit den ganzen Leuten auf die Insel wollte und warum sie gekniffen haben! Weil sie nämlich ein irre Angst hatten vor diesem Lawrence! Sie haben es ihm angesehen, es stand ihm ins Gesicht geschrieben! … Von wegen einen Schwung Weiber hernehmen und Land besiedeln! KOLONISIEREN! Dass er 80 Flieger abgeschossen hat, reißt ihn da nicht raus!«
»Nein, nein, Lou«, sagte ich, »das war nicht Lawrence. Das war Baron Manfred von Richthofen.«
»Der war dann wahrscheinlich noch schlimmer als Lawrence. Bei jedem Abschuss hat er wahrscheinlich sein –«