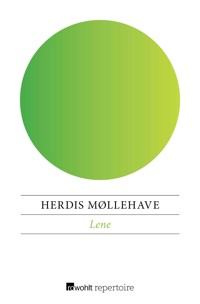9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie schon in den Romanen «Le und die Knotenmänner» und «Lene» beginnt es blutig: Helene, mit dem Rechtsanwalt Peter verheiratet, flieht mit Körperverletzungen zu ihrer Freundin Lene; ihr Mann hat sie zum erstenmal in zwanzig Ehejahren geschlagen. Das Gespräch der beiden Frauen bildet den Rahmen für die Erinnerung an Szenen einer Ehe, wie sie schwieriger kaum denkbar ist: zwischen einem konservativen Patrizier und ehrgeizigen Lokalpolitiker und einer in kleinbürgerlichem Milieu aufgewachsenen, vielfältig sozial engagierten Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Herdis Møllehave
Helene oder Die Verletzung
Aus dem Dänischen von Sara Schneeweis
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wie schon in den Romanen «Le und die Knotenmänner» und «Lene» beginnt es blutig: Helene, mit dem Rechtsanwalt Peter verheiratet, flieht mit Körperverletzungen zu ihrer Freundin Lene; ihr Mann hat sie zum erstenmal in zwanzig Ehejahren geschlagen. Das Gespräch der beiden Frauen bildet den Rahmen für die Erinnerung an Szenen einer Ehe, wie sie schwieriger kaum denkbar ist: zwischen einem konservativen Patrizier und ehrgeizigen Lokalpolitiker und einer in kleinbürgerlichem Milieu aufgewachsenen, vielfältig sozial engagierten Frau.
Über Herdis Møllehave
Herdis Møllehave (1936–2001) war eine dänische Sozialarbeiterin und Autorin.
Inhaltsübersicht
Mit liebevollem Dank an
Ane Marie Christensen und
Karin Muff Haestad
für ihre Hilfsbereitschaft
und ihr Engagement
Ein Mensch, der liebt, geht durch die Welt
wie ein Anarchist mit einer tickenden Bombe.
Graham Greene: Der menschliche Faktor
Leiden:
Ohne Leid keine Einsicht.
Deshalb sucht man das Leid: um zur Einsicht zu gelangen.
Es muß nicht sein. Es reicht, die Einsicht zu suchen:
Das Leiden kommt von selbst.
Nicht weil die Wirklichkeit im Kern Leiden ist,
sondern weil der Weg dahin so weit ist
und wir getan haben, was wir konnten,
ihn zu versperren.
Villy Sørensen: Windtage
Bei Lene
Wie lange braucht ein Auge, um zuzuschwellen? dachte Helene und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. Sie versuchte, eine Grimasse zu schneiden, aber es gelang ihr nicht. Er hatte sie auch auf den Mund geschlagen; die Unterlippe war geschwollen. Sie tupfte sich das Blut von den Lippen und tastete mit Zunge und Fingern ihre Zähne ab. Sie waren noch heil, aber ansonsten bot sie keinen schönen Anblick, stellte sie fest.
Sie sah sich unsicher um, ihr Blick fiel wieder in den Spiegel, während sie langsam und prüfend seine Worte wiederholte: «Du verdammte Klimakteriumsau», «du verdammte Klimakteriumsau».
Sie zündete eine Zigarette an, sah, wie ihre Hand zitterte, und zog begierig. Mit den Fingern fuhr sie über die Schrammen in ihrem Gesicht, hielt einen Augenblick beschützend eine Hand über das verletzte Auge. Große Tränen tropften auf die glänzend polierte Mahagonikommode. Ihr verletztes Gesicht hatte sie so beschäftigt, daß sie erst jetzt die Schmerzen in der linken Schulter und im rechten Arm spürte. Er hatte nach ihr geschlagen, zuerst fast blindwütig, dann berechnender, und ihr irgendwann auch den Arm umgedreht.
Dann nahm sie ihren Kalender aus der Tasche, fand eine Telefonnummer und wählte. Erst als ihre Verbindung zustande kam, sah sie auf die Uhr. Es war nach zwölf.
Lene schlief fest. Sie war allein im Haus, Andreas war mit den Kindern in ein verlängertes Wochenende gefahren. Sie war zu Hause geblieben, weil sie für die neuen Gruppen, die am Montag anfingen, Aufsätze korrigieren und den Unterricht vorbereiten mußte. Sie hatte die Einsamkeit genossen. Jeden Tag von vielen Studenten umgeben zu sein, hatte ihr Bedürfnis danach, hin und wieder mit sich allein zu sein, verstärkt. Sie war früh ins Bett gegangen und hatte mit schlechtem Gewissen einen Roman gelesen. So viel Fachliteratur wartete darauf, zuerst gelesen zu werden.
Als das Telefon sie weckte, war sie einen Moment lang verwirrt. Bevor sie ganz wach war und das Licht angeknipst hatte, bekam sie Angst, den Kindern oder Andreas sei etwas zugestoßen. Sie ging ans Telefon; es war Helene.
«Ich brauche Hilfe, deine Hilfe.» Lene hörte die Tränen in Helenes Stimme und wie sie versuchte, sich zu beherrschen.
«Ja», sagte Lene. «Was ist passiert, soll ich kommen?»
«Ich bin verprügelt worden. Richtig zusammengeschlagen. Kann ich kommen?»
«Soll ich dich holen, oder – kannst du selber fahren?»
«Nein», antwortete Helene. «Ich möchte gerne rasch hier weg. Ich kann nicht selber fahren, mir tun die Arme weh. Und ich habe ein blaues Auge. Ich nehme ein Taxi. Ich muß das alles mit dir durchsprechen.»
Lene schlug vor, ein paar Kleider einzupacken, damit sie bleiben könne, so lange sie wolle. Sie habe reichlich Platz und Zeit, sei allein zu Hause. Sie schlug Helene vor, einen Schnaps und ein Schmerzmittel zu nehmen, sie werde dann mit dem Kaffee auf sie warten. Plötzlich, sehr besorgt:
«Du hast dich doch nicht etwa übergeben?»
Helene versuchte, ihrer Stimme einen ironischen Klang zu geben: «Ganz so schlimm ist es nicht. Ich kann so in anderthalb Stunden bei dir sein. Ich beeile mich.»
Lene zog sich an. Schaltete die Kaffeemaschine ein, weil sie etwas brauchte, um richtig wach zu werden. Sie dachte, sie würden wohl jede Menge Kaffee brauchen, und zündete sich eine Zigarette an. Sie fragte sich, wieviel sie eigentlich von Helene wußte, die sie zu ihren besten Freundinnen zählte: Jemand, auf den man sich immer verlassen konnte, der immer hilfsbereit war. Und jetzt offensichtlich Hilfe brauchte. Wenn sie sagte, daß sie geschlagen worden war, dann konnte es nur ihr Mann gewesen sein, Peter. Auch, weil sie so schnell von zu Hause weg wollte.
Lene konnte sich einfach nicht vorstellen, daß Peter seine Frau schlug. Aber es gab viele Menschen, ihr waren einige begegnet, denen man Gewalttätigkeit nicht zutraute. Trotzdem griffen sie zu diesem Mittel, wenn sie sich provoziert fühlten. Meistens, wenn sie getrunken hatten.
Sie wußte nicht viel mehr von Peter, als daß Helene ihn liebte. Das konnte Lene schwer verstehen; und Helene hatte nie akzeptieren können, daß Lene sich nichts aus Peter machte, und umgekehrt. Wenn Helene von Peter sprach, hielt sie immer unwahrscheinlich zu ihm. Aber plötzlich fielen Lene Bemerkungen ein, die gefallen waren, als sie Helene besucht hatte, um sich wegen Arbeitsproblemen helfen und beraten zu lassen.
Plötzlich sah sie es wieder vor sich, wie einsam Helene gewirkt hatte, als sie in der Tür der riesigen Patriziervilla mit der schönen geschnitzten Tür stand, an dem frühen Morgen, an dem Lene nach dem Gespräch einer langen Nacht fortgefahren war. Sie hatten ausgerechnet über das Gefühl einer großen Einsamkeit geredet, auch wenn man Menschen hatte, die man liebte und die einen liebten. Und die Selbstverständlichkeit, mit der Helene davon gesprochen hatte, die Einsamkeit akzeptieren zu müssen. «Zuinnerst ist die Einsamkeit», woher kamen diese Worte? Lene konnte sich nicht daran erinnern.
Und Helenes Bemerkung: «Peter findet es schamlos, über Einsamkeit zu reden.» Sie hatte resigniert geklungen. Und verbittert. Als Lene gesagt hatte, daß sie fast nie über Männer und Liebe geredet hatten und daß es bei ihnen in der Luft lag, darüber zu schweigen, es wäre ihr, Lene, indiskret vorgekommen, etwa danach zu fragen, hatte Helene gesagt, das sei wohl falsch verstandene Diskretion.
Und Helenes Antwort, als Lene sie fragte, ob sie Verlustangst kenne. Die habe sie sehr früh gründlich kennengelernt, und die Angst habe sie seither nie mehr verlassen. Während Lene sich eine Tasse Kaffee einschenkte – Helene würde wahrscheinlich erst in einer Stunde kommen –, fiel ihr ein, daß sie viel früher dieselbe Frage gestellt hatte.
Plötzlich erinnerte sie sich, wie sie im Park hinter der Sozialpädagogischen Hochschule saßen, in der sie in derselben Klasse waren. Es war kurz vor dem Examen, und Lene hatte eben ihr erstes Kind geboren. Das Kind nahm sie in den letzten Tagen vor den Semesterferien in einer Tragetasche mit, weil es die Brust brauchte. Sie erinnerte sich an ihre Freude über das Kind und an ihre Schuldgefühle. Der erste Tag, an dem sie nach den Tagen in der Klinik mit ihm nach Hause kam, fiel ihr ein; sie hatte es im Bett gestillt und die Zeitung durchgeblättert. Eine Schlagzeile hatte ihr ein schlechtes Gewissen gemacht, denn in was für eine Welt hatte sie ihr Kind geboren! Nuklearpartikel in der Atmosphäre, die mit dem Wind trieben; sie waren über Dänemark, und man wußte nicht, ob es einen Niederschlag geben und welche Schäden der verursachen würde.
Sie hatte geweint aus Angst um das Neugeborene, weil man so hilflos war und ein so wehrloses, ausgeliefertes Wesen nicht genügend beschützen konnte. Andreas hatte sich erschreckt, sie hatte mit ihm darüber diskutiert; er war so wunderbar optimistisch, auch wenn er sie verstehen konnte. Und dann hatte sie sich, um seinen Schrecken zu mildern, mit einer postnatalen Depression entschuldigt. Aber zugleich hatte sie erlebt, wie stark sie sich an das Kind gebunden fühlte – das erste, das sie geboren hatte. Und ihre Angst, daß ihm etwas Böses zustieß. Hatte erlebt, wie die Angst zu verlieren mit dem Glück zu lieben zusammenfiel.
In der Beziehung mit einem Mann konnte seine Liebe zu Ende gehen. Dem Kind, das man liebte, konnte etwas zustoßen. Es konnte behindert werden oder sterben. Darüber hatten Helene und sie in dem Park mit seiner Herbststimmung geredet. Und Helene hatte sie verstanden; das mit dem Kind – denn Helene war selbst alleinstehende Mutter mit einer Tochter, und sie hatte etwas in der Art gesagt, daß man nicht helfen oder trösten könne. Denn ihr ging es genauso: Die Angst, daß Anne etwas zustieß, verließ sie fast nie.
Und das mit dem Mann? Ja, an dem Tag, an dem Ole – Helenes erster Mann – sie verließ, hatte sie ein für allemal gelernt, wie schmerzhaft es war, den zu verlieren, den man gernhat. «Liebt», hatte Helene leise gesagt, als sei sie es nicht gewohnt, Gefühle auszudrücken. Sie kannten sich auch noch nicht so gut; das hieß, eigentlich sehr gut, aber Helene machte einen verschlossenen Eindruck und schien nicht gern über Gefühle zu reden. Aber da hatten sie bereits über Verlustangst geredet, darüber, daß sie, Helene, den Schmerz damals nie überwunden hatte. Er hatte sie fürs Leben geprägt.
Lene dachte: Wird sie ihn jetzt verlieren, oder hat sie bereits den, den sie gern hat – liebt – zum zweitenmal verloren? Denn es gab nie einen Zweifel, wie sehr sie Peter liebte, mit dem sie seit, ja, fast seit zwanzig Jahren verheiratet war. Lene hatte sich manchmal gedacht, diese Liebe sei eine für andere unverständliche Leidenschaft. Ob Helene selbst sie erklären konnte? Aber konnte man je erklären, warum man gerade den Menschen liebte? Konnte man Leidenschaft erklären?
Und Peter, was wußte sie eigentlich von ihm? Ein erfolgreicher Anwalt, den Helene kennengelernt hatte, als sie nach ihrem Examen eine Stelle in einer Provinzstadt bekam. Nach so großen Gegensätzen mußte man lange suchen, sowohl was Elternhaus als auch Einstellungen anging. Dachte sie, denn sie kannte Peter kaum, der, wenn sie ihn traf, jedenfalls kalt und arrogant wirkte. Sie waren ein paarmal zu viert zusammengewesen, aber sie kamen eindeutig schlecht miteinander aus. Ihre Einstellungen und Interessen klafften zu weit auseinander. Andreas hatte hinterher gesagt, wie schön es doch sei, nach Hause ins Warme zu kommen. Er hatte den ganzen Abend gefröstelt und sich Helene zuliebe sehr beherrscht, er mochte sie, auch weil Lene sie gernhatte und weil Andreas wußte, daß sie einander halfen, wenn sie Probleme hatten, vor allem berufliche. Deshalb trafen Lene und Helene sich ab und zu ohne ihre Männer. Sie und Andreas wurden aus dem Bekanntenkreis herausgehalten, der weit mehr zu Peter als zu Helene gehörte. Vielleicht nur zu Peter.
Lene hatte nie herausbekommen, warum Helene sich überreden ließ, ihre Stelle als Sozialarbeiterin aufzugeben und in Peters Kanzlei einzutreten. Helene, die immer so stolz auf ihre berufliche Unabhängigkeit gewesen war, hatte sich trotzdem vor einigen Jahren von Peter dazu überreden lassen.
Es klingelte. Vor der Tür stand eine schlimm zugerichtete Helene. Lene zog sie vorsichtig herein, half ihr aus dem Mantel. Helene jammerte auf, als sie die Arme aus den Ärmeln ziehen mußte. Lene legte sanft den Arm um sie, als sie ins Wohnzimmer traten; Helene sah so aus, als müsse sie die Zähne zusammenbeißen. Lene sagte leise: «Jetzt bist wohl du mit dem Weinen an der Reihe. Und mit dem Reden, so viel oder so wenig du willst. Letztesmal ist es mir so gegangen. Möchtest du noch etwas, außer Kaffee und Schnaps?» Helene schüttelte den Kopf, setzte sich und begann zu weinen. Lene kümmerte sich um sie, fragte, ob sie sicher sei, daß sie keine ärztliche Untersuchung brauche, mit dem Auge und dem schmerzenden Arm. Helene schüttelte den Kopf. Lene hielt ihr ein Taschentuch hin, als sie sah, wie schwer es Helene fiel, ihre Tasche zu öffnen. Zündete zwei Zigaretten an, gab eine davon Helene in die Hand und sagte: «Jetzt heulst du einfach und läßt dich mal gehen. Ich, wir haben massenhaft Zeit. Und du sagst einfach, wenn du müde bist und ins Bett möchtest. Das Gästezimmer ist bereit.»
Helene versuchte, etwas zu sagen, das halb in Tränen erstickt wurde. Lene umarmte sie vorsichtig; sie fürchtete sich, die schmerzenden Stellen zu berühren. Helene sagte leise: «Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Denn ich weiß nicht, wann es anfing schiefzugehen. Aber ich weiß, das hier ist das Ende, ich lasse mich scheiden. Darüber gibt es sicher keine große Diskussion, ich glaube, Peter ist ganz meiner Meinung, denn er findet, ich habe ihn blamiert – habe ich auch, aber es war nichts zu machen. Öffentlich, das ist das Unverzeihliche. Damit kommt man nicht ungestraft davon in dem ‹Milieu›, das ja eigentlich zwanzig Jahre lang auch mein Milieu gewesen ist, aber …»
«Du hast es nie so empfunden, nicht?»
«Nein», antwortete Helene, «nicht wirklich; ich mußte mich damit arrangieren, weil es zu Peter gehörte und weil ich ihn liebte. Aber ich habe mich nie eingefügt, es war seine Welt, nie meine. Ich war immer fremd; die anderen wußten das und behandelten mich wie eine, die durch einen Irrtum dazugekommen war. Ich glaube, sie rechneten in der ersten Zeit damit, daß ich genauso schnell wieder verschwinden würde, wie ich aufgekreuzt war. Und später … Weißt du, heute abend oder nacht, als er mich zusammenschlug und mir seinen ganzen Zorn und Haß entgegenschleuderte – er ließ alles heraus, was er sicher sehr lange, vielleicht viele Jahre mit sich herumgetragen hat. Aber das Seltsame ist, denn das meiste wußte ich eigentlich schon, was mich am meisten verletzte, waren die Worte: ‹du verdammte Klimakteriumsau›. Nicht ‹verdammt› oder ‹Sau›, sondern, und das ist eigentlich das Seltsame, das Wort ‹Klimakterium›» …
«Wofür du nichts kannst. Hast du schlimme Beschwerden?»
«Nein, manchmal vielleicht, phasenweise. Ich habe versucht, es geheimzuhalten, andere nicht damit zu belasten, und Peter schon gar nicht. Warum trifft das Wort dann härter als alles andere?»
«Kamen die Probleme zwischen euch gleichzeitig damit?» wollte Lene wissen.
Helene schüttelte den Kopf: «Nein, ich glaube nicht. Aber sie spitzten sich in der letzten Zeit zu, auch wegen dem Bürgerzentrum. Heute abend auf der Stadtratssitzung sind sie kulminiert, als ich …»
Helene sah zu Lene auf und schüttelte den Kopf: «Es hat keinen Sinn, ich rede zusammenhangloses Zeug, und …»
«Und man kann im nachhinein nicht mehr feststellen, wo die entscheidenden Probleme beginnen, wolltest du das sagen?» Und, als Helene nickte: «Was den Zusammenhang betrifft, kannst du ruhig kreuz und quer reden, dann bringen wir es hinterher in eine Ordnung. Wie damals, als ich von dir Hilfe bekam. Ich stelle Fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Und du erzählst, was du willst, in der Reihenfolge, wie es dir einfällt.»
«Wie soll man ein ganzes Leben oder eine ganze Ehe erzählen?» Helene schwieg lange. «Und ökonomische Transaktionen, die ich selbst nicht verstehe, die mit dem Gesetz für Aktiengesellschaften zusammenhängen. Ehe und Aktiengesellschaft, da gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede. Soviel ist mir klar. Wenn man in Konkurs geht, wird die Gesellschaft aufgelöst. Soweit die Ähnlichkeit. Aber der Unterschied besteht in den Verlusten, in der Ehe sind es Verpflichtungen und Verluste. Die man in der Gesellschaft vermeiden kann, und …»
«Du hast von einem Bürgerzentrum gesprochen. Warst du daran beteiligt?»
«Ja, obwohl Peter dagegen war, habe ich mitgemacht. Aber es mußte sein. Für die anderen, aber auch für meine Selbstachtung. Kennst du dich in legaler Korruption aus?»
«Du meinst legale Illegalitäten?»
Helene nickte. «Ja, und erlaubter, jedenfalls unangreifbarer Mißbrauch einer politischen Position. Und die Frage, die ich nicht klären kann: Wo liegt die Grenze? Ich bin in etwas verwickelt oder war es, denn jetzt habe ich mich sicher für immer herauskatapultiert, oder die anderen werden es schon für mich besorgen. Aber das schlimmste dabei ist, daß ich so vieles nicht verstehe. So habe ich noch nie gelebt, noch nie gearbeitet. Wenn ich früher etwas nicht verstand, konnte ich es herauskriegen, jedenfalls meistens. Aber das hier, das fing an, als ich in Peters Kanzlei eintrat. Viel zu oft gab es Dinge, die ich nicht verstand. Aber auch Dinge, über die Peter mich im unklaren lassen wollte. Er wollte nichts erklären, und ich konnte niemand sonst fragen. Das wäre Verrat gewesen. Also war ich wohl – ungewollt – an legalen Gesetzeswidrigkeiten beteiligt …»
«Warum bist du eigentlich in Peters Kanzlei eingetreten?» fragte Lene. «Ich habe das nie verstanden, wie du unter anderem deine Unabhängigkeit zum Teil aufgeben konntest. Und daß du auch an Sachen mitarbeiten mußtest, die du gar nicht gutheißen konntest, jedenfalls nicht moralisch, oder?»
«Es gab mehrere Gründe, das erkläre ich dir später», antwortete Helene. «Ich kam mit der Arbeit, die ich hatte, nicht von der Stelle. Alles wurde immer geschlossener. Es war auch davon die Rede, ich solle meine Stelle in der Behörde niederlegen. Ich verstand es so, daß ich ihnen zur Last fiel. Die Stelle ließ sich vielleicht retten, wenn jemand anderes sie übernahm. Auch weil Peter … ich hatte das Gefühl, daß er sich vor etwas fürchtete und mich deshalb gern bei sich haben wollte. Aber ich weiß es nicht, sollte ich Zeuge sein? Oder Bürge? Nein, ich verstehe es selber nicht. Denn eine Reihe von Dispositionen wurden ganz klar hinter meinem Rücken getroffen. Es war etwas, was er zusammen mit seinem Kompagnon und seiner Sekretärin und wohl auch mit dem Buchhalter gemacht hat.
Aber falls er mich brauchte, wollte ich ihm helfen. Denn ich liebe ihn, und es darf nicht … Na so was, jetzt rede ich in der Gegenwart. Denn ich liebe ihn immer noch, aber ich weiß nicht – ich kann ihn nicht achten. Ich glaube, hin und wieder ist er das, was ich unter unehrenhaft verstehe. Ich glaube, er mißbraucht seine politische Macht; nein, das weiß ich. Er macht einen korrupten Eindruck auf mich. Deshalb mußte ich mich lösen und deshalb …»
«Und deshalb wurdest du zusammengeschlagen und auf dein Klimakterium hingewiesen. Glaubst du, dieser Mißbrauch fing erst an, als du in die Kanzlei eingetreten bist, oder war es schon früher so, ohne daß du davon wußtest?»
«Ich weiß nicht. Wenn er diese Baugeschichten hatte und oft sehr eng mit dem Bauunternehmer, Dam Petersen, zusammenarbeitete. Das hat mir immer Sorgen gemacht. Er hat mir nicht gefallen. Aber er war immer präsent, das erste Mal habe ich ihn ja an dem Wochenende vor bald zwanzig Jahren getroffen.»
Helene lächelte, als ihr das Wochenende im Sommerhaus einfiel.
«Das habe ich dir sicher noch nie erzählt, was? Du kannst Peter nicht ausstehen, du glaubst, er besteht nur aus Kälte und Arroganz und Karriere. Er wirkt so, aber es gibt auch noch einen anderen. Weißt du, was Leidenschaft ist?» Und, als Lene nickte: «Weißt du, wie lange Leidenschaft dauern kann?»
Lene lächelte: «Manche behaupten, ein paar Jahre. Ich glaube, Leidenschaft kann ein Leben lang dauern. Und du?»
«Das glaube ich auch. Mehr oder weniger intensiv in verschiedenen Phasen. Und an dem Wochenende, an dem ich früher aufbrach … Das war, nachdem ich im Anschluß an unser Examen den Umzug hinter mir hatte.»
Helene
Helene, dreißig Jahre, alleinstehende Mutter der fünfjährigen Anne. Eine frischgebackene Sozialarbeiterin, die sich um eine Stellung bei der Sozialverwaltung einer mittelgroßen Provinzstadt beworben und sie bekommen hatte. Helene war froh, Kopenhagen hinter sich zu lassen. Und es war ihrem Selbstbewußtsein sehr gut bekommen, als Sozialarbeiterin fertig ausgebildet zu sein. Es war aus verschiedenen Gründen eine Art Flucht und der Wunsch, ein neues Leben zu beginnen. Auch wenn sie realistisch genug war zu wissen, daß man seiner Vergangenheit nicht entkommen, nur eine gewisse Distanz von ihr gewinnen und nur nach außen hin einen «Neuanfang wagen» kann, wie es so großartig heißt. Aber der räumliche Abstand war aus Rücksicht auf Anne praktisch, die zu oft von ihrem Vater, Ole, im Stich gelassen wurde, weil er die Verabredungen vergaß, die er getroffen hatte.
Helene wußte, es war auch, um selber eine Distanz zu einer hoffnungslosen Hoffnung zu gewinnen. Nein, es gab nichts mehr zu hoffen. Und es war eine berufliche Herausforderung, über die sie froh war.
Sie war noch nicht lange da, als sie eines Tages buchstäblich mit Peter zusammenstieß. Sie ging die Treppe zum Verwaltungsbüro hinauf, während sie über einen Fall nachdachte; ihre Tasche hatte sie unter dem Arm, als sie in einen Mann hineinlief, der die Treppe herunterkam. Sie ließ ihre unverschlossene Tasche fallen, und alles, was in einer Tasche sein kann, die zugleich als Aktenmappe dient, kullerte auf die Stufen.
Sie hatte «Entschuldigung» gemurmelt und angefangen, ihre Sachen zusammenzusuchen, wobei er ihr half. Zuerst hatten sie die Akten eingesammelt, danach ihre Kulis und Bleistifte, alte Kinokarten und allen möglichen Krimskram. Während sie all das Zeug entgegennahm, das nicht in eine Tasche gehörte, sondern in einen Papierkorb, mußte sie plötzlich lachen, als sie den feinen Herrn betrachtete, der ihr half. «Ein flotter Typ» war sicher nicht der richtige Ausdruck, dafür wirkte er zu nobel. In kariertem Tweedsakko – etwas zu kariert, aber ausgesprochen englisch und geschmackvoll und teuer, mit Krawatte, Taschentuch, Socken, Hose und Hemd, die zu den Brauntönen des Sakkos paßten. Sie mußte noch lauter lachen und konnte nicht erklären, warum; denn ihr wurde klar, daß sie nur deswegen so heftig aufeinandergeknallt waren, weil er sich absolut sicher gewesen sein mußte, sie würde ihm ausweichen.
«Sie arbeiten hier im Rathaus?» hatte er gefragt oder festgestellt. Wahrscheinlich wegen der Akten.
Sie nickte: «In der Sozialverwaltung.»
«Dann sind Sie die neue Sozialarbeiterin», stellte er fest. «Ich heiße Peter Magnussen. Ich bin Anwalt und gehöre zum Sozialausschuß. Es kann ja sein, daß wir miteinander zu tun bekommen.» Er hatte ihr die Hand gegeben, sie stellte sich vor, nickte nach seiner letzten Bemerkung und warf einen Blick auf die rindslederne Aktentasche, die er abgestellt hatte.
«Ich mache kein Geheimnis daraus, ich war gegen die Anstellung einer Sozialarbeiterin.» Er hatte den richtig überlegenen Anwaltstonfall. Sie sah ihn an, schätzte, daß seine Mappe den Großteil eines Sozialarbeiter-Monatsgehalts gekostet hatte, und fragte:
«Was haben Sie gegen Sozialarbeiter?» Offenbar hatten sie beide Vorurteile. Ganz gleich, was er sagt, steht es unentschieden, wenn nicht zu seinen Gunsten, konnte sie noch denken, denn sie hatte ihn nach Tonfall, Aktenkoffer, Anzug bereits eingeordnet und ihn im Kopf zu den ehrgeizigen Aufstrebern gezählt, die sie immer furchtbar langweilten und ärgerten; zu ihren Kennzeichen gehörten Sicherheit, Besserwisserei und die Vorhersagbarkeit ihrer Ansichten.
«Eine Sozialarbeiterin ist zumindest potentiell eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung für die Stadt. Dabei denke ich an die Gehaltsausgaben», sagte er mit einer Sicherheit, als sei es eine unwiderlegbare Wahrheit und als dulde er keinen Widerspruch.
«Und meinen Sie nicht, das ist der Sinn der Sache?»
Seinen Gesichtszügen konnte sie ansehen, daß er eine andere Antwort erwartet hatte – etwa, man würde dieses Geld später einsparen, oder das übliche Gerede, daß Vorbeugen besser sei als … Das hatte er zu oft gehört. Aber zuzugeben, daß man es natürlich darauf abgesehen habe, der Stadt Ausgaben zu verursachen – auf diese Antwort war er offensichtlich nicht vorbereitet, obwohl er sich überraschend schnell darauf umstellte.
«Sozialistische …» er suchte nach Worten.
«Weltverbesserer», schlug sie vor und entdeckte das Rotary-Abzeichen an seinem Revers. Rotarier, Anwalt, dann ist er also konservativ. In wenigen Minuten erzählt er mir, daß «jeder seines Glückes Schmied» ist.
«Ich hätte allerdings Reformler gesagt», meinte er mit einem Anflug von Ironie. «Aber ich finde …»
«Jeder ist seines Glückes Schmied», sagten sie aus einem Mund. Er sah sie verblüfft an: «Woher können Sie …»
«Entschuldigen Sie mich», sagte sie mit einem Blick auf die Uhr; er war anziehender, wenn er verwirrt war. «Ich muß gehen, denn ich möchte pünktlich an meinem Arbeitsplatz erscheinen. Danke für Ihre Hilfe beim Aufsammeln meiner alten Bus- und Kinokarten. Und für die Information über Ihre Einstellung zum sozialen Hilfsnetz.»
«Ich bin besser als mein Ruf», antwortete er, immer noch leicht verwirrt, auch weil gewöhnlich er es war, der ein Gespräch beendete. Und weil diese sichere Frau ungewöhnlich war.
«Ich wußte nicht, daß Sie einen Ruf haben. Meinen Sie hier oder in der Stadt?»
Sie dachte: Er gehört zu den Wohlhabenden; wenn er nur nicht so trivial ist, zu meinen, daß …
Er sagte: «Ich meine ja nur, daß …»
«Geld nicht glücklich macht», sagten sie aus einem Mund. Wieder sah er sie verblüfft an, während sie sagte: «Jetzt muß ich aber raufgehen und mich erkundigen, ob Ihr Ruf richtig ist. Finden Sie es nicht ärgerlich, daß immer nur die Falschen das mit dem Geld sagen?»
Sie schüttelte den Kopf, als er etwas sagen wollte. Nickte ihm lächelnd zu und ging die Treppe hinauf.
«Na, du hattest anscheinend einen Zusammenstoß mit der Rechten», sagte der Sozialbeamte, der sie vom Fenster aus beobachtet hatte. «Und mit dem Großkapital?» wollte sie wissen. Der Beamte dachte nach.
«Ja, Kapital, das kann man schon sagen. Renommierte Kanzlei, die er von seinem Vater übernommen hat. Aber er ist besser als sein Ruf.»
«Worin besteht sein Ruf? Er hat nämlich selbst davon angefangen. Nein, das kann ich immer noch früh genug erfahren. Ich habe so schon genug Vorurteile.» Es ärgerte sie, daß er die zwei Redensarten gebraucht hatte, die ihr am gründlichsten verhaßt waren; auch weil sie manchen, die sie kannten, als Beweis für die Chancengleichheit aller herhalten mußte. Und sie wußte, wie wenig das auf alle zutraf. Zum Beispiel hatten nicht alle ihre Mutter gehabt.
Helene, uneheliche Tochter einer Fabrikarbeiterin. Das hinterließ unauslöschliche Spuren. Ihre Mutter hatte mit ihren Ansichten und Meinungen, aber vor allem durch ihre Persönlichkeit und schließlich durch ihre totale Erschöpfung ihre Jugend im besten Sinn beherrscht. Helene hatte ihre Mutter vergöttert und sowohl indirekt als auch direkt eine große soziale Wut kennengelernt, als sie erlebte, wie zynisch das Arbeitsleben die niedrig Bezahlten, Unausgebildeten zur Strecke brachte. Ihre Mutter, die immer Rückenschmerzen hatte und immer kränker wurde, sich aber trotzdem zur Arbeit schleppte. Sie hätte längst Frührente haben müssen und bekam sie erst, als es zu spät war; zum Aufgeben war sie zu stolz und der Arzt zu unerfahren, um sie zu überreden. Der Arzt hatte ja keine Ahnung, wovon er sprach, als er ihr sagte, sie solle sich mal «ein wenig» erholen, alles «etwas ruhiger» angehen. «Etwas ruhiger». Wie sollte man Fabrikarbeit mit Ruhe angehen, wenn man nicht nur sich allein zu versorgen hatte? Die Mutter verzieh dem Arzt seine Unerfahrenheit. «Woher soll er es auch wissen», lautete ihr Kommentar, «er hat doch keine Ahnung, von was er redet. Aber du, Helene, du mußt weiterkommen und uns trotzdem nie vergessen.»
«Weiter» hieß: nicht nur Hauptschule, sondern mehr Schuljahre. Wissen war Macht. «Und vergiß nie: Sprache ist Macht», sagte ihre Mutter oft. Besonders, wenn sie als Vertrauensfrau erlebte, wie diejenigen, die die Sprache in ihrer Macht hatten, sie anderen gegenüber mißbrauchten. «Du sollst lernen, die Sprache zu beherrschen, aber auch, anderen, weniger gebildeten damit zu helfen. Du darfst sie nie mißbrauchen. Dafür sind die Wörter, ist die Sprache zu gut.»
Die Mutter, die ihr «Ditte Menschenkind» und «Pelle der Eroberer» vorgelesen hatte. Und gemeinsam mit ihr über Ditte geweint hatte.
Es hatte Widersprüche gegeben, die Helene nie ganz klären konnte. Unter anderem hatte ihre Mutter, während sie sie zur Solidarität mit der Arbeiterklasse und besonders den Frauen daraus erzog, ihr vielleicht unbewußt eine schmerzhafte und nie aufgearbeitete Angst vor der Armut mitgegeben.
Das war verständlich, denn ihre kleine Haushaltskasse geriet so leicht aus den Fugen. Ihre Mutter traute sich nicht, das Angebot einer besseren, weniger feuchten Wohnung anzunehmen, weil sie die etwas höhere Miete fürchtete. Ihre Mutter nahm sie zum Umzug am ersten Mai mit und zeigte ihr die betrunkenen Männer. «Nimm dich vor denen in acht», sagte sie, «heirate nie so einen, der zerstört dein Leben.» Erst sehr viel später wurde Helene klar, daß sie aus bitterer Erfahrung sprach, denn «so einer» war anscheinend ihr Vater gewesen, und «so einer» hatte – jedenfalls zum Teil – das Leben ihrer Mutter zerstört.
Eine Mutter, die sich selbst nie schonte und nur fürchtete, daß Helene sich von der Klasse unterschied, nicht so schön angezogen war wie die anderen. In ihrer spärlichen Freizeit strickte und nähte sie.
Helene sollte vorwärts kommen, ohne ihren Hintergrund zu vergessen. Das war der heißeste Wunsch ihrer Mutter. Sie erlebte nicht, wie er in Erfüllung ging, weil sie früh starb. Helene vermißte sie oft. Am meisten vermißte sie sie, als sie selbst Mutter wurde und dann besonders, als sie selbst kurz darauf alleinstand. Obwohl sie nicht «so einen» geheiratet hatte.
Helene bekam nur schwer die Erlaubnis, ihrer Mutter zu helfen. Sie mußte sie lange überreden, bevor sie einen kleinen Job neben der Schule annehmen durfte. Helene sollte ihre Zeit dazu verwenden, zu lernen und klug zu werden.
Als Helene im Gymnasium anfing, erkrankte ihre Mutter schwer; es war nicht mehr nur der Rücken, der sie lange Jahre geschmerzt hatte, sondern jetzt auch Krebs und Wasser im Körper. Jetzt fand der Arzt, daß sie arbeitsuntauglich war und sich um Frührente bemühen sollte. Es fiel ihrer Mutter schwer, zu akzeptieren, daß sie «der Gesellschaft zur Last fallen» sollte, wie sie es nannte. Und nur Helene versuchte, sie davon zu überzeugen, daß sie ein Recht darauf hatte.
Als Helenes Mutter auf die Bewilligung ihrer Frührente wartete, wußte Helene, daß sie ihr das Studium unmöglich finanzieren konnte, und ohne erst mit ihrer Mutter darüber zu reden, ging sie zum Direktor und erklärte ihm die Veränderung ihrer Verhältnisse. Sie durfte direkt in die Realschule überwechseln. Das verschaffte ihr Zeit, eine etwas einträglichere Nebenbeschäftigung anzunehmen. Ihre Mutter weinte, als sie es erfuhr, aber sie wußte ja, daß bei ihrer Finanzlage nichts zu machen war. Und Helene versprach ihr, später das Abitur nachzumachen und zu studieren.
Früher hatte Helene nie den Wunsch gehabt, etwas über ihren Vater zu erfahren. Dazu liebte sie ihre Mutter zu sehr, die alle ihre Bedürfnisse nach einer Familie erfüllt hatte.
Außerdem wollte sie ihre Mutter nicht mit Fragen verletzen; aber in der letzten Zeit, als ihre Mutter sehr von der Krankheit gepeinigt war, erhielt Helene einige verstreute Hinweise, die sich nach und nach zu einem Bild zusammenfügten. Und sie begriff, daß ihr Vater die einzige Leidenschaft ihrer Mutter gewesen war; er war nicht nur «so ein» Betrunkener gewesen, sondern auch ein Träumer, vielleicht ein Phantast, mit ehrgeizigen Plänen, die er nicht realisieren konnte.
Bei Fieberanfällen oder wenn ihre Mutter, vor Schmerzen weinend, nicht schlafen konnte, saß Helene bei ihr und hörte die Bruchstücke einer Liebesgeschichte, die noch nie jemand erzählt bekommen hatte. Von einem Mann, der die Schranken, die sein Milieu, seine fehlende Bildung ihm setzten, nicht verkraftete, ein künstlerischer Typ, zum Arbeiter verurteilt. Und sie verstand, daß der Ehrgeiz ihrer Mutter, was ihre Tochter anging, auch eine Liebeserklärung an ihren Vater bedeutete, der an der Unvereinbarkeit von Traum und Wirklichkeit zerbrochen war.
Helene redete selten von ihrer Mutter. Schon gar nicht, als es modern wurde, mit einem sogenannten «proletarischen Elternhaus» zu prahlen und zu kokettieren.
Erst viel später konnte sie wieder über ihre Mutter sprechen, als ihre jüngste Tochter etwas über Helenes Kindheit und Jugend wissen wollte. Anne, die ältere, hatte selten gefragt, aber Maria wollte oft von der Großmutter hören, die sie nie gekannt hatte. Und Helene hatte entdeckt, wie schön es war, ihrer wißbegierigen Tochter von ihrer Mutter zu erzählen. Das schweißte zusammen, führte zu einer Vertraulichkeit und Gemeinsamkeit, die nur sie beide miteinander hatten.
In der letzten Zeit – auch weil Maria nicht zu Hause war und weil sie sich daher sehr allein fühlte – hatte Helene oft an ihre Mutter gedacht. Und sie dachte – auch wenn es pathetisch klang –: an diesem Abend hatte sie so gehandelt, wie ihre Mutter es für richtig gehalten und wie ihre Mutter gehandelt hätte. Sie wußte auch, Maria würde ihr Auftreten bei der Stadtratssitzung und damit Peter gegenüber richtig finden. Ohne Rücksicht auf die Folgen, wäre Maria stolz auf sie.
Sie lächelte bei dem Gedanken, daß Maria ihrer Mutter ähnlich war.
Ole und Anne
Als Helene ihr Jurastudium wegen Ole aufgegeben und eine Stelle als Anwaltssekretärin angenommen hatte, dachte sie oft, es werde ihr nie gelingen, eine Ausbildung zu bekommen, die ihr gefiel. Sie würde das Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hatte, nie einhalten können.
Trotzdem hatte sie, als sie Ole kennenlernte, das Gefühl, seine Zukunft ginge vor, ihre sei zweitrangig. Sie hatte sich gefragt, ob sie als Mann genauso gedacht hätte. Ob es weiblich oder menschlich sei zu meinen, der Begabteste käme zuerst. Es war weiblich.
Sie hatte daran geglaubt, sich jedenfalls davon überzeugen lassen, daß Ole Schriftsteller werden würde. Er studierte seit Jahren Literaturwissenschaft, es fehlte nicht mehr viel und er konnte als «ewiger Student» gelten, aber das wußte Helene damals nicht. Weil Ole so wenig Chancen hatte, besonders finanziell, glaubte sie, wurde er mit dem Studium nicht fertig. Aber auch, weil er lieber Gedichte schrieb. Und die Gedichte waren es, die sie gefangennahmen. Nie zuvor war ihr ein «richtiger» Schriftsteller begegnet.
Achtung vor der Sprache hatte ihre Mutter ihr beigebracht, indem sie ihr aus Büchern vorlas. Im Gymnasium hatte es ihr weh getan, wie die Literatur zerfasert wurde, so wie davor in Botanik die Blumen zerfasert wurden.
Die Dänischstunden gefielen ihr nicht, was ihr aber den Spaß am Lesen nicht verdarb, wie so vielen anderen. Sie kam zu dem vernünftigen Schluß, daß nicht die dänische Literatur irrte, sondern ihre Interpreten, jedenfalls die im Gymnasium.
Sie las gierig alles, wozu ihr Zeit blieb. Ihr Bedürfnis nach Büchern ließ sich nie ganz befriedigen; immer hatte sie zu wenig Zeit. In den letzten Lebensmonaten ihrer Mutter hatte sie ihr einige Bücher vorgelesen. Es war, als würden die Rollen – auch hier – vertauscht. Sie war es, die bereits in der Realschule und später, als sie in einem Büro in die Lehre kam, Entscheidungen zu treffen lernte. Weil ihre Mutter zu krank war. Und auf ihre Hilfe angewiesen. Nach dem Tod der Mutter waren die Bücher ein Trost. Sie halfen ihr ein wenig über die große Sehnsucht und das Gefühl unbeschreiblicher Einsamkeit hinweg, jetzt, da sie ganz allein war und nur die Verantwortung für sich selber hatte.
Neben ihrer Arbeit im Büro machte sie das Abitur in der Abendschule nach. Es war anstrengend und erforderte einige Willensstärke. Aber darüber machte sie sich nie Gedanken, es war etwas Notwendiges. Sie konnte nicht erklären, warum sie mit dem Jurastudium anfing; sie hatte sich frühzeitig dazu entschieden. Sie glaubte nicht, daß die naive Vorstellung entscheidend war, man werde Gesetze und Richtlinien der Gerechtigkeit lernen. Auch wenn diese Vorstellung zu ihrer Wahl beigetragen hatte. Das Logische, das Spitzfindige und auch das Unlogische an diesem Studium interessierten sie. Sie mußte abends und an den Wochenenden arbeiten, um sich zu unterhalten; zum Glück hatte sie die billige Wohnung ihrer Mutter behalten dürfen. Billig und schlecht, aber gut genug für sie.
Sie war in diesen Jahren ziemlich einsam, aber darüber machte sie sich keine Gedanken; es war ihr eigentlich recht. Unter den anderen Studenten fühlte sie sich als Fremde. Sie hatten einen ganz anderen Hintergrund, wirkten unreif und ein wenig verwöhnt. Wenn sie über all die Dinge redeten, die ihnen Spaß machten, alles, wofür sie Zeit und Geld übrig hatten, schienen sie aus ganz anderen Welten zu kommen. Sie erinnerte sich nicht mehr, ob sie sie je beneidet hatte, diese behüteten jungen Leute, die über Dinge redeten, an denen sie, wie sie wußte – oder glaubte –, nie teilhaben würde. Sie hatte ihre Welt, die anderen eine andere, es konnte nicht anders sein. Die Erlebnisse, die sie brauchte, fand sie in Büchern, auch wenn sie nicht sehr viel Zeit zum Lesen hatte neben Studium und Jobs.
Ole lernte sie in der Universitätscafeteria kennen. Er saß mit anderen an einem Tisch und redete über moderne Dichter. Es war sehr voll gewesen, deshalb hatte sie sich zu ihnen setzen müssen; sonst aß sie gewöhnlich allein. Ole führte das große Wort, die anderen waren mehr seine Zuhörer; er schien sehr viel zu wissen und war dem Literaturstudium gegenüber besonders kritisch.
Als die anderen zur Vorlesung aufbrachen, blieb er sitzen. Sie auch; seine sichere Art machte Eindruck auf sie, seine überzeugende Kritik am Studium und seine Beurteilung gegenwärtiger Autoren. Als sie nur noch zu zweit waren – sie versäumte zum erstenmal eine Vorlesung –, kamen sie ins Gespräch. Allerdings war hauptsächlich er es, der redete; er erzählte von sich, seinem Studium, seinen Zukunftsplänen, auch, daß er gerade einen Lyrikband zusammenstelle und mit einer Veröffentlichung rechne. Als sie zu ihrer Arbeit mußte, verabredeten sie sich für den nächsten Tag. Nach einiger Zeit begann sie auch ein wenig von sich zu erzählen. Es fiel ihr nicht schwer, auch wenn er der erste war, dem sie sich anvertraute.
Ein paar Monate darauf zog er zu ihr, nach ein paar Monaten heirateten sie, wieder ein paar Monate später gab sie das Studium auf und nahm eine Stelle in einer Kanzlei an. Ole brauchte Ruhe, um seinen Lyrikband zur Veröffentlichung fertigzustellen und sich auf sein Studium zu konzentrieren. Sie vereinbarten, daß sie, wenn er fertig wurde und vielleicht eine Stelle bekam – er wußte nicht so recht, was er mit einem Magister anfangen sollte, Unterrichten kam jedenfalls nicht in Frage –, ihr Studium wieder aufgreifen könne. Er war davon überzeugt, daß sie sich dann für ein anderes Fach als Jura entscheiden würde.
Obwohl sie sehr selbständig geworden war, hatte sie das Gefühl, von Ole viel zu lernen. Dankbar dafür, von jemand anderem mit Interesse und Liebe bedacht zu werden, ließ sie sich von ihm formen und beeinflussen. Sie liebte ihn mit einer Innigkeit und Freude und Dankbarkeit, die sie seine Fehler übersehen ließ.
Sie hatte auch das Gefühl, daß er sie sozusagen formte und die aus ihr machte, die sie dann wurde. Und ihrem Leben einen Inhalt gab. Sie war, seit sie ganz klein war, selbständig gewesen, aber er brachte ihr bei, etwas anzufangen mit ihrer Selbständigkeit; das Wissen und die Erfahrungen, die sie hatte, einzusetzen.
Ihre Liebe war bedingungs- und grenzenlos. Und zugleich war sie ihm zutiefst dankbar, weil er sie dazu brachte, sich zu entwickeln, sich selbst zu finden, ihre Ansichten zu klären. Daher war es nur natürlich, daß sie es ihm dafür ermöglichte, sich so zu entfalten, wie er wollte.
Mit der Zeit – aber so langsam, daß sie es erst ganz zuletzt merkte, wohl auch, weil sie es nicht merken wollte oder konnte –, mit der Zeit wurde sie ihm auch intellektuell überlegen. Das konnte er nicht akzeptieren. Statt von ihr zu lernen und so eine gegenseitige Beeinflussung zuzulassen, zog er sich zurück, vielleicht unbewußt, und verbarg sich hinter einem ironischen Panzer. In dieser Phase war er verletzlich und leicht beleidigt. Als seine Gedichte von diversen Verlagen zurückgeschickt wurden, weil man sie nicht für veröffentlichungsreif hielt – der wesentliche Einwand war meist, sie wirkten nicht genügend durchgearbeitet –, wollte er nichts von ihren Vorschlägen und ihrer konstruktiven Kritik wissen. Im Gegenteil. Mit Verwunderung merkte sie, daß gerade ihre Vorschläge von anderen kommen mußten; noch besser, er hielt sie für seine eigenen Ideen, dann schienen sie ihm brauchbar. Es wurde so kompliziert, daß sie es aufgab, ihm zu helfen; sie merkte, daß er sich von ihr zurückzog. Es fiel ihr auch schwer, mit seiner Ironie zurechtzukommen, besonders, wenn er versuchte, sie und das, was sie sagte, vor ihren Freunden und Bekannten lächerlich zu machen. Da seine Veränderung mit ihrer Schwangerschaft zusammenfiel, die sie gewünscht und geplant hatte, nahm sie an, sie würde sein Verhalten überinterpretieren, weil sie besonders empfindlich sei. Ihre Beziehung würde sich sicher ändern, oder besser, so werden wie früher, wenn die Geburt überstanden war.
Seine Einstellung zu ihrer Schwangerschaft wunderte sie auch. Er hatte beschlossen – zuerst hielt sie es für einen Witz –, zwar ein Kind zu wollen, aber nur unter der Bedingung, daß es ein Junge werde.
Er wollte nichts davon wissen, daß es doch genausogut ein Mädchen werden konnte und sie dann ebenso glücklich wäre. Völlig irrational bestand er auf einem Sohn. Denn er wollte nur eine Kopie seiner selbst, eine möglichst ähnliche Kopie.
Sie bekam eine Tochter, und er nahm sich eine andere, eine junge, unselbständige Frau, die ihn bewunderte und ihn versorgen konnte und wollte. Es war so schmerzhaft für sie, daß sie das Komische daran nicht sehen konnte.
Seine Enttäuschung und sein fehlendes Interesse an ihrer Tochter war ihr bereits aufgefallen, als sie noch im Krankenhaus lag, wo er sie nur ein paarmal besuchte. Sie glaubte, wenn sie erst nach Hause käme und er sich an das Kind gewöhnte, würde er es auch lieben, so wie sie. Vielleicht nicht so leidenschaftlich und dankbar; aber man konnte doch sein Kind nicht ablehnen. Er konnte es. Er ließ es sich nicht direkt anmerken, um sich nicht lächerlich zu machen, aber innerlich lehnte er es von Anfang an ab, und daran änderte sich nie etwas.
Sie liebte ihn immer noch, demütigte sich, um ihn zum Bleiben zu bewegen.
Sie war zu stark geworden und hatte ihn nicht «reproduziert». Deshalb verließ er sie. Mit ihrem Kind im Arm lernte sie bis auf die Knochen Verlustangst und -schmerz kennen. Die Angst, die sie später nie mehr verließ.
Lange Zeit hoffte sie, er werde zurückkommen. Und ihre Liebe und Leidenschaft dauerte noch länger.
Sie bestand darauf, daß er in Kontakt mit seinem Kind blieb – obwohl es ein Mädchen war. Aus den Büchern über Kinderpsychologie, die sie las, wußte sie, wie wichtig es für ein Kind war, sich mit beiden Eltern identifizieren zu können. Stimmte es wirklich, hatte sie auf einen Vater verzichten können? Obwohl ihre Mutter so stark gewesen war und ihre gesamten emotionalen Bedürfnisse nach Eltern hatte erfüllen können? Sicher hatte sie einen Vater vermißt zu Zeiten, an die sie sich nicht erinnern konnte. Und ihr Interesse an dem, was sie ihrer Mutter über ihn entlocken konnte in der letzten Zeit ihres Lebens, wäre wohl kaum so groß gewesen, wenn sie vorher mehr über ihn gewußt hätte. Sie hatte geradezu hektisch Bruchstücke gesammelt, weil sie wußte, jedes Wissen um ihren Vater würde mit dem Tod ihrer Mutter verschwinden.
Ihre Anne sollte einen Vater haben und am besten auch ein natürliches Verhältnis zu ihm, obwohl er seit ihrer Geburt ein geschiedener Vater war und obwohl es schwer war, ihn zu geregelten Zusammenkünften zu bewegen. Er wollte keine festen Verabredungen. Er fand, sie könnten sich jedesmal neu spontan verabreden. Was dazu führte, daß sie nie etwas planen und Anne, die, als sie erst verstand, was ein Vater war, ein ziemliches Interesse für ihn an den Tag legte, nie vorbereiten konnte. Wenn es zu einer Verabredung kam, dann im letzten Augenblick. Helene konnte Anne nie etwas sagen, worauf sie sich hätte freuen können, denn die Termine wurden oft kurzfristig abgesagt. Helene wußte nicht, was schädlicher für Anne war: Wenn sie erst ganz spät erfuhr, sie würde ihn besuchen, oder wenn sie vorbereitet war, aber Gefahr lief, daß ihr Vater sie sitzenließ. Und schließlich, ob das fehlende Interesse ihres Vaters nicht genauso schlimm war, wie wenn sie ihren Vater gar nicht gekannt hätte. Sie wußte es nicht, aber diese Überlegungen trugen jedenfalls entscheidend dazu bei, daß Helene sich um eine Stelle in einiger Entfernung von Kopenhagen bewarb. Denn dort ließen sich die Vater-Tochter-Besuche nicht mehr so spontan wie bisher durchführen. Sie mußten geplant werden, und – so Helenes Beschluß – wenn das nicht möglich war, mußten die Besuche und der Kontakt eben aufhören. Was binnen kurzem der Fall war.
Peter
«Er hat den Ruf …» – «Er steht im Ruf …» Helene schüttelte jedesmal den Kopf. Sie wollte nichts von Peter Magnussens Ruf wissen. Sie gehörte nicht zu denen, die auf Klatsch und Tratsch hörten. Wenn sie sich eine Meinung bildete, dann nur auf Grund eigener Beobachtungen. Er schien sogar ein klein wenig stolz auf seinen «Ruf» zu sein und darauf, daß er «besser» war. In der ersten Zeit begegnete sie ihm ein paarmal in der Sozialverwaltung: Stellungnahmen zu einem Kriminalfall, einem Scheidungsprozeß, zu einer Streitfrage in Sachen Erziehungsberechtigung. Ihr fiel auf, daß sein eleganter Anwaltshabitus nicht zu Fällen paßte, in denen es mehr um soziale und menschliche Probleme ging als um juristische Spitzfindigkeiten.
Sein Ruf bestand übrigens hauptsächlich darin, daß er ein Karrierist sei, der seine Zeit fast ausschließlich darauf verwende, aus der renommierten Familienkanzlei noch mehr zu machen; daß er in der ansehnlichen Patriziervilla am Ort lebte. Daß er fünfundvierzig war und Junggeselle. Und der «Traum» vieler Frauen.
Einmal rief er wegen eines sozialen Problems an, das einen seiner Klienten betraf. Ein anderes Mal saßen sie zufällig im Kino während eines Bergman-Films nebeneinander. Nach dem Film lud er sie auf eine Kleinigkeit ins nächste Restaurant ein – «um über den Film zu reden, es sei denn, Sie sind um Ihren guten Ruf besorgt». Sie nahm die Einladung an; sie fürchtete nicht um ihren Ruf, entdeckte aber im Lauf des Abends und der folgenden Tage, daß sie sich vor ihm fürchtete. Oder vielmehr vor ihren Gefühlen für ihn.
Eine Woche danach lud er sie ins Theater ein, als ein Gastspiel gegeben wurde, wieder mit anschließendem Gespräch im Restaurant.
Er wirkte unerhört selbstsicher und manchmal in seinem Urteil über andere Menschen, aber auch wenn sie hin und wieder soziale Probleme diskutierten, sehr arrogant. Oft verhielt er sich besserwisserisch, manchmal auch väterlich-überheblich. Aber sie bemerkte, daß er unsicher wurde, wenn sie anders reagierte, als er erwartete – im allgemeinen erwartete er das Naheliegendste oder Banalste; er hatte klischeehafte Vorstellungen von so vielem, auch von Dingen, die mit ihrem Beruf zusammenhingen.
«Warum sind Sie eigentlich Sozialarbeiterin geworden?» fragte er bei einem ihrer ersten Treffen.
Sie lächelte, dachte daran, wie oft sie diese Frage beantwortet hatte; an ihre erste Psychologiestunde, als alle Studenten danach gefragt wurden. Und an die vielen Antworten, eine missionarischer als die andere, die sie schließlich, als die Reihe an sie kam, auf die Palme gebracht hatten: für andere dasein, den Bedürftigen helfen, Menschen in Not retten. Und wie sie selbst, leicht irritiert über diesen Missionseifer, gesagt hatte, sie sei neugierig, mische sich liebend gern in die Probleme anderer und wolle über sie bestimmen.
Dasselbe antwortete sie ihm, und er war verwirrt; er hatte eine der Standardantworten erwartet. Sie dachte: Es ist gefährlich, ihn zu verwirren, denn dann wirkt er zu anziehend. Auch wenn es mir gelingt, ihn aus seiner Besserwisserrolle zu holen, verunsichert er mich.
Sie hatte daran gedacht, Kontakte anzuknüpfen, «sich einen Freundeskreis aufzubauen», wie man sagt. Aber ihr Bedürfnis danach war zu gering; sie fühlte sich ausgefüllt von ihrem Beruf, dem Zusammensein mit Anne, von den meist allein verbrachten Abenden, an denen sie las, Musik hörte.
Eines Tages fragte er sie, ob sie fände, daß er so sei wie sein Ruf oder besser. Da gingen sie zum Du über. Als sie ihm erzählte, daß sie seinen Ruf nicht kenne, sich nie dafür interessiert habe, wirkte er verblüfft.
«Aber deinen Vorstellungen von einem Rechtsanwalt entspreche ich doch wohl?»
«Gibt es denn nur eine Sorte von Rechtsanwälten? Aber du meinst vielleicht: meinen Vorurteilen?» Sie lächelte ihn an und betrachtete sein Rotary-Abzeichen: «Ja, schon, aber du bist nicht nur so …» Sie hielt inne, wollte nicht zu persönlich werden, in ihrem eigenen, aber auch in seinem Interesse. Sie wußte, es würde ihn verunsichern, wenn sie von «dem anderen» zu reden anfinge, denn das war sicher eine Seite, die er an sich selbst nicht mochte und vor anderen versteckt halten wollte.
Als sie eines Tages zur Arbeit fuhr, sah sie ihn alleine, in Gedanken vertieft dahergehen. Sie hatte Rot und blieb stehen; er fühlte sich unbeobachtet. Er sah sehr allein aus, eine Einsamkeit, die von innen kam; und genau an dieser Kreuzung, an diesem Tag merkte sie, daß sie in ihn verliebt war. Eine Liebe, die ihr nicht ungefährlich vorkam. Es war vielleicht der falsche Ausdruck, aber das fiel ihr als erstes ein. Er konnte den Schutzwall angreifen, den sie um sich errichtet hatte, als Ole sie verlassen hatte.
Eines Abends hatte er sie ins Kino eingeladen und danach zu sich nach Hause, wo seine Wirtschafterin ihnen einen Imbiß zurechtgemacht hatte, der zweifellos besser schmeckte als ihre übliche Restaurantkost. Sie wußte genau, wo er wohnte, kannte das große, stattliche alte Patrizierhaus mitten im Zentrum: die Eingangstür ein Rundbogentor aus Eiche mit Schnitzereien, Fenster von Palast-Ausmaßen. Er erzählte, es sei ein Erbe seiner Eltern; daraus schloß sie, daß beide tot waren.
«Du wunderst dich vielleicht, weil ich kaum etwas verändert habe?» Sein Tonfall war fragend. «Vielleicht, weil ich kein Bedürfnis oder Interesse habe, meinen Stempel zu setzen, aber außerdem … ich finde, es hat etwas Beruhigendes, wenn ein Heim unverändert bleibt, nicht wie alles andere vom Wechsel der Laune oder Mode abhängig ist. Na ja, vielleicht liegt es eben an meiner konservativen Haltung.»
Sie nahm viele kostbare Antiquitäten und Möbel wahr, Bilder in Goldrahmen, von denen einige sehr beeindruckend waren, andere ihr unbedeutend vorkamen.
Zunächst saßen sie in einem großen Eßzimmer, Weiß und Gold, schweres Silberbesteck und Meißener Porzellan. Sie blickte zu ihm hinüber. Er wirkte sehr einsam in dem großen Raum. Sie fragte ihn, ob er jeden Tag hier esse, aber er aß sonst in der Küche.
Danach setzten sie sich ins Wohnzimmer, sie in einen der tiefen Ledersessel, er aufs Sofa, und tranken Kaffee aus achteckigen Mokkatassen. So etwas hatte sie noch nie gesehen, das Dekor hieß wohl «Doppelspitze»; sie hatte die vage Vermutung, daß jede einzelne Tasse mehr kostete als ihr sämtliches Porzellan. Wieder kam er ihr ungeheuer einsam vor in dem großen Zimmer, wo nichts ihm persönlich gehörte, alles seine Herkunft, sein Erbe und sein Milieu repräsentierte.
Sie bekam es auf einmal mit der Angst zu tun. Zwischen ihnen geschah etwas, von ihm aus vielleicht nur etwas Erotisches, etwas, worauf er zusteuerte. Sie war in ihn verliebt. Und dann dieses imponierende Ambiente, das an ihr Mitleid appellierte; ein Mitleid, das er sich sicher verbeten hätte, aber er wirkte so einsam, und das beängstigte sie.
Deshalb trank sie ihren Kaffee rasch aus, stand zu seiner Verwunderung auf und verabschiedete sich. Wegen Anne, sagte sie. Sie redete oft von Anne, weil sie nicht wollte, daß er in seinen Zukunftsplänen für sie beide – falls er welche machte – ihre Verpflichtungen dem Kind gegenüber vergaß.
Sie spürte, daß ihr übereilter Aufbruch wie eine Flucht aussah und von ihm auch so aufgefaßt wurde. Als sie in ihrem Auto in Sicherheit war und auch noch danach, als sie den Babysitter ausbezahlt hatte, sicher in ihrem Bett lag und über ihr Sicherheitsbedürfnis lächelte, dachte sie daran, wie oft Ole sich verzweifelt beklagt hatte, daß sie die Liebe viel zu ernst nehme. Ständig hatte er wiederholt, die Liebe sei ein Spiel, es werde zu wenig gespielt, viel zu wenig würden die Leute spielen, sie beide spielten viel zu wenig, und vor allen Dingen sie sei viel zu selten zum Spielen aufgelegt. Die Liebe – ein Spiel; diese Auffassung würde sie nie verstehen, sie war ihr viel zu fremd. So konnte sie nie fühlen.
Peter rief sie nach ein paar Tagen an. «Ich habe dich neulich verscheucht, und ich habe mir Gedanken gemacht, was dich verschreckt haben könnte?» Er war verlegen.
Helene ärgerte sich, weil ihre Anträge auf finanzielle Zuwendungen vom Sozialausschuß in so vielen Fällen abgelehnt wurden.
Sie redete mit dem Sozialbeamten darüber. Er sah sie prüfend an: «Es heißt, du triffst dich privat mit ihm?»
«Überwältigend, wie schnell sich so was bei euch rumspricht», sagte sie. «Das erste, was er mir erzählt hat – du weißt, unser Zusammenstoß im Treppenhaus –, war, daß er gegen die Anstellung einer Sozialarbeiterin ist. Und er ist, soweit ich beurteilen kann, ein Mann, der Arbeit und Privatleben strikt auseinanderhält. Ich bilde mir nämlich mein eigenes Urteil. Was die Leute sagen, interessiert mich nicht.»
«Worauf willst du hinaus?» fragte er.
«Die Dinge auseinanderhalten ist ein ausgezeichnetes Prinzip. Aber ungleiche Behandlung nicht. Ich habe ein paar Fälle verglichen. Ich käme nie auf den Gedanken, mit ihm darüber zu diskutieren. Ich habe nämlich auch meine Prinzipien. Ich kann zwar noch nichts beweisen, aber ich wollte dich bitten, meinen nächsten Antrag auf eine Zuwendung so einzureichen, als käme er von dir.»
Er runzelte die Stirn und dachte nach.
«Ich weiß, es ist viel verlangt von dir. Ich werde natürlich einen Fall aussuchen, für den du eintreten kannst. Und du mußt dich voll auf mich verlassen können, ich meine darauf, daß ich dichthalte, nicht?»
«Das geht ziemlich weit, findest du nicht? Ist dir klar, was ich riskiere?» fragte er.
«Ja, aber du mußt zugeben, der Versuch ist wichtig.»
«Woher kann ich wissen, ob du es nicht später gegen ihn verwendest?»
«Wenn es ein später überhaupt gibt oder geben sollte, dann bin ich nicht mehr hier. Und ich bin keine von denen, die im nachhinein etwas gegen andere verwenden, schon gar nicht, um ihnen damit zu schaden.»
Der Sozialrat nickte. «Du bist ein seltsamer Mensch. Du gehörst zu den wenigen Leuten, auf die ich mich hundertprozentig verlasse. Obwohl ich dich erst seit kurzem kenne. Ich kann dir nichts versprechen, aber wenn du mir einen Fall bringst – oder gleich mehrere», fügte er nach einer Pause hinzu, «dann werden wir ja sehen, ob du recht hast.»
«Du weißt genau, daß ich recht habe, nicht wahr?»
Er sah sie prüfend an. Dann nickte er. «Ich glaube schon. Und was willst du mit dem Ergebnis anfangen?»
«Mich in angemessener Zeit nach einer neuen Stelle umsehen. Das wäre auch meinen Klienten gegenüber das richtigste, nicht wahr?»
Und als erriete sie, was er fragen wollte, aber für zu indiskret hielt: «Ganz gleich, ob es ein später gibt.»
Nach ein paar Monaten hatten sie mehr als genug Beweise, daß ihre Annahme, wer Bewilligungen erhielt und wer nicht, richtig war.
Als Peter sie einmal wieder zu sich eingeladen hatte, überlegte sie, ob sie sich revanchieren und ihm ihre gemütliche Zweieinhalbzimmerwohnung mit der schlafenden Anne, mit ihren Flohmarktmöbeln und den Plakaten an den Wänden zeigen sollte. An jenem Abend füllte er die Zimmer aus, während er ihr einen komplizierten juristischen Fall erzählte, den er gewonnen hatte, weil er besser vorbereitet gewesen war, weil er die Argumente der anderen Partei vorausgesehen hatte. Er ging vor ihr als Publikum im Wohnzimmer auf und ab und erläuterte den Fall und seine juristische Problematik. Wirkte charmant und sicher. Plötzlich unterbrach er sich, setzte sich zu ihr, streichelte ihr Haar. Sie rührte sich nicht, er drehte ihr Gesicht zu sich herum, sah ihr ernst in die Augen. «Du bist so … so anders», murmelte er und küßte sie. Er merkte, daß sie unruhig wurde, und legte die Arme fest um sie. «Du darfst nicht fliehen, wie letztesmal», flüsterte er, «ich brauche dich. Du mußt bleiben.»
Er konnte nicht wissen, daß sie unruhig wurde, weil sie Angst bekam, als sie spürte, wie sehr es sie nach ihm verlangte, wie leicht es für ihn war, all die Gefühle wieder bei ihr hervorzurufen, die sie für sicher verstaut hielt. Freute sie sich über die Entdeckung, daß sie noch so ansprechbar war? Sie hatte immer geglaubt, etwas in ihr sei zerbrochen, als Ole ging. In dem Maße, in dem sie mit der Vorstellung zufrieden war, sie würde sich nie mehr ihrer Gefühle wegen von einem Mann beherrschen lassen, hatte sie sich auch seit langem geschlechtlich, als Frau, behindert oder gelähmt gefühlt.
Und da spürte sie nun hier in seinem Haus, daß sie sich zwar geschützt, aber auch Mangel gelitten hatte.
Als er merkte, wie sie seine Zärtlichkeiten immer mehr erwiderte, wie es ihm gelang, sie leidenschaftlich zu machen, stand er auf, zog sie fest an sich und sagte leise: «Komm, wir gehen zu mir ins Bett.»
Es war keine Frage.
Wenn sie später an das erste Mal dachte, als sie miteinander ins Bett gingen, war ihr klar: Sie hatte gehofft, er sei kein besonderer Liebhaber. Oder ihm ginge – jedenfalls beim erstenmal – etwas schief.
«Ich verstehe nicht», sagte sie mitten in der Nacht, «du brauchst nicht zu antworten, wenn es dir zu persönlich ist, aber wieso hast du eigentlich gesagt, du brauchst mich? Du kannst doch haben, wen immer …»
«Ja, aber Helene, es geht mir doch nicht darum, irgend jemand zu haben. Du bist es, von der ich –» er überlegte – «ja, angezogen bin. Du faszinierst mich. Sicher, ich verstehe mich ganz und gar nicht auf dich, du sagst fast nie das, was ich erwarte. Es ist ja kein Geheimnis, daß ich einige Frauenbekanntschaften hatte, aber ich weiß nicht … es hat nie lange gedauert, bis ich wußte, wie sie reagierten, was sie sagen würden, wonach sie fragten.
Du hast mich zum Beispiel nie gefragt, was ich an einem Fall verdiene. Wenn du etwas fragst, zum Beispiel nach etwas Juristischem, ja, dann hörst du zu, und ich merke, daß du mir damit nicht gefallen willst, sondern es interessiert dich wirklich.
Außerdem bist du die erste Frau in meinem Leben, die mich verwirrt. Es wundert mich richtig, daß ich dir das nicht übelnehme. Aber … Und dann», sagte er lächelnd und sah in ihre ernsten Augen, «ist mir noch nie jemand mit so großen schönen Augen begegnet. Und es ist schön, mit dir zu schlafen. Möchtest du noch mehr Noten?»
«Ich dachte, ich hätte vergessen, wie …» Sie wußte plötzlich nicht, ob sie ihr Geständnis bereute. Beschloß, sich nicht um Taktik zu scheren, auch wenn ihm die anscheinend wichtig war.
«Was du vergessen hast, kann ich dir sicher rasch wieder beibringen. Du machst einen gelehrigen Eindruck», er lachte leise, und seine Stimme klang froh und stolz. Er streichelte und küßte sie aufs neue. Sie spürte, wie ihr Körper nur allzu bereitwillig war, sie klammerten sich aneinander, er nahm sie zärtlich und leidenschaftlich zugleich. Als er kam, sank er mit einem zufriedenen Seufzen auf sie und schlief ein. Sie genoß es, daß er immer noch in ihr war und sein Körper schwer auf ihr lag. Kurz darauf wachte er auf und entschuldigte sich, daß er eingeschlafen war. Sie lächelte und meinte, es sei schön so.
«Du klingst so froh», er lag auf der Seite und betrachtete sie. «Ist es lange her, daß du mit einem Mann zusammen warst?» Sie nickte, wollte nicht an Ole denken und an das Verschmähtwerden mit seinen Folgen, Minderwertigkeitsgefühlen.
«Darüber möchtest du jetzt nicht reden, das hat Zeit, nicht wahr?» stellte er fest, als er ihren Gesichtsausdruck sah. «Helene, eine ganz andere Frage, du brauchst natürlich nicht zu antworten, aber ich habe oft darüber nachgedacht. Als wir uns das erste Mal begegneten und auf der Treppe zusammenstießen, was war denn da so maßlos komisch?»
Sie schüttelte lächelnd den Kopf. «Darauf antworte ich erst, wenn wir uns besser kennenlernen.»
«Kennengelernt haben», verbesserte er. Sie freute sich über seine Berichtigung, fürchtete aber zugleich, zuviel Bedeutung hineinzulegen. Sie stand auf und zog sich an.
«Warum bleibst du nicht bis morgen früh?»
«Ich denke an den Ruf des Herrn Rechtsanwalts», sagte sie lächelnd.
Er sah sie erstaunt an. «Du, ich verstehe dich nicht. Der Ruf ist dir immer egal gewesen. Du findest es sicher komisch, daß ich Rücksicht darauf nehme. Trotzdem richtest du dich danach … Ich begreife schon wieder nicht …»
«Aber Peter», ihr fiel auf, wie liebend gern sie seinen Namen sagte, «man kann doch schließlich Rücksicht nehmen auf etwas, was dem anderen wichtig ist, auch wenn man es vielleicht nicht begreift oder gleichgültig findet … Ich meine, ich könnte doch auch an etwas hängen oder mich für etwas engagieren, das du uninteressant oder albern fändest … Ich meine, deswegen könntest du das bei mir doch trotzdem respektieren, oder? Nein, bleib liegen. Ich finde die Tür.»
Sie küßte ihn und ging.