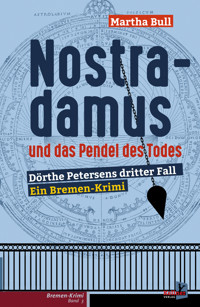Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kellner, Klaus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Name, neue Menschen, die Hoffnung, dass man nicht gefunden wird. All diese Probleme hat Helene, als sie mit dem Schiff nach Amerika auswandert. Ihr vertrautes Umfeld ist weg und ein Geheimnis verbirgt sich hinter ihr. Sie trifft auf ein Mädchen, welches sich äußerst merkwürdig verhält. Was ist hier los? Dann verschwindet einer der Passagiere spurlos, und sie wird verdächtigt, damit in Verbindung zu stehen. Dieser Roman gibt authentisch die Umstände der vielen ausgewanderten Menschen im 19. Jahrhundert wieder. Helenes Überfahrt beginnt in Bremerhaven und führt sie über den großen Ozean nach New York. In atemberaubender Weise werden ihr Leben und ihre Odyssee biografisch geschildert. Lesen sie das fesselnde Abenteuer einer Auswanderin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTHA BULL
Helenes
weg
nach
amerika
Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de
VORWORT
Ich möchte dem Deutschen Auswandererhaus in der Columbusstraße 65 in Bremerhaven für seine Unterstützung und seinen wertvollen Rat danken. Meine Fragen wurden mir mit großer Mühe bereitwillig und freundlich beantwortet. So können Sie mit Helene eine historisch genaue Schifffahrt erleben, zu einer Zeit, in der das Reisen eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Nachzuerleben ist dies ganz greifbar und eindrücklich in den Räumen des Museums.
Eine literarische Freiheit habe ich mir allerdings herausgenommen und die Errichtung der Auswandererhallen in der Bremer Hemmstraße zeitlich vorweggenommen.
Sollten sich tatsächlich historische Fehler eingeschlichen haben, so habe ich gepatzt.
Da es sich um einen historischen Roman handelt, habe ich das damals übliche Wort »Indianer« für die amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner verwendet. Die rassistischen Vorurteile waren damals unter den Auswanderern weit verbreitet und sollen darum nicht unerwähnt bleiben.
Gleich geblieben ist bis heute in all den Jahrhunderten der Auswanderung die Angst vor der Zukunft und zugleich die Hoffnung auf ein besseres Leben, denn so ganz freiwillig gingen und gehen wohl die wenigsten.
1.
»Name«, herrscht mich der uniformierte Mann hinter dem Schreibtisch an.
»He, äh, he…« Ich räuspere mich. »Franziska Wilkens«, antworte ich hastig und spüre, wie ich rot werde. »Lieber Gott hilf«, bete ich, bemühe mich um ein gleichgültiges Gesicht.
Wie oft habe ich mir diese Situation vorgestellt. Wie oft habe ich diesen Namen geübt. Aber man kann wohl nicht üben, den durchdringenden Blick dieser Kontrolleure zu überstehen. Wie stolz er da sitzt unter dem Bild eines Schiffes unter vollen Segeln, als wäre er der Kapitän persönlich. Dabei ist er bloß ein einfacher Auswandereragent. Er soll mir den Schiffsplatz auf der »Mannheim« geben, also muss ich freundlich bleiben, und wenn er ein noch so arroganter Wichtigtuer ist.
»Kennkarte«, schnauzt er weiter und streckt fordernd die Hand aus.
Stumm reiche ich ihm die Papiere. Er betrachtet sie eingehend, sieht dann von der Beschreibung zu mir hoch.
»Ein Meter einundsiebzig groß, kräftige Statur«, liest er vor, schaut erneut auf die Papiere und fährt fort, indem er mich wie einen zu erwerbenden Gegenstand mustert: »Dunkelblondes, glattes Haar, braune Augen, schmales Gesicht. Geboren 12. September 1872? Gerade erst achtzehn geworden? Sehen älter aus.«
»Helene ist älter«, denke ich in einem Anflug von Trotz.
»Minderjährig also. Einwilligung Ihres Vormundes?« Er wartet meine Antwort nicht ab, blättert weiter in den Papieren. »Ach ja, hier steht’s ja, Vater Franz Wilkens. Hausdiener im Arbeitshaus von Neustadt. Arbeitshaus von Neustadt? Hm, hm.« Er sieht nachdenklich auf die Papiere. Er zwirbelt seinen Schnurrbart.
Jetzt ist alles aus. Jetzt erinnert er sich. Ganz bestimmt hat es hier ebenfalls in der Zeitung gestanden: »Arbeitshausleiter mit minderjährigem Schützling verschwunden!« Womöglich war ein Bild von mir dabei. Er wird mich erkennen! Mir bricht der Schweiß aus. Meine Hände kneten nervös die Zipfel meines Schultertuchs. Wie konnte Franz nur denken, dass das gut geht?
»Gut. New York also.«
Der Agent liest weiter. Himmel sei Dank!
»Haben Sie eine Passagekarte?« Wieder prüft er mich mit kaltem Blick.
Ich zucke verängstigt zusammen. Passagekarte? Ach, den Fahrschein meint er. Erleichtert nicke ich. »Sie muss dabei sein«, murmele ich und zeige auf die Papiere, die ich ihm gereicht habe. Sie muss dabei sein, Franz hat doch für alles gesorgt. Mürrisch blättert er die Papiere noch einmal durch.
Endlich, endlich reicht er mir die ersehnten Reisepapiere. Meine Bordkarte nach New York, nach Amerika. Meine Fahrkarte in die Fremde, aber eben auch in die Freiheit.
»Die ›Mannheim‹ geht in zwei Tagen«, erklärt er mir nun ein wenig freundlicher. Vielleicht hat er einfach Angst gehabt, dass ich nicht bezahlen kann. Verständlich eigentlich, man sieht mir das Dienstmädchen schon von weitem an.
»Sie können im Auswandererhaus wohnen. Sowieso besser für ein Mädchen alleine.« Er beschreibt mir den Weg, winkt mich ungeduldig weiter.
»Danke, Himmel! Danke, Franz«, flüstere ich und versuche, nicht hektisch davonzustürzen.
»Du darfst nicht ängstlich wirken, Helene«, hat Franz mir eingeschärft. »Nur so ängstlich wie ein junges Mädchen, das auswandert. Gerade, wenn du denkst, du hast es geschafft, musst du vorsichtig sein.«
Rennen könnte ich sowieso nicht mit dem schweren Gepäck, das ich mitschleppe. Ich habe gedacht, dass ich kaum etwas besitze. Doch aus »kaum« sind ein großer Korb und ein Koffer geworden, fast alles Sachen, die mir Franz gegeben hat. Jetzt kommt es mir zugute, dass ich gelernt habe, schwere Arbeit zu tun.
»Man sieht dir an, dass du anpacken kannst, das mögen die Leute drüben. Du findest bestimmt eine Arbeit.«
Franz mit seinen guten Ratschlägen. Wo wäre ich jetzt ohne Franz? Im Gefängnis? Wenn ich nur wüsste, was Franz mit dem Mann gemacht hat. Will ich das wirklich wissen? Mag sein, es ist besser, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde mir der Mut vollends fehlen, einem anderen Menschen ins Gesicht zu sehen.
Mit diesen Gedanken trete ich aus dem Haus.
»Ho, Deern, pass op!«
Huch! Fast wäre ich in einen Bäckerburschen gelaufen, der hastig an mir vorbeieilt und seinen Korb mit Backwaren vor dem Zusammenstoß gerade eben retten konnte. Oh, wie das duftet! Ich spüre meinen Hunger und sehe dem Jungen sehnsüchtig nach.
Ich muss wirklich aufpassen, wo ich langgehe. In dieser großen Stadt sind ständig Menschen unterwegs. Zu Fuß drängen sie an mir vorbei, missbilligende Blicke werfen sie auf mein Bündel, das ihnen den Weg versperrt. Warum haben sie es bloß alle derart eilig? Die Pferdekutschen rasseln lärmend vorüber. Hier am Bahnhof stehen die Mietdroschken und warten auf Kunden. Noch nie zuvor habe ich so einen Trubel gesehen. Himmel hilf! Wie soll ich mich hier nur zurechtfinden?
Ein ärmlich aussehendes Mädchen von etwa zwölf Jahren spricht mich an: »Du suchst bestimmt das Auswandererhaus. Komm, ich zeig es dir, ich will auch dahin.«
Hilfsbereit fasst sie mein Gepäck mit an. Gemeinsam tragen wir es über die Straße. Sie scheint die Stadt schon länger zu kennen, denn sie scheut sich nicht, sich zwischen den Fahrzeugen durchzuwinden. Dabei redet sie freundlich auf mich ein.
»Wo kommst du her? Ich bin die Grete Sander, wir fahren nach Australien. Morgen! Endlich geht es los! Mein Bruder ist jetzt seit einem Jahr drüben. Er hat uns das Reisegeld geschickt.«
Sie hüpft vor Freude, ohne den Korb dabei loszulassen.
»Australien«, rufe ich erstaunt, »das ist ja am andern Ende der Welt! Ich dachte, Amerika sei schon entsetzlich weit weg.«
»Ja, ja, das stimmt, aber man kann dort gute Arbeit finden, sagt mein Papa. Ach, bin ich froh, dass wir endlich fahren können. Es ist teuer hier in der Stadt, und in dem Haus ist es eng. Auf dem Schiff wird es bestimmt nicht viel besser. Das wird eine lange Reise.« Diese Vorstellung scheint sie allerdings nicht zu ängstigen, im Gegenteil. Sie tänzelt ein paar Schritte vor Aufregung.
»Da sind wir. Du musst dich dort bei dem Drachen melden.« Sie zeigt kichernd auf eine ältliche Frau, die uns mit zusammengekniffenen Lippen entgegensieht.
»Danke!«, rufe ich Grete hinterher. Sie winkt, ist bereits an der Frau vorbeigehüpft. Die sieht ihr missbilligend nach. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden nicht gut miteinander auskommen und lächle bei dem Gedanken.
Die Frau sieht mich kritisch an. Meine Kleidung ist einfach, aber sauber. Ich habe mich gründlich gewaschen, damit ich einen guten Eindruck mache. Sie erklärt mir, wo ich meine Sachen verstauen kann, dazu die strengen Regeln des Hauses, »gerade für alleinreisende junge Frauen«, wie sie betont. Es ist klar, dass sie das Alleinreisen nicht gutheißt. Welche anständige Frau reist ohne männliche Begleitung? Ich muss grinsen. Wäre männliche Begleitung in meinem Fall wirklich anständiger?
Das Haus ist tatsächlich eng, alles ist erstaunlich sauber. Im Speisesaal sind mehr als fünfzig Personen versammelt. Ich bin unschlüssig, wo ich mich hinsetzen soll, da sehe ich die kleine Grete winken. Ich zögere einen Moment. Vielleicht wäre es besser, ich würde mich irgendwo alleine hinsetzen. Doch ein Blick über die vollbesetzten Bänke zeigt mir schnell, dass das nicht möglich ist. Überall sitzen Menschen. Sie alle sind wohl begierig, ihre eigenen Pläne zu bereden und die der anderen zu hören, um Ratschläge zu erteilen, ob erwünscht oder nicht. Um mich herum herrscht ein Sprachengemisch, das mich erstaunt. Ich höre fremde Sprachen, dazwischen manches, das sogar Deutsch sein könnte mit irgendeinem fremden Dialekt. Erst jetzt wird mir bewusst, wie groß dieses Land ist, wie viele unterschiedliche Menschen darin wohnen.
Ich setze mich besser zu Grete und ihrer Familie. Die wollen nach Australien, ich werde ihnen nie wieder begegnen, da ist es nicht so wichtig, was ich erzähle. Außerdem gefällt mir Grete, sie ist so lebendig. Lächelnd schiebe ich mich durch die Reihen der Tische zu ihr hin. Gretes Verwandte machen mir neugierig Platz. Es ist eine große Familie, ganz klar ist mir nicht, wer an dem langen Tisch alles dazugehört.
Schnell werde ich in ein Gespräch verwickelt. Ich antworte vorsichtig, damit ich mich nicht in meinen Lügen verstricke. Noch bin ich es nicht gewöhnt, Franziska Wilkens zu sein.
»Meine Tante wohnt in Virginia. Sie hat mich eingeladen, sie wird alt«, erzähle ich meine Geschichte.
Es ist der letzte Abend der Familie Sander in Deutschland. Morgen früh reisen sie weiter nach Bremerhaven, von wo ihr Schiff schon am Abend ablegen wird. Entsprechend lange und laut wird gefeiert, obwohl sie nicht viel Alkohol trinken, denn »sonst kotzt ihr morgen beim ersten Seegang das Schiff voll!«, mahnt Vater Sander lachend.
Unbekannte Städtenamen, Reiserouten, Preise für Land und Vieh schwirren über den Tisch und hüllen mich ein. Mein Bauch beginnt zu kribbeln, auch mich erfasst das Reisefieber. Ach, könnte ich doch ebenfalls morgen fahren! Weg hier, nur weg.
Grete zappelt vor Aufregung, ihre Wangen sind gerötet. »Wir fahren, wir fahren«, summt sie immer wieder.
»Warum fahrt ihr eigentlich weg?«, frage ich. Als ob ich es mir nicht denken könnte.
Da bricht es wie eine Welle über mich herein. Alle reden, nein, schreien durcheinander: »Wir wollen endlich einmal leben können von unserm Acker. Hungerlöhne kriegt man für seine Arbeit. Die Steuern fressen uns auf. Die alte Meiers ist letzten Winter einfach verhungert in ihrer Kate. Verhungert, stell dir das vor!«
Diese Geschichten kenne ich. Auch in meiner kleinen Heimatstadt sind Menschen vor Armut gestorben.
»Sei dankbar, dass du in Dienst gehen kannst, Helene, dort hast du stets zu essen und ein Dach über dem Kopf. Dazu noch bei Familie von Haltern. Das ist ein Name! Du kannst stolz sein, dass sie dich nehmen. Mach uns keine Schande.« Mutters ständige Mahnung fällt mir wieder ein. Wie sehr habe ich ihre Hoffnung enttäuscht.
Ich kann mich ein wenig zurücklehnen und zuhören. Ich bin froh, dass ich nicht alleine bin an diesem ersten Abend hier in der Fremde.
Als ich am nächsten Morgen in den Speisesaal komme, sind die Sanders fort. Ein wenig traurig setze ich mich an einen der Tische. Die Menschen neben mir sprechen eine fremde Sprache, ich verstehe sie nicht. Um mich herum an den Nachbartischen wird genug diskutiert und beratschlagt. Ein paar Frauen rufen aufgeregt durcheinander.
»Ich will nachher eine große Dauerwurst kaufen, damit wir eine Notration haben.«
»Käse musst du mitnehmen, Thea, Käse!«
»Die Amerikaner wolle nich mehr alle neilasse, hab ich g’hört. Die Alten un Kranken schicke se wieder z’rück.«
»Ach was, meine Tante ist siebzig, die ist letztes Jahr rüber.«
»Letztes Jahr is nich heute.«
»Das Essen auf der ›Mannheim‹ ist hundsmiserabel, kauft lieber vorher tüchtig ein.«
»Un ich sach euch, so nen Sturm habt ihr noch nie nich erlebt, die Segel, die fetzten man wech wie Papier.«
»Man gut, dass es Dampfschiffe gibt.«
»Die ›Mannheim‹ ist schnell, man ist in acht Tagen drüben bei gutem Wetter.«
»In Oregon gibt es Land, da kann man drei Ernten im Jahr haben. Drei Ernten! Richtige Ernten, wenn ihr versteht, was ich meine.«
»Oregon? Nee, das is mir zu gefährlich.«
»Indianer!«
»Ich sag’s ja, Indianer. Die schleichen sich gaaanz leise an, das merkst du nicht und schwups!: schneiden sie dir die Kehle durch.«
»Oder sie verschleppen dich in ihre Zeltlager. Da quälen sie dich zu Tode. Nee, nee, ich bleib im Osten, da ist es zivilisierter.«
Ob das stimmt? Sind diese Ureinwohner tatsächlich so grausam, oder erzählen die Leute Gruselgeschichten? Ich denke an das Seemannsgarn, mit dem Franz mich unterhalten hat. Nein, man muss nicht alles glauben.
Ich lausche dem Stimmengewirr, während ich den dünnen Kaffee schlürfe. Was wird werden aus diesen Menschen? Was wird werden aus mir? Soll ich mich einer Gruppe anschließen, wie mir Franz geraten hat? Woher weiß ich, dass es die Menschen ehrlich mit mir meinen? Ich bin misstrauisch geworden. Etwa acht Tage wird die »Mannheim« brauchen bis nach New York. Vielleicht reicht das, um meine Mitreisenden kennenzulernen und eine Entscheidung zu treffen.
Erst mal hinüberkommen, nein, erst mal an Bord kommen, erst mal das Land verlassen. Danach sehe ich weiter.
Schritt für Schritt.
2.
Einen Tag habe ich noch Zeit, mich in dieser großen Stadt umzusehen, womöglich etwas einzukaufen. Die anderen Reisenden haben mich unsicher gemacht. Brauche ich zusätzlichen Proviant? Ich habe nichts dabei, man hat mir gesagt, es gäbe auf dem Schiff Essen. Wird es wirklich derart schlecht sein?
Kann es schlechter sein als im Arbeitshaus von Neustadt? Bestimmt nicht. Ich sollte mein Geld besser zusammenhalten, es ist ohnehin schon wenig genug. Franz hat es mir gegeben. Woher hat er es? Er verdient ja nicht viel als Hausdiener in Neustadt.
Denk lieber nicht darüber nach, das gehört zu den Sachen, die ich besser nicht wissen sollte.
Neugierig gehe ich durch die schmalen Straßen. Um mich herum rennen und hetzen die Leute, ständig bin ich jemandem im Weg. Aber niemand rempelt sich an, es sieht eher aus wie ein schneller Tanz, rechts vorbei, links vorbei. Eine Dame mit kleinem Schirm schreitet mit langsam gemessenem Schritt durch die Menge, ihre beiden Kinder gehen gezwungen brav nebenher. Zwei Gassenjungen springen wild an ihnen vorbei, rufen allerlei Frechheiten. Junge Leute schlängeln sich durch, weichen den Alten aus, die wie ich im Weg stehen. Hausfrauen und Dienstmädchen warten vor den Läden, diskutieren über das Angebot oder die Preise. Die Fußwege sind viel zu schmal. Überall sind dazu die Kisten und Tröge der Händler aufgebaut. Auf der Straße rasseln ständig Pferdefuhrwerke vorbei. Ich wundere mich, dass nicht dauernd etwas passiert.
Eine Weile bummele ich durch die Stadt, die Gassen werden schmaler, die Häuser kleiner. Pferdekutschen werden seltener, die meisten Menschen sind zu Fuß unterwegs. Die Kleidung wirkt immer ärmlicher. Hier fühle ich mich nicht mehr so fremd.
Ich lehne mich an eine Hausecke, muss ein wenig ausruhen. Da höre ich plötzlich laute Rufe, Marschschritte und Gesang aus der Seitenstraße. Ein paar Leute sehen sich nervös um, einige rennen sogar weg. Andere bleiben neugierig stehen.
»Die Sozialisten!«, ruft einer. »Da marschieren sie!«
Tatsächlich, aus der Nebenstraße biegt eine geordnete Reihe von Männern in die Hauptstraße ein. Sie gehen im Gleichschritt und untergehakt mitten auf dem Fahrweg. Man muss ihnen Platz machen. Ja, es sind Arbeiter, man sieht es an ihrer Kleidung. Sie singen im Takt ihrer Schritte, die am Rand gehen recken dazu ihre Fäuste in die Luft. Ich verstehe den Text nicht, aber ein paar Worte bleiben hängen. Irgendetwas mit »Menschenrecht« singen sie. Viele sind es, Reihe um Reihe. Oh, da sind sogar ein paar Frauen dabei. Sie marschieren wie die Männer, strecken genauso mutig die geballten Hände hoch. Dass sie das wagen!
Diese Menschen machen mir Angst. Dieser Aufmarsch hat etwas Bedrohliches, Machtvolles, obwohl alles sehr geordnet zugeht. Ein solcher Protestmarsch ist sicherlich verboten, trotzdem tun sie es einfach. Ich möchte weglaufen, zugleich faszinieren mich der Mut und die Disziplin dieser Menschen. Ihr Gesang berührt mich merkwürdig tief. Ich spüre, wie sich meine Nackenhaare aufstellen. Ich merke, dass ich ohne nachzudenken beginne, die Melodie mitzusummen. Erschrocken schlage ich die Hand vor den Mund.
Die meisten Menschen am Straßenrand sehen stumm zu. Andere rufen: »Hoch! Hoch!«
Ein Mann neben mir schnauft empört: »Gesindel! Man muss die Polizei holen!«
Die ist unterwegs. Von irgendwo hört man Pferdegetrappel. Jemand schreit: »Polizei!«
Um Gottes Willen, die Polizei! Ich kann doch nicht in eine Polizeiuntersuchung geraten! Weg hier!
Ängstlich stolpere ich zurück, haste ohne hinzusehen in den nächsten Laden am Wegrand. Durch die kleinen Scheiben sehe ich berittene Polizisten, die ihre Säbel in den Händen halten. Hui, das war knapp!
Von den Arbeitern ist keiner mehr in der Nähe. Sie müssen sich blitzschnell zerstreut haben. Die Straße ist fast leer, ein paar Passanten stehen herum, einige halten einen Arbeiter fest, der sich verzweifelt zu befreien versucht.
»Ach. Wieder ein Aufmarsch der Sozialisten?«, höre ich hinter mir eine leise Stimme. Ein kleiner, alter Mann, wohl der Ladeninhaber, tritt neben mich. Er schaut neugierig aus dem Fenster. »Wird nicht mehr lange dauern, bis man ihnen ihre Partei erneut erlauben wird, kein Zweifel.« Ich verstehe nicht, was er meint.
Jetzt erst sehe ich mich um. Ich stehe in einer Buchhandlung. Noch nie bin ich in einer Buchhandlung gewesen! Neugierig betrachte ich die vollen Regale, überall Bücher, sogar auf den kleinen Tischen stapeln sie sich. Liebe Güte, ich wusste nicht, dass es derart viele Bücher überhaupt gibt!
»Sind Sie nur geflüchtet, oder kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragt mich der Buchhändler und mustert mich neugierig.
»Ich fahre morgen nach Amerika«, antworte ich dümmlich. Es ist das Einzige, was mir einfällt.
»So? Amerika.« Er nickt. »Das ist ebenfalls eine Lösung.«
Er weist nach draußen. »Kämpfen oder Gehen. Ja, ja. Obwohl, kämpfen müssen Sie drüben genauso, liebes Kind. Wird einem nichts geschenkt im Leben, nirgendwo. Auch nicht in Amerika.«
Er beugt sich zu einem Regal hinunter, kramt ein bisschen und hält mir eine Broschüre hin. Darauf sieht man ein junges Mädchen, das auf einem Koffer sitzt und weint.
Ich entziffere langsam den Titel: »Ratschläge für junge Frauen, die in die Neue Welt gehen wollen«.
»Sie können lesen?«, fragt er.
Ich nicke, kann meine Augen nicht abwenden von diesem Bild. Warum weint sie? So will ich nicht enden. Ich muss dieses Buch haben!
»Dreißig Pfennige. Vielleicht ist es drüben Gold wert.«
Zitternd vor Aufregung ziehe ich meine Geldbörse heraus, zähle vorsichtig das Geld ab. Er lächelt, packt mir das Heft in braunes Papier ein und reicht es mir.
»Viel Glück, mein Kind. Viel Glück!«
Er hält mir die Tür auf. Verwirrt trete ich auf die Straße.
Ich habe mir ein Buch gekauft! Noch nie im Leben habe ich ein Buch besessen, außer der Bibel natürlich. Noch nie. Ich habe nicht einmal gewusst, dass man in einem Buch Ratschläge für Amerika finden kann. Davon hat Franz mir nichts gesagt. Dabei kann Franz lesen.
Ich presse das Paket an mich wie einen Schatz. Wie merkwürdig es manchmal zugeht in der Welt. Ohne diesen Aufmarsch der Arbeiter wäre ich nie in diesen Laden gegangen. Nie hätte ich dieses Buch gekauft. Dabei ahne ich bereits jetzt, dass es mir nützlich sein wird. Vielleicht hat der Himmel mir dieses Buch geschickt. Dann hält er doch seine Hand schützend über mich. Trotz allem. Ich gehe schneller, will zurück ins Auswandererhaus, will anfangen zu lesen.
Lange sehe ich mir das Titelbild an. Weint sie, weil sie fort muss, oder weil sie in der Fremde unglücklich geworden ist? Ich möchte alles richtig machen, den Eltern nicht noch einmal Schande machen. Ich habe mich zuletzt nicht mehr nach Hause getraut. Wie gerne würde ich in ein paar Jahren zurückkehren und es ihnen zeigen, beiden, Vater und Mutter, dass aus mir etwas Ordentliches geworden ist. Nur, was ist »etwas Ordentliches«?
Ich halte das Buch lange in den Händen, ohne es aufzuschlagen. Ein Buch! Das ist für mich wertvoller als eine Perlenkette.
Lernen! Ich möchte so gerne länger zur Schule gehen, nicht bloß diese vier Jahre. Selbst dafür muss ich meinem Vater stets dankbar sein.
»Andere Mädchen dürfen das nicht, Helene, also sei fleißig.«
So viel ich auch bettele und weine, nach vier Jahren muss ich in unserm Laden mithelfen. Meine Mutter unterstützt mich zwar: »Helene könnte mit ein wenig mehr Schulbildung gut heiraten, schließlich können wir ihr sonst wenig mitgeben.«
Mein Vater ist jedoch strikt dagegen. »Lernen für Mädchen ist überflüssig. Helene kann nun fix rechnen und schreiben, das reicht für den Laden. Kein vernünftiger Mann heiratet eine kluge Frau. Das weißt du selber. Schluss jetzt mit dem Gerede.«
Dabei ist mir immer alles leichtgefallen.
»Sie ist wie ein Schwamm«, erklärt der junge Lehrer meinen Eltern. »Sie nimmt alles sofort auf und kann es augenblicklich. Geben sie ihrer Tochter eine Chance.«
Vergebens.
Der Lehrer leiht mir ab und zu ein Buch, damit ich weiter lesen üben kann. Allerdings ist dies nach der täglichen Arbeit mühsam, meistens schlafe ich nach ein paar Seiten ein.
Dabei mag ich die Arbeit in dem kleinen Laden gern, vor allen Dingen, wenn mich Botengänge in die Häuser unserer kleinen Stadt führen. Dort sehe ich mich neugierig um, versuche, so viel wie möglich über diese Menschen zu erfahren. Nicht über meine Nachbarn natürlich, wir wohnen viel zu eng beieinander, als dass man Geheimnisse haben könnte. Spannend ist es, wenn ich in ein Haus der besseren Leute der Stadt geschickt werde. In meinen Träumen lebe ich die Leben all dieser Leute anschließend weiter auf meine Weise. Mit diesen Träumereien verbringe ich meine Freizeit sogar noch lieber als mit den Büchern des Lehrers.
Jedenfalls Lesen, Schreiben und Rechnen kann ich gut. Darauf bin ich stolz. Deshalb vermittelt der Pfarrer mir die Anstellung bei den Herrschaften von Haltern. Ich soll dort von Frau Karstensen, der Haushälterin, lernen, wie man einen großen Haushalt leitet. Sehr zum Verdruss meines Vaters, der mich gerne weiter im Laden behalten hätte. Gegen den Pfarrer wagt er allerdings keinen Widerspruch.
Meine Mutter dagegen ist sehr stolz. »Das ist deine Gelegenheit, mein Kind. Sieh zu, dass du es zu etwas bringst.«
Allerdings muss ich erst all die normalen Dienstmädchenarbeiten verrichten. Ab und zu darf ich mit Kurt, dem Sohn der von Haltern, am Unterricht teilnehmen. Nicht etwa, damit ich lerne, sondern wegen Kurt. Die Hauslehrerin Fräulein Auguste Gerber will das nicht akzeptieren.
»Muss das sein, Gnädige Frau, dass ich eine Dienstmagd unterrichte? Ich bin es gewöhnt, mit Kindern von Stand zu arbeiten. Ich bin meinem Namen ein gewisses Niveau schuldig.« Dabei wirft sie mir einen giftigen Blick zu.
Kurt sitzt schmollend daneben. Er beginnt, mit der Feder Tinte aufs Papier zu klecksen und zieht daraus lange Fäden, bis lauter Tintenspinnen über sein Blatt laufen. Igitt!
»Kurtchen lernt nun mal leichter, wenn Helene dabeisitzt, er zeigt ihr so gerne, was er kann«, widerspricht Frau von Haltern.
Das ist sehr freundlich ausgedrückt. Eigentlich will er bloß angeben. Es kommt sowieso sehr selten vor.
»Wenn Sie Ihre Stellung behalten wollen, Fräulein Gerber, werden Sie es zulassen müssen. Wenn Ihr Niveau wirklich ein derart besonderes ist, wie erklären Sie mir, dass Sie bei Kurt nicht mehr Erfolg haben, so dass Sie ihn auch ohne Helenes Anwesenheit für den Unterricht interessieren können?«, fügt sie spitz hinzu und rauscht aus dem Raum.
Die Gerber sieht mich hasserfüllt an. Kurt wirft ihr das vor Tinte triefende Spinnenblatt fast ins Gesicht. Sie verliert die Beherrschung, sie schlägt ihn heftig auf die Wange. Wir sind alle drei sehr erschrocken. Mit zitternder Stimme fordert sie Kurt auf, seine Hausaufgaben hervorzuholen.
Zwei Tage später kommt ein neuer Hauslehrer. Er duldet meine Anwesenheit ohne Kommentar. Mit ihm lerne ich sogar ein paar Dinge mehr, über die Erde, über Pflanzen und Tiere, aber es ist selten und viel zu wenig.
»Die Gerber unterrichtet jetzt die Töchter der Frau von Falkenroth«, erzählt die stets gut informierte Köchin ein paar Wochen später. »Vielleicht kann sie mit Mädchen besser umgehen.«
Das bezweifle ich.
Mir hilft das neue Wissen bei der Arbeit allerdings überhaupt nicht. Da werden andere Fähigkeiten verlangt.
»Du kannst lesen und rechnen, das ist dringend erforderlich in diesem Amt, aber das reicht natürlich nicht«, belehrt mich die Haushälterin in den Stunden, die sie für meine spezielle Ausbildung vorsieht. Viel lerne ich vom Haushalten allerdings nicht, denn dann kommt Jakob.
Ich habe gegen alle Vernunft gehofft, dass Wilhelm mich heiratet, wenn ich ein Kind von ihm bekomme. Damit habe ich alle enttäuscht, die Eltern, den Pfarrer, alle. Ich traue mich nicht zurück nach Hause, lieber gehe ich zu Schwester Margarita in die nächste große Stadt. Da kennt mich niemand. Zu sehr schäme ich mich.
Die Schwestern führen ein Haus für solche Mädchen wie mich. Dort bringe ich meinen Jakob zur Welt. Die Adresse hat mir ein anderes Dienstmädchen heimlich zugesteckt. Hat sie sie von Wilhelm, der sich schuldig fühlt?
Wilhelm!
Mein Vater soll gedroht haben, mir das ungeborene Kind aus dem Leib zu prügeln.
So schlimm die täglichen Demütigungen bei den Schwestern sind, ich bin mit anderen Mädchen zusammen, denen es ähnlich ergangen ist wie mir. Doch kurz nach der Geburt werfen sie mich einfach auf die Straße, den kleinen Jakob und mich. Ohne Geld, ohne irgendetwas. Wie können sie sich heilige Schwestern nennen und so etwas tun?
Ich treibe mich eine Weile auf der Straße herum mit dem kleinen Baby. Immer auf der Suche nach Essen, nach einem Platz und auf der Flucht vor der Polizei. Eine furchtbare Zeit! Streunen ist verboten, aber wo hätte ich denn hingehen sollen. Bald greift mich die Polizei auf. Man bringt mich ins Arbeitshaus. Niemand fragt mich, was ich will. Eine Anstellung hätte ich sowieso nirgendwo mehr bekommen. Die beste Schulbildung hätte mir nicht geholfen.
Ob ich meine Eltern je wiedersehe? Sehnsüchtig sehe ich aus dem Fenster. Heimweh schleicht sich in mein Herz. Schließlich schlage ich die Broschüre auf und beginne, erst mühsam, danach flüssiger zu lesen.
Es wird vor vielen Dingen gewarnt: vor den alleinreisenden Männern, vor allem den älteren, die nach jungen Frauen Ausschau halten, denen sie alles versprechen, damit diese sie begleiten. Später, in der Einsamkeit der Wildnis, halten sie diese Frauen wie Sklavinnen. Es wird auch zur Vorsicht vor ganz bestimmten Stadtvierteln in den großen Städten geraten, dort gibt es Bordelle, die als Hotels getarnt sind.
Es gibt Adressen von Organisationen, an die sich Frauen wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. Dort gibt es Deutsche, die genug Englisch können, um weiterzuhelfen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich kann bloß ein paar Worte, die mir Franz beigebracht hat.
Ein paar Seiten weiter gibt es eine Liste mit den grundlegenden englischen Begriffen, sogar die Aussprache steht daneben, aber das kann ich nicht nachsprechen, zu komisch sieht das aus.
Neugierig blättere ich weiter. Ich lese, dass es einfach ist, im Westen an Grundbesitz zu kommen. Daneben die Warnung vor den Indianern, die sich gerade einsame Siedlungen aussuchen, um sie zu überfallen.
Ist denn nicht genug Platz für alle? Wenn der Kontinent derart groß ist, warum können nicht alle in Frieden leben?
Aber warte, in den Wäldern von Herrn von Haltern war es sogar verboten, Holz zu sammeln. Allerdings hat Herr von Haltern in besonders kalten Wintern nicht genau hingesehen. Was hätte er für einen Aufstand gemacht, wenn fremde Menschen sich in seinem Garten eine Holzhütte gebaut hätten? Ich muss lachen bei dem Gedanken. Aber Deutschland ist viel enger als Amerika. Andererseits waren die amerikanischen Ureinwohner schließlich zuerst da.
Nachdenklich schaue ich aus dem Fenster. Erneut fallen mir die Arbeiter ein. Die wehren sich auch.
»Kämpfen oder weggehen.«, hat der Buchhändler gesagt. Kann ich das, kämpfen? Ich habe nie gelernt, mich zu wehren, nein zu sagen. Dennoch will ich nicht so enden wie das Mädchen auf dem Titelbild. Ob ich das lernen kann, mich zur Wehr zu setzen?
Das Buch liegt in meinem Schoß, während meine Gedanken kreisen. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen mehr über mein Leben nachgedacht als in all den Jahren zuvor. Ernsthaft, meine ich, nicht diese Tagträumereien. Ist das »erwachsen werden«? Oder sind es die Umstände?
Plötzlich rutscht ein Papier aus dem Buch, flattert auf den Boden. Verwundert hebe ich es auf. In großen roten Buchstaben steht dort: »Was wollen die Deutschen Sozialisten«.
Ich sehe erstaunt auf die dicht bedruckten Zeilen. Lese die Überschrift langsam ein zweites Mal: »Was wollen die Deutschen Sozialisten«. So steht es dort.
Wie kommt dieses Blatt in das Buch? Hat der Buchhändler mir das beim Einpacken hineingeschoben? Anders kann es nicht sein. Mit Amerika hat es doch gar nichts zu tun.
Schnell sehe ich mich im Aufenthaltsraum um, ob mich jemand beobachtet. Obwohl ich bisher kein Wort gelesen habe, ist mir nur zu klar, dass dieses Blatt hier nicht in meinen Händen gesehen werden darf. Sicherlich würde man mich unrühmlich hinauswerfen, wenn nicht gar Schlimmeres passiert. Franz hat mir ab und zu ein wenig erzählt von den Arbeiteraufständen der letzten Jahre. Erst jetzt wird mir bewusst, dass er sich ziemlich gut auskennt. Ob er etwa bei einem Aufmarsch wie heute mitmarschiert wäre? Franz? Der friedliche, ruhige Franz?
Neugierig geworden, beginne ich zu lesen. Es ist nicht ganz leicht, es gibt Wörter, die habe ich noch nie gehört, ich kann sie kaum entziffern. Andere Gedanken dagegen sind mir nicht neu.
Aber he, das hier, das ist, äh … Das steht hier tatsächlich geschrieben: alle Menschen sollen gleiche Rechte haben. Egal, ob sie adlig sind oder Arbeiter, sogar egal, ob Mann oder Frau.
Männer und Frauen? Ich soll die gleichen Rechte haben wie mein Vater? Oder gar wie … Wilhelm? Das wäre … Das wäre …
Ich lächele. Seufze. Schüttele ungläubig den Kopf. Alles wäre anders gekommen. Ich würde nicht hier sitzen. Müsste nicht das Land verlassen. »Das ist ein Traum«, denke ich. Es ist nur ein Traum.
Ich lese weiter. Den Arbeitern sollen die Fabriken gehören, weil sie ja die Dinge dort herstellen. Wie soll das denn gehen? Wie kann den Arbeitern die Fabrik gehören? Dummes Zeug.
Ich muss laut lachen. Breche schnell ab und schlage die Hand vor den Mund, schaue scheu um mich. Aber niemand achtet auf mich, der Raum ist um diese Zeit fast leer. Alle sind mit sich selbst beschäftigt. Trotzdem, Franziska, pass auf.
Meine Gedanken wandern zurück zu den von Halterns. Ich muss an Frau Karstensen denken, ohne sie wäre der ganze Haushalt völlig zusammengebrochen. Frau von Haltern konnte nicht einmal Wasser für ihren Tee kochen. Wo wäre die Familie geblieben mit ihren im ganzen Landkreis berühmten Festessen zur Weihnachtszeit, wenn nicht die Köchin und die Küchenmädchen ihre Arbeit gemacht hätten! Selbst die kleine Tine, die erst zehn war, wurde gebraucht. Hätte die nicht abgewaschen, wäre alles im dreckigen Geschirr erstickt. Was hat Tinchen dafür bekommen? Einen Hungerlohn. Muss deshalb das Haus der von Haltern nun der Haushälterin gehören? Oder gar Tinchen?
Ich bin verwirrt. Ich lese langsam noch einmal alles von vorne. Ganz allmählich verstehe ich, worauf diese Sozialisten hinauswollen. Jetzt, beim erneuten Lesen erscheint mir vieles gar nicht mehr dumm. Hier behaupten sie, wenn ich das richtig verstehe, dass es das Geld ist, das uns auf unseren Platz in der Welt stellt, und dass das nicht gerecht ist.
Moment. Was steht da? Das Geld? Etwas in meinem Kopf nickt zustimmend bei dem Gedanken. Aber … aber das stimmt doch nicht! Gott hat uns auf unseren Platz gestellt. Das sagt der Pfarrer. Gott, nicht das Geld.
Was stimmt nun? Ich erschrecke. Das Blatt zittert in meinen Händen.
Ich möchte erneut nicken. Darf ich das denn? Weil, also … Wenn ich jetzt nicke, widerspreche ich allem, was der Pfarrer Sonntag für Sonntag gepredigt hat. Es muss Oben und Unten geben. Gott will das so. Und Gott hat schließlich alles richtig geordnet auf der Welt. Daran darf der Mensch nicht rütteln.
Jetzt kann ich befriedigt nicken. So ist das richtig.
Aufrührerisch sind diese Sozialisten. Von Gott ist nirgendwo die Rede. Selbst mein Vater, der stets gesagt hat, dass die Herrschaften faule Leute sind, war ein gläubiger Mann. Dennoch habe ich nie zu Hause ähnliches gehört.
Sicher ist es verboten, dieses Papier zu lesen. Deshalb hat der Buchhändler es heimlich in mein Buch gelegt. So etwas muss verboten sein, es zerstört doch alle Ordnung. Und darum darf ich das hier nicht offen lesen. Pass auf, Franziska, riskiere nicht noch am letzten Tag deine Freiheit!
Aber ist es falsch? Ist es deshalb falsch? Oder ist die Ordnung falsch? Ist es etwa richtig, dass sie zerstört wird? Zum Beispiel von marschierenden Arbeitern? Das heißt demnach aber auch, dass es gar keinen Gott gibt!
Mir stockt der Atem. Der Zettel brennt in meinen Händen, schnell lege ich ihn zur Seite, als könnten diese sündigen Gedanken damit verschwinden.
Oh nein! Das kann ich nicht glauben. Natürlich gibt es Gott. An was kann ich glauben in meiner Angst und Not, wenn nicht an Gott? Soll ich an die Sozialisten glauben und zu ihnen beten? Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen soll. Nein, nein, den Gedanken ertrage ich nicht. Ganz bestimmt gibt es Gott.
Halb zornig, halb ängstlich schiebe ich das Blatt zurück in das Buch. Dennoch bleibt die Verwirrung. Lore und Klara fallen mir ein, zwei Frauen aus dem Arbeitshaus. Die führten dauernd wilde Reden. Sie verlangten sogar mehr Geld oder weniger Arbeit. Aber selbst die beiden gingen jeden Sonntag mit in die Kirche. Nur, was weiß ich, was sie tatsächlich gedacht haben? Was weiß ich denn von der Welt?
Ich komme mir auf einmal dumm vor, so naiv. Ich möchte lernen, viel mehr wissen. Ich möchte nicht stets die Dumme sein, mit der andere machen können, was sie wollen, bloß weil ich nicht verstehe, was eigentlich passiert.
Das fordern sie ebenfalls, diese Sozialisten, Bildung für die Armen. Damit bin ich sofort einverstanden.
»Kämpfen oder weggehen«, hat der Buchhändler gesagt. Warum gehen die Arbeiter nicht weg? Es ist in Amerika ja viel besser. Jeder, der fleißig ist, kann dort reich werden.
Reich werden. Ach was, ich will nicht reich werden. Mehr als altes Brot und Wassersuppe für einen langen Arbeitstag, das würde mir schon reichen. Dazu ein Zimmer für mich, das im Winter geheizt werden kann, und ein bisschen Geld, das übrig bleibt für ein neues Kleid oder ein Buch.
Ist das zu viel verlangt?
Diese Sozialisten würden spotten über meine bescheidenen Wünsche. Mir sind sie groß genug. Vor allem glaube ich fest daran, dass sie erreichbar sind.
3.
Erster Reisetag.
Ich lehne an der Reling und schaue auf die Menschenmenge, die sich am Kai drängt.
»Franziska«, flüstere ich, horche dem noch unvertrauten Klang nach. Ab sofort bin ich wirklich Franziska. Du bleibst an Land, Helene. Ich lächle ein bisschen traurig bei diesem Gedanken. Langsam hebe ich die Hand, winke der unsichtbaren Doppelgängerin zu.
»Verrückt«, denke ich. Werde ich mich wirklich daran gewöhnen können, nicht mehr Helene zu sein? Ich war es achtzehn Jahre lang. Ich schaue auf die bunte Menge dort unten. Das sind die, die bleiben.
Helene bleibt in Deutschland. Franziska fährt nach Amerika.
Ein Arm in weißem Leinen wedelt plötzlich vor meinen Augen und holt mich in die Wirklichkeit zurück. Ich sehe erstaunt zur Seite. Da steht eine junge Frau, eher ein Mädchen in meinem Alter, ihr rundes Gesicht ist gerötet vor Aufregung. Mit beiden Armen winkt sie weit über die Reling gebeugt. Ihre blonden Zöpfe fallen nach vorne, wippen mit jeder Bewegung. Ihr weißes Leinenkleid ist in bester Qualität, dafür habe ich einen Blick.
»Was macht so ein gut gekleidetes Mädchen auf dem Zwischendeck?«, frage ich mich. »Die gehört bestimmt zur zweiten Klasse. Ich dachte, die haben ein eigenes Deck.« Womöglich täuscht ihre vornehme Kleidung. Wer weiß, wie viele hier an Bord etwas zu verbergen haben. Sicher bin ich nicht die Einzige. Etwas an ihr fasziniert mich. Immer wieder muss ich zu ihr rübersehen.
»Lebt wohl!«, ruft sie jetzt. »Lebt wohl!«
Neugierig geworden schaue ich hinunter, suche die, denen dieser Abschied gilt. Meine Augen gleiten über die vielen Menschen dort am Kai. Ist es der alte Mann dort im dunklen Anzug? Nein, er sieht jetzt in eine andere Richtung. Oder die junge Familie gleich vor uns? Die Frau hat ein kleines Kind auf dem Arm, – »nicht viel älter als Jakob«, denkt Helene – der Mann legt seiner Frau beschützend die Hand auf den Arm. Die bleiben. Sie geben ein schönes Bild ab.
»Warum bin nicht ich das mit Wilhelm?«, denkt Helene.
»Hau ab, Helene«, flüstere ich. »Verschwinde aus meinem Kopf, du bleibst an Land!«
»Elisabeth, huhu, ich schreibe euch«, schreit die Blonde fast in mein Ohr.
Ich weiche unwillkürlich ein Stück zur Seite. Diese Bewegung ist wohl unten bemerkt worden. Eine füllige ältere Frau in dunkelblauem Kostüm lächelt und zeigt auf mich. Auf mich? Oder sieht das nur so aus? Sie schüttelt leicht den Kopf. Meine Nachbarin hält einen Moment inne, unsere Blicke begegnen sich, aber die klaren blauen Augen der Blonden zeigen kein wirkliches Erkennen, sofort wendet sie sich wieder den unten stehenden Menschen zu. Ich spüre Irritation, Ärger, dabei kenne ich das doch. Das ist der Blick, den Herrschaften für ihre Dienstboten haben oder für ihre Möbel. Das ist der klassische Diener- und Möbel-Blick.
»Was ist das denn für eine?«, denke ich trotzig. Ich habe das gleiche Recht, hier zu stehen wie die. Ich habe meine Passage bezahlt. Ich lehne mich nun selbst ein wenig vor. Immer noch kommen Fahrgäste über die Laufplanke. Einige vor Aufregung oder Freude entschlossen mit großen Schritten, andere eher zögerlich, als wollten sie ihre Entscheidung im letzten Moment noch einmal überdenken.
Was treibt sie alle fort? Was suchen sie in der Fremde? Mit welchen Hoffnungen oder Ängsten schiffen sie sich ein? Schon als Kind wollte ich über das Leben anderer Menschen alles wissen. Ich könnte mir zu jeder Person eine Geschichte ausdenken.
Die Blonde hat offensichtlich keine Zweifel an ihrem Tun.
»Kommt nach, Elisabeth«, ruft sie jetzt. »Wir schreiben euch.«
Elisabeth nickt nun. Sie hebt eine Hand, winkt eher müde oder traurig. Hinter ihr steht ein kräftiger Mann in Uniform, der jetzt seine Arme auf Elisabeths Schultern legt. Er sagt etwas, sie schüttelt den Kopf. Beide sehen herauf zu uns.
Sehen mich an. Oder täuscht das? Sie sind viel zu weit weg. Diese Frau, diese Elisabeth, fixiert mich. Ich spüre trotz der Entfernung ihren forschenden Blick. Was will die von mir? Kennt sie mich? Erkennt sie mich, erkennt sie Helene?
Was für ein Leichtsinn, mich hier hinzustellen vor aller Augen, wie auf dem Präsentierteller! Meine Güte, nicht in letzter Minute noch erkannt werden! Noch haben wir nicht abgelegt. Wie gut sind deine Papiere, Hel… äh, Franziska? Im Zweifel nicht gut genug. Oh, fahr endlich, fahr endlich!
Angst überfällt mich. Meine Fäuste umklammern jetzt den Holm der Reling, so dass meine Knöchel weiß werden.
»Fliehen!«,