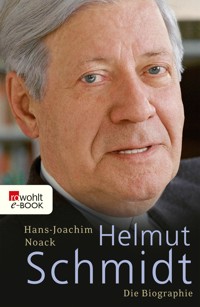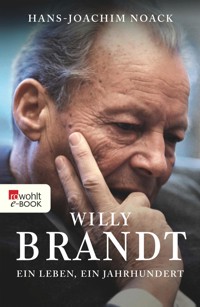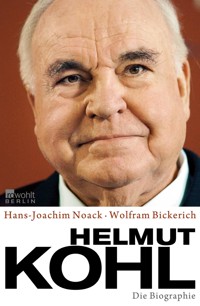
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es war im September 1989, als CDU-Rebellen um Heiner Geißler und Norbert Blüm den Sturz ihres Parteivorsitzenden planten: Helmut Kohl war in allen Umfragen eingebrochen, er galt als verbohrt, ohne Fortune, ein Übergangskanzler. Dann fiel die Mauer. Der Rest ist Geschichte: Kohl wurde für die Deutschen der Kanzler der Einheit. Die langjährigen «Spiegel»-Politikchefs Hans-Joachim Noack und Wolfram Bickerich beschreiben das Phänomen dieses Ausnahmepolitikers: Sie beleuchten den langen Aufstieg vom jüngsten Ministerpräsidenten Deutschlands zum CDU-Parteivorsitzenden und Kanzler. Sie analysieren das System Kohl, das die Partei zum Kanzlerwahlverein degradierte, und schildern den jähen Absturz nach der Parteispendenaffäre. Die Autoren widmen sich gleichermaßen seinen Leistungen und Erfolgen wie seinen politischen Fehlern und persönlichen Niederlagen. Und natürlich der Frage, was den Menschen Kohl im Innersten angetrieben hat. Das einfühlsame Lebensporträt des Vollblutpolitikers Helmut Kohl – und zugleich ein packendes Panorama deutscher Geschichte der letzten acht Jahrzehnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Hans-Joachim Noack/Wolfram Bickerich
Helmut Kohl
Die Biographie
«Dann wird er über die Ufer treten…»: ein Vorwort
Er ist der Kanzler der Einheit. Seine Amtszeit währte länger als die jedes anderen deutschen Regierungschefs. Er überstand vier Bundestagswahlen siegreich, war sechzehn Jahre lang fast unangefochten in Partei und Parlament.
Anfangs als Tollpatsch belächelt, wegen seiner Redeschwäche geschmäht, strebte der Mann aus der Pfalz beharrlich an die Spitze. Sein ganzes Leben widmete er der Politik, unermüdlich rackerte er sich ab auf der Ochsentour nach oben – von Hinterzimmern über Vorzimmer in Chefzimmer, von Weinfesten über Bierzelte, Rathäuser, Parteitage bis in die höchsten Ämter. Er hatte wenig Flausen im Kopf und keine Utopie einer neuen Gesellschaft. Die Macht war sein Ziel.
Noch zu Beginn seiner Kanzlerschaft galt er als der «am meisten unterschätzte Politiker»: ein auffällig heimatliebender, dem Pathos zugeneigter Biedermann, den man seiner Statur wegen «Schwarzer Riese» nannte, der aber eher die etwas zu groß geratene Verkörperung des deutschen Kleinbürgers war. Er wirkte nicht eisig überheblich wie sein Vorgänger Helmut Schmidt, nicht entrückt grüblerisch wie der Visionär Willy Brandt, nicht rechthaberisch auftrumpfend wie der Männerfreund Franz Josef Strauß, nicht professoral belehrend wie der hartnäckige Widersacher Richard von Weizsäcker. Sein damaliger geistlicher Beistand Pater Basilius Streithofen charakterisierte ihn so: «Der Kanzler besitzt die Tugend des Maßes. Sie hält die von der Klugheit geforderte richtige Mitte ein, zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig.»
Aber dann, gegen Ende seiner Amtszeit, das er ungebührlich lange verzögerte, verlor er jedes Maß: Die Einheit war erreicht, ein Ehrenplatz im Haus der Geschichte gesichert, da nahm er für sich ein ganz eigenes Recht in Anspruch, vorbei an lästigen Regeln oder gar Gesetzen. Das in westlichen Demokratien fein gewirkte System von Checks and Balances, die oft mühsame Suche nach einem Kompromiss zwischen den Parteien und Lagern, war ihm fremd. Denn wem schuldete er Rechenschaft – außer dem Wähler? Die sogenannte veröffentlichte Meinung interessierte ihn im Grunde nicht; für sie hielt er einen Standardsatz bereit: «Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht das mache, was die Medien von mir fordern.»
Stattdessen tat er ein Leben lang – vor allem, als das Karriereziel erreicht war – das, was sein Instinkt für richtig hielt. Und die Mehrheit der Deutschen ließ sich davon zunehmend beeindrucken. Im Gegenzug verlangte er ihr möglichst wenig ab.
Geduldig erfand und festigte der vor Selbstvertrauen strotzende Christdemokrat ein eigenes, nach ihm benanntes System der Machterhaltung, das freilich nur überdauern konnte, weil er in seinem Herrschaftswillen konkurrenzlos blieb: Widersacher wurden kaltgestellt, auf unwichtige Posten abgeschoben oder, wie Norbert Blüm, als Hofnarren geduldet. Schon die Abfolge der von ihm installierten Parteimanager von Kurt Biedenkopf bis zu Peter Hintze glich einer öffentlichen Demontage dieses Amtes – vom General steil abwärts zum Sekretär.
Überhaupt sah er in einsamen, überraschenden Personalentscheidungen den höchsten Ausweis seiner Macht. Dabei war er vor Irrtümern natürlich nicht gefeit: Sein erster Kanzleramtschef Waldemar Schreckenberger – ein Schulkamerad – war eine glatte Fehlbesetzung. Ein weiterer Freund aus Jugendtagen, Hermann Jung, vom Kanzler zeitweilig mit der Verwaltung und Koordination der Geheimdienste beauftragt, verschloss und vergaß wichtige Akten in seinem Tresor.
Andererseits besaß er ein herausragendes Gespür für politische Talente, die er förderte, solange sie ihm nützlich erschienen; man denke in der frühen Zeit an Heiner Geißler, Roman Herzog oder Bernhard Vogel, und später an Angela Merkel, das von Kohl so genannte «Mädchen».
Zugleich zeigte er das typische Verhalten eines Patriarchen: Mögliche Nachfolger wie Wolfgang Schäuble wurden kleiner gemacht, als es ihrer wahren Bedeutung entsprach. Auch das gehört zu den Grundvoraussetzungen eines jeden Staatsmannes: Ohne die Fähigkeit, seine Kombattanten und ihre Erwartungen zu enttäuschen, wäre er nicht geworden, was er ist.
War Helmut Kohl ein großer Kanzler?
Jacob Burckhardt, der Urvater der deutschen Geschichtsschreibung, hat die «historische Größe» eines Staatsmanns von seiner «Einzigkeit» oder «Unersetzlichkeit» abhängig gemacht. «Der große Mann ist ein solcher, ohne welchen die Welt uns unvollständig schiene, weil bestimmte große Leistungen nur durch ihn innerhalb seiner Zeit und Umgebung möglich waren und sonst undenkbar sind.» Das trifft unter deutschen Kanzlern ohne Zweifel auf Otto von Bismarck und Konrad Adenauer zu. Den Gründervater der Bundesrepublik erwählte sich Helmut Kohl schon früh zum Vorbild – so früh, dass er noch drei Jahrzehnte brauchte, sein Vorbild endlich zu beerben.
Der promovierte Historiker Kohl schätzt seine eigene Bedeutung gewiss geringer ein, als es die Maßstäbe Burckhardts vorgeben, auch wenn ihm Bescheidenheit von jeher fremd gewesen ist: Er hatte das Glück, er nennt es «Fortune», in einer Zeit zu amtieren, die als kurze Epoche «einzig» war.
Wie unterschiedlich dabei die großen Leistungen der an der Wiedervereinigung beteiligten Staatsmänner in ihren jeweiligen Ländern bewertet werden, zeigt sich am Beispiel Michail Gorbatschows. In der Bundesrepublik hoch dekoriert, gilt er daheim nur als Mann des Übergangs.
Die persönliche Begegnung mit dem russischen Reformator fernab aller Berater, Minister oder Protokollbeauftragten rechnet Kohl zu den Höhepunkten seiner sechzehnjährigen Regentschaft. Später beschreibt er einen Schlüsselmoment im Verhältnis zu Gorbatschow: Es ist Mitternacht am 15.Juni 1989 – und die beiden stehen im Park des Bonner Bundeskanzleramts vor einem Mäuerchen in Sichtweite des Rheins, als dem Gastgeber spontan das Herz aufgeht: «Schauen Sie sich den Fluss an, der an uns vorbeiströmt. Er symbolisiert die Geschichte; sie ist nichts Statisches. Sie können diesen Fluss stauen, technisch ist das möglich. Doch dann wird er über die Ufer treten und sich auf andere Weise den Weg zum Meer bahnen. So ist es auch mit der deutschen Einheit. Sie können ihr Zustandekommen zu verhindern suchen. Dann erleben wir beide sie vielleicht nicht mehr. Aber so sicher, wie der Rhein zum Meer fließt, so sicher wird die deutsche Einheit kommen – und auch die europäische Einheit.»
Mag sein, dass Kohl diese in seinen «Erinnerungen» festgehaltene Szene mit zu viel Symbolik befrachtet oder auch leicht übertreibt (Gorbatschow erwähnt in seinen Memoiren weder den nächtlichen Spaziergang noch den Gedankenaustausch), aber so sieht der Deutsche die Geschichte: In ihrer Stetigkeit ist sie für ihn ein mächtiger Strom, dem der Einzelne nichts entgegenzusetzen vermag.
Der Kanzler der Einheit hat noch andere Prädikate verdient. So schwach seine innenpolitischen Leistungen ausfielen – in Wahrheit kümmerte er sich nicht um die überfällige Reform der Gesellschaft–, so unvergleichlich stark war sein Engagement in der Außenpolitik.
Spätere Generationen werden Kohl als den Architekten des vereinten Kontinents würdigen; an diesem Ehrentitel hat er zeitlebens hart gearbeitet. Die europäische Einigung zäh vorangetrieben zu haben, war die fast noch größere Leistung, als nach dem Mauerfall den Zipfel vom Mantel der Geschichte zu erhaschen – die Einheit, heute wissen wir es aus dem tristen Erbe der DDR-Akten, wäre ohnehin auf die Deutschen zugekommen, der Zusammenschluss Europas vermutlich noch immer nicht so weit gediehen. Mit Recht wurde der Altkanzler zum «Ehrenbürger Europas» ernannt. In den USA galt er als «Staatsmann des Jahrzehnts». Sein Büro, das in Berlin in einer repräsentativen Dépendance des Bundestages Unter den Linden liegt, hat schon längst vor der Zählung der Ehrendoktorhüte, Ehrentitel, Ehrenspangen kapituliert.
Allerdings ist der Kreis derjenigen, die sich in seinem Ruhm zu sonnen wünschen, kleiner geworden, seit er im Zuge der Spendenaffäre gezwungen wurde, den Ehrenvorsitz seiner Partei aufzugeben, der er ein Vierteljahrhundert lang vorstand.
Darf ein Regierungschef bewusst Gesetze umgehen, die er mit seiner eigenen Unterschrift gutgeheißen hat? Darf er als spendensammelndes Parteioberhaupt für sich selbst eigene Regeln aufstellen, die mit dem geltenden Recht kollidieren? Wiegt ein von ihm selbst verfertigtes «Ehrenwort» schwerer als staatliche Normen? Darf er eine mit seiner Hilfe eigens geschaffene Behörde verklagen, weil diese die Rechtslage zu seinen Ungunsten interpretiert?
Vor der von Kohl immer wieder beschworenen «Geschichte» ist das sture Beharren auf einem vermeintlichen Schweigegelübde eine lässliche Sünde; freilich eine, die lange haftenbleibt und erst langsam vor anderen Erinnerungen an seine Amtszeit zu verblassen scheint.
Inzwischen dominiert er sogar die Rangliste der Persönlichkeiten, die Deutschland seit 1949 «am meisten geprägt» haben: In einer Erhebung nennen vierzig Prozent der Befragten den Namen Kohl, mit Abstand folgt sein politisches Vorbild Konrad Adenauer – und dann erst kommen Helmut Schmidt und Willy Brandt. Kohls politischer Niedergang im vergangenen Jahrzehnt, den er selbst unbeirrt einem letztlich verzeihlichen Fehler zuschreibt, war offensichtlich kein Denkmalsturz.
Mit dem Eingeständnis dieses «Fehlers», so gab er immer wieder zu Protokoll, habe er größeren Makel von seiner Person fernhalten wollen: Er sei eben nicht bestechlich gewesen – jedenfalls nicht in dem Sinne, dass er sich für staatliches Handeln von anonymen Nutznießern bezahlen ließ; und tatsächlich konnte ihm – trotz intensiver Bemühungen der Aufklärer in Justiz, Parlament, Publizistik – ein solches Verhalten nie nachgewiesen werden. Nach allem, was man über ihn herausgefunden hat, war er keineswegs korrupt.
Als langjähriger Vorsitzender wusste Kohl jedoch um die Schwierigkeiten und die klammen Kassen einer Organisation, deren Gedeihen den meisten seiner Wähler gleichgültig ist – er war ein Parteisoldat, wie es ihn nur selten gab. Die CDU empfand er als sein Zuhause. Wer nicht dazugehörte, war ein «Soz», also ein Outcast. Er schuf aus einem Kanzlerwahlverein eine moderne Volkspartei, die er zunächst zum Widerspruch gegen die Altvorderen aufstachelte, dann aber unter seiner Führung nur allzu gerne wieder in den alten Trott der Ergebenheit zurückfallen ließ. Sie emanzipierte sich erst, als Angela Merkel den Übervater mit einem kalten Schlag verdrängte.
Immer wieder beschreiben Biographen diesen Kanzler als «überdurchschnittlichen Durchschnittsbürger» – eine Kraftnatur aus der pfälzischen Weinstube im deutschen Nachkriegsidyll. Aber als es darauf ankam, erwies er sich doch als Staatsmann.
Mit der von Kohl häufig im Munde geführten «Wegweisung» war es dagegen nicht so weit her. Für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft galten ihm stets die Maximen seines großen Vorbilds als Richtschnur: «Konrad Adenauer», so betonte er nicht nur in seiner ersten Regierungserklärung, sondern hielt sich auch später stets daran, «führte vor über 30Jahren die Deutschen in die Gemeinschaft der freien Völker des Westens und baute darauf die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Auf dieses Erbe dürfen wir aufbauen, und aus diesem Erbe ziehen wir auch die Kraft, das für heute Notwendige zu tun.»
Im Rückblick erstaunlich: Helmut Kohl wollte die Bürger der Achtziger zurück in die vermeintlich goldenen Fünfziger führen. Es herrschte Gemütlichkeit, wie der Kanzler sie sogar im Umgang mit seinen Staatsgästen vorlebte – (möglichst) mit Schlappen an den Füßen, Vivaldi im Ohr, einem von Gattin Hannelore nach eigenem Rezept gefüllten Saumagen im Ofen und ausreichend Pfälzer Wein im Keller. Der stets mäkelnde «Spiegel» bezeichnete dieses vom «Mann aus Oggersheim» mit Hingabe gepflegte Idyll als «Atomenergie mit Familiensoße».
Aber seine Wähler mochten ihn dafür – oder für seine Strickjacken, die er nicht allein in historischen Momenten überstreifte und die ihm besser standen als der Frack oder gar der Stresemann. Eine von ihnen schmückt jetzt das von ihm gegründete Deutsche Historische Museum in Bonn.
Der Philosoph Jürgen Habermas nannte Kohl wegen dieser unbekümmerten Attitüde «die verkörperte Entwarnung». Trotz seiner massigen Erscheinung war bei ihm nie ein Anflug von persönlicher und militaristischer Großmannssucht zu spüren – wie sich spätestens bei seinem Auftritt mit François Mitterrand in Verdun zeigt. Das machte seine Gespräche mit anderen Mächtigen über die Einheit Deutschlands und die Einigung Europas so glaubwürdig. «Kohl ist weder gefährlich noch einschüchternd», applaudierte Habermas. «Er ist repräsentativ ohne Repräsentation.» Und als habe er die späteren Wirrungen und Irrungen erahnt, fügte der Vordenker der deutschen Intellektuellen 1994 ein als Tadel getarntes Lob hinzu: «So könnte uns einzig sein unschätzbarer Vorzug, so gar nicht zum Vorbild zu taugen, zum Nachteil gereichen.»
Kapitel 1
«PFÄLZER KRISCHER»: JUGEND UND LEHRJAHRE
Als Anfang der achtziger Jahre zweiundvierzig mehr oder minder bedeutende Bundesbürger gebeten werden, in einem Sammelband ihre Kindheit und Jugend zu reflektieren, macht der prominenteste von ihnen gerne mit. Helmut Kohl, gerade zum Kanzler gewählt, schildert akribisch seine Herkunft, ein zuweilen fast sentimentaler Text. Später, als Elder Statesman, verdichtet er den Extrakt daraus zum ersten Schlüsselsatz seiner Memoiren: «Ich bin ein klassisches Beispiel dafür», schreibt der am 3.April 1930 in der pfälzischen Industriestadt Ludwigshafen geborene einstige Regierungschef, «welchen Einfluss das Elternhaus hat.»
Ihm, so bekräftigt er auch bei anderen Gelegenheiten, verdanke er die entscheidenden Anstöße, die fortan sein inneres Koordinatensystem bestimmen. Eigenschaften wie die oft demonstrativ zur Schau gestellte Bodenständigkeit oder sein pralles Ego, die sich anhand einer «bürgerlichen Werteskala» entwickeln, sind das Resultat frühester Prägungen. Obenan stehen Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Gottvertrauen.
Der Vater Hans Kohl, ein aus dem Fränkischen in die damals bayerische Kurpfalz übergesiedelter Steuersekretär, und die liebevoll um sein Wohl bemühte Mutter Cäcilie, so entsinnt sich der letztgeborene Sohn, machen nicht viele Worte. Für die geistig-moralische Grundorientierung gilt in der streng katholischen Familie die Kirche als höchste Instanz – und was an Erziehungsmethoden «heute problematisiert, psychologisiert und im Übermaß analysiert» werde, notiert der Autor als Kanzler, sei daheim «schlicht vorgelebt» worden.
Immerhin ist man dort so «stockschwarz», dass ihn manche der frommen Riten bis in die Gegenwart begleiten. Wie in den dreißiger Jahren der hungrige «Helle» über jedem frischangeschnittenen Laib Brot das Kreuz schlägt, tut das mit gleicher Selbstverständlichkeit noch der erwachsene Staatsmann.
Bei den Kohls – einem «typischen, kleinen Beamtenhaushalt» – herrschen praktische Vernunft und ein Realitätssinn, der sich «aus Pflichtbewusstsein und Fröhlichkeit des Herzens speist». Sie sind sparsam, ohne das Feiern zu vergessen, und bekennen sich trotz fester Weltanschauung stets zur Toleranz. So ruft die patente Mama «je nach Bedarf und Zuständigkeit» ihre Schutzheiligen an, hört die sonntags per Volksempfänger ausgestrahlten Predigten der leichteren Verständlichkeit wegen aber lieber bei den Protestanten. Und als Helmut später nicht nur eine aus Sachsen stammende – in der Pfalz so genannte Hereingeschneite–, sondern obendrein noch evangelische Frau heiratet, macht ihm niemand einen Vorwurf.
Mit den acht und vier Jahre älteren Geschwistern Hildegard und Walter verbringt der kleine Helmut Josef Michael eine zunächst ausgesprochen glückliche Kindheit. Weil der Vater in der stürmischen Umbruchphase der Weimarer Republik um seinen Job bei der Ludwigshafener Finanzbehörde nicht zu fürchten braucht und der Opa mütterlicherseits der Familie 1932 ein im Stadtteil Friesenheim gelegenes Haus mitsamt prächtigem Nutzgarten vererbt, fällt auf seine ersten Jahre kaum ein Schatten.
Für zwei Portionen Fleisch pro Woche oder die vom Jüngsten heißbegehrten Süßspeisen reicht es da immer, und unter den vierzig gepflegten Obstbäumen darf er sich im Garten, der damals noch an freie Felder grenzt, nach Belieben austoben. Wie die Schwester zu erzählen weiß, bildet sich bei dem quicken Junior schon früh ein gewisses Geltungsbedürfnis heraus: Einmal habe sich der zu Faxen neigende Helmut ein Bettlaken um die Schultern geschlungen und als Mitra einen Kaffeewärmer auf den Kopf gesetzt, um dann seinen Spielkameraden zu befehlen, ihm «die Schleppe zu tragen».
Auch sonst entfaltet der selbstbewusste Bub beträchtliche Aktivitäten. Die ihm täglich übertragene Aufgabe, das in Scharen vorhandene Kleinvieh zu versorgen, bringt ihn rasch auf andere nützliche Ideen: Er handelt mit Stallhasen, die er vorher prämierten Rammlern zugeführt hat, oder fängt in den Nebengewässern des Rheins Flusskrebse, um sie anschließend zu verhökern. Der Versuch, sogar eine Seidenraupenzucht aufzubauen, bleibt allerdings erfolglos.
Aber die schönen Zeiten ändern sich. Wie dem Sohn nach der Machtübernahme der Nazis im Lauf der Jahre langsam bewusst wird, stehen die patriotisch gesinnten Eltern dem ausufernden völkischen Größenwahn kritisch gegenüber – und was ein Krieg im Leben der Menschen anrichtet, erfährt er auf schmerzliche Weise schon bald am eigenen Leib.
Die erste Bombe, ein Blindgänger, schlägt bereits Anfang Mai 1940 im Vorgarten seines Hauses am Hohenzollernring 89 ein, und von da an haben die knapp 150000Einwohner der prosperierenden Chemie-Metropole Ludwigshafen unter insgesamt mehr als 120Luftangriffen zu leiden. Helmut Kohl ist gerade mal zwölf Jahre alt, als er mit den Schülerlöschtrupps, die überall zur Trümmerbeseitigung verpflichtet werden, zwangsläufig auch Tote bergen muss. Da habe er, wie sich noch der alte Mann erinnert, «aufgehört, ein Kind im normalen Sinne zu sein».
Doch der schlimmste Schock folgt erst in der Schlussphase des Infernos. Bevor er selbst in einem Wehrertüchtigungslager in der Nähe des Berchtesgadener Obersalzbergs landet, um als Pimpf die letzte Bastion des «Führers» mit dem Einsatz von Nebelwerfern abzuschirmen, stirbt an der Front der Bruder. Die Familie trifft dieser Schicksalsschlag umso härter, als sich der Vater mitschuldig fühlt. Schon in der kaiserlichen Armee als «Tapferkeitsoffizier» kämpfend und im Zweiten Weltkrieg abermals eingezogen, hatte er den an soldatischem Heldentum kaum interessierten Jungen zu einer Karriere beim Militär überredet, was ihn nun in Seelenqualen stürzt.
Und dennoch – darauf legt der Bundeskanzler a. D. im Rückblick großen Wert – sei das Elternhaus «intakt» geblieben. Da man bei aller Vaterlandsliebe nie auch nur ansatzweise in ein «nationalistisches Fahrwasser» geriet, ging der Kompass, so versichert er seinen Lesern, «in keinem Augenblick verloren».
Die Familie nimmt demütig hin, was ihr von höheren Mächten zugedacht worden ist, und vor allem der überlebende Sohn entwickelt dabei ungeahnte Kräfte. Bei Kriegsende schlägt er sich zu Fuß mehrere hundert Kilometer nach Hause durch und verbringt den Sommer 1945 auf einem Bauernhof in Franken, um dort an der Pflugschar oder im Kuhstall schwere körperliche Arbeiten zu verrichten. Er will sein Geld künftig als Landwirt verdienen, aber dieser Kindertraum verflüchtigt sich bald. Schon im Herbst kehrt er nach Ludwigshafen in die mittlerweile wieder geöffnete Oberrealschule zurück.
«Helle», der vorher zu den eher Schwächeren seines Jahrgangs zählt, mausert sich. Als Streber mag der inzwischen hochaufgeschossene Teenager zwar nur ungern gelten, umso mehr aber als eine «Art Leitwolf», der an seiner Schule die Strippen zu ziehen beginnt. Mit Freunden und von ihm selbst beschafften Baumaterialien setzt er auf eigene Faust nicht nur das in den Feuerstürmen erheblich beschädigte Unterrichtszimmer instand, er macht auch sonst gezielt von sich reden. Nach hitzigen Wortgefechten mit jenen Lehrern, die zum Teil noch in der alten martialischen Paukermanier fortfahren, wird er prompt zum Klassensprecher gewählt.
Als der Staatsmann längst in den politischen Olymp aufgerückt ist, loben Zeitzeugen, schon der junge Kohl habe einen bemerkenswerten Corpsgeist bewiesen. Nach ihren Schilderungen steigert ein von ihm formulierter «Ehrenkodex», der die leistungsstarken Schüler verpflichtet, ihre schwächeren Kameraden abschreiben zu lassen – und sich in Verhaltensweisen einzuüben, die den eigenen, noch etwas vagen Vorstellungen von Demokratie entsprechen–, enorm seine Beliebtheit. Dass er sie häufig nutzt, um seinen Führungswillen zu untermauern, fällt zunächst nur kritischen Geistern auf.
In den Jahren des Hungers und Mangels begründet vor allem ein beachtliches Organisationstalent seinen Ruf. Um die Klasse mit Schülerinnen des Ludwigshafener Mädchen-Gymnasiums zusammenzubringen, beschwatzt er als Rudelführer die Wirtsleute des Gasthauses «Zum Weinberg», über die damals noch üblichen Prüderien hinwegzusehen und einen gemeinsamen Tanztee-Abend zu erlauben. Bei dieser Gelegenheit lernt er die aus Leipzig geflüchtete und mit ihren Eltern im nahen Mutterstadt wohnende Hannelore kennen – seine spätere Ehefrau.
In der Rückschau beschreibt der Pensionär Helmut Kohl die darauffolgende Zeit als die «vielleicht unbeschwerteste» seines Lebens. Als es funkt, ist er achtzehn und sie fünfzehn, und die beiden gelten sofort als unzertrennliches Paar. Seines kräftigen Haarwuchses wegen nennt sie ihn etwas spöttisch «mein schwarzer Italiener», während er die modebewusste Blondine als erfrischend «kesse Person» empfindet. Am liebsten schwimmt man im Rhein hinter Lastkähnen her, bricht zu langen Fahrradtouren auf oder tuckert, als er das nötige Geld beisammenhat, auf einer gebrauchten «Lambretta» durch die heimische Gegend.
Helmut Kohls zweite und kaum minder große Leidenschaft gehört da schon ganz der Politik. Was im geteilten Deutschland und in der Welt vor sich geht, interessiert ihn viel mehr als die Schule, die er infolge der kriegsbedingten Unterbrechungen erst als Zwanzigjähriger mit einem eher glanzlosen Ergebnis abschließt. Lapidar redet er das Abitur zum «reinen Akt der Pflichterfüllung» herunter, der für ihn «zum Weiterkommen einfach notwendig war».
Nach dem jähen Ende der vom NS-Staat fanatisch beförderten Großmachtphantasien beflügelt ihn – wie viele seiner Kameraden – allem voran der Gedanke an einen in Frieden und Freiheit vereinigten Kontinent. In einer von Jungintellektuellen in Ludwigshafen zu diesem Zweck gegründeten «Arbeitsgemeinschaft» erprobt er mit Erfolg, was im Lauf der Jahre konsequent zum Bestandteil seines berühmt-berüchtigten «Systems» verfeinert wird: Eine als fester Block anrückende Friesenheimer «Ortsgruppe», die bei den Vorstandswahlen kaltschnäuzig durchmarschiert, verhilft ihm in der Vereinsführung auf Anhieb zum ersehnten Stellvertreterposten.
Was macht es da schon, dass dem Club rasch die Puste ausgeht. Als es einige Mitglieder aus der Südpfalz an die Grenze zieht, um dort zum Erschrecken des französischen Besatzungsregimes die Schlagbäume abzuräumen, ist es mit dem Spaß gleich vorbei. Weil sie aber belegt, um wie viel zupackender als andere er seinen stets europafreundlichen Avantgardismus pflegte, erzählt noch der Kanzler Kohl diese Episode in stets bester Laune. Von der Möglichkeit, sein Selbstwertgefühl auf politischem Terrain auszuleben, mag er danach jedenfalls nicht mehr lassen, und die beiden Männer, die ihm zunächst einmal Pate stehen, könnten unterschiedlicher kaum sein.
Zu dem einen wird er von seinem Friesenheimer Gemeindepfarrer in die zwölf Kilometer entfernte Arbeitersiedlung Limburgerhof geschickt, wo ein engagierter Dekan namens Johannes Fink an jedem Sonntag junge Leute um sich schart. Er will sie für eine auf christliche Prinzipien gegründete Gesellschaftsordnung gewinnen und erkennt sofort die große Begabung seines neuen Eleven. Der wiederum sieht in dem ebenso fachlich profunden wie didaktisch geschickten Geistlichen einen «Lehrmeister erster Güte».
Dabei gibt es zur selben Zeit noch einen zweiten Mentor, der ihm mächtig imponiert. Er heißt Otto Stamfort und bringt ihm im Gymnasium Mathematik und Physik bei – ein Jude und überzeugter Marxist, der das «Dritte Reich» als Exilant überdauert hat. Auch bei ihm trifft sich ein kleiner Kreis, um über Politik, Philosophie und die dunkelsten Kapitel der deutschen Vergangenheit zu diskutieren. Kohl wird ihm selbst dann noch brieflich verbunden bleiben, als er 1948 in die sowjetisch besetzte Zone wechselt und in Thüringen als Staatssekretär das Kultusministerium leitet.
Aber die Entscheidung darüber, welche Richtung er in Zukunft einschlagen soll, ist da längst gefallen. Sosehr sich der Schüler bald mit möglichst provokant formulierten Thesen zum Rebellen stilisiert, gibt es an seiner grundsätzlichen Einstellung «nicht den Hauch des Zweifels». Nach dem Vorbild des Vaters, der in der Weimarer Republik stets dem katholischen «Zentrum» die Stange hielt, sieht sich der erdverwachsene Spross «auf der Basis des schwarzen Milieus», in dem er groß geworden ist, eindeutig als Konservativer.
Und wie sich der Senior nach dem Krieg rasch den in Ludwigshafen 1946 aus der Taufe gehobenen Christdemokraten anschließt, kann es auch der Sohn kaum abwarten. Sein Mitgliedsbuch unter der Nummer 00246 bestätigt dem Neuling, der vorher den Kreisverband der Jungen Union mitbegründet hat, eine spektakulär frühe Aufnahme. Nur das exakte Datum bleibt seltsamerweise umstritten. Er selbst behauptet, ihm sei schon als Sechzehnjähriger «das Glück» zuteilgeworden, in die CDU eintreten zu dürfen. Bei den geltenden Statuten hätte er allerdings mindestens achtzehn sein müssen – eine Klippe, die er vermutlich umschifft, indem er sich heimlich über die Nachwuchsorganisation in die Mutterpartei einschleusen lässt.
Dass der leicht entflammbare «Helle» vom Start weg als besonders ruppiger «Pfälzer Krischer» auf sich aufmerksam macht, liegt zum Teil auch an den Verhältnissen in seiner Heimatstadt. In Ludwigshafen, das von der SPD dominiert wird, hat der übersteigerte Konflikt zwischen den bürgerlichen und linken Kräften Tradition – für einen Troubleshooter wie Kohl genau das richtige heiße Pflaster. Noch nach Jahrzehnten erklärt der Altkanzler die dortigen Spitzengenossen grimmig zum «Inbegriff doktrinären Denkens» – und bereits im Vorfeld der ersten, auf den Mai 1947 anberaumten rheinland-pfälzischen Landtagswahl geht er als fleißiger Plakatkleber im Wettbewerb mit den verhassten «Roten» keiner Keilerei aus dem Weg. Andererseits steckt in ihm zu viel politisches Talent, als dass es ihm dauerhaft Vergnügen bereiten könnte, in seiner Union nur den Frontkämpfer zu spielen. Um seinen Horizont zu erweitern, nimmt er in den damals scharf voneinander abgegrenzten Besatzungszonen einige Mühen in Kauf. Anstatt daheim für den Unterricht zu pauken, verlangt es ihn immer drängender danach, auf Kundgebungen den Koryphäen der konkurrierenden Parteien zuzuhören, wobei ihn der charismatische SPD-Chef Kurt Schumacher ebenso beeindruckt wie der Vorsitzende der Liberalen, das künftige Staatsoberhaupt Theodor Heuss. Die Begegnung mit dem Größten der Großen folgt dann im August 1949.
Im südpfälzischen Landau gibt sich kurz vor der ersten Bundestagswahl der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer, die Ehre, und der neunzehnjährige Primaner, der mit Freunden in einem Lautsprecherwagen für die nötige Propaganda sorgt, darf dem Stargast gleichsam als Herold vorauseilen. Er wird den Tag schon deshalb nie vergessen, weil es die Versammelten wieder wagen, die nach Kriegsende von den Alliierten verbotene Nationalhymne anzustimmen.
Mit dem späteren Gründervater der Republik verbindet Helmut Kohl sofort das euphorische Gefühl einer «geistigen Verwandtschaft», und so eindeutig er bis dahin die Parteifreunde Karl Arnold und Jakob Kaiser als christdemokratische Kanzlerkandidaten bevorzugt, fasziniert ihn nun der «Alte von Rhöndorf». Nach dessen Einzug ins Bonner Palais Schaumburg überprüft der politisch gelehrige Abiturient prompt, was an seinen bisherigen Positionen obsolet geworden sein könnte, und erlaubt sich gelenkig ein paar Korrekturen. Insbesondere lässt er die im jugendlichen Überschwang erhobene Forderung nach dem Verzicht auf Wiederbewaffnung fallen; der unbeirrbar in die westliche Staatengemeinschaft strebende 74-jährige Patriarch hat seine «volle Sympathie».
Weil der Lauf der Geschichte «das so wollte», wird sich Kohl in den folgenden Jahren immer wieder rechtfertigen, sei eine enge «Großvater-Enkel-Beziehung» auch eine Notwendigkeit gewesen. Früher und schärfer als andere erkennt er, wie sehr es der in zwei blutigen Kriegen grässlich dezimierten mittleren Generation an geeignetem Personal mangelt – die Gremien sind kaum noch in der Lage, ihre langsam vergreisende Führungsschicht aus der Weimarer Zeit zu ersetzen.
Die daraus resultierenden Vorteile macht er sich Schritt für Schritt zunutze. Niemand kann ihn davon abhalten, seinen unbändigen Ehrgeiz zu befriedigen. Bereits in der Tanzstunde stellt er sich seiner Freundin als künftiger Mainzer Ministerpräsident vor – und er ist gerade mal dreiundzwanzig, als er nach einem ausgeklügelten Plan überfallartig zur ersten Kampfabstimmung antritt und gewinnt. Statt des in Würden ergrauten Landauer Oberbürgermeisters Alois Krämer, der auf seine Meriten vertraut hat, sitzt nun plötzlich ein zu scharfer Polemik neigender Youngster aus Ludwigshafen im einflussreichen christdemokratischen Bezirksverband Pfalz am Vorstandstisch.
DIE «GROSSVÄTER» SIND GEWARNT
Sooft sich Helmut Kohl damals wie in späteren Jahrzehnten zu seiner Herkunft äußert, gerät er unvermittelt ins Schwärmen. Seine Landsleute, pflegt er dann häufig mit schnalzender Zunge weit auszuholen, seien ein «ganz besonderer Menschenschlag», und der Grund für diese Unverwechselbarkeit liege zweifellos in ihrer Geschichte. Wer schon von den Römern den Anbau des Weinstocks erlernt oder seit dem Mittelalter im Dom zu Speyer die deutschen Kaiser zur Ruhe gebettet habe, müsse sich von keinem mangelnde Identität vorwerfen lassen. Und natürlich vergisst er dabei nie das anno 1832 auf dem Hambacher Schloss gefeierte «Hochamt der Demokraten».
Neben dem Tod des Bruders und den Schrecken des Krieges, die sich nie wiederholen sollen, ist es ebendieses Verständnis von Historie und Heimat, das ihn zum Politiker werden lässt. «Elementar», doziert er leicht theatralisch – und reiht sich damit in die Galerie großer Namen wie des bekennenden Rheinländers Konrad Adenauer oder des Schwaben Theodor Heuss ein–, wirke allein «die Verbundenheit mit den Wurzeln». Nur daraus sei ihm die Kraft zum Dienst am Vaterland und hernach an Europa erwachsen.
In den ausgehenden vierziger Jahren jedoch steht es gerade in Rheinland-Pfalz mit solchem der Scholle verpflichteten Selbst- und Sendungsbewusstsein nicht zum Besten. Der von den Franzosen kontrollierte deutsche Südweststaat ist ein willkürlich aus ehemals bayerischen, preußischen und hessischen Provinzen zusammengestoppeltes Konglomerat, das noch lange um seine Daseinsberechtigung ringt. Bis Ende der Sechziger liegen sich Repräsentanten aller Parteien darüber in den Haaren, ob das ungeliebte «Land aus der Retorte» wieder zerlegt und in ein vernünftigeres Verbundsystem integriert werden soll.
Auf den Konferenzen der CDU, die ihre anfänglich nur knappe Mehrheit in der Region zwischen Rhein, Mosel und Saar von Wahl zu Wahl ausbaut, nimmt sich der sonst redselige Kohl auffällig zurück. Er scheint dem letztlich fruchtlosen Streit über die Sinnfälligkeit einer territorialen Neugliederung wenig abgewinnen zu können, und außerdem gibt es für ihn ja auch einen praktischen Grund: Wer in dieser Region an die Spitze vorstoßen will, sollte sie tunlichst nicht in Frage stellen.
Also arbeiten sich andere daran ab, dass zum Beispiel die rechtsrheinischen Vororte der neuen Hauptstadt Mainz dem hessischen Wiesbaden zugeschlagen worden sind – für den bei aller Emphase pragmatischen Pfälzer ist das ein untergeordnetes Problem. Er fühlt sich wohl in seinem kleinen Reich, zu dem er sich spätestens dann uneingeschränkt bekennt, als die Deutschen im Sommer 1954 bei der Fußball-Weltmeisterschaft triumphieren. Schließlich stammt die Hälfte der «Helden von Bern», die den noch immer kriegsgebeutelten Bundesbürgern zu neuem Stolz verhelfen, vom Kaiserslauterer Betzenberg. Neben dem Kanzler sind jetzt Sepp Herberger und der aufopferungsvolle Kapitän der Nationalmannschaft, Fritz Walter, seine Leitbilder.
Darüber hinaus denkt er schon lieber in deutlich «größeren Kategorien». Mitte der fünfziger Jahre hat sich das von Frankreich abgetrennte Saargebiet zu entscheiden, ob es sich in Zukunft mit einem Sonderstatus zufriedengeben oder in die Bonner Republik «heimkehren» möchte, wie der Patriot Kohl es heiß ersehnt. Subversiv versorgt er die Freunde jenseits der Grenze mit entsprechendem Propagandamaterial und darf sich nach dem Wahltag zu den Siegern zählen.
Es ist für ihn ein besonders bewegter Zeitabschnitt. Seit 1950 studiert der ruhelose Christdemokrat zunächst in Frankfurt, wo er sich sowohl in die juristisch-staatswissenschaftliche als auch in die philosophisch-ökonomische Fakultät einschreibt. Doch weil sich die zertrümmerte Mainmetropole damals von Ludwigshafen aus mit der Bahn noch ziemlich schwer erreichen lässt, steigt er bereits zum Wintersemester 1951/52 auf die näher gelegene Uni Heidelberg um. Statt Jura ist dort Geschichte sein Hauptfach, während er im Nebenfach Politik belegt.
Nach dem Sprung in den pfälzischen CDU-Vorstand gehört er im politischen Betrieb zu den Leuten mit Zukunft – in der Arbeitswelt dagegen heuert Kohl beim heimischen Chemiekonzern BASF auf der untersten Stufe an. Da er für seinen Lebensunterhalt weitgehend selbst sorgen muss, lernt er in der Knochenmühle einer Steinschleiferei immerhin drei lange Jahre, was es heißt, im Akkord und auf Stechkarte zu malochen. Der Selbstversuch an der «Basis» wird von da an nicht nur seine Biographie schmücken, sondern ihm im Kampf um den «kleinen Mann» einen beträchtlichen Zuwachs an Glaubwürdigkeit verschaffen.
Denn die braucht er, um seinen hochfliegenden Plänen den nötigen Nachdruck zu verleihen. Die Union, die in der Frühphase des Bonner Teilstaats noch fast ausschließlich dem konfessionell gebundenen Bürgertum zugewandt ist, soll sich nach seiner Vorstellung in eine «moderne Volkspartei» umgestalten und dabei die unterschiedlichsten Schichten vereinen. Keine Macht ohne Besetzung der «Mitte» – und diese Mitte, das haben ihm bereits der aufgeklärt-liberale Priester Johannes Fink wie auch dessen sozialistisches Pendant Otto Stamfort eingeschärft, erfordert zwingend die Partnerschaft mit den «ganz normalen Leuten».
Solche im Kern wenig sensationellen Bekundungen genügen schon, ihm in der CDU den Ruf eines linken Querkopfs einzutragen, und so zieht er, wie er es selbst empfindet, als «seltsamer Verschnitt aus Student und Politiker» durchs Land. Dass er rhetorisch allenfalls Durchschnitt ist und sich häufig in schwerverständlichen Schlingsätzen verheddert, schadet ihm nicht. Was ihm als Redner fehlt, gleicht der zu stattlichen 1,93Metern emporgewachsene Jungstar mit einer enormen körperlichen Präsenz aus, die ihn bisweilen zum Übermut verführt.
Komplexe sind ihm aber nicht allein seiner Statur wegen fremd. Helmut Kohl hat eine Botschaft, und die lässt sich am effektvollsten in der Pose des Anklägers verkünden. Die CDU, lautet sein mal pathetisch, mal mit triefendem Spott vorgetragenes Credo, sei an ihren Anfängen gemessen allzu schnell «verkrustet». Auf Kongressen oder wo immer sich sonst die Gelegenheit dazu bietet, attackiert er deshalb vorzugsweise die «Honoratioren», deren Selbstgefälligkeit der Partei jeden Elan austreibe. Am liebsten geißelt der Katholik ihre Nähe zum Klerus, dem er ein Beharren auf überkommenes Gedankengut vorwirft.
Die Absicht ist leicht zu erkennen: Je schwärzer der Hintergrund, vor dem der junge Raufbold mit der dicken Hornbrille und ewig kokelnden Pfeife agiert, desto leuchtender er selbst, der sich ja nicht nur verbal einiges zutraut. Im frischen Alter von fünfundzwanzig besitzt er – wie er danach selbst süffisant anmerkt – spontan die «Unverfrorenheit», bei der Wahl zum stellvertretenden Landesvorsitz einem leibhaftigen Bonner Promi die Stirn zu bieten. Da ihm gegen den in Neuwied lebenden Familienminister Franz-Josef Wuermeling nur eine einzige Stimme zum Sieg fehlt, findet er sich zum Ausgleich in der erweiterten Führungsspitze der rheinland-pfälzischen CDU wieder.
Und die «Großväter» sind gewarnt. Allen voran der noch im neunzehnten Jahrhundert geborene und seit 1947 in Mainz amtierende Regierungschef Peter Altmeier sieht in Kohl plötzlich den Mann, der sich stark genug zu fühlen scheint, sogar an seinem Stuhl zu sägen. Doch die neue Lichtgestalt übt sich erst mal in Zurückhaltung. Der Student, der sich aufgemacht hat, seine Couleur das Fürchten zu lehren, widmet sich in der Folgezeit ganz seiner Promotion, in der er praktischerweise die «Politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945» abhandelt. In Ludwigshafen laufen indessen sämtliche Personalfragen über seinen Schreibtisch.
Die Dissertation wird derweil von seiner Verlobten Hannelore Renner in eine Reiseschreibmaschine getippt, die drei Jahrzehnte später kurzfristig Weltberühmtheit erlangt. In den Wirren der Wende entsteht auf ihr jenes «Zehn-Punkte-Programm», mit dem der Kanzler Kohl die untergehende DDR konföderativ an den westdeutschen Teilstaat binden will. In diesem Sommer 1958 ist es ein nicht ganz so schwergewichtiges Dokument.
Die von ihrem zukünftigen Mann verabschiedete und knapp mit «cum laude» dekorierte Arbeit bezieht ihren Wert in erster Linie daraus, dass sie dem Dr. phil. zu einem neuen Image verhilft. Kaum ein zweiter Politiker verschmilzt den akademischen Grad so sehr mit seinem Namen, und der Erfolg gibt ihm recht. Neben seiner vornehmlich auf das Praktische ausgerichteten Qualität, die die Rheinland-Pfälzer längst anerkennen, verleiht ihm der Titel zusätzlich das Flair des Intellektuellen.
Die Voraussetzungen, das Volk im Parlament zu vertreten, sind für Kohl damit erfüllt.
Kapitel 2
«RAUS AUS DER GARTENLAUBE»: AUFSTIEG IN MAINZ
Schon als Pennäler scheint es dem christdemokratischen Musterschüler Helmut Kohl zu gefallen, seine ausufernden Reden mit allerlei Spruchweisheiten zu garnieren. Mal zitiert er seinen Lieblingsschriftsteller, den in Rheinhessen geborenen Carl Zuckmayer, dessen pralle Heroen, etwa der «Schinderhannes», ihm imponieren – oder er bedient sich bei Karl May, wenn es um Männertreue geht, wie Old Shatterhand und Winnetou sie vorleben. Weil er sich den Zuhörern als kenntnisreicher, aber zugleich unverbildeter Zeitgenosse empfehlen möchte, bevorzugt er die schlichten Aphorismen, die den gesunden Menschenverstand spiegeln.
Selbst was am Ende ein «großer Baum» werden wolle, müsse zunächst einmal «klein wachsen», heißt zum Beispiel eine der Bauernregeln, die er bereits als junger Knecht der Natur abgeschaut hat – und natürlich gilt die ebenso im politischen Geschäft.
Die wohlfeile Wahrheit führt zu einem Verhaltensmuster, dem er noch lange anhängen wird: Da er weder wie der Vater eine Beamtenlaufbahn einschlagen noch in der freien Wirtschaft reüssieren will, bleibt ihm in seinem Metier bloß das, was man in einer politischen Organisation die «Ochsentour» nennt: Ein solides lokal- und kommunalpolitisches Fundament ist für ihn dabei der Schlüssel zur Verwirklichung aller Träume. Nur wer von der Pike auf sein Handwerk erlernt, weiß der bodenständige Pfälzer, kann auf dieser Basis nach Höherem streben.
«Die Partei» und insbesondere die sorgfältige Pflege ihrer Wurzeln, analysiert der Unionsexperte Alexander Gauland in einem Essay, sei für den späteren Bundeskanzler «von Anfang an Berufung, Beruf und Heimat» gewesen – er ist nach seiner Einschätzung der «erste klassische», in keinem anderen gesellschaftlichen Milieu verankerte Berufspolitiker, und Kohl sieht das offenbar ähnlich. «Um das Abenteuer des Lebens leben zu können», wie er sich im Lauf der Jahrzehnte etwas schwülstig auszudrücken beliebt, braucht er den Kitzel des Spiels mit der Macht.
Zum ersten Mal fasziniert ihn die Möglichkeit, praktisch vor der Haustür um Menschen und Mehrheiten zu werben, als es das Bundesland Rheinland-Pfalz noch gar nicht gibt. Im September 1946 dürfen die Ludwigshafener frei über ihr Stadtparlament entscheiden, und der von seinen Eltern ins Wahllokal mitgenommene Helmut findet das an sich wenig dramatische Procedere hochspannend. Er bleibt als Zuschauer dabei, bis um Mitternacht die letzten Stimmen ausgezählt sind, und studiert in den Tagen danach die Resultate, wie sich seine Altersgenossen in Fußball-Tabellen vertiefen.
Im Kreise Gleichgesinnter die angeblich bornierten «Roten» zu befehden, um Schritt für Schritt selbst ins Zentrum des Geschehens zu rücken, lässt ihn von da an nicht mehr los. Eifrig büffelt er in der «politischen Sonntagsschule» beim Dekan Johannes Fink die Essentials des künftigen, demokratisch organisierten Gemeinwesens, die Ideen der katholischen Soziallehre und in diesem Kontext vor allem das Subsidiaritätsprinzip. Das gesteht auch den vor Ort tätigen Funktionären beträchtliche Mitspracherechte zu – ein Gebot, das zur Selbstverantwortung verpflichtet und aus dem Kohl mehr und mehr persönliche Ansprüche ableitet.
Die reale Chance, bereits mit fünfundzwanzig für den Landtag zu kandidieren, lässt der kühl berechnende Youngster andererseits verstreichen. Er möchte zunächst seine privaten Verhältnisse ordnen, aber er trifft doch Vorkehrungen, seine Anwartschaft zu sichern: Aus dem pfälzischen Dunstkreis gelangen ausnahmslos treue Gefolgsleute auf die Bewerberliste, und bei der Bundestagswahl 1957, die der Union die absolute Mehrheit beschert (ein in der Geschichte der Bundesrepublik einmaliger Vorgang), übernimmt er in Ludwigshafen als Cheforganisator der Christdemokraten vollends die Regie. Zum Zuge kommt nur noch, wem der rigide Helmut Kohl den Zuschlag erteilt.
Erscheint es ihm nützlich, hievt er die Kombattanten – etwa Ende der Fünfziger den CDU-Kreisvorsitzenden und engen Jugendfreund Egon Augustin – bisweilen als kurzfristig benötigte Platzhalter auf vakante Posten, um sie dann kaltschnäuzig wieder zu verdrängen. Denn mit Menschen wie in einem Verschiebebahnhof umzugehen, übt schon früh großen Reiz auf ihn aus. «Gewissermaßen als Nebeneffekt dieser zentralen Rolle, die personalpolitische Entscheidungen in meinem Denken immer gehabt haben», schreibt er lakonisch zu seiner Rechtfertigung, entsteht so das vielzitierte und von ihm selbst stolz im Munde geführte Kohl’sche «System». Für Ideen Verbündete zu finden und mit deren Hilfe auf eindeutig demokratische Weise legitimierte Ziele durchzusetzen, hält er seinen Kritikern entgegen, sei gewiss kein anrüchiges Verfahren.
Und er bekennt sich umso freimütiger zu diesem «einzigartigen Erfolgsmodell», als seine frappierende Fähigkeit, die eigenen zu anderer Leute Interessen zu machen, auch außerhalb der Partei bald Früchte trägt. Nach dem Abschluss des Studiums bietet ihm ein Freund den ersten Fulltimejob als Direktionsassistent in einer Eisengießerei an, und ein Jahr später wechselt er in die Führungsetage des einflussreichen rheinland-pfälzischen Landesverbandes der Chemischen Industrie. Als Referent des Vorsitzenden knüpft der ehemalige Steinschleifer von da ab fleißig Kontakte zu den wirtschaftlichen Granden der Gesellschaft.
So kann er sich bei seinem Bemühen, endlich ins Mainzer Parlament einzuziehen, auf ein mehr als ordentliches Zubrot stützen, und der Rest ist praktisch Formsache. Schließlich geht der in seiner Vaterstadt wie ein «bunter Hund» bekannte «Doktor Kohl» bei der Landtagswahl im Frühling 1959 nicht nur als Kreisparteichef ins Rennen – eine Funktion, die ihm von vornherein einen sicheren Listenplatz garantiert–, er gilt zudem als besonderer Kandidat. Auf dem Gipfel der von einigem Getöse begleiteten Kampagne gelingt es ihm, den Schutzpatron Konrad Adenauer nach Ludwigshafen zu lotsen, der damals im Zenit seiner Popularität steht. Und bei dieser mit 10000Besuchern größten politischen Kundgebung seit Kriegsende hat er sogar die Chuzpe, für die Show auch noch Eintrittsgeld zu verlangen.
So verwundert es kaum, dass sich danach im Landtag ausgerechnet der jüngste aller nach Mainz entsandten Volksvertreter prompt mit weiteren unkonventionellen Aktionen ins Gerede bringt. Auf einer vom Fraktionschef Wilhelm Boden ausgelegten «Wunschliste» trägt er sich lässig unter dem Stichwort «Haushalts- und Finanzausschuss» ein – in der Parlamentarier-Riege der regierenden Christdemokraten sind das die begehrtesten Posten, bisher nur verdienten Oldtimern vorbehalten. Und als der merklich irritierte Landesvater Peter Altmeier zunächst an ein Missverständnis glaubt, bekräftigt der neue Kollege seine Ambitionen.
Alte Gewohnheiten oder Privilegien sind dem gerade mal neunundzwanzigjährigen Draufgänger ziemlich schnuppe. Er erkennt schnell, dass erschreckend viele der konservativen Abgeordneten schon im Rentenalter oder beklagenswert kriegsversehrt sind, und diesen Zustand will er möglichst bald ändern. Immerhin steht er ja nicht mehr allein auf weiter Flur. Aus den Bezirken Koblenz und Trier haben die wichtigsten Protagonisten der von ihm gebildeten «innerparteilich-oppositionellen Brückenköpfe» ebenfalls den Sprung in den Landtag geschafft.
Ist es die Furcht vor dieser Clique von «Kohlisten», der den amtierenden Ministerpräsidenten zum Einlenken bewegt? Der betagte, «Fischpitter» genannte ehemalige Kaufmann thront seit einer kleinen Ewigkeit in der Manier eines Monarchen über den Niederungen seiner Provinz – und jetzt kriegt ein aufmüpfiger Jungstar seinen Willen! Dass der Novize im Plenarsaal gleichsam zur Strafe die letzte Bank drücken und sich wochenlang noch mit Sonderaufgaben wie der Bearbeitung von Wasser- und Abfallbeseitigungsrichtlinien herumschlagen muss, raubt ihm allenfalls vorübergehend den Nerv.
Dabei hat er durchaus Startschwierigkeiten. Zu Beginn des Jahres 1960 misslingt ihm die Jungfernrede so gründlich, dass sich sogar seine Anhänger peinlich berührt zeigen, während die Altvorderen frohlocken. Seiner Funktion gemäß soll Helmut Kohl den Etat erläutern, aber in einem inhaltlich wie rhetorisch missratenen Potpourri politischer Gemeinplätze warnt er hauptsächlich vor den Gefahren des Rechtsradikalismus und ergeht sich in einem pathetisch formulierten historischen Exkurs. Der vermeintliche Supermann scheint an seine Grenzen gestoßen zu sein.
Und im Herbst kommt es noch ärger. Um in Ludwigshafen endlich der SPD den Garaus zu machen, schlägt er sich dort bei der Kommunalwahl ungeniert als Spitzenkandidat vor und überhebt sich gewaltig. Der Zugewinn zweier Mandate ändert nichts daran, dass die Sozialdemokraten ihre Hochburg locker verteidigen – für den wütend anrennenden Herausforderer eine besonders schmerzliche Erfahrung. Die fixe Idee, in seiner Geburtsstadt die seit dem Kriegsende zementierten Kräfteverhältnisse zugunsten der Union umzukehren, bleibt ein unerfüllter Traum.