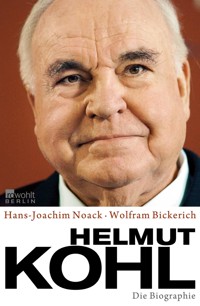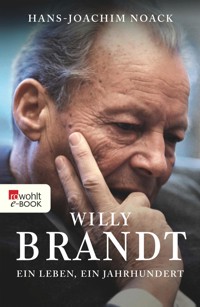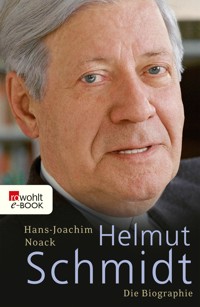
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seine Stimme fand weit über Deutschlands Grenzen hinaus Gehör, sein Urteil als Elder Statesman und moralische Instanz hatte Gewicht. Helmut Schmidt hat Maßstäbe gesetzt wie kaum ein anderer deutscher Politiker der Nachkriegszeit. Aber was hat ihn geprägt? Was trieb ihn unermüdlich an, bis weit ins hohe Alter? Und was bewegte den Menschen hinter dem Mythos? Hans-Joachim Noack, langjähriger Politikchef des «Spiegel» und unter den politischen Journalisten einer der wenigen Vertrauten des Altkanzlers, hat dessen Karriere über Jahrzehnte aus nächster Nähe verfolgt. Ein faszinierendes Lebensporträt – und zugleich eine Zeitreise durch fast ein Jahrhundert deutscher Geschichte. «Helmut Schmidt wird uns allen als ein Mensch in Erinnerung bleiben, der in seltener Einheit ein Mann der Tat, des klaren Gedankens und des offenen Wortes war.» Joachim Gauck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Hans-Joachim Noack
Helmut Schmidt
Die Biographie
Informationen zum Buch
Seine Stimme fand weit über Deutschlands Grenzen hinaus Gehör, sein Urteil als Elder Statesman und moralische Instanz hatte Gewicht. Helmut Schmidt hat Maßstäbe gesetzt wie kaum ein anderer deutscher Politiker der Nachkriegszeit. Aber was hat ihn geprägt? Was trieb ihn unermüdlich an, bis weit ins hohe Alter? Und was bewegte den Menschen hinter dem Mythos? Hans-Joachim Noack, langjähriger Politikchef des «Spiegel» und unter den politischen Journalisten einer der wenigen Vertrauten des Altkanzlers, hat dessen Karriere über Jahrzehnte aus nächster Nähe verfolgt. Ein faszinierendes Lebensporträt – und zugleich eine Zeitreise durch fast ein Jahrhundert deutscher Geschichte.
«Helmut Schmidt wird uns allen als ein Mensch in Erinnerung bleiben, der in seltener Einheit ein Mann der Tat, des klaren Gedankens und des offenen Wortes war.» Joachim Gauck
Informationen zum Autor
Hans-Joachim Noack, geboren 1940 in Berlin, war Reporter der «Süddeutschen Zeitung» und der «Frankfurter Rundschau» und arbeitete lange Jahre für den «Spiegel», zuletzt als Leiter des Politikressorts. Für seine journalistische Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. 2008 erschien die Biographie «Helmut Schmidt», die zum Bestseller wurde.
«Kerl ohne Fisimatenten»: eine Annäherung
Geschichten beginnen häufig mit Zufällen – etwa diese im Mai 1980.Als Kurzurlauber in Rom fand ich in einem Café nur noch an jenem Tisch Platz, auf dem ein Exemplar der «Frankfurter Allgemeinen» lag, das vermutlich Landsleute zurückgelassen hatten. So fiel mein Blick auf einen Artikel des einflussreichen Bonner Hofchronisten Walter Henkels. Der eigentlich den christlichen Parteien zugeneigte Korrespondent lobte darin die allgegenwärtige Siegermentalität des regierenden Sozialdemokraten Helmut Schmidt. Erst kürzlich habe der in kaum einer Stunde eine Reihe von Journalisten im Schach abgebügelt.
Ich arbeitete damals in Frankfurt bei der «Rundschau» und galt dort zu Recht als Spieler; also war das eine aufregende Information. Dass den in der Bundeshauptstadt akkreditierten Kollegen solche Chancen geboten wurden, ließ mir keine Ruhe. Wahrscheinlich seien ihm da einige lausige Amateure über den Weg gelaufen, raunte ich dem Kanzler bei der ersten Gelegenheit mutig ins Ohr.
Meine Begegnungen mit Helmut Schmidt hatten mir bis dahin wenig Ruhm eingetragen. Im Winter 1978 war ich von ihm empfangen worden, um als politischer Reporter über den schwierigen Amtsalltag des Chefs der sozial-liberalen Koalition zu schreiben – eine ziemliche Blamage. Ich wollte ihm bescheinigen, in vielerlei Hinsicht skrupulöser zu sein, als es seinem öffentlichen Image entsprach. In der noch weitgehend unkorrigierten Deutschland-Auflage der «FR» tauchte aus unerfindlichen Gründen das befremdliche Adjektiv skrupelloser auf.
Der Kanzler war «not amused», wie mir sein zerknirschter Adlatus und Regierungssprecher Klaus Bölling ausrichtete, weshalb ich nun offenkundig dafür büßen musste. Ob ich mir einbildete, «mehr draufzuhaben als andere», fragte Schmidt nach meiner flapsig intonierten Herausforderung am Rande einer Pressekonferenz gallig zurück und zeigte mir dann ungnädig die kalte Schulter. Passé schien der schöne Journalistentraum, eine der Schlüsselfiguren im Lande als Schachpartner ködern zu können.
Aber ich täuschte mich. Ein volles Vierteljahr später meldete sich an einem fortgeschrittenen Sonntagabend eine Bonner Stallwache am Telefon. Der Bundeskanzler, wurde mir mitgeteilt, habe mein Erscheinen «zum vereinbarten Match» für den folgenden Nachmittag, 14Uhr, in seinem Feriendomizil am schleswig-holsteinischen Brahmsee «vorgemerkt». Ich möge wegen der dort herrschenden strengen Sicherheitsmaßnahmen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass nicht vergessen.
So traf ich ihn anderntags in seinem bescheidenen Anwesen, einer am Rande der Gemeinde Langwedel gelegenen ehemaligen Wehrmachtsbaracke. Der Gastgeber, der mich leger in Shorts und Ringelhemd begrüßte, erwies sich als angenehm unprätentiös. Er bat höflich um Verständnis dafür, dass im Garten mit Schnellfeuergewehren bewaffnete Grenzschutzbeamte Patrouille liefen, und führte mir dann nicht ohne Besitzerstolz das zum Teil von ihm selbst restaurierte «lütt Hus» vor. Am Ende durfte ich sogar ins eheliche Schlafzimmer sehen, wo in akkurat glattgestrichenen Betten sein blauweiß gestreifter Pyjama neben dem altrosa gerüschten Nachthemd von Frau Loki lag.
Es war ein bisschen wie bei Schmidts aus der Nachbarschaft: behütete grüne Idylle im deutschen Winkel und ein sichtlich entspannter Kanzler. Am Schachbrett bevorzugte er lustvoll einen auf möglichst raschen Figurenabtausch bedachten rustikalen Stil und freute sich diebisch, als ich ausgerechnet die für mich interessanteste Partie verlor. Die hatte ich mit seiner Einwilligung mitgeschrieben, um mir die Notation anschließend signieren zu lassen, worauf er nun grinsend bestand.
Es wurde trotzdem ein denkwürdiger Tag, von dem ich auch in meinem Job profitierte. Wir spielten danach immer mal wieder – etwa im Herbst 1980 während des Wahlkampfs gegen Franz Josef Strauß in seinem Sonderzug oder bei längeren Überseeflügen–, und nicht selten folgte dem exklusiven Vergnügen eine umfängliche politische Tour d’Horizon. Die bescherte mir stets einige verwertbare Details oder zumindest sachkundige Einschätzungen der jeweiligen Lage.
Das erste Interview, das ich mit Helmut Schmidt führen konnte, hatte in der Zeit der Großen Koalition stattgefunden, es sollte über Jahre hinweg mein Bild von ihm prägen. Im Kern teilte ich, was den Fraktionschef der SPD betraf, die Skepsis der «Achtundsechziger». Vor allem dass der alerte Genosse die heißumstrittenen Notstandsgesetze durchpaukte, hielt ich empört für einen obrigkeitsstaatlichen Amoklauf, und als er am 16.Mai 1974 gar den in meinen Kreisen angehimmelten Kanzler Willy Brandt ablöste, war das für unsereins fast wie ein Volkstrauertag.
Andererseits gab es aber auch Seiten an ihm, die mir früh imponierten. Die zupackende Art, mit der sich der damalige Hamburger Innensenator 1962 gegen die verheerende Flutkatastrophe in seiner Heimatstadt stemmte, beeindruckte mich ebenso wie sein ein Jahr vorher – noch als Bundestagsabgeordneter – publizierter Essay über «Verteidigung oder Vergeltung», eine militärstrategische Analyse des zunehmend maroden Ost-West-Verhältnisses.
Ich bewunderte fortan seine Fähigkeit, sich in außerordentliche Problemstellungen hineinzudenken, aber meine moralischen Vorbehalte legten sich erst im sogenannten Deutschen Herbst. Wie er in der schwierigsten Zeit seiner Kanzlerschaft 1977 beim Kampf gegen den Terror der «Roten-Armee-Fraktion» leise einräumte, selber Schuld auf sich geladen zu haben, als er den entführten Wirtschaftsmagnaten Hanns Martin Schleyer opferte, bewies mir sein Format. Helmut Schmidt, nach seinem Triumph über die RAF bald «Held von Mogadischu», war offenbar weit mehr als nur der vielzitierte «Macher».
Und der Besuch Anfang August 1980 am Brahmsee bewirkte ein Übriges. Es schmeichelte mir, dass mich der Hausherr, der das Gros der ihn umschwirrenden Korrespondenten manchmal rüde mit «Wegelagerern» verglich, erstaunlich zuvorkommend behandelte. Bei meinem ersten Privatissimum wie bei allen anderen, die er mir in den folgenden mehr als zweieinhalb Jahrzehnten gewährte, ließ er von der ursprünglich befürchteten arroganten Unnahbarkeit wenig spüren.
Ganz im Gegenteil: Sein properes Selbstwertgefühl machte die journalistische Arbeit mit ihm immer unkompliziert. Als Mann der klaren Worte gehörte er nie zu jener Kategorie von Politikern, die vor Interviews off the record, also unter der Hand, munter drauflosschwadronieren, um dann bei der Durchsicht der Druckfassung ihrer Texte bänglich die Pointen zu tilgen. Was er meinte sagen zu müssen, galt in aller Regel als gesagt, und so ähnlich präsentierte er sich auch, als ich ihn bat, mir bei seiner Rückschau auf sein bewegtes Leben Rede und Antwort zu stehen.
Geriet er in Wallung, langte er wie eh und je kräftig hin. Dass der vormalige Kanzler ein «prima Elder Statesman» geworden sei, «leider nur das gelegentliche Herumsauen nicht lassen» wolle, hatte mir noch in seinem Todesjahr 1992 der SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt bestätigt – was Schmidt nun ungerührt unterstrich. Mit Vertretern konkurrierender Parteien sprang er dabei meistens weniger ruppig um als mit den eigenen Leuten. «Lieblingsgenossen» wie Erhard Eppler, Egon Bahr oder Horst Ehmke lieferten mir bei begleitenden Recherchen einige deftige Kostproben.
Auffällig war, wie selten der zweite sozialdemokratische Regierungschef einmal von ihm gefällte Urteile über Menschen oder Sachverhalte aus der zeitlichen Distanz abschwächte. Er verstärkte sie eher noch. Verbiestert nannte er etwa den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter «einen Schimmerlos vom Anfang bis zum Ende», um danach seine Freunde, vorweg das später ermordete ägyptische Staatsoberhaupt Anwar as-Sadat, warmherzig zu umgarnen. «Ich habe diesen Kerl geliebt», verriet er mir mehrmals und schwärmte wie ein jugendlicher Pfadfinder von gemeinsamen nächtlichen Bootsfahrten auf dem Nil. «Unter prächtigem Sternenhimmel» sei ihm da ein grundlegend neues, Juden, Christen und Moslems umschließendes holistisches Weltbild vermittelt worden.
In solchen Augenblicken durfte ich einem sehr viel empfindsameren Helmut Schmidt zuhören, als mir bis dahin bekannt war. Andererseits überwog, wie in seinem Metier üblich, auch bei ihm die Kunst, kühl kalkuliert nur jenen Teil der eigenen Identität abzuspalten, den er der Allgemeinheit preiszugeben gedachte. Fragen, die ihm signalisierten, dass sie sein Innenleben allzu sehr einzukreisen versuchten, wies er manchmal grantig zurück.
Reflektierte Gespräche: ja – aber bloß keine Psychoanalyse! Sich vor irgendwelchen «Seelenklempnern» rechtfertigen zu müssen, erzeugte in Schmidt eine eisige Abwehrbereitschaft, die er lapidar mit seiner angeblich «schlichten Bauart» begründete: Zu einer qualvollen oder auf eitle Verbrämung hinauslaufenden Introspektion, mokierte er sich, fehle ihm «einfach das Gen».
Man sollte ihm glauben, dass er deshalb auch konsequent davon absah, einer unter Spitzenpolitikern verbreiteten Verlockung zu erliegen. Wie seine Kanzler-Kollegen von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder mit den obligaten Selbstzeugnissen auf den Markt zu kommen, erschien ihm nicht nur als überflüssig, sondern historisch untaugliches Mittel. Autobiographen, belehrte er mich, ähnelten Männern bei der täglichen Nassrasur: «Die sind ständig in der Gefahr, sich zu schneiden, und möchten doch nur gut aussehen.»
Aber galt das nicht auch für ihn? In Wahrheit hatte er öfter zur Feder (oder genauer, zu einem seiner weichen Bleistifte) gegriffen als jeder andere Regierungschef der Bonner Nachkriegsrepublik. Auf «an die fünfundzwanzig Bücher» schätzte Schmidt bereits kurz vor dem 80.Geburtstag seinen gewaltigen Output, und in vielen, vor allem in einigen, die im Jahrzehnt danach dazukamen, befasste sich der Autor ausführlich mit seinem öffentlichen und privaten Leben.
Memoiren auf Raten, die erkennbar der Selbstvergewisserung dienten und natürlich das eigene Gewicht in der Welt nicht aussparten. Zugleich beharrte er aber auch in allen Gesprächen darauf, man möge ihm abnehmen, wie wenig Gedanken er sich darüber mache, in die Geschichtsbücher einzugehen. Was die Historiker letztlich mit seiner Person anfingen, sei ihm «völlig wurscht», schickte er unwirsch hinterher. Insbesondere habe er sich nie danach gedrängt, Regierungschef zu werden.
In Wirklichkeit begann der immens mitteilungsfreudige Workaholic schon früh damit, Schriftstücke jeglicher Art für die Nachgeborenen einzusammeln. Am Ende seiner Dienstzeit stapelten sich sowohl in der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn als auch daheim im Hamburger Stadtteil Langenhorn einige hundert laufende Meter Akten: ein künftiges Helmut-Schmidt-Archiv. Das Material soll nach seinem Ableben der Wissenschaft dienen.
Denn zu allen Zeiten war ihm daran gelegen, den Deutschen in guter Erinnerung zu bleiben. Einer seiner engsten Kombattanten, der ehemalige Finanz- und Verteidigungsminister Hans Apel, erzählte mir von einer bezeichnenden Begegnung mit dem einstigen Chef: Wie es um seine Chancen «als historische Figur» stehe, wollte der Ex-Kanzler erfragen, und er, der für seine Schnodderigkeit bekannte einstige Kronprinz, habe «idiotischerweise» geantwortet, «fürs Geschichtsbuch» werde es kaum reichen. Ein Lapsus, der ihre Freundschaft merklich eintrübte.
Dabei hatte Apel nur bekräftigen wollen, was der Realist Schmidt nicht anders sah: Große Kanzler benötigen große Themen – und als er das Zepter übernahm, waren mit Konrad Adenauers Westintegration und Willy Brandts Ostpolitik die entscheidenden Weichenstellungen in der Erfolgsstory der Bundesrepublik längst vollzogen. Die deutsche Einheit unter der Schirmherrschaft Helmut Kohls lag da noch in weiter Ferne.
Durfte er, der sich in hanseatischem Understatement einmal zum «leitenden Angestellten» des Bonner Teilstaats reduzierte, nicht ein bisschen neidisch darauf sein? Das «Glück eines epochalen Auftrags», ließ Schmidt zuweilen leicht elegisch einfließen, sei ihm nie beschieden gewesen. Der wohl sachkundigste und mit den besten Voraussetzungen ausgestattete Kanzler musste mit einer vergleichsweise unspektakulären Zeit des Übergangs vorliebnehmen.
Die erlegte dem im Ausland als «Weltökonom» gefeierten Deutschen auf, sich anstelle wegweisender Reformen dem Problemkatalog jener Jahre, vor allem der nach dem Ölpreisschock steigenden Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung zu widmen, was ihm nur zum Teil gelang. Dass er dabei der Bundesrepublik im internationalen Maßstab immer noch einen beachtlichen Rang sicherte, war ihm nur ein schwacher Trost.
Der vor Ehrgeiz lodernde Krisenmanager empfand sich zu Hause als chronisch unterschätzt, ein Gefühl, das ihn nie ganz verließ. Hatte nicht auch er – neben dem Kampf gegen den Terror der RAF und seiner unermüdlichen Bereitschaft, gemeinsam mit den Franzosen die Einigung Europas voranzutreiben–, zumindest eine strategische Meisterleistung vollbracht? Sooft es um die Highlights seiner achtjährigen Kanzlerschaft ging, war es Schmidt spürbar ein Anliegen, den von ihm initiierten und den USA aufgedrängten «Nato-Doppelbeschluss» gewürdigt zu wissen.
Sein Beharren darauf, die von Moskau gegen Westeuropa gerichteten SS-20-Raketen gegebenenfalls mit amerikanischen Pershings zu kontern, trieb Ende der Siebziger nicht nur eine gewaltige Friedensbewegung auf die Straßen. Die Entscheidung trennte ihn peu à peu auch von der Mehrheit seiner Genossen, die ihm so offenkundig widerstrebend folgten, dass sie der ohnehin schon schwankenden FDP den Vorwand lieferten, seinen Sturz zu riskieren. Erst Helmut Kohl verfügte über die nötige Unterstützung, das gefährliche Planspiel durchzusetzen. Der eigentliche Urheber war noch kläglich gescheitert.
Aber gab ihm der weitere Verlauf der Geschichte dann nicht auf glorreiche Weise recht? Er könne sich «vorstellen», presste Schmidt einmal zwischen den Zähnen hervor, dass, wenn er noch lebte, selbst der zu den Nachrüstungsgegnern «übergelaufene» Brandt im Lichte der globalen Folgen des Beschlusses seine Meinung geändert hätte.
Am Streit in dieser Frage lag es allerdings nicht allein, dass sich die Beziehungen des fünften Bonner Regenten zum vierten wie ein roter Faden durch seine Retrospektive zogen. Während ihm etwa zu Herbert Wehner, dem schwer durchschaubaren dritten Mann in der SPD-Troika, kaum ein abträgliches Wort über die Lippen kam, trieb ihn der Parteivorsitzende offenkundig um. Mal hielt Schmidt sich zugute, er habe schon an einer Ostpolitik gearbeitet, als «der frühere Berliner Bürgermeister noch in seiner Stadt zu den Kalten Kriegern zählte». Mal warf er ihm «Wankelmut» oder «Feigheit vor Freunden» vor, um dann im selben Atemzug seine «phänomenale Ausstrahlungskraft» zu bewundern.
Schwang da ein Hauch von Missgunst mit, wenn er sich gleichzeitig darauf versteifte, er habe den von Brandt erzeugten «Wärmestrom» weder kopieren noch mit ihm konkurrieren wollen? Von den Menschen respektiert zu werden, begründete er einmal unvermittelt heftig, sei für ihn «immer vollauf ausreichend gewesen – mich musste keiner lieben».
Also blieb er bei seinem Leisten – ein jenseits aller Moden und Trends an harten Fakten sich orientierender Aufsteiger, der sich im Kern seines Wesens dem ordentlichen und strebsamen Durchschnittsdeutschen, vor allem dem «Facharbeiter» und mit ihm der klassischen «Mitte» der Gesellschaft, verwandt fühlte. Und die dankte es ihm: Noch 1993, elf Jahre nach seinem von Liberalen und SPD-Linken erzwungenen Abgang, wünschten sich annähernd zwei Drittel der befragten Landsleute sein Comeback.
Brach da in den Wirren der Wende die Sehnsucht nach einem Politiker auf, der schon den Bürgern in der Bonner Republik «gerne mal in den Hintern getreten, dafür aber hochkompetent den Laden zusammengehalten hatte»? So sah es selbst Egon Bahr, der sich oft als Kritiker des Ex-Kanzlers profilierte. Und einige Monate lang schien sich für Helmut Schmidt, inzwischen Mitherausgeber der Hamburger Wochenzeitung «Die Zeit», tatsächlich die Chance zu bieten, doch noch den «epochalen Auftrag» zu ergattern. Es gab deutliche Hinweise darauf, dass er ernsthaft darüber nachdachte, es noch einmal zu versuchen. Aber seine SPD hüllte sich vielsagend in Schweigen.
Den «Willy-Brandt-Enkeln», die in den frühen Neunzigern auf dem Sprung standen, steckten nicht nur die zahllosen Kräche mit dem fast 75-jährigen Spitzengenossen in den Knochen – sie entsannen sich auch eines ewig umhergeisternden geflügelten Wortes, das sie wie kaum ein zweites als fortdauernde Kränkung empfanden: Helmut Schmidt, so hatten vor allem Sympathisanten der Konservativen unter das Volk gestreut, sei «der richtige Mann in der falschen Partei». Und der Veteran wich zurück. Angesichts seines Alters, ließ er die Fans in einer schriftlich verbreiteten sibyllinischen Botschaft wissen, verbiete sich eine Kandidatur.
Wie er öfter auf Gedächtnislücken verwies, wenn ihn Fragen verdrossen, war ihm dieser Vorgang, als wir uns darüber Jahre später unterhielten, angeblich entfallen. Dass er je einen neuen Anlauf im Schilde führte, entrüstete sich der Staatsmann a. D. mit gespieltem Ingrimm, sei «gewiss ein ebenso großer Quatsch» wie die ihm angedichtete Nähe zu anderen politischen Gruppierungen: Da habe man ihm «listig ein klassisches Danaer-Geschenk ins Nest gelegt – büsch’n vergiftet, will ich mal sagen».
Aber dann entspannten sich seine Züge. Im Übrigen, korrigierte sich Helmut Schmidt, während er sein immer noch vitales Raubtierlächeln vorführte, sei da «durchaus was dran». Wer ihm auf solche Weise habe bescheinigen wollen, dass er eine parteiübergreifende Vernunft verkörpere, werde von ihm nicht gescholten: «Ich sah mich nie als einen Kanzler der SPD.»
Vermutlich erklärt dies auch seine anhaltende Popularität. Keiner seiner Vorgänger und Nachfolger wurde so sehr von Wählern favorisiert, die zu den jeweils regierenden Farben in Opposition standen, wie der eigenwillige «Sozi» aus Hamburg. Der wiederum achtete sorgsam darauf, das gebräuchliche Genossen-Kürzel auf die ihm genehme Art zu übersetzen: Sozialdemokrat zu sein, hieß für ihn nicht, «irgendwelchen ideologisch überhöhten Spinnereien» anzuhängen, sondern sich schlicht als sozialer Demokrat zu bewähren.
Und ein zweiter Grund dafür, dass sich vor allem das bürgerliche Lager weit über seine Amtszeit hinaus mit ihm identifizierte, lag in seiner Vita. Wie bei kaum einer anderen öffentlichen Figur spiegelt die Biographie Helmut Schmidts, der unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs geboren wurde, die Höhen und Tiefen deutscher Geschichte: Der Junge erlebte «Weimar», der junge Mann sowohl den NS-Staat als auch die Auferstehung aus Trümmern – und als die Bundesrepublik erwachsen wurde, stand er ihr in einer Phase ökonomisch und technologisch bedeutsamer Umbrüche als Regierungschef vor.
So verdichtet sich die Entwicklungsgeschichte des Landes in der Entwicklungsgeschichte einer Person: Im «Dritten Reich» die fatale Verführbarkeit und danach eine emsige Bereitschaft, die Demokratie erlernen zu wollen; später ein weltweit gerühmter wirtschaftlicher Erfolg, aber auch die Neigung, die Vergangenheit so zu bewältigen, dass sie das prosperierende Gemeinwesen nicht lähmte. Und schließlich, als Ergebnis langjährigen Wohlverhaltens, die Rückgewinnung uneingeschränkter staatlicher Souveränität, die den Deutschen allerdings erst nach Schmidts Ära gelang.
Immerhin darf er noch erleben, wie «normal» sie mittlerweile geworden sind – «beinahe normal», schränkt der Publizist in einer Wolke von Mentholzigaretten-Qualm grübelnd ein, als ich ihn im Hamburger Herausgeber-Büro besuche, um mit ihm über seinen Anteil daran zu sprechen. Hatte der einst Lotse genannte rote Realo mit der obligatorischen Prinz-Heinrich-Mütze nicht in einer tückischen «Zwischenzeit» Mitte und Maß vorgegeben?
Ich will mit ihm über einen Satz Hans Apels reden, von dem er kurz zuvor als «Kerl ohne Fisimatenten und Inbegriff deutschen Wiederaufstiegs» gepriesen wurde – doch den seit Jahren fast tauben Altkanzler plagen die Geräusche eines über das Verlagsgebäude hinwegziehenden Flugzeugs, die sich wie detonierend in seinem Hörgerät brechen.
Er bittet mich, erst einmal das Fenster zuzumachen. Dann kommt er zur Sache.
Erstes Kapitel
«Weil ich ein Held sein wollte»: Jugend und Soldatenzeit
Als er am 23.Dezember 1918 geboren wird, vollzieht sich im schwer erschütterten Deutschen Reich gerade der große Epochenbruch. Vielerorts herrschen chaotische Zustände. In Hamburg kontrolliert an diesem Tag vor Weihnachten, während im roten Stadtteil Barmbek der Lehrer Gustav Schmidt und seine Ehefrau Ludovika ihr Söhnchen mit Namen Helmut Heinrich Waldemar im Arm halten, ein provisorischer Arbeiter- und Soldatenrat den Senat und die Bürgerschaft. Es ist die siebente Woche nach dem Ende des verlorenen Ersten Weltkrieges.
Der Vater, ein strebsamer ehemaliger Anwaltsgehilfe, dem noch vor seiner Dienstverpflichtung in einem preußischen Infanterieregiment die Umschulung zum Pädagogen gelang, interessiert sich für den tiefgreifenden Wandel nur mäßig. An der Front früh verwundet, hat er den Ruin der kaiserlichen Truppen im vergleichsweise beschaulichen Garnisonsstandort Schleswig verfolgt und widmet sich nun verstärkt seinem eigenen Fortkommen. In der «Weimarer Republik», die im Februar 1919 gegründet wird, absolviert er ein Abendstudium als Diplom-Handelslehrer, avanciert zum Studienrat und übernimmt danach sogar die Leitung einer Schule.
Für einen Mann, der sich aus ärmlichen Verhältnissen hocharbeiten musste, ist das eine erstaunliche Karriere. Immerhin hatte dessen Vater, der im Kreise der Familie allseits so genannte Opa Schmidt, noch als halber Analphabet und «unständiger» Stauer im Hamburger Hafen von Gelegenheitseinsätzen gelebt. Sooft in den siebziger Jahren der zweite sozialdemokratische Kanzler der Nachkriegsrepublik porträtiert wird, findet sich dieses bemerkenswerte Detail in besonders pointierter Form wieder. Es soll dazu dienen, die geradezu bilderbuchhaften proletarischen Wurzeln des prominenten Enkels zu belegen.
Der im Dreikaiserjahr 1888 geborene Gustav Schmidt wäre wohl kaum so erfolgreich gewesen, hätte er seinen Fleiß nicht mit äußerster Strenge verbunden. Seine Sprösslinge, der anfänglich etwas zart besaitete Helmut wie der 1921 zur Welt gekommene Bruder Walter, werden deshalb noch stramm nach den Denk- und Verhaltensmustern erzogen, die die wilhelminische Ära bestimmten.
Sowenig ihn die politischen Umwälzungen kümmern, so entschieden bleibt der Familienvorstand dem in den Zeiten der Monarchie gewachsenen gesellschaftlichen Komment verhaftet. Was ein «richtiger Hamburger Jung» sein will, hat natürlich die Tränen zurückzuhalten. «Do lach ick öber», ruft der auf Härte und Selbstdisziplin pochende Schulmeister, wenn sich die beiden Söhne beim Spielen blutige Schrammen holen. Während die sanftmütige Frau Ludovika solche Methoden stillschweigend hinnimmt, ahndet er Verstöße gegen die zahllosen Verbote nicht selten mit dem Rohrstock.
Er habe eine rundum «kleinbürgerliche Kindheit» verlebt, erinnert sich der Elder Statesman Helmut Schmidt – zugleich aber auch eine schöne, die er in erster Linie seiner Verwandtschaft mütterlicherseits verdankt. Denn dieser Zweig, die zum Teil aus Rheinhessen stammende, musisch begabte Familie Koch, legt auf Geselligkeit und Gemeinschaft großen Wert. Sie versammelt sich regelmäßig zu beschwingten Liederabenden, spendiert ihm Klavierunterricht und fördert seinen Hang zur zeitgenössischen Malerei. Einen starken Eindruck hinterlässt vor allem der Großvater, der als gelernter Schriftsetzer und Drucker einer selbstbewussten Arbeiter-Aristokratie angehört. Der schafft mit dem Erwerb eines Weißwäsche- und Kurzwarenladens am Mundsburger Damm den Sprung in den Mittelstand. Zu seinen Gesprächspartnern zählt sogar der Vorsitzende der Deutschen Demokratischen Partei, Friedrich Naumann.
Dem quicken Helmut, der seiner manchmal nervenden Redseligkeit wegen als «Schnackfass» gehänselt wird, prägen sich die auffälligen Milieuunterschiede von klein auf ein: Hier der Vater des Vaters, der sich in Barmbek in einer schäbigen Kate mit aushäusigem Plumpsklo verschanzt hat – und dort der Respekt gebietende, aber leider häufig aufbrausende und deshalb für die Enkel nur schwer zugängliche Opa Heinrich Koch! Ihn ausgenommen, bleibt ihm die «ganze Sippe» als weitgehend «apolitisch, vielleicht sogar antipolitisch» im Gedächtnis.
Dabei beschäftigen ihn schon früh einige Fragen, die um eine noch diffuse «Gerechtigkeitsvorstellung» kreisen. Weshalb geht es den einen so viel schlechter als den anderen? Warum muss zum Beispiel die fünfköpfige Familie seiner Mitschülerin Hannelore («Loki») Glaser im Stadtteil Borgfelde auf 28Quadratmetern hausen? Das würde der damals zehnjährige, über diesen Zustand «entsetzte» Helmut gerne erklärt haben, doch gegenüber seinem bis zum Stehkragen zugeknöpften Vater behält er solche aufwühlenden Erfahrungen lieber für sich.
Und ebenso wenig kommen daheim die gravierenden politischen Umbrüche zur Sprache. Der Lehrer schottet sich ab und verlangt das auch von den Seinen. «Kinder», lautet eine der kruden Maximen, «lesen keine Zeitung.» Kann es da verwundern, wenn sich der im Kern seines Wesens wissbegierige ältere Sohn der «Weimarer Verhältnisse» nur in vagen Umrissen entsinnt? Aus der Endzeit der ersten deutschen Republik vermag er sich immerhin an die Schießereien zwischen Kommunisten und SA-Leuten zu erinnern, als am berüchtigten «Altonaer Blutsonntag» im Sommer 1932 siebzehn Menschen sterben.
Andererseits ist der Studienrat Gustav Schmidt nicht nur ein engstirniger Patriarch, der an überkommenen Grundsätzen festhält. Weil ihm für die Sprösslinge die beste Bildung gerade gut genug erscheint, schickt er sie statt aufs Gymnasium in eine jener avantgardistischen Lehranstalten, die sich seit den frühen Zwanzigern einer konsequenten Reformpädagogik verschrieben haben. Als der erste Versuch scheitert, im Reich einen parlamentarisch verankerten Rechtsstaat zu etablieren, besucht der spätere Kanzler bereits die renommierte, nach einem vormaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle benannte Alfred-Lichtwark-Schule.
Die hat sich zum Ziel gesetzt, die alten Hierarchien abzuschaffen, betont die musischen Fächer deutlich stärker als den naturwissenschaftlichen Sektor und pflegt die damals noch seltene «Koedukation». Jungen und Mädchen sollen zum weitgehend selbständigen Arbeiten erzogen und zu freier Entfaltung ermuntert werden – alles Prinzipien, die den aufgeweckten Helmut enorm beflügeln. Er wird ein Leben lang kaum eine Gelegenheit auslassen, seinen Lehrern dafür zu danken.
Bereits als Dreizehnjähriger traut er sich so, nach einem Ausflug ins Weserbergland detailliert über die Renaissancebauten in Hameln zu schreiben oder danach die wichtigsten Nordseehäfen einer vergleichenden Analyse zu unterziehen. Er macht als fleißiger Chorsänger von sich reden, spielt mit Freuden Klavier oder schwärmt vom Poeten Ringelnatz wie von Brechts «Dreigroschenoper».
Für den deutlichsten Schub in seiner Entwicklung sorgt indessen die gleichaltrige Loki, Tochter eines arbeitslosen Elektrikers, die in der Klasse vor allem durch ihre Furchtlosigkeit beeindruckt. Bis in die Teenagerjahre hinein überragt sie die meisten Jungs nicht nur um Haupteslänge, sondern geht im Konfliktfall– Spitzname «Schmeling» – auch keiner Keilerei aus dem Wege. Um ihr zu imponieren, trainiert der körperlich zunächst etwas zurückgebliebene «Schmiddel» beim Rudern und Segeln auf der Außenalster oder bei den üblichen Radtouren zäh seine Muskulatur und profiliert sich darüber hinaus als prima Kumpel.
Nur was sonst um ihn herum geschieht, scheint ihn kaum zu kümmern. Als sich die «Weimarer Republik» der NS-Diktatur ausliefert und die braunen Horden durch die Straßen zu ziehen beginnen, so wird es Helmut Schmidt später immer wieder betonen, seien ihm die «altersbedingten Betätigungsfelder» weitaus wichtiger gewesen, als angestrengt über die großen Fragen der Welt zu grübeln. Außer von Fußball, Malerei und Mädchen habe er «keine Vorstellung von irgendetwas» gehabt.
Und wie in seiner patriotisch gesinnten Familie die Machtergreifung Adolf Hitlers allenfalls leise Beunruhigung hervorruft, misst auch er diesem Ereignis eine eher untergeordnete Bedeutung zu. «Aus der Rückschau betrachtet, hätte ich damals durchaus dem Zeitgeist erliegen und wenigstens anfänglich ein kleiner Nazi werden können», gesteht der Altkanzler in einem 1992 publizierten «Politischen Rückblick auf eine unpolitische Jugend», in dem er sich mit seinen Erfahrungen im «Dritten Reich» beschäftigt.
Unverblümt erzählt der pensionierte Staatsmann sogar, wie er als Schüler den sehnlichen Wunsch gehabt hat, in die Hitlerjugend eintreten zu dürfen, in der sich nach der Gleichschaltung der Pfadfinder, Freischar- oder Wandervogel-Bünde die meisten seiner Freunde vergnügen. Der umtriebige Helmut, der liebend gerne «auf Fahrt» geht und begeistert von der «Romantik des Lagerfeuers» schwärmt, fühlt sich da fast ein bisschen ausgeschlossen.
Denn die Eltern sperren sich. Nach deren Verhaltensnormen müssen Verbote Kindern nicht näher erläutert werden, aber als der Sohn insistiert, vertraut ihm die Mutter ein ängstlich gehütetes – und inzwischen auch brandgefährliches – Geheimnis an: Der Hafenarbeiter Opa Schmidt, verrät sie ihm, ist in Wirklichkeit nur der Ziehvater seines Vaters, der leibliche ein seit langem aus Hamburg verschwundener jüdischer Bankier namens Ludwig Gumpel.
Ihren Sohn aus Gründen der Camouflage umso eifriger in des «Führers» Jungmännerriege zu schleusen, kommt für die Eltern nicht in Frage, und dass der Vater im Falle der Aufdeckung seiner wahren Herkunft unweigerlich mit der Zerstörung der beruflichen Existenz würde bezahlen müssen, erschreckt auch den enttäuschten Helmut. Also vergräbt er die Nachricht in seinem Herzen. Im Übrigen hat er vor dem Vater noch so viel Bammel, dass er bis in die Kriegstage hinein kein einziges Wort mit ihm darüber wechselt.
In die Hitlerjugend gerät er dann doch noch, weil der zunehmend durchorganisierte NS-Staat den Ruderverein seiner Schule, dem er inzwischen als Kapitän vorsteht, kurzerhand der Marine-HJ einverleibt. Von da ab trägt er sogar den Titel eines Kameradschaftsführers, aber die große Leidenschaft scheint erloschen. Seit der Offenbarung der Mutter, so drückt es der Publizist fast sechzig Jahre danach in seinem Essay aus, habe er «innerlich» nicht mehr Nazi werden können.
So umständlich bemüht diese Erklärung auf den ersten Blick wirken mag, so präzise beschreibt sie den Zwiespalt, in dem er sich nun einzunisten beginnt. In seiner Parallelklasse beobachtet er einige «Abgänge»: Beliebte Lehrer müssen plötzlich ihren Dienst quittieren, und immer öfter verschwinden dort Freunde, deren Familien, wie man sich erzählt, ihre «Auswanderung» vorbereiten; vermutlich alles Juden. Dass sich die Betroffenen «bedrängt» fühlen, nachdem die öffentliche Diffamierung deutlich zunimmt, kann er sehr wohl verstehen.
Aber welche Schlüsse soll er daraus ziehen? Ihm dämmert, dass den neuen Herren, sofern man durch ihr politisches oder ideologisches Raster fällt, Leib und Leben nur wenig wert sind – doch zugleich begeistern ihn auch noch die Gemeinsinn und andere hehre Ziele vorgaukelnden Rituale der neuen Volksgenossenschaft. Und in seinem Umfeld findet sich niemand, der den faulen Zauber entlarvt.
«Denn schließlich», gibt Schmidt als Erwachsener zu bedenken, «hatte es unsereins mit Schulfreunden zu tun, deren Eltern Fischhöker auf der Fuhlsbütteler Straße waren», im Wesentlichen also mit uninformierten und einer permanenten Berieselung ausgelieferten Leuten. Von denen den nötigen Überblick zu verlangen, hält er noch heute für ziemlich abwegig, und überdies räumt er ein, er selber habe bis 1937 – das Jahr, in dem er sein vorgezogenes Abitur macht, weil das Regime dringend Soldaten braucht – «einzelnen NS-Ideen» durchaus nahegestanden. Er meint damit, ohne konkrete Beispiele anzuführen, das im Nazistaat angeblich verfochtene «quasi-sozialistische Moment».
In der Lebenswelt des jungen Mannes haben solche Versuche, dem Regime wenigstens einige positive Aspekte abzugewinnen, durchaus eine Rolle gespielt. Sosehr ihn die Misere mit dem jüdischen Opa zuweilen bedrückt, so empfänglich zeigt er sich für verlockende Angebote, die ihm und den Altersgenossen – wie er es in seinem «Rückblick» ziemlich kryptisch formuliert – eine «funktionale Erziehung zu Kameradschaft und Gemeinschaft» ermöglichen. Zum Programm der liberalen Lichtwark-Schule seien ihm insofern nur geringe Unterschiede aufgefallen.
Und er nutzt die Chancen. Als Scharführer leitet er im Stadtteil Eimsbüttel Heimatabende, auf denen mit Inbrunst deutsches Liedgut geschmettert wird, während zwischendurch eine Art Basisschulung stattfindet. In den Sommerlagern seiner Organisation missfällt ihm zwar der unbequeme Kasernenhof-Drill, doch er kann dort auch Sportprüfungen ablegen, etwa die begehrten Segelscheine erwerben. Im Olympiajahr 1936 nimmt er an einem landesweiten «Hitlermarsch» zum Nürnberger Parteitag teil, der ihm allerdings weniger behagt, weil er dort seine geschlossen antretende Marine-HJ als bloße «Kulisse» zweckentfremdet sieht.
Folglich eckt er zuweilen auch an und verbreitet «mit Kodderschnauze» über seinen obersten Chef, den «Reichsjugendführer» Baldur von Schirach, einige Anzüglichkeiten. Als es darum geht, den ihm zur Verfügung gestellten Saal für die Veranstaltungen in Hamburg zu renovieren, pinselt der zur Renitenz neigende Schmidt über die frisch gestrichenen Wände kühn einen Slogan, dessen Text er scheinbar blauäugig einem Liederbuch entnimmt: «Freiheit ist das Feuer, ist der helle Schein/solang’ sie noch lodert, ist die Welt nicht klein», steht da einen Abend lang in flammend roter Schrift auf weißem Untergrund.
Seine Vorgesetzten beantworten die Provokation mit dem sofortigen Rausschmiss, ein abrupter Karriereknick, den er sich wohl eher aus Übermut eingebrockt hat. Immerhin will er Architekt werden, und die von ihm abgelieferten schulischen Leistungen rechtfertigen solche Ambitionen. Ohne großen Aufwand macht er drei Monate später sein Notabitur mit guten bis sehr guten Zensuren. Als «tadellos» bewerten die Lehrer sein sicheres «eigenes Urteil», die stets wache Mitarbeit und sein solidarisches Verhalten.
Selbstverständlich ist dieses Zeugnis keineswegs, denn die Schule am Rande des Hamburger Stadtparks, die die NS-Behörden von Beginn an als «kommunistischen Saustall» attackieren, wird mit seinem Jahrgang geschlossen – aber der Eleve Schmidt darf hoffen. Die HJ-Hierarchen belassen es bei der Amtsenthebung, und den geschassten Jugendfunktionär verbindet mit den Nazis auch danach noch zumindest ein Rest von Sympathie.
Barbarisch erscheinen ihm die Machthaber erst, als sie sein ästhetisches Empfinden verletzen. Bereits als kleiner Junge – auf dem Weg zur Klavierstunde – hat er die in einem Schaufenster aushängenden Karikaturen des antisemitischen Hetzblattes «Der Stürmer» widerlich gefunden, und nun schließt sich der Kreis: Als der NS-Propagandaminister Joseph Goebbels im Juli 1937 die von ihm verehrten, angeblich «entarteten» Expressionisten brandmarkt, zieht er nach seinen Erinnerungen wütend den Schlussstrich: «Die Braunen sind verrückt», schießt es ihm durch den Kopf, «bei denen stimmt was nicht.»
Seit dem Nazi-Verdikt, das seine geliebten Künstler Ernst Barlach, Käthe Kollwitz oder Emil Nolde aus der Volksgemeinschaft verbannt, habe er endlich gewusst, wogegen er sei, aber noch längst nicht, wofür es sich zu kämpfen lohne. Er will möglichst bald studieren, weshalb er sich prompt zum Wehrdienst meldet, um das Unvermeidliche rasch hinter sich zu bringen. In den südlichen Elbregionen Hamburgs hilft er zunächst im Reichsarbeitsdienst beim Deichbau, für den gerade mal Achtzehnjährigen nicht nur physisch ein Knochenjob. Er macht auch geistig eine ebenso einschneidende wie verwirrende Erfahrung: Zwei politisch höchst unterschiedlich engagierte «Kameraden», ein Bürgerlich-Liberaler und ein strammer Kommunist, versorgen ihn mit entsprechender Literatur.
In dieser Phase liest er sowohl Schriften von Marx und Engels als auch die russischen Klassiker Tolstoi und Dostojewski – und mehr: Die Lektüre ermutigt ihn, in der freien Zeit nach Büchern aus der Bibliothek seines Vaters zu greifen, die den Söhnen bis dahin verschlossen geblieben ist. Vor allem der «Aufstand der Massen», ein Essay des spanischen Philosophen Ortega y Gasset, oder Oswald Spenglers gewaltiges Opus vom «Untergang des Abendlandes» beeindrucken ihn schwer.
Die in den Texten versammelte Vielfalt von mitunter krass divergierenden Möglichkeiten, sich die Welt zu erklären, öffnet Schmidt zusehends die Augen – und doch hängt er weiterhin vielen in Hitlerdeutschland gängigen Sichtweisen an. Mit den meisten Menschen teilt er das Empfinden, dass die harschen Reparationen, die dem Volk nach dem verlorenen Krieg auferlegt worden sind, den Nazis erst zum Durchbruch verholfen haben. Der sogenannte Versailler Schandvertrag, der etwa seine Heimatstadt dazu zwang, den Siegern ihre stolzen Handelsschiffe zu überantworten, ist auch für ihn die Wurzel fast aller Übel.
Was ihn bewegt, vertraut er im Telegrammstil Notizbüchern an, die beim Großangriff auf Hamburg Ende Juli 1943 verbrennen. Auf Erinnerungen daran und nachfolgende Aufzeichnungen bezieht er sich, als er im Sommer 1945 in britischer Kriegsgefangenschaft eine Stichwortkartei über seine Zeit während des «Dritten Reiches» anlegt. Schmidt will zunächst für sich selbst seine Entwicklung in dieser Epoche rekapitulieren, eine spontan erstellte grobe Skizze, von der er allerdings erst Anfang der neunziger Jahre öffentlich Gebrauch macht – in dem bereits erwähnten «Rückblick».
Der repressiven NS-Ideologie steht der im Herbst 1937 eingezogene Rekrut demnach «ohne Einschränkung ablehnend gegenüber», doch andererseits verfestigt sich in ihm eine ausgeprägt patriotische Haltung. Er möchte sich nicht feige in die Büsche schlagen, und dass er nun der in Vegesack bei Bremen stationierten leichten Luftwaffen-Flak angehören darf, erfüllt ihn keineswegs mit Unbehagen. Er glaubt tatsächlich – und bringt es auch später noch so zum Ausdruck–, «endlich im einzig anständigen Verein» gelandet zu sein.
Gewiss ist das im Lichte der sich anbahnenden Katastrophe ein aufreizend provokanter Satz, den er im Laufe der Jahre, nachdem er in Bonn in höchste Ämter eingerückt ist, deutlich abschwächt, aber als junger Mann sieht er das so. Und er bekräftigt über längere Zeit hinweg diesen seltsam anmutenden Vergleich: Da es weder unter den Kollegen einen einzigen Nazi gegeben habe noch von den Vorgesetzten den Hauch nationalsozialistischer Beeinflussung, sei ihm der Standort «wie eine Oase» erschienen.
Auf jeden Fall teilt Helmut Schmidt die ihn umgebende Wirklichkeit in zwei strikt voneinander getrennte Bereiche: Auf der einen Seite die Truppe, alles ordentliche Kerle, die sich nach bestem Gewissen bemühen, ihrem von äußeren und inneren Feinden bedrohten Vaterland die Stange zu halten – auf der anderen das in wachsendem Maße ungesetzliche und mit immer neuen bösen Überraschungen aufwartende NS-Regime, vor dessen Zumutungen er nur als Soldat halbwegs geschützt zu sein glaubt.
Und das nicht ohne Grund. Erleichtert registriert der Enkel eines Juden, «dass mich nun keiner mehr nach meiner arischen Abstammung fragen konnte». Erfolgreich wehrt er von Vegesack aus einen Versuch der Hamburger NSDAP-Kreisleitung ab, die ihm das übliche Antragsformular zur Aufnahme in die Partei zugeschickt hat. Er müsse sich erst einmal, wagt er nach Tagen der Angst vor möglichen Folgen mutig zurückzuschreiben, seiner Ausbildung zum Kanonier widmen – und die Nazis lassen ihn in Ruhe.
So erfüllt er seine Verpflichtungen, ohne sich einer herrschenden Gesinnung unterworfen zu fühlen. Zwar ödet ihn «der idiotische Kasernenhof-Dienst» an, aber seine Vorgesetzten schätzen den talentierten «jungen Spund». Mit der Sudetenkrise im September 1938, die dazu führt, dass seiner Einheit im Rahmen einer Teilmobilmachung Reservisten zugeteilt werden, steigt er innerhalb weniger Monate zum Geschützführer auf. Nun darf er einem halben Dutzend erwachsener Männer vorstehen, ein unverhoffter Zuwachs an Macht, nach dem er sich «ziemlich bedeutend» vorkommt.
Dass Hitler nach dem bereits in den NS-Staat eingegliederten Nachbarn Österreich auch das Sudetenland «heimholt», erscheint ihm da nur konsequent. Immerhin haben Franzosen, Engländer und Italiener der Annexion zugestimmt, und im Flakbatterie-Unterricht, in dem die Ausbilder einmal wöchentlich die aktuelle Lage behandeln, heißt man den dreisten Coup ebenfalls gut. Welche Skrupel sollen den einfachen Soldaten noch befallen, wenn schon sein «Verein» an dem völkerrechtswidrigen Gewaltakt so wenig Anstoß nimmt und überdies die im Nazi-Jargon als Reichskristallnacht verhöhnten Judenpogrome auf sich beruhen lässt? Die finden laut Helmut Schmidt mit keiner Silbe Erwähnung.
Er habe davon «zunächst nichts gemerkt», beteuert der Rekrut in der mehr als ein halbes Jahrhundert danach publizierten Retrospektive auf seinen Wehrdienst, den er im Übrigen als die «unbeschwerteste Zeit» seiner Jugend beschreibt. Und er wundert sich: «Sonderbarerweise» sei ihm völlig entfallen, wann und unter welchen Umständen er mit den Exzessen am 9.November 1938 konfrontiert wurde.
Ist das eine für seine Generation typische Behauptung, die sich immer dann auf reduziertes Erinnerungsvermögen beruft, wenn sie mit Vorwürfen konfrontiert wird? Der Altkanzler wehrt solche Fragen kaum ab, sondern verweist noch einmal auf seine damals betont unpolitischen Präferenzen: «Zeitungen las man nicht, und während des Sonntagsurlaubs war für mich alles andere wichtiger, als zu wissen, was in der Welt vor sich ging.» Aber beschäftigt haben ihn, der nach den Nürnberger Rassegesetzen als «Mischling 2.Grades» eingestuft worden wäre, die grassierenden Judenverfolgungen irgendwie doch. In seinen im Gefangenlager aufgeschriebenen Stichworten bekennt er unter dem Rubrum «Ende 1938» seine «Scham» über den Terror.
«Nunmehr klare Kontra-Stellung zum N.S.», notiert er da als Internierter im Stil eines Buchhalters – eine Bekräftigung seiner noch vor Kriegsbeginn langsam wachsenden Aversion gegen den nationalsozialistischen Rassenwahn, der in alle Lebensbereiche vordringt. Er verdankt diese Einsicht vor allem einer neuen Bekanntschaft.
Weil ihm der kärgliche Wehrsold, pro Tag gerade mal 50Pfennig, keine großen Sprünge erlaubt, besucht der Soldat an dienstfreien Wochenenden regelmäßig das in der Nähe von Vegesack gelegene Künstlerdorf Fischerhude. Dort gewinnt er einen Freundeskreis, der ihn bald stärker als alles andere beeinflussen wird.
Die Bindung an seine Jugendliebe Loki hat sich inzwischen erheblich gelockert. Nach dem Abitur ist die ebenfalls zum Reichsarbeitsdienst beorderte Hannelore Glaser darauf bedacht, eine Laufbahn als Volks- und Realschullehrerin einzuschlagen, und sie erreicht ihr Ziel. Das Verhältnis zu Helmut, mit dem sie nach ihrer späteren Erinnerung 1935 «auf einer Bank im Hamburger Stadtpark erste zarte Küsse austauschte», erschöpft sich in der Zeit der Ausbildung in eher sporadischen Kontakten. An seinem Standort besucht sie den vormaligen Freund, der ihr auch deshalb ans Herz gewachsen war, weil man mit ihm «so gut zanken» und «endlos über Gott und die Welt diskutieren konnte», bloß ein einziges Mal. Dann reißt die Verbindung ab; man ist sich nun leider, wie sie nüchtern feststellt, «recht fremd» geworden.
Nach Fischerhude zieht es den neugierigen Rekruten, weil sich dort ein Kriegskamerad seines Lieblingsonkels Heinz Koch niedergelassen hat – und die auffällig lockere Atmosphäre in dessen Bekanntenkreis beflügelt ihn umso stärker, als ihn besonders eine Frau fasziniert. Die von einem Holländer geschiedene, mehr als doppelt so alte Tänzerin und Malerin namens Olga Bontjes van Beek unterhält ihrerseits enge Kontakte zu regimekritischen und unerschrocken liberal gesinnten Menschen. Denen versucht der Gast zu gefallen, und obwohl er sich beharrlich als «pflichtbewusster deutscher Patriot» präsentiert, wird er herzlich aufgenommen. Die ungewohnte Umgebung, schätzt sich Helmut Schmidt noch 1980 glücklich, sei für ihn in entscheidend prägenden Jahren der «Ursprungsort geistiger Orientierung» gewesen.
Ein junger Mann zwischen zwei Welten. Die eine, in der hochrespektable Nonkonformisten wie Otto Modersohn oder die Witwe Clara des Lyrikers Rainer Maria Rilke verkehren und eine verschworene Gemeinschaft zu bilden scheinen, nennt er emphatisch seine «seelische Heimat». Doch die andere, die militärische, der er vor allem zu dienen hat, setzt ihn erheblich unter Druck. In Vegesack bedrängt ihn der Batteriechef mehrfach, in Anbetracht seiner hervorragenden Eignung die Karriere eines Berufsoffiziers zu wagen. Helmut Schmidt redet sich vorsichtig damit heraus, auf jeden Fall Architektur studieren zu wollen. Zunächst aber sucht er kurz entschlossen nach einem dritten Weg.
Mit einer vom Vater spendierten «zurückhaltend karierten blauen Jacke» kreuzt der noch nicht volljährige Filius gegen Ende der Wehrpflicht in Hamburg bei der Deutschen Shell auf, um die Chancen für eine Anstellung auszuloten. Ihm schwebt vor, in Holländisch-Indien nach Öl zu bohren. Doch dazu ist es schon zu spät.
Die Ereignisse überrollen ihn. Am 1.September 1939, einem der letzten Tage seines Dienstes beim Flakregiment 28, hört er im Kreise von Kameraden am Radiogerät den entscheidenden Satz Hitlers, der – wie Schmidt es später ausdrücken wird – den «großen Schlamassel» einleitet. SS-Stoßtrupps in der Montur polnischer Widerstandskämpfer haben in der Nacht davor die grenznahe Rundfunkstation Gleiwitz gestürmt, eine plumpe Finte, mit der die bestens vorbereitete NS-Militärmaschine ihren vom «Führer» heiser herausgebrüllten Waffengang rechtfertigt: «Seit fünf Uhr fünfundvierzig wird zurückgeschossen…!»
Etwas mehr als zwei Jahrzehnte nach dem ruinösen Ersten Weltkrieg ziehen die Deutschen wieder in die Schlacht.
Zwar ist die Euphorie über den Feldzug gegen den Nachbarn im Osten nicht annähernd so groß wie im August 1914, als vor allem junge Menschen singend und jubilierend zu den Fahnen eilten, aber die HJ-Indoktrination trägt Früchte. Vor der Dienststelle der SS in Vegesack versammeln sich Halbwüchsige in Scharen, die als Freiwillige ihre gedemütigten Väter rächen und rechtzeitig dabei sein wollen, wenn es um Ruhm und Ehre geht. Die an der Front kämpfenden Kameraden stehen nämlich schon bald tief im Feindesland.
Der Wehrmachtsangehörige Schmidt, der nun nicht mehr entlassen, sondern zum Wachtmeister der Reserve befördert wird, schwankt dagegen. Er habe den Ausbruch des Krieges, schreibt er als alter Mann lakonisch, eher «wie ein Naturereignis» empfunden, doch nie ins Kalkül gezogen, dass der «Führer» ihn unbedingt wollte: «Ich glaubte tatsächlich, die Polen hätten den Sender Gleiwitz überfallen, weshalb wir Deutschen uns jetzt wehren müssten.»
Zumindest trifft er weiterhin eine gravierende Unterscheidung. Sosehr ihm die Nazis zuwider sind, folgt er zunächst dem Urteil zahlloser Landsleute, die den letztverantwortlichen Hitler in deutlich milderem Licht sehen. Ihn nimmt er, wie er in seinen Notizen einräumt, selbst nach dem Angriff auf Polen «persönlich noch aus», und erst als der Diktator auch Frankreich im Handstreich erobert, fürchtet der kleine Kanonier ein weltumspannendes Inferno. Seinem Volk prophezeit er nun das zwangsläufige Desaster.
Müssen sein Denken und Handeln so nicht in einen unauflösbaren Widerspruch geraten? Helmut Schmidt erkennt die Gefahr: «Damals», hält er in seinem Rückblick fest, «begann für mich das, was man eine gespaltene Bewusstseinslage nennen könnte: Während ich einerseits den Nationalsozialismus ablehnte und ein schlimmes Ende des Krieges erwartete, zweifelte ich andererseits nicht an meiner Pflicht, als Soldat für Deutschland einzustehen.» Die Zukunft seiner Nation, ahnt er, wird «grauenhaft», aber er sieht auch keine Möglichkeit, sich diesem Drama zu entziehen.
Der Fachmann für leichte Flakgeschütze arrangiert sich mit der Situation. Noch im Laufe des Jahres 1940 trägt er die Rangabzeichen eines Leutnants der Reserve, und nachdem er in die Reichshauptstadt abgeordnet worden ist, wo er beim Oberkommando von Hermann Görings Luftwaffe mit der Ausfertigung wichtiger Schießvorschriften betraut wird, bringt er es 1942 zum «Kr. O.» – Kürzel für Kriegsoffizier.
Und auch privat stabilisiert sich Schmidt, allen Untergangsphantasien zum Trotz. Seine inzwischen als Pädagogin arbeitende Jugendfreundin Hannelore Glaser fasst sich ein Herz, um ihren in Sachen Liebe wankelmütigen Helmut noch einmal zu prüfen. «Nach mehreren beiderseitigen Abkühlungen, Affären mit anderen und Wiederanknüpfungen», wie er es etwas ungelenk in seinem Gedächtnisprotokoll festhält, kommt es im Sommer 1941 zu einer unvergesslichen Woche in Berlin. «In neuer Vertrautheit», bestätigt Loki, sitzt man dort stundenlang auf den Bänken unter der Hochbahn am Nollendorfplatz und verlobt sich spontan.