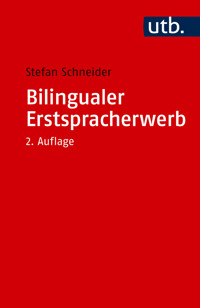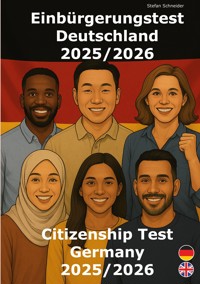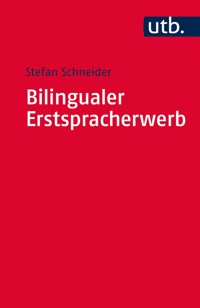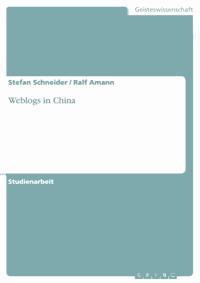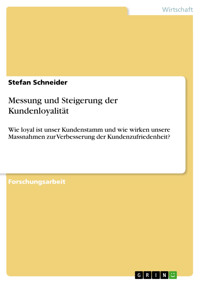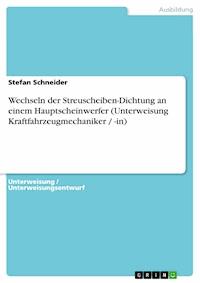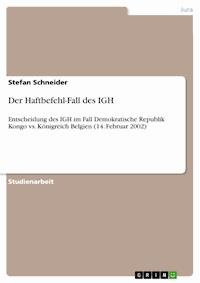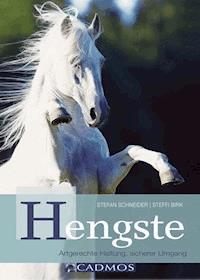
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cadmos Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Haltung und Gesundheit
- Sprache: Deutsch
Das Buch bietet fundierte Informationen über alles, was Hengsthalter wissen sollten. Von der Grunderziehung und -ausbildung über Präsentation in Sport und Show bis hin zu Zucht und Haltung. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, den Hengst nicht als "Mythos" zu verklären, sondern als das darzustellen, was er ist - ein Pferd!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hengste
Artgerechte Haltung, sicherer Umgang
Stefan Schneider | Steffi Birk
Hengste
Artgerechte Haltung, sicherer Umgang
Haftungsausschluss:
Autoren und Verlag lehnen für Unfälle und Schäden jeder Art, die aus den in diesem Buch dargestellten Übungen, Ratschlägen und Ansichten entstehen können, jegliche Haftung ab.
Sicherheitstipps:
In diesem Buch sind Menschen abgebildet, die ohne splittersicheren Kopfschutz reiten oder Pferde ohne Handschuhe führen. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen.
Achten Sie im Umgang mit Pferden und gerade mit Hengsten immer auf entsprechende Sicherheitsausrüstung: feste Schuhe und Handschuhe bei der Bodenarbeit sowie Reithelm, Reitschuhe und Reithandschuhe beim Reiten.
Impressum
Copyright © 2012 by Cadmos Verlag, Schwarzenbek
Gestaltung und Satz: Ravenstein, Verden
Lektorat: Maren Müller
Coverfoto: Christiane Slawik
Fotos im Innenteil: Birte Ostwald, Christiane Slawik
Druck: Westermann Druck, Zwickau
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Abdruck oder Speicherung in elektronischen Medien nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Verlag.
Printed in Germany
ISBN: 987-3-8404-1028-4
ISBN (EPUB) 978-3-8404-6100-2
ISBC (Kindle) 978-3-8404-6101-9
www.cadmos.de
Vorwort
Mythos Hengst: Ausdruck von Leidenschaft, Anmut und Männlichkeit. (Foto: Slawik)
Wer ist nicht tief berührt von dem Anblick eines im Sonnenuntergang glänzenden Hengstes, der über eine Weide galoppiert, oder begeistert von der geballten Kraft, die ein Hengst in seinen beeindruckenden Bewegungen zeigt? Wie viele Menschen lassen sich von „Jahrhunderthengsten“ in den Medien mitreißen, obwohl sie sonst kaum pferdeaffin sind? Weshalb faszinieren die in voller Mannespracht stehenden Pferde so viele Kulturen auf der ganzen Welt?
Die Vorfahren der Pferde lebten bereits vor 60 Millionen Jahren. Die natürliche Selektion, die ihr Überleben sicherte und dazu führte, dass sie sich schließlich zu unseren Hauspferden entwickelten, hat die heutigen Vererber zu dem gemacht, was sie sind: starke, angepasste, überlebensfähige, bemerkenswerte Leistungserbringer, die in der von Menschen beherrschten, lauten, unruhigen Welt nicht nur bestehen können, sondern sogar ganze Völker in ihren Bann ziehen.
Wir möchten, dass Sie – alle von Hengsten begeisterte Menschen – von unserer langjährigen Erfahrung als Trainer, Hengsthalter und Tiermediziner profitieren und einen Einblick in die Welt dieser wundervollen Tiere erhalten. Dieses Buch erklärt typische Verhaltensweisen, informiert über artgerechten Umgang, mögliche Haltungsformen und wichtige Aspekte der Erziehung und vermittelt grundlegendes züchterisches Wissen. Es soll Ihnen als Nachschlagewerk rund um das Thema Hengst dienen.
Araber wurden als Zeichen von Zuneigung und Respekt verschenkt und werden noch heute auf der ganzen Welt verehrt. (Foto: Slawik)
Warum soll’s ein Hengst sein?
Der Hengst gilt seit Menschengedenken als Inbegriff von Stärke, Herrschaftlichkeit und Eleganz. Tatsächlich fallen Hengste durch ihr sicheres Auftreten, das glänzende Fell, den wachen, aufmerksamen Blick und den breiten, kräftigen Hengsthals besonders auf. So ist es nicht verwunderlich, dass die Haltung von Hengsten in vielen Regionen der Welt eine jahrhundertealte Tradition hat. Hengste wurden seit je verehrt, zur Zucht verwendet oder als Friedensangebot und Geschenk zur Versöhnung zwischen verschiedenen Völkern eingesetzt.
Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die Vollblutaraber. Sie werden bereits seit dem siebten Jahrhundert aktiv gezüchtet, und schon im Koran steht geschrieben, dass Rassepferde begehrenswert sind. Die arabischen Herrscher unterstrichen ihr Ansehen und ihren sozialen Status durch den Besitz der kräftigsten Hengste, die die meiste Männlichkeit ausstrahlten. Wird ein Araberhengst verschenkt, gilt das noch heute als Zeichen besonderer Wertschätzung.
Jahrhundertelang beherrschten die Araber Spanien, und so drang der Ruf der arabischen Pferde, ohne die diese Herrschaft nicht möglich gewesen wäre, bis nach Mitteleuropa. Im 19. Jahrhundert sendeten Adelshäuser ganze Expeditionen aus, um einige Araberpferde zu sichern. Es heißt, das arabische Pferd sei der Quell, aus dem das Europa des 19. Jahrhunderts schöpfte, um seine modernen, edlen Reitpferderassen zu entwickeln. Araber waren es auch, von denen das Englische Vollblut abstammt, und heute werden arabische Hengste sogar in der Warmblutzucht eingesetzt, um die Ausdauer, Gesundheit, Charakterstärke und Umgänglichkeit dieser Pferde zu erhalten und weiter zu fördern.
Auch in anderen Kulturen finden sich Beispiele dafür, wie sehr Hengste geschätzt wurden und werden. So galten in Spanien die Hengste der Pura Raza Española als die Pferde der Könige, und auch die weißen Lipizzanerhengste wurden ursprünglich für den kaiserlichen Hof gezüchtet. In der Spanischen Hofreitschule in Wien wird bis heute ausschließlich mit Hengsten gearbeitet. Und in Shows in aller Welt wird man mit Sicherheit in erster Linie auf Hengste treffen, da sie durch ihre edle Erscheinung beim Publikum besonders gut ankommen.
Der Faszination, die von Hengsten seit je ausgeht, kann sich kaum jemand entziehen. Im 21. Jahrhundert haben sie nach wie vor Kultstatus – der „Mythos Hengst“ ist ungebrochen. Bücher und Filme wie „Black Beauty“ und „Blitz, der schwarze Hengst“ sind wahre Klassiker. Hengste wirken wie Magnete, die überall auf der Welt Menschenmassen anziehen. Hengstschauen sind in allen namhaften Gestüten regelmäßig ausverkauft, und ganz aktuell füllt der Jahrhunderthengst „Totilas“ die Zuschauerränge auf internationalen Turnieren.
Doch leider werden sehr viele Hengste heute nicht mehr gehalten, um ihre Qualitäten an Nachkommen weiterzugeben oder ihre Leistungsstärke durch entsprechendes Training zur vollen Entfaltung zu bringen. Allzu oft ist es reines Prestigedenken, das zum Kauf eines Hengstes verleitet, und nicht selten verzweifeln die stolzen Hengstbesitzer nur zu bald an ihren stattlichen und kräftigen Statussymbolen. Selbstverständlich ist es absolut in Ordnung, sich für einen Hengst als Freizeitpartner zu entscheiden, vorausgesetzt, man kann einen angemessenen Umgang und eine artgerechte Haltung gewährleisten. Hengste fordern ihren Besitzer deutlich mehr als Stuten oder Wallache, darüber muss sich jeder, der seine Zeit mit ihnen verbringen möchte, im Klaren sein. Die Macht des Fortpflanzungstriebs, der beim Hengst im Gegensatz zur Stute rund ums Jahr, Tag für Tag, besteht und der alles andere überlagern kann, ist nicht zu unterschätzen. Hengsthalter brauchen einige Pferdeerfahrung und fundiertes Wissen, um ihr Pferd in die richtigen Bahnen zu lenken und es auch auf der Spur zu halten. Dieses Buch bietet hierbei Unterstützung.
Als Showpferde begeistern Hengste Menschen in aller Welt. (Foto: Slawik)
Natur und Verhalten von Hengsten
Die natürliche Ordnung in einer Pferdeherde: Der Herdenführer geht voran, alle anderen folgen, wobei die hinteren Pferde meist die rangniedrigsten sind. (Foto: Ostwald)
Wir möchten dieses Kapitel mit einem Exkurs in die Natur aller Pferde beginnen. Grundlegende Kenntnisse über Verhaltensweisen und Kommunikationsmöglichkeiten der Pferde sind die Basis für den Umgang mit ihnen, unabhängig vom Geschlecht des jeweiligen Pferdes, der bevorzugten Pferdesportdisziplin oder der Rasse, für die man sich entschieden hat. Dieses Wissen wird uns in vieler Hinsicht das Training erleichtern, was im Folgenden anschauliche Beispiele zeigen werden. Und mit diesem Hintergrundwissen fällt es auch nicht schwer, das im weiteren Verlauf dieses Kapitels beschriebene typische Verhalten von Hengsten zu verstehen und richtig einzuordnen.
Die Natur der Pferde
Pferde sind Herdentiere und als solche auf ihre Artgenossen angewiesen. Ein in der natürlichen Umgebung von der Herde ausgeschlossenes Pferd ist in der Regel dem sicheren Tod geweiht. Soziale Isolation ist daher eine der schlimmsten Bestrafungen für ein Pferd. Diese Tatsache sollten wir selbstverständlich bei der Haltung und auch bei der täglichen Arbeit berücksichtigen. Bei der Erziehung kann man sie sich unter bestimmten Umständen zunutze machen. Wenn wir mit einem Pferd ohne Beisein von Artgenossen arbeiten, schließt es sich bei vertrauensvollem Umgang während dieser Zeit dem Menschen an und ist somit nicht mehr allein. Zeigt das Pferd nun unerwünschtes Verhalten, überrennt es uns zum Beispiel beim Führen rüpelhaft, so können wir den Führstrick lösen und das Pferd durch unsere Körpersprache von uns wegschicken. Das ist selbstverständlich nur dann eine Option, wenn wir uns in einem umgrenzten Areal, etwa in einer Reithalle, befinden.
Pferde sind zudem Fluchttiere. Ihr Fluchtinstinkt ist in der Natur überlebenswichtig, um möglicherweise tödlichen Angriffen von Raubtieren zu entgehen. Auch in menschlicher Obhut können sie ihn nicht einfach abschalten und reagieren daher auf für sie bedrohlich wirkende Situationen, wie nicht zuordenbare Geräusche oder plötzliche Bewegungen, in der Regel mit Fluchtverhalten.
Das Pferd scheut vor einem Reiz von links. Es springt deshalb nach rechts und hebt den Kopf, um den Auslöser besser fokussieren zu können. (Foto: Ostwald)
Häufig scheuen oder erschrecken Pferde, wenn in ihrer unmittelbaren Umgebung etwas passiert, das sie nicht einordnen können. Sie haben zwar nahezu einen Rundumblick (circa 355 Grad), aber direkt vor den Vorderhufen, unterhalb des Kopfes und Halses sowie ein bis zwei Meter genau vor dem Kopf befinden sich die „toten Winkel“. Zudem nehmen Pferde einen großen Teil ihres Sichtfelds nur mit einem von beiden Augen und eher unscharf wahr. Lediglich in der Ferne liegende Dinge können sie scharf sehen. Nicht zuletzt mangelt es ihnen auch noch an räumlichem Sehen. Das funktioniert nämlich nur in dem relativ kleinen Bereich, den sie mit beiden Augen wahrnehmen können. So ist es nicht verwunderlich, dass Pferden Wasserpfützen oder Schatten nicht geheuer sind. Aus ihrer Sicht könnte es sich dabei um tiefe Löcher handeln.
Das Sichtfeld des Pferdes: Die roten Bereiche kann das Pferd nicht sehen, die grünen sieht es mit beiden Augen und in weiter Entfernung am schärfsten, die blauen jeweils nur mit einem Auge.
Im Training bedeutet das, dass man ein Pferd, das seinem Fluchtinstinkt folgt, nicht bestrafen sollte. Besser ist es, stets selbst aufmerksam die Umgebung im Blick zu behalten. Wer den Schatten am Boden frühzeitig bemerkt, kann schon agieren, bevor das Pferd davor erschrickt. Zudem ist es selbstverständlich möglich, Pferde auf verschiedene Situationen, Umgebungs- und Umweltänderungen vorzubereiten, sodass ein Fluchtverhalten seltener oder nur noch in abgeschwächter Form auftritt.
Das Überleben eines Fluchttiers hängt unter anderem von seiner Reaktionsgeschwindigkeit ab. Auch diese Erkenntnis nützt uns für das Training, denn es ergibt sich daraus, dass Pferde eine äußerst kurze Reaktionszeit haben. Während der Mensch etwa drei Sekunden braucht, bis er einen Reiz in seiner Umgebung überhaupt wahrnimmt und darauf reagiert, liegt die Reaktionszeit eines Pferdes bei lediglich 3/10 bis 8/10 einer Sekunde. Und nur wenn eine Reaktion bis maximal drei Sekunden nach einem Reiz erfolgt, kann das Pferd beides überhaupt miteinander in Verbindung bringen. Wird ein Pferd also erst nach dem Reiten für eine gelungene Übung gelobt oder für ein Fehlverhalten bestraft, kann es den Zusammenhang nicht verstehen. Lob oder Strafe müssen deshalb immer sofort erfolgen.
Pferde sind Energiesparer. In der Natur finden sie nur wenig energiereiches Futter. Wenn Pferde nicht laufen müssen und auch keine Überversorgung an Energie durch zu viel Kraftfutter haben, werden sie instinktiv überflüssige Bewegungen vermeiden. Ist eine Flucht notwendig, laufen sie erst mal nur einige Hundert Meter weit und überprüfen dann, ob die Gefahr noch immer droht oder ob sie bereits stoppen können. Würden Pferde wegen jedem „Fluchtauslöser“ mehrere Kilometer weit rennen, hätten sie im Fall einer tatsächlichen Bedrohung nicht genug Energie übrig. Bei der Ausbildung müssen wir also berücksichtigen, dass es sich nicht um Sturheit, sondern um natürliches Verhalten handelt, wenn unser Pferd langsamer wird, nachdem es einige Zeit Energie aufgewendet hat. Wir müssen einem Pferd erst nach und nach beibringen, dass es längere Zeit am Stück Energie aufwenden muss. Nun ist es sicher auch einleuchtend, warum Pausen im Training so wichtig sind.
In der Natur fressen Pferde die meiste Zeit des Tages, weil sie in ihrem oft nur spärlich bewachsenen Lebensraum nur so die nötige Energie tanken können. (Foto: Ostwald)
Dass Pferde Pflanzenfresser sind und sich in der Natur hauptsächlich von energiearmen Steppenpflanzen und Gräsern ernähren, wurde bereits angesprochen. Mit etwa 18 Litern Volumen ist der Pferdemagen verhältnismäßig klein. Damit ein Pferd seinen Tagesbedarf an Energie decken kann, muss es täglich (die Angaben schwanken je nach Literatur) 14 bis 18 Stunden lang fressen. Die Evolution hat Pferde daher mit einem großen Kaubedürfnis ausgestattet, das auch bei unseren Hauspferden noch vorhanden ist. Wir müssen das bei der Fütterung berücksichtigen und reichlich Raufutter zur Verfügung stellen. Eine ausreichende Energieversorgung ließe sich zwar durch wenig, aber gehaltvolles Kraftfutter erreichen, doch wenn das Futter aufgebraucht ist, fangen einige Pferde mit Krippenbeißen oder Koppen an, andere überfressen sich mit Stroh und Späneeinstreu oder zernagen Weidezäune und Boxenwände. Magengeschwüre treten bei Raufuttermangel signifikant häufiger auf.
Der natürliche Tagesablauf
Im natürlichen Herdenverband frei lebende Pferde verbringen die 24 Stunden eines Tages im Durchschnitt etwa so: 20 Prozent der Zeit stehen sie still, teilweise dösend, 10 Prozent der Zeit liegen sie, 10 Prozent der Zeit pflegen sie Sozialkontakte, etwa in Form von gegenseitigem Beknabbern, Miteinander-Spielen oder Sich-Balgen, und 60 Prozent des Tages verbringen die Pferde mit der stetigen Futteraufnahme. In Offenställen gehaltene Kleingruppen, die Heu und Stroh zur freien Verfügung haben, verhalten sich ebenso.
Pferdebesitzer unterstellen ihrem Tier häufig planvolles Verhalten, etwa dass es sie absichtlich „ärgert“ oder sich nicht verladen lässt, weil es „weiß“, dass ein Besuch in der Tierklinik ansteht. Im Gegensatz zu Raubtieren sind Pferde jedoch kaum zu strategischem Handeln fähig. Der hierfür zuständige Teil der Großhirnrinde – der Neokortex – ist bei ihnen, verglichen mit dem von Katzen, Hunden, Tigern oder Wölfen, kleiner. Ein Jäger muss sein Vorgehen in gewissem Umfang planen, um erfolgreich zu sein. Und der Erfolg, das Reißen der Beute, ist für ein Raubtier überlebensnotwendig. Pferde aber senken nur ihren Kopf zum Boden und finden dort entweder Nahrung oder auch nicht. Wenn nichts Fressbares vorhanden ist, werden sie weiterziehen, bis sie etwas finden. Pferde brauchen also keine Strategie zum Überleben. Für Futter müssen sie sich weder besonders anstrengen, noch müssen sie dafür kämpfen. Der bekannte Pferdetrainer Monty Roberts sagte dazu einmal: „Vor einem Pferd ist noch nie ein Grashalm weggelaufen.“ Das ist auch der Grund, warum ein Leckerli für ein Pferd eine geringere Motivation darstellt als zum Beispiel für einen Hund.
Wie aber denken Pferde nun? Sie denken in Bildern. Ein bisschen kann man diese Denkstruktur auch mit einem Daumenkino vergleichen. Verhaltensforscher sprechen von „assoziativem Denken“. Wie sich das im täglichen Umgang auswirkt, soll hier ein Beispiel zeigen: Bei einem Ausritt führt der Weg an einer Mülltonne vorbei. Das Pferd scheut vor dieser Tonne und zögert weiterzugehen. In diesem Moment benutzt der Reiter seine Gerte, um das Pferd grob zum Weiterlaufen zu animieren. Obwohl ihm das schließlich auch gelingt und er die Tonne passieren kann, verweigert das Pferd beim nächsten Ausritt an der gleichen Stelle. Warum? Es hat das Bild der Tonne mit dem Schmerz durch die Gerte in Verbindung gebracht. Ebenso verhält es sich bei Pferden, die ab einer ganz bestimmten Stelle immer wieder abrupt rückwärts aus dem Pferdehänger rennen. Sie haben sich häufig entweder an genau diesem Punkt ihren Kopf am Hänger gestoßen oder sie wurden hier, als sie beim ersten Mal nicht weitergehen wollten, von hinten mit dem Besen „motiviert“.
Immer wieder kann man beobachten, wie Menschen versuchen, Pferde an der Hüfte, der Schulter oder anderswo ein Stück herumzudrücken, um andere Pferde vorbeizulassen oder um mehr Platz zu bekommen. Das Pferd weicht jedoch nicht, sondern stemmt sich dagegen. Das ist eine natürliche Reaktion. Entdeckt wurde dieser „Oppositionsreflex“ (umgangssprachlich auch Drucksyndrom genannt) von Iwan Pawlow. Tiere orientieren sich instinktiv häufig an Druck: sei es, dass sie dicht an einem Zaun entlanglaufen, obwohl genügend freie Fläche zur Verfügung steht, sich beim Über-das-Fell-Streichen gegen die Berührung lehnen oder bei Zug am Halfter rückwärts dagegen anziehen. Dieses Verhalten kann für den Menschen auch nützlich sein, beispielsweise, wenn man ein Pferd zum ersten Mal in seinem Leben sattelt. Dem Oppositionsreflex sei Dank wird es nämlich in der Regel so lange stehen bleiben, bis man die „Druckzone“, die sich dicht um das Pferd befindet (1,5 bis 2 Meter), verlässt. Allerdings ist es für den täglichen Umgang mit Pferden nicht nur sinnvoll, sich dieses Reflexes bewusst zu sein, sondern man kann und sollte Pferden auch beibringen, Druck zu weichen. Dazu mehr im Kapitel über Erziehung.
Hier ist der „Oppositionsreflex“ deutlich zu erkennen: Der Mensch zieht nach links, und statt dem Druck zu folgen, stemmt sich das Pferd dagegen. (Foto: Ostwald)
Noch anzumerken ist, dass man Wildpferde seltener wiehern hören wird als unsere Hauspferde, denn lautes Wiehern würde im ungünstigen Fall Raubtiere anlocken. Ganz still geht es aber auch in der Natur nicht zu. Stuten wiehern nach ihren Fohlen und umgekehrt. Beim Deckakt wird geschnorchelt und gequietscht, und auch lautes „Schreien“ gehört bei Hengsten durchaus Repertoire, nämlich dann, wenn ihnen ein Widersacher zu nahe kommt.
Lautes Wiehern ist typisch für unsere Hauspferde, in der Natur hört man es seltener. (Foto: Ostwald)
Herdenstruktur
Häufig wird von dem sogenannten Leithengst gesprochen. Tatsächlich hat der Hengst in der Herde zwar eine gewisse Position und auch feste Aufgaben, angeführt wird die Herde – mit einer Gruppengröße von bis zu 20 Pferden – allerdings von der Leitstute. Sie bestimmt, welche Stuten der Hengst wann decken darf, wann die Herde welchen Weg einschlägt und wer an der Wasserstelle zuerst trinken darf.