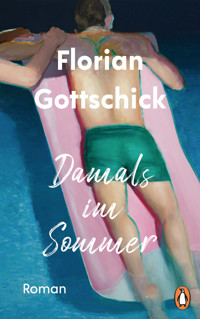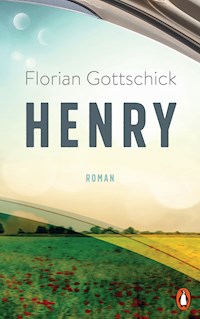
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einer Entführung aus Versehen, die alle Beteiligten auf beglückende Weise lehrt, näher bei sich selbst anzukommen.
»›Henry‹ ist Kino zum Lesen und sehr unterhaltsam.« BR 24
Die 12-jährige Henriette, genannt Henry, wächst in Berlin Wilmersdorf überbehütet auf und sehnt sich nach dem großen Abenteuer. Als ihre Mutter ihren nagelneuen BMW – samt auf dem Rücksitz schlafender Tochter – kurz unabgeschlossen stehen lässt, kommt ein fremder junger Mann, setzt sich ins Auto, fährt davon. Eigentlich nur, um eine Runde damit zu drehen. Doch als Henry wach wird, überredet sie den Mann, der Sven heißt, die verrückte Idee weiter auszukosten. Zusammen mit Nadja, Svens Freundin, brechen sie zu einem Roadtrip auf. Voller Übermut, Spaß und einem ganz besonderen Gefühl der Zusammengehörigkeit beginnt für alle drei eine Reise, die ihnen eine beglückende neue Sicht auf das Leben eröffnet.
»Eindrückliche bezaubernde Bilder, kurzweilige Dialoge und der Plot ist auf jeden Fall filmreif.« NDR Kultur »Neue Bücher«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ZUDIESEMBUCH
Die 12-jährige Henriette wächst in Berlin-Wilmersdorf überbehütet auf und sehnt sich nach dem großen Abenteuer. Als ihre Mutter ihren nagelneuen BMW – samt auf dem Rücksitz schlafender Tochter – kurz unabgeschlossen stehen lässt, kommt ein fremder junger Mann, setzt sich ins Auto, fährt davon. Eigentlich nur, um eine Runde damit zu drehen. Doch als Henriette wach wird, überredet sie den Mann, die verrückte Idee weiter auszukosten. Zusammen mit Nadja, Svens Freundin, brechen sie zu einem Roadtrip auf. Voller Übermut, mit Spaß am Verbotenen und einem ganz besonderen Gefühl der Zusammengehörigkeit beginnt für alle drei eine Reise, die ihnen eine neue Sicht auf das Leben eröffnet.
Temporeich, originell, mit eindrücklichen Bildern und feinem Humor erzählt der preisgekrönte Filmemacher Florian Gottschick von einer Entführung aus Versehen, die alle Beteiligten das Wichtigste überhaupt lehrt: Wenn es einen Sinn im Leben gibt, dann ist es das Leben selbst. Und es ist nie zu spät, um den Ort aufzusuchen, an dem man bei sich selbst ankommt.
ZUMAUTOR
Florian Gottschick machte sein Diplom 2013 in Filmregie an der Filmuniversität Babelsberg und arbeitete parallel als Creative Producer für diverse Filmproduktionen. Die Filme unter seiner Regie liefen auf über 70 internationalen Filmfestivals und brachten ihm zahlreiche Nominierungen und Preise ein, u. a. Grimme-Preis, Studio Hamburg Nachwuchspreis, Förderpreis Neues Deutsches Kino für Regie und Drehbuch. Sein aktuellstes Projekt ist (neben zwei Serien für die ARD) eins von drei 2020 produzierten deutschen Netflix Originals. Er lehrt als Dozent Filmschauspiel, Drehbuch/Dramaturgie und Filmregie. Dies ist sein erster Roman.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Florian Gottschick
HENRY
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2021 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack
Umschlaggestaltung: Favoritbuero
Umschlagabbildungen: © Oleg Senkov/shutterstock; © Jacob_09/shutterstock; © Pongsak A/shutterstock; © Daniel Fung/shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26147-4V005
www.penguin-verlag.de
Für Rike
und ihren Mann Thomas
mit Theresa und Hendrik
Erwarte das Glück schlafend.
Japanisches Sprichwort
Eine Dummheit zu begehen ist kein Verbrechen.
Sie nicht zu Ende zu bringen, das schon.
Sergej Lukianenko Sternenspiel
1
»Polizei Notruf?«
»Ja, hallo, mein Kind ist entführt worden.«
»Wo ist das passiert?«
»Zu Hause, hier zu Hause.«
»Wie ist die genaue Adresse?«
»Bamberger Straße 30.«
»Wie ist Ihre Postleitzahl?«
»Ich … Bitte fahren Sie los! Die können noch nicht weit sein!«
»Bitte bleiben Sie ruhig, und geben mir Ihre Postleitzahl.«
»10797, nein, 79.«
»Sind Personen verletzt? Sind Sie verletzt?«
»Nein … nein …«
»Wie ist Ihr Name?«
»Die können noch nicht weit sein!«
»Bitte bewahren Sie Ruhe, nennen Sie mir Ihren Namen.«
»Angermeier mit e-i.«
»Ein Wagen ist unterwegs, Frau Angermeier. Jetzt sagen Sie mir bitte, was genau passiert ist.«
»Nein, Sie sollen doch nicht zu mir fahren! Sie sollen … die sind vielleicht gerade mal ein paar Straßen weiter!«
»Bitte bewahren Sie Ruhe, und beantworten Sie meine Fragen. Setzen Sie sich hin, Frau Angermeier, und schauen auf einen fixen Punkt. Und jetzt erklären Sie mir, was genau passiert ist.«
2
Statistiker gehen davon aus, dass weltweit 2,6 Millionen Geschlechtsakte im gleichen Moment vollzogen werden. Während sich Nigerianer mit rund 24 Minuten die meiste Zeit dafür nehmen, ziehen die Deutschen die Erhebung mit nur 15,2 Minuten nach unten. Was ihnen nicht unangenehm sein muss, denn ein Forscherteam aus den USA soll festgestellt haben, dass die ideale Dauer 13 Minuten beträgt.
Der Akt, um den es hier geht, ist in diesem Moment einer von 19 im Berliner Bezirk Wilmersdorf, einer von 1 230 in der ganzen Stadt und von 19 748 in ganz Deutschland.
Die eher schlechte Statistik für diesen Abend kann eventuell nach dem anstehenden Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich nach oben korrigiert werden. Demografen hoffen auf einen guten Spielausgang. Und dennoch ist es müßig zu erwähnen, dass die Deutschen kein sexuell sehr aktives Völkchen sind. Während in Frankreich, Italien und Spanien Konflikte über einen einfachen Beischlaf beigelegt werden, tun sich die Deutschen schwer damit, die Aktivität vom Hirn in den Schritt zu verlegen. Im Kongo und in Angola gibt es sogar Affen, nämlich Bonobos, die das den Deutschen voraushaben.
Der Akt, um den es sich hier dreht, endet wie einer von dunkel geschätzten 5 Millionen im Jahr in Deutschland: mit der Befruchtung. Die kleine Samenzelle erweist sich auf ihrem Marsch durch die Uterushöhle schon in ihrem zarten Alter von drei Stunden als stur und im Wettkampf ihren mehr als 116 Millionen Genoss*innen überlegen. Weit über die Hälfte ist sowieso in den falschen Eileiter abgebogen – Sackgasse. Spektakuläre 9 Minuten und 8 Sekunden nach der Ejakulation durchstößt sie, später auf den Namen Henriette getauft, mit ihrem X-Chromosom die Gallerthülle der Eizelle, nur um sie daraufhin eigennützig zu fertilisieren. Aus einer puren Laune der Natur heraus wird die bisherige Alleinherrscherin über diese Eizelle entmachtet.
Von allen 398 Eizellen, die sie im Laufe ihres Lebens produziert haben wird, ist dies die erste (und letzte) befruchtete.
3
Ihr Höhepunkt verebbt gerade, und Marion hält sich die Hand ermattet an die Schläfe. Sie hört Thomas lachen, wie jedes Mal, wenn er wie ein Pferd, oder den Geräuschen zufolge wie ein Walross, gekommen ist. Warum tun Männer das nur immer nach ihrem Orgasmus? Thomas liegt auf Marions Schlüsselbein und fasst an ihren linken Busen, vielleicht um sich zu vergewissern, dass er auch nach dem Sex noch da ist. Drückt zwei Mal zu, ohne hinzusehen, und kratzt sich dann mit der gleichen Hand umständlich am Rücken. Marions Gedanken schweifen ab. Zu all den Aufgaben, die sie noch zu erledigen hat, bevor sie ihre Diplomarbeit abgibt. Sie geht die einzelnen To-dos im Kopf durch. Thomas’ Hand wandert zu dem Kondom, er zieht sich aus ihr zurück und rollt sich von ihr herunter. Marion presst die Lippen zusammen.
»Woran denkst du?«
An nichts, will sie sagen. »Dass ich noch zum Copyshop muss«, antwortet sie stattdessen.
Er lacht auf.
Die Zeit dehnt sich aus, zumindest wenn sich Marion später an den Augenblick erinnert, als Thomas an sich heruntergeschaut und einen Fluch ausgestoßen hat. Um daraufhin mit seinen zitternden Händen – zitterten die wirklich?, fragt sich Marion im Nachhinein – die Latexreste von seinem erschlaffenden Glied zu ziehen.
»Schatz?«
»Was ist?« Marions Blick fällt auf die Überreste des Kondoms. Gedanken überschlagen sich und galoppieren in wirre Richtungen davon.
»Ich habe nicht gespürt, dass es kaputtgegangen ist«, beteuert Thomas hilflos.
»Ich auch nicht. Ich dachte immer, es macht irgendwas, wenn es reißt. Dass es ziept.«
»Bei mir hat nichts geziept.«
»Bei mir auch nicht.« Marion zwingt sich, ruhig zu bleiben, aber Panik schleicht sich in ihre Stimme: »Du hast mich quasi ohne Präser gebumst. Fühlt man das nicht?!«
Thomas will mit den Schultern zucken, weiß aber, dass Marion das hasst. Er unterdrückt den Impuls, sagt stattdessen: »Es war unglaublich schön.«
Marion rollt mit den Augen, bevor ihr einfällt, dass Thomas das eigentlich hasst. Marion steht auf.
»Ich mach jetzt mal besser keine Kerze«, sagt sie beschwichtigend, aber nicht ganz ohne den Klang eines Vorwurfs, und geht ins Bad.
Marions Regel bleibt aus. Henriette hat es geschafft, das Ruder zu übernehmen. Kein Wunder, sie ist ja auch Marions Tochter. Da stoßen zwei Gemüter aufeinander, die ähnlicher nicht sein könnten. Die beiden Leben gehen weiter. Während es sich Henry in der Gebärmutter gemütlich macht, verteidigt Marion ihre Diplomarbeit. Sie hadert nur selten mit der Situation, und wenn, dann aus verletztem Stolz. Ihr Plan wurde ohne Absprache mit ihr geändert. Eine Änderung, die ihre Lebensziele, so nimmt sie sich vor, so wenig wie möglich beeinflussen soll.
Thomas schlägt Marion vor, die erste Zeit für sein Start-up zu arbeiten. Marion lehnt launisch und beleidigt ab:
»Du glaubst also, nur weil ich jetzt schwanger bin, kann ich nicht mehr meine eigene Karriere machen, oder was? Wir haben die Zweitausender!«
Thomas bleibt gelassen. Er ist jemand, der es intuitiv draufhat, statt in Konfrontation in eine Umarmung zu gehen. Und so lange »schschsch« zu machen, bis sich Marion beruhigt hat.
Keine 276 Tage mehr, da bahnt sich Henriette ihren Weg in die Welt. Marion bekommt – wie weitere 665 126 Frauen in Deutschland – ein kleines, wunderschönes, verrunzeltes und der Welt gegenüber durch und durch misstrauisches Baby.
4
Henry hat ihren Kosenamen von ihrer Großmutter, die findet nämlich, dass sich »Henriette« sehr nach einer feinen Lady anhört. Aber für eine Lady ist Henry doch viel zu keck! Sie versteht es, die Menschen um sich herum zu bezirzen. Und sie hat, wie Marion, ihren eigenen Kopf und ist, wie Marion, über alle Maßen stur. Thomas ist der einzige Mensch, der sich ihr gegenüber durchsetzen kann. Und das auch nur mit einer wasserdichten logischen Argumentationskette. Denn seit Henry vier Jahre alt ist, kann sie es nicht mehr leiden, wenn man sie als Kind behandelt; wenn Erwachsene glauben, sie müssten ihre Sprache kindgerecht anpassen.
Henry nimmt die Welt nicht hin, wie sie ist, sie erforscht sie. Zu allem hat sie Theorien und erklärt sich Funktionsweisen von allerlei Gerätschaften auf zwar naive, aber oft erstaunlich logische Weise.
»Na, wer bist du denn, kleine Dame?«
»Mein Name ist Henry. Ich hätte da mal eine Frage. Wie oft reinigen Sie Ihr künstliches Gebiss?«
Noch bevor Henry lesen kann, fischt sie sich Bücher aus dem Regal im Wohnzimmer und setzt sich damit auf die Couch. Sie geht gewissenhaft Zeile für Zeile durch und blättert dann um.
»Wieso tut sie so, als könnte sie schon lesen?«, flüstert Marion Thomas zu, ohne imstande zu sein, den gebannten Blick von Henry zu lösen. Gäste sind stets beeindruckt von diesem außergewöhnlichen vierjährigen Mädchen.
Noch vor der Grundschule kennt Henry ein paar Buchstaben und entziffert einzelne Wörter. Thomas und Marion lesen ihr jeden Tag vor, und Henry taucht in die Geschichten ein. Beim Frühstück oder Abendessen erzählt sie ihren Eltern die jeweilige Geschichte zu Ende. Thomas ist erstaunt über Henrys Fantasie, Marion macht sie eher Angst. Henrys Versionen der Geschichten sind zwar kindlich, drehen sich aber immer darum zu rebellieren. Hänsel und Gretel zum Beispiel gehen nicht wieder zurück zu ihrem feigen Vater, sondern gründen mit der Hexe eine Wohngemeinschaft im Wald. Wenn sie schon alle einsam im Wald leben, sollten sie doch zusammenhalten, findet Henry.
Ihr erstes Buch, das sie alleine komplett durchliest, ist Krabat. Sosehr sie der Meister in der Mühle im Koselbruch auch gruselt, kann sie es doch nicht weglegen. Das Mystische beginnt, sie zu interessieren. In der dritten Klasse liest Henry ihren ersten Stephen King. Heimlich hat sie das Buch Jahreszeiten. Herbst & Winter aus dem obersten Regal gezogen und die Geschichte »Herbstsonate« gelesen; sie handelt von Gordie, der mit seinen Kumpels eine Gang gründet. Sie machen sich mit Zelt und Ausrüstung auf den Weg, in der Wildnis die Leiche eines vermissten Jungen zu suchen.
Diese enge Freundschaft zwischen den vier Jungs, ihr Zusammenhalt und ihr Zugehörigkeitsgefühl faszinieren Henry. Und dass sie eine gemeinsame höhere Aufgabe haben – nämlich diese Leiche zu finden. Henry sehnt sich danach, solche Freunde zu haben. Aber mit dem, was ihre Mitschülerinnen interessiert – Barbies und Pokémon –, kann sie nichts anfangen. Heimlich schaut sie alte Filme im Netz und schwärmt für Die Träumer, Jules und Jim und Die Außenseiterbande.
Mit sieben Jahren beginnen Science-Fiction und Fantasy Henry in den Bann zu ziehen. Und bald bekommt sie einen dreiteiligen Liebesroman eines japanischen Autors in die Hände. Es ist die Geschichte von dem Schriftsteller Tengo und der Auftragskillerin Aomame, die seit ihrer Kindheit ineinander verliebt sind und sich erst nach 25 Jahren wiedersehen. Aber um miteinander leben zu können, geraten sie auf eine parallel existierende Erde, wo zwei Monde am Himmel stehen – nur in einer alternativen Realität finden sie zueinander. Denn alle handelnden Figuren kommen in ihrer eigenen Parallelwelt ihrem wahren Wesen näher – sei es für Tengo und Aomame die mit den zwei Monden, für die alte Dame das von der Welt abgeschottete Schmetterlingshaus oder für den namenlosen Reisenden die Stadt der Katzen, in die er sich flüchtet und nie wieder zurückkehrt.
Dieses Paralleluniversum beschäftigt Henry sehr, fühlt sie sich doch in ihrer eigenen Welt nicht immer heimisch. Sie ist davon überzeugt, dass sie durch einen blöden Irrtum in die falsche Ausgabe ihres Universums hineingeboren wurde. Oft schaut sie abends hoch in den Himmel, denkt an die beiden Monde, die Protagonisten und den langen Weg, den sie gehen mussten. Um wieder zu den Menschen zu werden, die sie als Kinder waren, als sie sich ineinander verliebt hatten. Was für ein Mensch war ich, bevor man mir gesagt hat, wer ich zu sein habe?, überlegt Henry.
Zwanzig Jahre später würde Henry ihrer Therapeutin erzählen, dass sie sich als Kind oft wie ein Schmuckstück gefühlt habe.
»Zunächst war ich ein Versehen. Ein geplatztes Kondom. Und als ich dann auf der Welt war, hatte meine Mutter eine Wochenbettdepression. Sie konnte mich nicht mal angucken. Das hat sie mir später erzählt. Aber als sie mich endlich annehmen konnte, gefiel es ihr ganz gut, ein Kind rumzeigen zu können. Ich wurde zu einem Statussymbol.«
»Das heißt, Sie glauben, Ihre Mutter erfuhr durch Sie eine narzisstische Aufwertung«, meint die Psychoanalytikerin.
»Wenn Sie das so nennen wollen.«
»Das kann man doch auch als Kompliment sehen.«
»Was soll denn daran ein Kompliment sein?« Obwohl Henry ihn verbergen will, schwingt der Trotz in ihrer Antwort mit. Sie will ihre Mutter einfach nur verurteilt wissen.
»Das Leben als Statussymbol ist ja nicht gerade leicht. Man muss funktionieren. Man muss sich einpassen.«
»Einpassen worein?«
»In das Leben anderer Leute. In dem Fall in das Leben meiner Mutter. Und um etwas Eigenes zu sein, habe ich mir dann eben selber Geschichten ausgedacht.«
»Was meinen Sie mit ›etwas Eigenes zu sein‹?«
Henry atmet genervt aus. Die Analytikerin macht das oft so: Sie stellt sich bewusst dumm, damit Henry ihre Antwort präzisiert. »Eine eigene Person. Meine Mutter wollte immer eine kleine Prinzessin haben, stattdessen kam dann ich«. Eine Trauer macht sich in Henry breit, die einer Enttäuschung ähnlich ist.
»Und was für Geschichten?«
»Ich habe sehr viel gelesen. Und mir Geschichten ausgedacht, in denen ich eine tolle Heldin war. Und die habe ich dann anderen als Realität verkauft.«
»Eine eigene Persönlichkeit hatten Sie schon, Frau Angermeier. Aber Sie hatten das Gefühl, dass sie nicht ausreicht, kann das sein? Sie wollten etwas Besonderes sein.«
Henry nickt abwesend, den Blick in die Vergangenheit gerichtet.
Die Analytikerin schließt: »Das heißt, Sie haben hochgestapelt.«
In Henry macht sich eine Erinnerung breit.
»Ich glaube, das habe ich von meiner Großmutter.« Gott hab sie selig, schiebt sie in Gedanken nach; ihre Großmutter, die große Geschichtenerzählerin. »Meine Helden aus den Büchern oder Filmen hatten alle ein spannenderes Leben als ich.«
»Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wie Sie hochgestapelt haben?«
Henry überlegt, und ein sanftes Lächeln legt sich auf ihre Lippen. »Auf einer Ferienfreizeit habe ich mal behauptet, mein Name sei nicht bloß Angermeier, sondern Gräfin von Angermeier. Dass wir in einem Schloss leben. Wir nur zu demütig sind, den vollen Titel immer zu nennen. Ich hieß dann während der ganzen Freizeit nur ›Frau Gräfin‹, das hat mir gefallen. Und später, mit Anfang zwanzig, habe ich in manchen Freundeskreisen erzählt, ich hätte schon einen Doktortitel in Psychologie und einen in Philosophie.«
»Und Ihre Freunde haben Ihnen das abgekauft?«
»Ich nehme es nicht an. Aber ich war sehr gut, ich war sehr belesen, konnte alles untermauern.«
»Das heißt, Sie haben sich selbst erhöht in Ihren Geschichten und begründen es damit, dass man Sie zu Hause nicht genug wertgeschätzt hat?«
Henry nickt düster. Wieder trifft die Frau den Nagel auf den Kopf.
»Und als Kind haben Sie sich in die Rolle eingepasst?«
Henry denkt nach. »Nein, ich habe es meiner Mutter schwer gemacht. Zumindest als Statussymbol. Aber als Kind war ich eigentlich ganz normal, soweit ich das beurteilen kann.«
»Hochstapler und Ihr Ich von früher haben etwas gemeinsam. Sie glauben, dass die Realität nicht mit ihrem Selbstbild übereinstimmt. Sie halten sich selbst für etwas Besseres, als sie gegenwärtig sind. So geht es vielen Menschen, und sie reagieren mit vielen verschiedenen Mechanismen darauf. Manche werden zusehends verdrossen und fallen dem Alkohol anheim. Andere krempeln nach und nach ihr Leben um, studieren oder leben sich künstlerisch aus. Und Hochstapler wiederum greifen in die Realität ein, indem sie Lügengeschichten von sich erzählen, um sich ihrem Selbstbild anzunähern.«
5
Mit einer Wollust, wie es nur im Herbst vorkommt, prasselt der Regen auf die Erde. Obwohl es schon dunkel ist, verfehlt er nicht seine Wirkung: Er trifft auf Dächer und Straßen, Fahrräder und Fahrradfahrer. Er bricht sich durch die herbstlichen Baumkronen Bahn bis auf den Asphalt, den er sodann überschwemmt und die Lichter von Berlin sich impressionistisch darin spiegeln lässt. Wo immer Tropfen auf eine Oberfläche treffen, entsteht eine ganz eigene Kakofonie. Pfützen bilden ein feines Grundrauschen, auf Autodächern trommeln sie, überlaufende Regenrinnen geben den Rhythmus an. Sie scheuchen späte Passanten unter Vordächer und stimmen Menschen, die noch vor die Tür wollten, kurzerhand um. Während die Menschen, die schon seit zwei Wochen die Heizungen aufgedreht haben, von einer jener Stimmungen erfasst werden, die sie sich im Sommer schon herbeisehnten. Wenn die Vorstellung, es sich bei Regenwetter mit einem heißen Getränk und einer weichen Decke auf dem Sofa gemütlich zu machen, verlockende Romantik verheißt.
Von der Rückbank aus sieht Henry aus dem Autofenster, kniet sich auf die Polster und schaut durch die Heckscheibe. Belustigt beobachtet sie die Menschen, die mit ihren scheppernden Einkaufswagen durch den Regen hasten. Und dann entdeckt sie ihre Mutter. Sie hebt zwei schwere Tüten aus dem Einkaufswagen und geht gemächlichen Schrittes zum Auto. Sie wirkt, als müsse sich der Regen eher vor ihr schützen als umgekehrt. Sie öffnet die Beifahrertür und lässt das Rauschen hinein, das die schwarze Limousine so gnädig gefiltert hat. Flutet damit die lederne Gemütlichkeit. Henry hält sich die Ohren zu.
Marion wirft einen Blick auf ihre Tochter. Da sitzt sie, blonde kurze Haare – mit einer kupierten Version eines Pferdeschwanzes –, die Füße auf den teuren Polstern. Marion greift nach hinten und zieht sie ihr von den Ledersitzen. Henry blendet geübt die Ermahnung ihrer Mutter aus. Marion startet per Druckknopf den Motor und lenkt die Limousine vom Parkplatz.
Der Mond wird es heute unmöglich schaffen, durch die Wolken zu brechen. Betrübt lehnt Henry ihre Stirn gegen die kalte Fensterscheibe. Die Stadt wischt an ihr vorbei. Der Regen verwandelt sich in dünne, mal dickere Fäden, die sich außen an der Scheibe hinabschlängeln. Sie haben etwas Verspieltes, das einem Tanz gleicht. Die Lichter der Stadt brechen sich in den Schlieren, wandern an ihnen entlang, drehen die Welt auf den Kopf. Genau so gefällt Henry diese Welt: auf dem Kopf.
Und so lässt sie sich zur Seite kippen und schläft ein. Nicht ahnend, dass, wenn sie wieder aufwacht, ihr Leben nie mehr das sein wird, was es vorher war.
An einer roten Ampel wirft Marion einen Blick auf die Rückbank. Sie lächelt – schlafend ist ihr das kleine Monster am liebsten. Sie greift nach der rauen, schwarz-weiß karierten Wolldecke, die sie sich aus dem Opel ihrer Oma genommen hatte, nachdem diese gestorben war, und die seit jeher die Autodecke war. Mit einer Hand, den Arm nach hinten ausgestreckt, entfaltet sie die Decke umständlich über dem kleinen, verletzlichen, schlafenden Körper.
Es war ein anstrengendes Wochenende, wie so viele in den letzten Monaten. Unter der Woche führen sie ihr IT-Unternehmen, das Thomas vor fünfzehn Jahren als Start-up gegründet hat und in das Marion nach ihrer Schwangerschaft als Geschäftsführerin eingestiegen ist. An den Wochenenden renovieren sie ihr kleines Landhaus in Brandenburg.
Marion braucht in ihrem Leben Struktur und Planung, schließlich hat sie oft das Gefühl, neben der Firma noch das Privatleben aller Familienmitglieder zu managen. Wie soll so ein Leben, in das sie da hineingeraten ist, auch anders zu meistern sein? Sie hatte immer fest vor, die Welt zu bereisen, Wandertouren durch den Himalaja zu machen, ihre Doktorarbeit zu schreiben, sobald Henry etwas älter wäre. Aber jetzt ist Henry etwas älter, geht schon in die siebte Klasse, doch Marions Leben hat sich weiterentwickelt. Es hat sich den Gegebenheiten angepasst. Ihre Träume von damals blieben Träume. Andere Dinge wurden Realität. Und Marion bereut nichts. Eigentlich.
Vor ihrer Berliner Stadtwohnung angekommen, hat der Regen noch immer nicht nachgelassen. Im Gegenteil, gerade jetzt dreht er noch mal so richtig auf. Marion atmet tief ein und still aus. Sie parkt in zweiter Reihe – wie immer gibt es keine freien Parkplätze. Sie will erst all die Sachen ins Haus tragen, die Werkzeuge und die Einkäufe, und dann Henry wecken. Marion marschiert um das Auto zur Beifahrertür, angelt die Tüten aus dem Fußraum und trägt sie zur Haustür. Sie schließt umständlich auf, um die Tür dann an der Wand einzuhaken.
Im Treppenhaus begegnet ihr Frau Reiser, natürlich einen Wäschekorb unter dem Arm und den immer gleichen Hauskittel an. Der Tag will es partout nicht gut mit ihr meinen.
»Ist draußen besseres Wetter?«, tönt ihre Stimme trompetengleich durch den Hausflur, »aufm Land?«
»Heute Morgen kam sogar die Sonne raus«, zwingt sich Marion zum Small Talk. Sie hasst es. Sie gehört zu jenen Menschen, die, wenn sie gefragt werden, wie es ihnen geht, lieber schweigen oder vieldeutig mit dem Kopf nicken, als mit einem ›gut, gut‹ die Wahrheit zu überspielen.
»Und wie geht’s Ihnen, Frau Angermeier? Ist schon ’ne ganz schöne Tortur, was?« Frau Reiser hat ihren Wäschekorb abgestellt. Horror! »Das ganze Muttersein, die Wohnung hier, das Haus da! Und dann noch die Firma! Dass man selbst da mal nicht zu kurz kommt!«
»Ich habe leider gerade gar keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten, Frau Reiser. Tut mir leid.« Marion steckt den Schlüssel ins Schloss der massiven Holztür im Hochparterre und stößt sie auf. »Schönen Abend noch!«
Das fahle Licht aus dem Treppenhaus erhellt den Wohnungsflur. Marion macht sich nicht die Mühe, das Deckenlicht anzuschalten, und verschwindet mit den Tüten im Halbdunkel. Der Wohnungsflur ist dunkelrot gestrichen, rechts geht die Gästetoilette und dahinter die Küche ab. Auf der linken Seite hängen Jacken in Schichten, darunter stapeln sich Schuhe, vor allem Henrys. Klack, die Beleuchtung im Hausflur geht aus. Der Flur öffnet sich zu einem weiten, im Dunkeln liegenden Wohnzimmer, das als Berliner Zimmer Straßen- und Hofseite verbindet. Dort, zum Hof, beginnt der lange Flur zu den Schlafzimmern und den beiden Badezimmern. Nach einer ganzen ruhigen Weile taucht Marion wieder auf, tritt in den Hausflur. Frau Reiser hat zum Glück ihren Weg durchs Treppenhaus fortgesetzt.
Die Szenerie, die sich Marion an der Haustür bietet, verändert ihr Leben auf immer. Später wird sie oft davon träumen und erzählen. Und auch Jahre und Jahrzehnte später wird ihr dieser Augenblick so bizarr erscheinen, wie er ihr jetzt vorkommt. Ein Bild, das man malen könnte: Der Regen bildet einen rauschenden Vorhang, vom Lichtkegel der Laterne silbrig gefärbt. Darin parkt ihr nagelneuer BMW noch immer in zweiter Reihe. Eine Gestalt, wahrscheinlich ein Mann, steht am Auto und schaut durch die Scheiben hinein, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Ein Gedanke schließt sich wie eine kalte Hand um Marions Nacken, die Erkenntnis kriecht ihr die Wirbelsäule hinauf: Sie hat das Auto nicht abgeschlossen. Sie macht jetzt zwei Dinge gleichzeitig – sucht in ihren Taschen fieberhaft, aber vergeblich nach der Fernbedienung und ruft ein lautes »Hey!« Eine Fehlentscheidung.
Die Gestalt schaut zu ihr hoch. Marion steht ein paar Stufen erhöht und keine zwanzig Meter entfernt, hat die Person im Visier, doch diese scheint tatsächlich – zu grinsen! Genau kann sie das nicht erkennen, aber etwas an der Haltung der Gestalt drückt Häme aus. Schon folgt ein Gefühl, wie wenn es in der Achterbahn nach dem Fall nach oben geht: Alles in Marions Körper sackt nach unten. Die Schwerkraft nimmt zu. Die Dinge passieren jetzt gleichzeitig und in Marions Erinnerung zäh wie in Zeitlupe: Die Gestalt öffnet die Fahrertür. Marion rennt los, rufend, dann schreiend. Der Regen dämpft ihre Stimme, und sie hat das Gefühl, gegen einen Widerstand anzurennen. Zwanzig Meter werden zu zweihundert. Der Typ steigt seelenruhig ins Auto und schließt die Tür. Die nächste Fehlentscheidung lässt Marion ums Auto herumlaufen, anstatt die näher gelegene Beifahrertür – oder noch besser die Hintertür – aufzureißen. Stattdessen erreicht Marion die Fahrertür in dem Moment, als der Mann die Verriegelung betätigt. Jetzt kann sie sehen, dass er lächelt. Marion sucht erneut ihre Jackentasche verzweifelt nach dem Schlüssel ab, hämmert mit flachen Händen gegen die Scheibe. Und jetzt hält der Mann den Grund seines siegessicheren Lächelns hoch: den Autoschlüssel. Marion hat ihn im Auto gelassen! Sie schreit durch die Scheibe, deutet auf die Rückbank. Dort sieht sie die schwarz-weiß karierte Wolldeckeund darunter ihre Tochter schlafen. Der Regen hämmert auf das Autodach.
Mit einem heiseren Raunen startet der Motor. Marion hält sich am Griff fest. Doch der Wagen fährt mit einer solchen Wucht los, dass ihr der Griff entgleitet und sie sich beinahe das Handgelenk bricht. Sie rennt dem Wagen nach, brüllt um Henrys Leben. Am Ende der Straße, schon weit von Marion entfernt, biegt der Wagen ab.
6
Kidnapper in Deutschland kommen im Jahr auf etwa 80 Entführungsvorhaben. In 20 davon belassen sie es bei dem Versuch, weil sich ihnen im Moment der Durchführung Unvorhergesehenes oder gar Zweifel in den Weg stellen, und so lassen sie vom Opfer ab. 60 allerdings werden durchgezogen. Das macht im Durchschnitt in der Woche eine Entführung. Die Polizei rühmt sich einer 90-prozentigen Aufklärungsquote, demnach kehren 6 dieser Opfer nicht in ihr Leben zurück.
Es gibt kein typisches Profil eines Durchschnittsentführers. Etwas haben aber die meisten gemein: Sie sind überwiegend männlich und blicken auf eine kriminelle Laufbahn zurück. Nur ganz wenige sind Gelegenheitstäter, die sich durch eine Schuldenlage zu der Tat drängen lassen. In den meisten Fällen begehen sie Kapitalentführungen, haben sie es doch auf ein Lösegeld abgesehen. Die Kapitalentführung zählt zu den vier Typen von Entführungen neben der Blitzentführung, wo das Opfer zum nächsten Geldautomaten gezerrt wird; dem Revenge-Kidnapping, wo ein Familienangehöriger aus Rachemotiven geklaut wird; und der Entführung aus Versehen.
In 68 Prozent der Entführungsfälle weltweit wird das Lösegeld bezahlt. 13 Prozent der Geiseln kommen ohne Zahlung frei. 9 Prozent werden befreit, 7 sterben und 3 Prozent von ihnen gelingt die Flucht.
7
Er sitzt auf dem Bürostuhl, der mit braunem Leder bespannt ist, seine besten Zeiten aber längst hinter sich hat. Auf den stählernen Schwingen schaukelt Sven hin und her, um seine Nervosität zu kanalisieren. Er trägt, wie immer in der Werkstatt, seinen Blaumann, darüber den abgewetzten grauen Kapuzenpullover. Seine Lederjacke hängt lässig über der Stuhllehne. Svens Blick wandert aus dem Fenster. Regen prasselt laut gegen die Scheiben. Sven fährt sich durch seine blonden Haare, während er zusieht, wie der Meister das Büro betritt, sich auf den Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches setzt und mit der Handkante Zigarettenasche von der Tischplatte in einen Aschenbecher fegt. Die Miene des Meisters sieht gar nicht gut aus.
»Machen wir es kurz …« Malewski atmet schwer aus, lehnt sich zurück. Sven schwant Übles. »Ich kann dich nicht übernehmen.«
Sven bleibt ruhig. Nickt langsam. »Dann war das alles nur Scheiße, was Sie mir erzählt haben.«
Malewski schüttelt leicht den Kopf. Er ist schon so lange in dem Geschäft, hat seine Kfz-Werkstatt seit 1981 hier im Kiez, sodass er schon alles gesehen hat. Typen wie Sven kennt er zuhauf und müsste lügen, wenn er behaupten würde, er käme mit denen nicht klar. Und ausgerechnet Sven mag er extrem gerne. Der Kerl ist in Ordnung. Er ist schlau, aber faul.
»Siehst du die hier?«, der Meister zeigt auf einen Stapel von Dokumentenhüllen, »das sind alles Bewerbungen, die über das Jobcenter gekommen sind.« Er nimmt die oberste vom Stapel und öffnet sie. Von einem Passbild schaut Sven ein Milchbubi mit Migrationshintergrund an – Afghanistan oder Nordafrika. »Murat hier will Mechatroniker werden. Er hat seinen Realschulabschluss in der Tasche. Vielleicht solltest du deinen auch …«
»N’ Scheiß sollte ich.« Sven stößt eine Winkekatze an ihrem Arm. Dieses hübsche Modell winkt allerdings nicht wie die meisten seiner Artgenossen freundlich Kundschaft herein, sondern hebt unentwegt seinen Mittelfinger. »Sie haben gesagt, ich hab was drauf. Sie haben gesagt, ich kann übernommen werden.«
»Ich habe aber auch gesagt, hol erst mal deinen Realschulabschluss nach. Wie alt bist du? 27?«
Sven wird laut: »Ich bin besser als die meisten hier. Guck dir doch mal Erik an, der kann nicht mal bis vier zählen. Soll der nur Motorradreifen wechseln oder was? Und wenn er doch bis vier zählen kann, bleibt er bei zwei steck-, steck-, stecken.«
Der Meister schmunzelt. Ja, der Typ hat was drauf.
»Hör zu, bring mir einen Abschluss, und du kannst hier anfangen.«
»Sie haben gesagt, Sie übernehmen mich. Aber das war nur Scheiße dahergelabert, damit ich hier die Drecksarbeit mache.« Sven deutet mit einem Kopfnicken auf den Stapel mit den Bewerbungen. »Aber da finden Sie bestimmt ’n neuen Idioten, der Ihnen das abnimmt.« Sven hält es nicht mehr auf dem Stuhl aus. Er geht ans Fenster, schaut in den Regen. Er denkt an Nadja. Er holt aus und schlägt mit der Faust gegen die Wand. »Fuck!«
»Bist du fertig?« Malewski lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Weißt du was, fick dich doch in deinen fetten Arsch.« Sven tritt gegen den Bürostuhl, der scheppernd umkippt, verlässt das Büro, schlägt die Tür laut hinter sich zu. Erik steht in seinem verschmierten »Malewski Autowerkstatt«-Blaumann an einem aufgebockten Toyota Corolla, schaut zu Sven und dreht einen Schraubenzieher zwischen seinen Fingern.
»Ich fin-, fin-, finde es schade, dass du immer so l-, l-, laut …«, sein Stottern bricht nicht seinen Stolz.
Sven stürmt auf ihn zu. Seinen drohenden Zeigefinger hält er direkt vor Eriks Nase. Erik spricht nicht weiter, die beiden Männer starren sich an. Dann lässt Sven seinen Arm sinken.
»Komm her.« Sven umarmt Erik, und der lässt es zu.
»Ich werd dich v-, v-, v-…«
»Ich dich auch. Ich komm wieder.« Sie klopfen sich auf die Schultern. Als er sich von seinem Kollegen löst, sieht er den Meister in der Bürotür stehen.
»Ich bin 26. Und sorry für den fetten Arsch.«
Der Meister zuckt mit den Schultern. »Wo du recht hast, hast du recht.«
Sven setzt sein Winner-Smile auf. »Ich habe immer recht.«
Sven zieht die Kapuze ins Gesicht und weiß nicht, was er tun soll. Das Gefühl, ein Verlierer zu sein, sitzt tief in seiner Brust. Er kann es förmlich spüren. Es ist rund, schwarz und hinterlässt einen Abdruck von Machtlosigkeit. Sein Leben ist im Arsch, denkt er. Nadja hält es jetzt schon den dritten Tag durch, er hat keine Lust mehr, auf der Couch zu schlafen. Eigentlich will sie, dass er heute auszieht. Das Wochenende war nur noch eine Gnadenfrist. Aber zurück zu seiner Mutter will er natürlich auf keinen Fall. Sie hat genug Sorgen, ist seit Kurzem Filialleiterin. Zwar verdient sie unwesentlich mehr Geld, bekommt aber wesentlich mehr Ärger, wenn etwas schiefgeht.
»Schade, dass wir kein Auto haben«, meinte sie müde lächelnd, als Sven ihr von seinem Job in der Werkstatt erzählt hat, »sonst könntest du es uns reparieren.«
»Nicht mehr lange, und dann werde ich dir ein Auto kaufen, Mama.« Sven war ganz euphorisch. Ihm war klar, dieses Mal durfte er seine Mutter nicht wieder enttäuschen.
»Ach, was soll ich denn mit einem Auto?«
»Mal rausfahren oder ans Meer.« Seine Mutter hat ein Leben lang hart für sie beide gearbeitet. Sven will ihr etwas zurückzahlen, will, dass es ihr gut geht. Aber tief in sich drin weiß er, dass er ihr die größte Freude mit einem ordentlichen Job und einem geregelten Leben machen würde.
»Ich bin eigentlich gerne hier bei uns zu Haus«, hat sie geantwortet.
Seit sie seinen Vater beerdigt hatten, als Sven noch ein Kind war, gab es keinen anderen Mann mehr an der Seite seiner Mutter. Der Kampf gegen den Krebs ihres Mannes hatte sie ermüdet. Als Svens Vater schließlich starb, war mit ihm auch etwas in seiner Mutter gestorben. Sven hätte es niemals zugegeben, aber seine Mutter war seitdem nur noch eine leere Hülle. Ein Roboter, der zur Arbeit ging, kochte; Dinge sagte, welche vom Leben müde Mütter sagen.
In seiner Jugend hatten sich die wenigen deutschstämmigen Jungs in Svens Heimatkiez bald zu einer Gang zusammengeschlossen – seine Mutter nannte sie immer »Bande«. Es war nie wirklich gefährlich auf der Straße, sie kamen sogar ganz gut mit den nicht deutschen Clans aus – Polen oder Albaner. Bis auf ein paar wenige Prügeleien glich es eher einer Zweckgemeinschaft. Sie deckten sich gegenseitig vor der Polizei, tauschten »Güter« aus – wahlweise zum Rauchen oder zum Durch-die-Nase-Ziehen. Die Gründe, die zu handfesten Auseinandersetzungen führten, waren die Mädels, die nicht selten die kleinen Schwestern der Gegenseite waren. Sven machte da immer alles richtig. Mit dreizehn Jahren verlor er seine Jungfräulichkeit an eine vermutlich nymphomane Fünfzehnjährige aus Cz˛estochowa, die schon aussah wie achtzehn. Seitdem war er kein Kind von Traurigkeit. Und er schaffte es dabei immer, seine Affären so zu führen, dass sich die Mädchen nicht zu sehr in ihn verliebten, ihn aber am Ende auch nicht hassten. Irgendwann verstand er es, die perfekte Mischung aus Charme, Sex-Appeal und Unverbindlichkeit an den Tag zu legen. Ihm ging es doch nie um den »reinen Vollzug«, wie es sein Kumpel Pavel immer nannte: Cover the face and fuck the base. Nein, er interessierte sich für den Menschen, hatte ein echtes, ungeheucheltes Interesse an den Mädchen, unterhielt sich gern mit ihnen. Und zwischen den Gesprächen besorgte er es ihnen aufs Feinste.
Den wenigen Geschichten und noch rareren Andeutungen seiner Mutter zufolge mochte er diesen Charakterzug durchaus von seinem Vater haben: ein Händchen fürs andere Geschlecht.
Und dann lernte er Nadja kennen. Er gerade mal 21, sie 24, der perfekte Altersunterschied. So gab es auf einmal neben seiner Mutter noch eine weitere Frau in seinem Leben, für die er sich anstrengen wollte.
Sven zündet sich eine Zigarette an. Der Regen hat nicht nachgelassen, er stellt sich an einer Bushaltestelle unter. Nadja ist einfach die perfekte Frau für ihn. Sie ist verantwortungsbewusst, intelligent, zielstrebig; weiß, was sie will. Auch im Bett. Wenn es normalerweise so läuft, dass er die Mädels überrascht – einfach mit der Art, wie er ist, wie er sie beim Sex komplett erfasst –, hat es Nadja nun ihrerseits geschafft, ihn zu überraschen. Sie ist nicht satt zu kriegen, holt sich, was sie braucht. Ist alles andere als ein Opfer. Opfer kann er im Bett nicht ausstehen. Einfach nur daliegen und es ihm überlassen.
In Svens Tasche vibriert es, er schaut auf sein Handy. Mona schreibt.
»Zeit?«
Die Gedanken haben Sven horny gemacht.
»Klar. Jetzt?«
»👍«
Sven zieht noch einmal an der Kippe, schnippt sie in einem Bogen vor sich und kickt sie aus dem Flug ins Gebüsch. Er macht sich zu Fuß auf den Weg. Nach zehn Minuten klingelt er an einer Tür.
»Ja?«, kommt Monas Stimme aus der Sprechanlage.
»Ich«, sagt Sven.
Der Summer ertönt, Sven drückt die Tür auf. Im Treppenhaus riecht es nach Schwimmbad. Er geht in den zweiten Stock, die Tür ist angelehnt. Mona kommt aus dem Bad, sie trägt einen Slip und ein T-Shirt.
»Du bist ja meganass.«
Sven nickt und zieht seine Jacke aus, löst die Schulterhalter des Blaumanns. Mona schlendert an ihm vorbei in Richtung Wohnzimmer, nicht ohne ihm einen Kuss zu geben.
»Alles gut?«
»Jap.« Sven folgt ihr.
Mona legt das Handtuch auf die Couch. »Ich hab heute Lust auf Reiten.«
Sven zieht sich sein Shirt aus und Mona ihres. Und wie er so seine Schuhe abstreift, noch in den nachmittäglichen Gedanken verhaftet, fasst er an ihre Brust.
Fünf Minuten später. Mona hat noch ihren Slip an. Sie sitzt barbusig auf der Couch und tröstet Sven. Mitten im Vorspiel hatte Mona ihn kurz gefragt: »Wie geht’s Nadja?« Und auf einmal hatte Sven angefangen zu weinen. Jetzt sitzen sie da, er verheult, kaut auf dem kleinen halbmondförmigen Anhänger an seinem Goldkettchen herum, Mona streichelt ihm über den Arm.
»Überrasch sie. Mach etwas, womit sie nicht rechnet. Lass sie über dich lachen.«
»Lachen?«
»Ja, aber so, dass sie dich süß findet.« Mona lehnt sich zurück. »Wir Frauen sind nicht so leicht … also … wir wollen ständig eine Bestätigung, dass wir die Queen sind, ja? Aber nicht zu viel. Du darfst nicht zu sub sein und immer alles raffen, was wir sagen, und jeden Wunsch erfüllen. Bäh, ich hasse solche Männer. Krieg dann immer ein schlechtes Gewissen. Aber aufmerksam sein und in den richtigen Momenten verstehen, was Sache ist. Nicht zu viele Gefühle zeigen, aber es ab und zu mal sagen.«
»OK«. Er nickt, überlegt, nickt wieder, »was sagen?«
»Dass wir die Queen sind.«
»Wie jetzt? ›Du bist die Queen‹?«
»Alta, ›ich liebe dich‹ sollst du sagen.«
»Ach so.« Sven schaut auf seine Socken. Erst jetzt, wo Nadja es durchzieht, merkt er, wie sehr er sie liebt.
»Na ja, und dann wollen wir, dass du uns zeigst, dass du auch ein guter Jäger und Sammler bist.«
»Was für’n Scheiß?« Seine Stimme klingt belegt.
»Rat doch mal, was wir suchen, wenn wir abends in den Club gehen und uns die Augen schön schminken …«. Sie macht eine kurze Pause, um mit beiden Zeigefingern die Wimpern am linken und rechten Auge nach oben zu drücken. Um den Effekt zu verstärken, zieht sie die Lippen nach unten und macht das Gesicht lang. »Und wenn wir uns die Haare geil machen und was Schönes anziehen. Rat doch mal, warum Mädels das machen.« Sie streicht sich die Haare hinter die linke Schulter und zieht ihre Beine angewinkelt hoch auf die Couch.
In Sven arbeitet es. »Um was zu ficken zu finden.«
Mona atmet hohl aus. »Glaubst du etwa, wir sind alles Schlampen?«
Sven beißt sich auf die Unterlippe. Er fasst ihr an eine der nackten Brüste, aber sie haut ihm die Hand weg. »Jetzt reden wir. Rat noch mal.«
Sven atmet schwer ein und aus. »Weil ihr’nen Freund wollt.«
»Das ist aber nicht alles.«
»Sondern?«
»Ich verrate dir jetzt etwas, das musst du aber für dich behalten. Sonst würde uns kein Typ mehr anfassen.« Mona grinst Sven an.
»Verarschst du mich oder was?«
Mona schüttelt den Kopf. »Nee.« Sie beugt sich näher zu ihm, und ihr Ton bekommt etwas Konspiratives: »Wir sind dauernd nur auf der Suche nach jemandem, dem wir zutrauen, der beste Vater für unsere Kinder zu sein, die wir dann mit dem kriegen wollen.«
Sven legt die Stirn in Falten. »Alta? Ihr wollt uns also nur Kinder unterjubeln?«
»Was heißt hier unterjubeln. Ihr sollt die auch gefälligst mit uns machen wollen. Du hast es noch nicht gecheckt, oder? Wir suchen den perfekten Mann und Vater unserer ungeborenen Kinder. Jäger und Sammler. Er soll geil sein, im Bett was draufhaben, gut aussehen, guten Schwanz, nicht so’nen hässlichen, der nur pikst. Deiner ist hübsch. Und er soll’n geilen Beruf haben, wissen, was er will, und Ziele haben. Er soll nicht kriminell sein, aber das kann man sich nicht immer aussuchen. Hauptsache erfolgreich.«
Sven pustet aus vollen Wangen die Luft aus. »Ja, is besser, dass du das sonst keinem Typen erzählst. Wir würden nicht mehr in Clubs gehen, sondern nur noch zu Hause bleiben und zocken, Digga.«
Mona nickt wissend. »Weißt du, was das Problem ist? Ihr seid alle feige.«
»Ey!«
»Wieso, stimmt doch. Ihr sucht nur irgend so ’ne Pussy, um euren Schwanz da reinzustecken und danach schnell das Weite zu suchen oder abzuhauen.«
»Das ist das Gleiche.«
»Was?«
»Das Weite suchen und abhauen.«
»Was geht denn mit dir?! Ja, immer nur unverbindlich. Aber auf unverbindlich haben wir auf Dauer keinen Bock. Wir wollen …«, sie sucht ein Wort, »Perspektive.«
»Also, was soll ich jetzt machen, mit Nadja?«
»Frag nach einem Zeichen.«
»Ein Zeichen?«
»Genau.«
»Von Nadja?«
»Nee. Dem lieben Gott.«
»What?«
»Ja. Oder egal von wem. Oder von deinem Herzen oder dem Universum, keine Ahnung. So, wir fragen jetzt nach einem Zeichen.« Mona schließt die Augen, bleibt ganz ernst, Sven sucht in ihrem Gesicht nach etwas, das auf einen Joke hindeutet. Mona streckt ihren Rücken durch, setzt sich gerade hin, und Sven macht es ihr unbewusst nach. Im Schneidersitz atmet sie drei Mal durch die Nase ein und durch die gespitzten Lippen aus. Sven beobachtet sie distanziert. Dann legt sie, ohne aufzuschauen, beide Hände an Svens Wangen. Er zieht die Stirn kraus.
»Was machst du da?«
»Pscht.« Nach einer kurzen Weile atmet Mona schwer aus, schlackert ihre Hände aus, »so.«
»Was war das denn?«
»Ich hab um ein Zeichen gebeten. Wenn du Nadja liebst, beeindrucke sie. Jetzt geht’s nicht mehr darum, ob du es ihr gut besorgst. Jetzt musst du ihr zeigen, dass du ’ne Perspektive gibst, ein guter Jäger und Sammler bist.«
»Klasse. Dann kann ich ja unterwegs zu ihr noch ein paar Beeren pflücken.«
8
Als Sven nach draußen tritt, ist es schon dunkel, und der Regen hat sich in eine regelrechte Sturzflut verwandelt. Sven zieht sich die Kapuze tief ins Gesicht, aber trotzdem sind seine Klamotten binnen weniger Minuten klatschnass. Von dem, was Mona erzählt hat, fühlt er sich eigentümlich beseelt. In ihm macht sich das Gefühl breit, dass er im Leben etwas leisten kann. Ja, dass er gar zu etwas berufen ist. Er wünscht sich ein Zeichen. Wenn es einen lieben Gott gibt, soll er ihm gefälligst eines schicken.
Autos sind seine Leidenschaft, und wenn er mit Autos arbeitet, verschmilzt er mit ihnen zu einer Einheit. Zwar nicht wie ein Transformer, aber mental. Er weiß intuitiv, wie er ein mechanisches Problem angehen muss. Und es erfüllt ihn mit Genugtuung, das Problem zu beheben.
Sven gibt sich ganz seinen Gedanken hin, und der Autopilot übernimmt den Heimweg. Doch auf einmal bemerkt er ihn. Svens Herz setzt einen Schlag aus, seine Atmung flacht ab. Er überquert die Straße, merkt kaum mehr den Regen, und da steht er vor einem dunkelblauen BMW M5. Langsam, aber innerlich hocherregt, läuft er um das Fahrzeug herum wie ein pubertierendes Mädchen um Michelangelos David. xDrive. Diese Limousine hat bis zu 625 PS und schafft es von null auf hundert in 3,3 Sekunden. Auf freier Strecke kommt sie auf über 300 km/h. Sie ist ein Wunder. Sven legt die Hand auf ihre kalten, regennassen Rundungen. Typisch für die Leute hier in Wilmersdorf. Haben zu viel Geld und kaufen sich so eine geile Kiste, aber können sie die überhaupt richtig würdigen? Er beugt sich runter, um die vier Auspuffrohre zu mustern.
»Du bist ja noch ganz neu«, flüstert Sven liebevoll.
Allradsystem. Damit fährst du Kurven bei ’ner krassen Geschwindigkeit, sagt er sich und berührt mit den Fingern das dreifarbige M5-Symbol, erschaudert. Diese Schönheit, die hier vor dir steht, kostet weit über hunderttausend Euro. Scheiße, wenn du so viel Geld übrig hättest!
Sven tritt einen Schritt von dieser Limousine weg, legt den Kopf schief und schaut sich sachte lächelnd die bei diesem Modell ausgeprägte Schattenlinie an. Fährt mit der Hand daran entlang, und wieder überträgt sich auf ihn das Gefühl der Einheit, das sich nur dadurch toppen ließe, wenn er sich ans Lenkrad setzen und es mit beiden Händen umfassen würde. Seine Hand streift den hinteren Türgriff, um dann beim vorderen anzuhalten. Schon allein die Tür zu entriegeln, würde ihm ein Gefühl von Befriedigung geben. Der Moment, in dem durch den komplizierten Dialog von Elektronik und Hydraulik das Schloss enthakt und die Tür freigibt – er zieht leicht den Türgriff nach außen.
Das Beschriebene passiert.
Sven erschrickt – das Auto ist nicht abgeschlossen! Er wird sich seiner Träumerei bewusst, kommt zu sich, drückt die Tür beinahe peinlich berührt und mit einem Gefühl des Erwischtwerdens wieder zu. Sein Blick wandert in den jetzt matt beleuchteten Innenraum. Tatsächlich! Dort liegt der Schlüssel auf der Ablage. Sven weiß, dass bei diesen Modellen der Fahrer den Schlüssel nicht in ein Zündschloss stecken muss, sondern ihn nur in der Nähe eines Sensors aufbewahren braucht. Und wenn er sich – mit dem Schlüssel – vom Auto entfernt, verriegelt es sich automatisch.
Das Licht erlischt wieder und mit ihm der Traum, sich in das Auto zu setzen, das Leder zu riechen, das Lenkrad kräftig zu umfassen, sich von der Sitzheizung wärmen zu lassen. Ein Ruf lässt ihn aufblicken. Da steht eine Frau im Hauseingang, keine zwanzig Meter von ihm entfernt. Genauso vom Regen durchnässt wie er. Meine Güte, was regt die sich so auf! Als wolle er das Auto klauen. Schließt das Auto nicht ab und glaubt, nur weil er nicht so schick angezogen ist wie sie, dass er … Jetzt rennt sie los. Was hat sie denn vor? Was glaubt sie, was er tun will? Und wenn sie dann hier ist? Stößt sie ihn weg von ihrem Heiligtum auf vier Rädern? Während die Furie auf ihn zugerannt kommt, ringen in Sven Trotz und Belustigung miteinander. Und ehe er sich’s versieht, hat er schon die Autotür geöffnet, lässt sich auf den Sitz gleiten, und die Tür schließt sich mit einem saugenden Geräusch. Und wie er da diese Frau beobachtet, die um das Auto herumrennt, empfindet er eine Berechtigung, tun zu dürfen, was er jetzt tut. Da geht einer Wilmersdorfer Hausfrau mal so ordentlich der Arsch auf Grundeis, denkt er. Sie sieht aus, als hätte sie noch nie wirklich arbeiten müssen – so dünn, so durchnässt, so zerbrechlich. Sven stellt sich vor, wie sie es ihrem Macker heute Abend beichten muss.
»Du Schatz, mein Auto ist weg.«
»Wie weg?«
»Ach, ich hab es nicht abgeschlossen. Da hat sich dann jemand anderes reingesetzt.«
»Nicht so schlimm, mein Liebling, dann nimmst du halt den Range Rover.«
»Was? Willst du mich verarschen? Damit finde ich nie einen Parkplatz.«
Wie aus einem Automatismus heraus betätigt Sven die Türverriegelung und muss immer noch über seine Gedanken schmunzeln, als die Frau die Tür erreicht und an dem Griff zerrt.
Svens Finger wandert auf den Startknopf. Was ruft sie denn da? Der Regen übertönt ihre Schreie, nicht aber das Klopfen. Ist die bescheuert? Will die die Scheiben einschlagen, nur um an ihr geliebtes Auto zu kommen? Er wollte sich doch nur mal kurz reinsetzen, um ihr eins auszuwischen. Einfach ein kleiner Denkzettel.