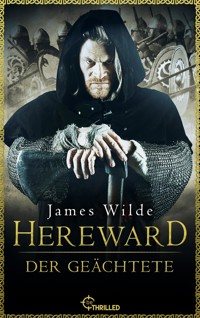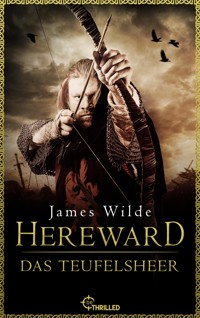
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hereward-Serie
- Sprache: Deutsch
In der dunkelsten Stunde führt er sie an: Hereward, Englands letzte Hoffnung!
England, 1067. Die Schlacht von Hastings wurde verloren, und Harald II., der letzte angelsächsische König, ist tot. Der neue König, Wilhelm der Bastard aus der Normandie, regiert England mit eiserner Hand: Dörfer werden verwüstet, die Bewohner hingerichtet. Doch es gibt einen Mann, der sich dem brutalen Eroberer in den Weg stellt: Hereward. In den Fenlands, dem sumpfigen Waldgebiet im Osten, schwelt Herewards Widerstand. Sein Heer aus Verbannten wächst stetig und erzielt kleine militärische Erfolge. Als der normannische König davon erfährt, entsendet er seine grausamsten Kämpfer, um die Rebellen zu vernichten. Können Hereward und seine Mannen der Übermacht trotzen?
»Brutal und blutig. James Wilde haucht dem angelsächsischen Helden Hereward neues Leben ein.« BBC HISTORY
Actionreiches Historienepos um den angelsächsischen Widerstandskämpfer Hereward, der sich gegen die normannische Eroberung Englands in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts auflehnte und daher zu den großen Legendengestalten des englischen Mittelalters zählt.
Band 1: Hereward der Geächtete
Band 2: Hereward: Das Teufelsheer
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Historische Anmerkung
Danksagung
Über den Autor
Weiterer Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
England, 1067. Die Schlacht von Hastings wurde verloren, und Harald II., der letzte angelsächsische König, ist tot. Der neue König, Wilhelm der Bastard aus der Normandie, regiert England mit eiserner Hand: Dörfer werden verwüstet, die Bewohner hingerichtet. Doch es gibt einen Mann, der sich dem brutalen Eroberer in den Weg stellt: Hereward. In den Fenlands, dem sumpfigen Waldgebiet im Osten, schwelt Herewards Widerstand. Sein Heer aus Verbannten wächst stetig und erzielt kleine militärische Erfolge. Als der normannische König davon erfährt, entsendet er seine grausamsten Kämpfer, um die Rebellen zu vernichten. Können Hereward und seine Mannen der Übermacht trotzen?
James Wilde
HEREWARD
DAS TEUFELSHEER
Aus dem britischen Englisch von Dr. Helmut Pesch
Für die Raben und Dohlen.
KAPITEL 1
Ostanglien23. Juni 1069
Die Endzeit war gekommen, und die Welt wandte sich vom Licht ab.
Über den Sümpfen ging die Sonne in einem blutroten Dunst unter. Schwarze Wolken von Mücken tanzten über den stinkenden Marschen, und zwischen den Eschen und Weiden vertieften sich die Schatten, als die Rotte stummer englischer Krieger ihren taumelnden Gefangenen wie ein Schwein, das man zum Schlachter führte, mit den Speeren vor sich hertrieb. Auf dem schweißbefleckten Wams des Normannen erblühten Blutrosen. Sein Kettenpanzer und Helm waren vor langer Zeit in das alles verschlingende Moor geschleudert worden und darin verschwunden. Sein doppelschneidiges Schwert jedoch hatte einer seiner verhassten Feinde für sich beansprucht. Wie ein geprügelter Hund fauchte er seine Peiniger an, und bei jedem neuen Speerstich in seinen geschundenen Rücken huschte sein Blick erneut zu jener kostbaren Klinge hinüber.
Auf dem Dammweg stolperte er und fiel; an den spitzen Steinen riss er sich die Hände auf. »Steh auf! Oder stirb!«, bellte einer seiner Entführer. Falls er die Sprache verstand, dann zeigte er es nicht. Aber die Speere stießen wieder zu, beharrlicher diesmal, und drängten ihn, den atemlosen Trab über die trostlosen Moore wiederaufzunehmen. Er zeigte den verhassten Engländern – es waren ihrer zehn – ein kaltes Gesicht. Ihre blassen Augen flackerten im Feuer des blutroten Himmels. Dann schluckte er und raffte sich auf müden Beinen hoch, um weiterzulaufen.
Als sie die nächste bewaldete Insel erreicht hatten, hob Hereward den rechten Arm, um die Marschkolonne zum Halten zu bringen. Er war der Anführer der Gruppe, ein Mercier von Geburt; sein helles Haar und seine blaue Augen zeugten von dänischem Blut. Tätowierte Kriegermale – Spiralen und Kreise – zogen sich um seine Arme und wanden sich wie Schlangen, wenn er die Muskeln spannte.
Als seine müden Männer keuchend zu Boden sanken, sah er, dass die Angst ihnen tiefe Falten ins Gesicht gegraben hatte. Sie waren Jäger, aber auch Gejagte. Er blickte zurück auf den Weg in die sich vertiefende Dunkelheit. Der Tod war nah und kam jeden Augenblick näher.
»Trinkt, rastet, und fasst Mut!«, rief er, während er unter den erschöpften Kriegern umherging. »Der Weg war hart, und ihr seid gut gerannt, aber wir werden von Hunden gehetzt und dürfen nicht säumen.«
Am Rande der Kriegerschar saß der Gefangene in dumpfem Grübeln. Hereward kniff die Augen zusammen und verfolgte jede Bewegung des Mannes. Wie Stein sind diese normannischen Bastarde, genauso hart und kalt, dachte er. Aber sie werden irgendwann zerbrechen. Die Hämmer der Engländer werden niemals ruhen.
In der Art, wie der Gefangene das Kinn hob, sah Hereward die ganze Überheblichkeit der Eindringlinge, die England über drei lange Jahre hinweg verwüstet hatten, seit Wilhelm der Bastard die Krone an sich gerissen hatte. In dem unnachgiebigen Blick drückte sich die ganze Brutalität aus, die das Blut von Männern, Frauen und Kindern vergossen, ganze Dörfer niedergebrannt und denen, die sich nur durch mühsame Arbeit vor dem Verhungern bewahren konnten, die Existenzgrundlage genommen hatte. Er schüttelte voller Verachtung den Kopf.
Der Mercier bückte sich und trat unter die Trauerweiden am Wegrand. Mit dem Handrücken wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Seine Männer netzten sich mit Wasser aus ihren ledernen Trinkbeuteln die Kehlen und spritzten es auf ihre glühenden Gesichter. Dieser Sommer war heißer als die Hölle. Die Hitze drückte sie am Tag nieder und erstickte sie in den schweißtreibenden Nächten. Und es war erst kurz vor Johannis, mit der Aussicht auf viele weitere Wochen der warmen Jahreszeit. Vielleicht war dieses grausame Wetter ein weiteres Zeichen der Endzeit, wie die alten Frauen munkelten.
Als ob seine Gebete erhört worden wären, wisperte eine kühlende Brise durch die raschelnden Blätter. Er blickte über die spiegelnden Gewässer der Moore, die im Abendlicht scharlachrot leuchteten. Schwarzköpfige Möwen schienen den Kriegern zuzurufen: Flieht! Flieht!, während sie über ihnen kreisten.
Hereward trank einen Schluck Wasser. Während er sich über den Mund wischte, sah er Swithun am Fuß einer Eiche sitzen. Mitleid ergriff ihn. Das Gesicht des jungen Kriegers war aschfahl, sein braunes Haar strähnig vor Schweiß, seine Augenlider flatterten. Die linke Seite seines Wamses war schwarz und voller Blut. Hereward ging zu dem Verwundeten hinüber und hockte sich neben ihn nieder.
»Es ist nicht mehr weit bis Ely«, sagte der Mercier leise. »Lass dich nicht unterkriegen. Der Bader wird dich bald mit seinen stinkenden Brühen und Pasten heilen.«
Swithun lächelte matt ob der beruhigenden Worte seines Anführers. Aber nach einem Moment schüttelte er den Kopf und runzelte die Stirn. »Ihr müsst mich zurücklassen. Ich bin eine Last.«
Hereward legte eine tröstende Hand auf die Schulter des jungen Mannes. »Wir lassen niemanden zurück.«
Der Verwundete protestierte mit einer Stimme, die wie trockene Blätter knisterte. »Fromund muss mich jetzt fast tragen, so schwach bin ich. Wenn die Normannen kommen, könnt ihr ihnen nicht davonlaufen, wenn ihr mich wie ein totes Schwein auf den Schultern mitschleppt.«
»Wir lassen niemanden zurück«, beharrte der Mercier. Er hielt Swithuns Blick stand und fügte mit warmer Stimme hinzu: »Von allen unseren Schlachtwölfen kämpfst du am tapfersten. Ohne deinen Speer hätten wir unseren Gefangenen nicht gefasst.«
Swithun lächelte abermals, schloss die Augen und lehnte den Kopf an den Baumstamm. Hereward erhob sich und wandte sich ab, um seine Besorgnis zu verbergen. Der Kampfschweiß, der das Wams des Mannes befleckte, breitete sich immer noch zu schnell aus. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit.
Hereward schritt zu den Weiden zurück und warf im Vorbeigehen einen Blick auf seine Männer. In den hochgezogenen Schultern und hohläugigen Gesichtern sah er ihre Erschöpfung. Sie waren nun schon zu lange auf der Flucht, dem Tod immer nur um Armeslänge voraus. Viele fürchteten, sie würden nicht mehr lange genug leben, um ihr Zuhause noch einmal wiederzusehen.
»Der Gefangene verheimlicht etwas. Man kann es in seinen Augen sehen.« Die wispernde Stimme gehörte Alric, dem Mönch. In den sieben Sommern, seit sie sich das erste Mal in einer bitteren nordhumbrischen Nacht begegnet waren, hatte sein schmales Gesicht die weiche Blässe verloren. Sorgenfalten zeichneten jetzt seine Stirn, und eine Narbe zierte seine Schläfe. Er wies mit einem Nicken auf den gefangenen Soldaten und legte eine Hand über den Mund, damit die anderen Männer ihn nicht hören konnten. »Hereward, ich habe Angst«, hauchte er. »Wir sind auf allen Seiten von Feinden umgeben. Was ist, wenn wir geradewegs in eine Falle hineinlaufen?«
»Jeder Schritt, den wir jetzt tun, birgt Gefahren«, gab Hereward ebenso leise zurück. Sein Gesicht zeigte keine Regung, aber seine Augen durchforschten unaufhörlich das einsame Land aus Wasser und Wald. So viele Orte, an denen sich eine Bedrohung verbergen könnte. Sie würden nichts ahnen, bis die Gefahr zum Greifen nahe war. Er lächelte. »Lass sie kommen. Mein Schwert, Hirnbeißer, dürstet nach mehr normannischem Blut.«
Er konnte sehen, dass seine Großspurigkeit nicht, wie von ihm erhofft, die Besorgnis seines Freundes beigelegt hatte, und wandte sich wieder dem Gefangenen zu. Die normannischen Kämpfer hielten sich immer für besser als die bierseligen, schwachbrüstigen Engländer, aber der hier war anders. Seine scharfen Augen hielten jeden Winkel der Bäume im Blick. Ein Lächeln flackerte um die Lippen des Mannes, verschwunden in einem Augenblick, als er unhörbar etwas vor sich hinmurmelte, ein Gebet oder einen Fluch.
»Tu ihm nichts«, beschwor der Mönch Hereward, als könnte er die Gedanken des Merciers lesen.
»Und du meinst, die Normannen würden uns dieselbe Güte zeigen, wenn sie allen, die gegen ihre Herrschaft auch nur die Stimme erheben, die Hände und Füße abschneiden?«
»Würdest du lieber ein Normanne sein?«
»Ich möchte jedenfalls kein Mönch sein«, gab Hereward spöttisch zurück. »Der einzige Mann, der ein Festgelage in eine Beerdigung verwandeln kann.«
Alric schüttelte müde den Kopf. Er war es gewohnt, dass sein Freund ihn hänselte. »Du hast dich sehr verändert, seit wir uns das erste Mal sahen. Du bist nicht mehr das wilde Tier, das einem Wolf mit seinen eigenen Zähnen die Kehle herausreißen würde. Du bist klug geworden«, sagte er in einem übertriebenen ungläubigen Tonfall, »ein Mann, der keine Angst davor hat, Güte und Freundlichkeit zu zeigen. Ein guter Anführer. Hätten die Engländer hier im Osten gegen die Männer des Königs den Kopf riskiert, wenn ein anderer sie befehligen würde?«
Hereward knurrte verlegen. Der Mönch kannte seine Schwachstelle. »Ich töte Normannen. Mehr nicht.«
Alric gab ob dieser Bemerkung ein unfreiwilliges Kichern von sich, und als dies erstarb, wurde er wieder ernst. »War es klug, diesen Mann so weit weg von zu Hause gefangen zu nehmen? Die Normannen sind wie hungrige Hunde, wenn man sie herausgefordert hat; das weißt du genauso gut wie ich. Sie werden nicht rasten, bis sie ihren Kameraden zurückgeholt oder ihn gerächt haben. Ich habe noch nie Menschen wie sie gekannt.«
»Wenn wir seine Zunge gelockert haben, wird er uns alles erzählen, was er über die Strategie der Normannen weiß: ihre Anzahl, ihre Nachschublinien und ihre Pläne, unseren Widerstand zu zerschlagen.«
Der Mönch richtete einen zweifelnden Blick auf seinen Freund. »Es gibt viele Normannen im Umkreis von Ely. Warum nicht einer von denen? Und dann müsstest du nicht durch die Nacht marschieren und unseren Feinden Zeit geben, uns zu jagen, hier draußen, wo wir uns nur schwer verteidigen können.«
Hereward bedachte ihn erneut mit einem spöttischen Seitenblick. »Bist du etwa auch ein Krieger geworden wie einige dieser normannischen Priester, von denen man so viel hört?«
Alric furchte die Stirn, unwillig, sich von Herewards Humor anstecken zu lassen. Er drehte sich langsam um und sah an den länger werdenden Schatten vorbei zu den still daliegenden Sümpfen, Tümpeln und Wäldern. »Du lachst, aber ich habe genug Zeit in deiner Gesellschaft verbracht, um zu wissen, wenn etwas schiefläuft. Kannst du es nicht fühlen? Ich habe Gänsehaut bekommen, und in meinem Magen dreht sich alles wie in einem Butterfass.« Er schluckte. »Unsere Feinde sind irgendwo da draußen, wo sie uns ganz gewiss beobachten und auf den Moment warten, in dem sie über uns herfallen und uns vernichten können.«
»Ist dein Glaube so schwach, Mönch?«, entgegnete Hereward und freute sich über seinen Scherz.
»Wenn die Normannen jetzt angreifen, sind wir alle tote Männer.«
»Es gibt Risiken bei allem, was wir tun. Und es wird noch mehr geben, bis wir genug Männer haben, um den Krieg zum König und seinen wichtigsten Streitkräften zu tragen. Unsere Zahl wächst, aber wir sind noch weit von der Stärke entfernt, die wir brauchen«, sagte Hereward in einem so beruhigenden Ton, wie er ihn aufzubringen vermochte. Wie man die Engländer zusammenbringen und eine Armee aufstellen konnte, das bereitete ihm die größte Sorge. Die Zeit wurde knapp. Bald würde Wilhelm der Bastard seine ganze Aufmerksamkeit auf den Osten richten. Weder Alric noch seine übrigen Männer begriffen, dass die Rebellion an einem dünnen Faden hing, bis er eine Lösung für dieses Problem gefunden hatte. Und er hoffte, dass diese Nacht dazu beitragen würde. Er legte eine Hand auf die Schulter seines Freundes und fügte hinzu: »Wir müssen Wagnisse eingehen, oder wir werden verlieren. Das ist die einfache Wahrheit.«
»Ja, aber wessen Leben steht auf dem Spiel, wenn du diese Wagnisse eingehst?«
Hereward zog es vor, nicht zu antworten.
Nachdem Alric zu den Männern zurückgekehrt war, erhoben sie sich und bildeten abermals eine Marschkolonne. Hereward nickte, und der vorderste Krieger stieß den Gefangenen an und zwang ihn, sich wieder auf den Weg zu machen. Der lose Grund knirschte unter den Ledersohlen der Marschierenden, als die Gruppe dem Dammweg durch die heimtückischen Moore folgte.
Die Nacht brach herein.
Zwischen den Weiden gab es nur wenig Mondlicht, um ihren Weg zu erhellen. Doch sie wagten es nicht, Fackeln zu entzünden, weil diese wie Leuchtfeuer aus dem Meer der Dunkelheit hervorstechen würden. Als ihre Schritte langsamer wurden, gingen Herewards Gedanken zurück in die Vergangenheit. Die friedlichen Tage seiner Jugend, das Fischen und Trinken mit Freunden rund um die väterliche Halle in Barholm, schienen manchmal zu einer anderen Person als ihm zu gehören. Er vermisste diese Zeiten – allerdings nicht die Faust und den Schuh seines Vaters. Er zuckte zusammen und versuchte, das Gesicht des alten Mannes aus seinen Gedanken zu vertreiben, aber stattdessen trat das Bild seiner Mutter, blutig und zu Tode geprügelt auf dem Boden des Flurs, vor sein inneres Auge. Diese Erinnerung ließ heißen Zorn in ihm aufwallen.
Dann stellte er sich den Bastard Wilhelm auf dem geraubten Thron vor. Er wusste nichts über das Aussehen des neuen Königs, aber seltsamerweise war es das Gesicht seines eigenen Vaters, das er dort unter der Krone sah, und sein Zorn brannte noch heißer.
Als sie die nächste Rast einlegten, lehnte er sich an die noch warme Rinde einer Esche und lauschte. Er hörte das Kreischen einer Eule über das Wasser hallen und sah das Flattern einer Fledermaus über seinem Kopf. Die Männer umklammerten ihre Speere; ihre Knöchel waren weiß in der Finsternis, die Köpfe gebeugt, damit niemand die Angst in ihren Gesichtern sehen konnte. Der Gefangene jedoch, der zu Füßen einer Weide hockte, beobachtete sie alle mit seinem lauernden Wolfsblick. Seine Wunden schienen ihn nicht zu kümmern. Seine Atmung war ruhig, seine Haltung entspannt.
Hereward legte seine Hand auf die Schulter des Mannes neben ihm. Godfrid war erst sechzehn Sommer alt und so unerfahren wie alle anderen, die diesen Streifzug nach Norden unternommen hatten. Der junge Krieger bestätigte den stummen Befehl seines Anführers mit einem Nicken. Er duckte sich und schlich voraus den Damm entlang, um den Weg zu erkunden.
Nach ein paar Augenblicken richtete Alric sich auf. »Ich habe etwas gehört«, zischte er.
Hereward sah sich um, aber es war unmöglich, mehr als vier Speerlängen weit zu blicken. Er konnte den frischen Angstschweiß des Mönchs riechen. »Das Wasser hört nie auf, sich zu bewegen. Der Schlamm saugt und rülpst. Du bist noch immer nicht an die Stimmungen des Landes in dieser Gegend gewöhnt«, antwortete er.
»Nein, es war ein hartes Geräusch«, widersprach Alric mit Nachdruck. »Wie Eisen auf Holz.«
Hereward wandte den Kopf und lauschte. Als der Nachtwind sich legte, hallte fern von Osten das leise Knacken eines Zweigs in der Stille. Er wirbelte herum und pfiff durch die zusammengepressten Zähne. Seine Männer duckten sich nieder, damit sie schwerer zu sehen waren. Der Gefangene grinste nur. Einer der Engländer stand auf und pflanzte einen Fuß in die Rippen des Mannes. Der Normanne funkelte ihn an, sagte aber nichts. Er wusste, dass sein Leben im Handumdrehen verwirkt wäre, wenn er es wagte, auch nur einen Laut von sich zu geben.
»Töte ihn sofort«, forderte einer der Männer. »Er wird uns nur aufhalten.«
»Unsere Feinde sind vielleicht nur zufällig auf unseren Weg gestoßen und wissen noch nicht, wo wir sind«, flüsterte Alric hoffnungsvoll.
»Sie wissen es«, knurrte Hereward. Er rannte zu dem Gefangenen, zog sein Schwert und richtete die Eisenklinge auf ihn, sodass deren Spitze den Hals des Mannes berührte. »Bleib nur einen Moment stehen, und ich werde deinen abgetrennten Kopf hier für deine Leute zurücklassen.«
Der Normanne hielt dem Blick des Kriegers einen Augenblick lang stand, ehe er die Augen senkte. Hereward presste sein Schwert in den Rücken des Gefangenen und trieb ihn anschließend in dieser Weise vor sich her, immer schneller, bis sie rannten. Vom Ende der Kolonne aus konnte er den keuchenden Atem Fromunds hören, der sich mit dem verwundeten Swithun abmühte. Die Prophezeiung des Sterbenden schien sich zu erfüllen.
Hereward hob den linken Arm. Während seine Männer zu ihm aufschlossen, spähte er mit zusammengekniffenen Augen in die vor ihm liegende Dunkelheit. Seine Sinne waren seit Langem an die flüsternden Moornächte gewöhnt, und er spürte, wie seine Haut kribbelte. Er schlich allein weiter. Kaum hatte er ein paar Schritte getan, als er zwischen den Bäumen eine graue Gestalt sah.
Ein normannischer Späher, dachte er, wobei er im selben Moment, als der Gedanke in ihm aufkam, bereits wusste, dass seine Annahme falsch war. Vorsichtig ging er noch ein paar Schritte weiter, und die blasse Gestalt wurde deutlicher erkennbar. Es war Godfrid, der Späher, den er vorausgeschickt hatte. Sein Körper hing in einem Weißdornstrauch. Blut tropfte in stetigem Rhythmus herab. Sein Kopf, der nur noch durch einen Streifen aus Fleisch und Sehnen mit dem Rumpf verbunden war, hing in einem unnatürlichen Winkel zur Seite.
Die Normannen waren überall.
KAPITEL 2
Die englischen Krieger wichen vor dem Toten zurück. Ihnen stockte der Atem, während ihre Blicke die Dunkelheit nach denen absuchten, die ihren Gefährten erschlagen hatten. Sie rissen die Schilde hoch und richteten die Spitzen ihrer Speere nach vorn; dann hockten sie sich alle zugleich nieder und lauschten. Ein Windhauch ließ die Blätter leise rascheln, und unter den Füßen des Gefallenen tropfte das Blut in die klebrige Pfütze, doch kein anderes Geräusch drang an ihre Ohren.
Hereward hockte sich neben sie. Er sah ihre weißen Fingerknöchel und ihre verängstigten Gesichter und wusste, dass er schnell etwas tun musste, um die aufkommende Panik einzudämmen. Angst führte zu Fehlern, und mit diesen unerfahrenen Männern wären Chaos und Tod die Folge. »Godfrid gab sein Leben für uns«, flüsterte er. »Sein Opfer darf nicht umsonst gewesen sein. Schnell. Auf den schmalen Weg beim Totenpfuhl …«
Im Osten flammten Lichter auf. Herewards beruhigende Stimme verebbte, als er den flackernden Schein sah. Es waren Fackeln. Ihr Feind sah keinen Grund mehr, sich unter dem Mantel der Nacht zu verstecken.
»Da.« Alric zeigte nach Westen. Zwischen den schwankenden Ästen sah man eine weitere Fackel leuchten. Als der Mönch sich langsam um die eigene Achse drehte, erblickte er ringsum weitere Lichter, die gerade entzündet wurden: fünf, zehn … Er gab es auf, sie zu zählen. Wie viele dieser Bastarde mochten da draußen sein? Fünfzig? Hundert? Die Normannen hatten abgewartet, bis sie sicher waren, dass sie ihre Beute umzingelt hatten, und dann die Falle zuschnappen lassen.
Auch Hereward schaute sich um, aber er war erfahren genug, um sich nicht von dem Gedanken lähmen zu lassen, dass es keinen Fluchtweg gab.
»Haltet den Kopf unten und lauft!«, befahl er. »Das ist unser Land. Wir haben immer noch einen Vorsprung.«
Der Gefangene lachte stumm, als er die bleichen Gesichter der Männer ringsum sah. Hunstan, der älteste von ihnen, fuhr herum, und richtete drohend seinen Speer auf ihn. »Er wird uns verraten. Wir müssen ihn töten.«
»Lass ihn laufen«, widersprach Hereward.
Die Krieger drehten sich zu ihm um und sahen ihn verblüfft an. Fassungslos stotterte Alric: »Godfrid gab sein Leben für uns, um zu erfahren, was dieser Normanne weiß. Und wenn er freikommt, wird er den Feind in wenigen Augenblicken zu uns locken.«
Rundum näherten sich Flammen im Meer der nächtlichen Finsternis. Das Klirren von Eisen lag in der Luft und das Geschrei von harten Stimmen. Das Blut der Normannen kochte. Sie waren bereit für ein Gemetzel. »Lasst ihn frei!«, befahl Hereward.
Der Gefangene sah sich um, unsicher, was jetzt geschehen würde. Hereward riss ihn an seinem schweißgetränkten Wams hoch und trat ihm mit voller Wucht ins Gesäß. Der Normanne wurde zu Boden geschleudert und warf noch einen mörderischen Blick zurück, bevor er sich auf die Füße rappelte und in die Dunkelheit davonrannte.
Alric packte den Arm seines Freundes. »Ein Akt der Güte für einen deiner Feinde? Und das von einem Krieger, der schon für ein falsches Wort Hände abgehackt und Gesichter verbrannt hat.«
»War es nicht dein Lebensziel, mich zu lehren, ein Lamm und nicht ein Wolf zu sein? Deine Arbeit war anscheinend doch nicht ganz umsonst«, sagte Hereward und ignorierte den skeptischen Blick des Mönchs.
Die Normannen schlugen mit den eisernen Schwertern gegen ihre Kettenpanzer, als ihr Todesmarsch näher rückte. Ihr gutturaler Kriegsgesang dröhnte über das öde Moor. Angst zu verbreiten war nur eine weitere ihrer Waffen, und sie nutzten sie recht wirkungsvoll.
»Lauft, als wäre der Teufel hinter euch her«, ermahnte Hereward seine Männer, bevor sie Zeit hatten, die Bedrohung, der sie ausgesetzt waren, in vollem Maße einzuschätzen. Er übernahm die Führung und folgte dem Weg, bis er die krumme Eiche sah, welche die Stelle markierte, wo ein schmaler Pfad nach links abzweigte. Es war ein tückischer Steg: kaum breit genug, um darauf zu gehen, schlängelte er sich durch tiefe Moore, wo ein einziger falscher Schritt genügte, um in den Tod zu stürzen. Diesen Weg zu nehmen würde ihr Fortkommen zweifellos verlangsamen, aber die Normannen konnten sie dort nur aus zwei Richtungen angreifen.
»Ich habe mich mehr als einmal gefragt, ob dich der Wahnsinn in den Klauen hat«, keuchte Alric zwischen schweren Atemzügen. »Aber diesmal glaube ich es wirklich – du hast den Verstand verloren.«
»Es ist mein Fluch, dein Gefasel Tag und Nacht hören zu müssen, bis ich sterbe; das ist mir voll und ganz bewusst«, raunzte Hereward, während er in die Dunkelheit hineinspähte. »Aber ich würde einen Tag auf Knien in deiner Kirche verbringen, wenn es mir für den Rest dieser Nacht Ruhe verschaffen würde.«
»Du hast mein Leben wahrscheinlich sowieso schon auf dem Gewissen, also kannst du dir deine Klagen sparen. Warum bin ich nicht in Ely geblieben?«
»Eine gute Frage«, sagte der Mercier mit gepresster Stimme.
Durch die Gruppen von Weiden und Eschen konnte er die tanzenden Flammen näher kommen sehen. Der Kreis zog sich immer enger zusammen. In seinem Kopf tauchte das grausame Gesicht von Ivo Taillebois auf, der von seinen eigenen Männern der Schlächter genannt wurde. Obwohl er den normannischen Sheriff nur ein paar Mal gesehen hatte – und dies auch nur durch eine Wand von Zweigen hindurch –, konnte er den Anblick des Verursachers von so viel Elend, das den Fens zugefügt worden war, nie vergessen. Wie musste dieser Bastard jetzt lachen! Er hatte mit einem englischen Stoßtrupp gerechnet, das war klar. Vielleicht hatte er sogar darum gebetet. Der Verlust eines seiner Männer würde ihm nichts bedeuten, wenn es ihm ermöglichte, dem geheimen Pfad zu folgen, auf dem er in das gut bewachte Herz des englischen Widerstands gelangen konnte.
Auch vor ihnen, wo der Pfad wieder festen Boden erreichte, waren Fackeln zu sehen. Hereward zischte, und die Männer hinter ihm hielten an.
»Wir sitzen in der Falle«, flüsterte Alric.
»Mönch«, warnte Hereward und drohte mit dem Finger. Er wies mit dem Kopf auf einen Markierungsstein am Rande des Pfades. »Unter der Oberfläche des Moores gibt es hier einen Streifen aus erhöhtem festem Boden, der wie ein Weg nach Süden verläuft. Der Pegel ist um diese Zeit des Jahres hoch, aber wenn wir vorsichtig sind, sollten wir in der Lage sein, darauf entlangzugehen und dabei den Kopf über Wasser zu halten.«
»Und wie willst du wissen, ob du diesem Streifen aus erhöhtem Boden wirklich folgst?« Die Stimme des Mönchs zitterte.
»Wenn es mir nicht gelingt, werde ich tot sein.« Hereward hörte seinen Freund schlucken und gönnte sich ein weiteres Grinsen. Endlich Schweigen. »Du hast zwei Möglichkeiten«, flüsterte er. »Glaub an Gott, oder glaub zur Abwechslung mal an mich. Ich habe dich bislang noch nicht sterben lassen, oder?«
Bevor Alric darauf etwas erwidern konnte, stieg er in den kalten Schlamm neben dem Markierungsstein. Die klammernden Finger des stinkenden Sumpfes zogen ihn nach unten. Blasen gurgelten und platzten um seine Leiste, seine Hüfte, stiegen immer höher und höher. Als der streng riechende Schlamm seine Brust erreichte, spürte er, wie sein Fuß auf festen Boden traf. Er watete ein paar Schritte vorwärts; seine ganze Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die Empfindungen seiner Füße. Einen winzigen Schritt nach dem anderen ertastete er die Erhebungen und Vertiefungen auf dem schmalen Weg durch das Moor. Als er weiterwatete, warf er einen kurzen Blick zurück. Alric folgte ihm dichtauf, und der Rest der Truppe kam hinter ihm her und wagte sich einer nach dem anderen in den Sumpf. Er erkannte die Silhouette von Fromund mit einem fast bewusstlosen Swithun. Kurz schaute er zu, wie Fromund die Arme des Verwundeten hielt und ihn in den Sumpf herabließ, wo ihn andere Hände packten und stützten. Während sich Hereward vorsichtig weiterarbeitete, dachte er, wie stolz er sein konnte, dass Swithuns Gefährten bereit waren, ihr eigenes Leben zu riskieren, um den verwundeten Kameraden nach Hause zu bringen.
Erst einmal zuvor hatte er diesen Weg genommen. Damals war er noch ein Junge gewesen, und sein Kinn hatte kaum über die Oberfläche gereicht. Aber damals war er von der Dummheit und dem Wagemut der Jugend erfüllt gewesen. Er erinnerte sich, wie der Schlamm ihm in den Mund geströmt und die Kehle hinuntergeronnen war. Wie er, dem Erstickungstod nahe, um Luft gerungen und sich die Dunkelheit über seinem Kopf geschlossen hatte. An seine Panik, als ihm klar geworden war, dass der Tod ihn in seiner Gewalt hatte … Er riss sich zurück in die Gegenwart.
Hände packten ihn von hinten und brachten ihn fast aus dem Gleichgewicht. Herewards Kopf fuhr herum. »Bei allem, was heilig ist – wenn du mich in den Tod reißt, werde ich dich mit runterziehen.«
»Verzeih mir«, antwortete der Mönch mit brüchiger Stimme.
Der Mercier konnte sehen, dass er zitterte und wahrscheinlich bald einen fatalen Fehler machen würde. Er legte die Hand auf die Schulter des Mannes und flüsterte: »Hab Vertrauen. Alles wird gut.«
Alric zwang sich zu einem Lächeln; seine Zähne leuchteten bleich in der Finsternis.
Schweigend wateten sie weiter durch die Dunkelheit. Umhüllt vom Gestank verrottender Vegetation, stemmten sie sich gegen den saugenden Sumpf. Bei jedem Schritt schwappte der Schlamm bis zu den Schultern hoch, und sie begannen, trotz der Schwüle der Nacht vor Kälte zu zittern. Hereward blickte zurück auf die Reihe der Krieger, die sich durch das Sumpfgebiet schlängelte. Das Ende der Kolonne verlor sich in der Finsternis, aber die Gesichter der ihm unmittelbar Folgenden waren angespannt und konzentriert. Jeder wusste, dass ein falscher Schritt das Ende bedeuten könnte. »Langsam gehen, und immer in Bewegung bleiben, so schafft ihr das«, zischte er ermutigend. Immer wieder hörte er ein gedämpftes Platschen, wenn jemand, dessen Füße vom schmalen Pfad abzurutschen drohten, rasch nach der Schulter des Vordermanns griff, um sich daran festzuhalten. In Alrics leise gemurmelten Gebeten schwang ein Ton zunehmender Verzweiflung mit.
Als sie einen mit Bäumen dicht bewachsenen Landstrich umrundeten, schimmerte eine Fackel zwischen den Zweigen kaum zehn Speerlängen entfernt. Hereward zischte, damit seine Männer anhielten. Normannische Stimmen erklangen aus dem Dunkel und kamen näher. Er kniff die Augen zusammen und zählte die Lichter, die von den Helmen blinkten. Fünf Männer, schätzte er. Sie erkundeten die Zunge trockenen Landes, die in das Sumpfgebiet hineinragte. Hereward beobachtete, wie das Licht der erhobenen Fackeln über die glänzende Oberfläche des Schlamms in Richtung der zusammengekauerten Engländer tanzte. Sobald es sie erst mal erfasst hätte, wären sie ein leichtes Ziel für die normannischen Bogenschützen.
Immer näher glitt das Licht über die Mooroberfläche auf Hereward zu, bis er es fast mit der Hand berühren konnte. Auf einmal hielt es schwankend inne, wie um sie zu verhöhnen. Die Stimmen erklangen lauter und hartnäckiger, durchbrochen von barschen Befehlen. Waren sie gesichtet worden? Er wünschte sich, er verstünde mehr von dieser fremden Sprache als die wenigen Worte, die er sich angeeignet hatte. Ihm wurde eng um die Brust.
Nach wenigen Augenblicken begann das orangefarbene Licht zu schwinden, und die Stimmen wurden leiser, während sich die Normannen von ihnen entfernten. Alric ließ den langen Seufzer, den er in der Kehle zurückgehalten hatte, entweichen. »Gott wacht über uns«, flüsterte er.
Als er sicher war, dass die Männer des Königs fort waren, gab Hereward den Befehl zum Weitergehen. Die Worte wisperten die Kolonne entlang zurück in die Dunkelheit. Er behielt die Fackeln im Auge, die überall zwischen den Bäumen schwankten und aus der Ferne an Glühwürmchen erinnerten. Die Normannen hatten ihre Beute gewittert. Sie würden nicht aufgeben, bis sie frische Köpfe auf ihre Tore spießen konnten.
Während er vorsichtig weiterging, hörte er auf einmal leise Stimmen hinter sich und blickte zurück. Alric lauschte, was der nächste Krieger in der Schlange ihm zu sagen hatte, und beugte sich dann vor. »Swithuns Wunden waren zu schwer«, sagte er leise. »Die Kälte hat ihm den Rest gegeben.«
Hereward ließ einen Moment lang den Kopf sinken und antwortete dann: »Lasst ihn hier.«
»Wir sollten ihn nach Hause bringen für ein christliches Begräbnis.«
»Ich werde nicht das Leben eines weiteren Mannes riskieren. Zwei sind genug für heute Nacht.«
Alric zögerte, dann nickte er. Er gab den Befehl weiter. Als die Krieger den Körper Swithuns in den Schlamm sinken ließen, intonierte der Mönch ein kurzes Gebet in lateinischer Sprache und fügte auf Englisch hinzu, dass den Krieger nun kein Leid mehr plage und er in den Frieden und die Fülle des Himmels eingegangen sei. Dieser kleine Trost wurde von den anderen Männern dankbar angenommen, wie Hereward erkannte. Der Mönch hatte seine Sache gut gemacht.
Sie bogen um eine weitere Landzunge herum und kamen schließlich langsam aus dem Sumpf heraus. Hereward erspähte die vertraute Silhouette dreier verkrüppelter Eschen, wo der zweite Markierungsstein stand. Mit einem leisen Ruf zu seinen Männern watete er an Land.
Die Engländer brachen auf dem trockenen Ufer zusammen und sogen keuchend die warme Nachtluft in ihre Lungen. Hereward erlaubte ihnen eine kurze Ruhepause, aber er ließ nie die sich ständig bewegenden Fackeln aus dem Auge.
»Und von hier aus führt ein Weg heim?«, fragte Alric leise, während er sich den Schlamm aus dem Gesicht wischte.
Der Mercier schüttelte den Kopf. »Für uns gibt es noch keine Heimkehr. Jetzt kämpfen wir.«
Alric starrte ihn entsetzt an. »Wir sind dem Feind um Haaresbreite entkommen, und jetzt willst du mit einer Handvoll müder Männer den Kampf mit ihm suchen. Du bist tatsächlich verrückt. Du wirst uns alle umbringen.«
KAPITEL 3
Der Mond trat hinter den Wolken hervor und tauchte die Weiden in ein silbernes Licht. Durch die tiefen Schatten unter den Bäumen liefen die Engländer mit gesenkten Speeren. Das Geräusch ihrer Schritte war nicht mehr als ein kaum vernehmbares Flüstern im Gras. Überall ringsherum funkelten die Fackeln ihrer Feinde. Alric konnte keinen Weg dazwischen erkennen.
Der Mönch mühte sich, mit Herewards Wolfstrab Schritt zu halten. »Willst du uns alle zugrunde richten?«, zischte er keuchend zwischen den Zähnen.
»Ich sagte dir doch: Glaub an mich.«
Alric wühlte sich mit den Händen durch ein Gewirr aus herabhängenden Ästen, das sein Freund mit Leichtigkeit meisterte. Er blickte zu den anderen Männern zurück, die jedem Wort ihres Anführers vertrauten, und betete, dass sie es nicht bereuen würden. An ihn glauben, dachte er bitter. Wenn Hereward nur wüsste, wie viel Glauben er auf ihrem langen gemeinsamen Marsch hatte aufbringen müssen.
Ein Hauch von verbranntem Holz stach ihm in die Nase. Er spähte in die Dunkelheit, suchte nach irgendeinem Zeichen einer Ansiedlung und sah nur Momente später die Umrisse von Gebäuden.
»Wo sind wir hier?«, keuchte Alric, als sie in einen Kreis von sechs strohgedeckten Häusern um einen Grasplatz auf einer Lichtung kamen.
»Norham«, antwortete Hereward, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Er trat die nächste Tür auf und schaute hinein. Der Herd war tot, ein Rest von Holzrauch hing in der Luft. Alric sah kein Leben im Inneren. War das ganze Dorf vor den Normannen geflohen?
»Brennt es nieder!«, schrie Hereward zu seinen Männern. »Alles. Macht schnell, und lasst uns dann sofort verschwinden.«
»Halt«, flüsterte der Mönch protestierend. »Das sind unsere Leute. Du kannst ihr Zuhause doch nicht einfach zerstören.« Er stellte sich vor den Mercier und bewegte sich hin und her, um dem Krieger den Weg zu versperren.
Mit einem verärgerten Knurren packte Hereward die Kutte seines Freundes und zerrte ihn zur Rückseite des Gebäudes. Fäulnisgestank kam ihnen entgegen. Der Mönch musste würgen und presste den Handrücken gegen Mund und Nase. An der Mauer war ein dunkler Stapel aufgeschichtet. Als sich seine Augen an die Finsternis gewöhnt hatten, sah er, dass es sich nicht um Brennholz handelte. Die Leichen der Dorfbewohner waren zu einem Haufen aufgetürmt worden: Männer, Frauen und Kinder. Das Blut war längst getrocknet, aber die klaffenden Wunden sprachen von scharfen Schwertern.
»Sie werden ihr Heim nicht mehr vermissen«, zischte Hereward.
»Wie lange sind sie schon tot?«, keuchte Alric.
»Fünf Tage sind es jetzt«, knurrte Hereward. »Die Nachricht erreichte mich, bevor wir nach Norden aufbrachen.«
»Was haben sie getan, um die Normannen so zu verärgern?«
»Sie haben unseren Kampf gegen den diebischen König unterstützt«, spie der Kämpe. »Manchmal haben sie denen Zuflucht geboten, die aus der Ferne gekommen waren, um sich uns anzuschließen, oder den Hungrigen einen Bissen Brot gegeben.« Er hatte zuletzt seine Stimme gesenkt, doch sie blieb eisenhart vor Zorn.
Alric starrte auf den Leichenhaufen. Wie oft er auch Zeuge der Brutalität ihrer neuen Herren wurde, er war doch immer wieder entsetzt.
Ohne ein weiteres Wort kehrte Hereward zur Vorderseite des strohgedeckten Gebäudes zurück und entriss einem der anderen Männer eine neu entzündete Fackel. Er schleuderte sie auf das schmutzige Rieddach, und im nächsten Augenblick leckten die Flammen hoch. Das Knistern wurde zu einem Brüllen. Orangefarbene Funken wirbelten zwischen dem schwarzen Rauch in den Nachthimmel empor. »Das soll ihr Scheiterhaufen sein«, brüllte er in die Dunkelheit, »und auch ein Leuchtfeuer!«
Alric stolperte über die Kräuterbeete, die man neben dem Haus angelegt hatte, und trat an die Seite seines Freundes. »Was nützt es, das Dorf niederzubrennen?«, protestierte er. »Es wird nur die Normannen auf uns aufmerksam machen.«
Hereward schirmte seine Augen gegen den grellen Schein der Flammen ab und sah zu, wie seine Männer die anderen Häuser in Brand setzten. »Diese stinkenden Köter sollen nur kommen«, knurrte er. Einen langen Moment schien er vom Spektakel gefesselt zu sein, und dann, als ob er aus einem Traum erwachte, stieß er eine Faust gen Himmel. »Folgt mir!«, schrie er über den Lärm der Flammen. »Wir müssen noch zwei weitere Dörfer niederbrennen. Lasst uns diese Bastarde auf einen Tanz führen, bevor der Tod kommt.«
Alric wurde es mulmig im Magen. Er packte den Arm seines Freundes und flüsterte: »Zieh diese guten Männer nicht mit dir hinab ins Verderben. Wenn du hier nur den nahenden Untergang siehst, sollten wir beide allein diesem Schicksal entgegentreten.«
Als Hereward sich ihm zuwandte, wich der Mönch zurück. Das Feuer brannte hinter dem Mercier, und die Flammen tanzten in seinen Augen, sodass er aussah wie der Teufel höchstpersönlich.
Ein höhnisches Grinsen breitete sich über das Gesicht des Kriegers aus. »Die Normannen wollten Gericht über die Engländer halten«, sagte er. »Lasst sie kommen, und ich werde sie richten.«
KAPITEL 4
Die Nacht war erfüllt von Feuer und Zorn. In der Finsternis der Fens leuchtete das brennende Dorf wie ein Fanal. Fackeln flackerten ringsum wie Funken im Rauch, und die warme Brise roch scharf und teerig nach Tod. Zwei Männer auf einer Bodenerhöhung zeichneten sich als Silhouetten gegen diesen orangefarbenen Lichtschein ab. Sie beobachteten die graue Welle normannischer Krieger, die sich unaufhaltsam auf ihre Beute zubewegte. Zu ihren Füßen schluchzte der gefangene Dorfbewohner. Blut von den Schlägen, die er erhalten hatte, verklebte ihm das Gesicht und tränkte seinen Kittel.
»Sieh nur, es war alles umsonst!« Wilhelm von Warenne musste schreien, um sich über dem Getöse und lauten Knistern des Feuers und dem Dröhnen des Kriegsgesangs Gehör zu verschaffen. Mit kalter Verachtung blickte der normannische Adlige auf seinen Gefangenen hinab. »Die englischen Krieger haben jedenfalls beschlossen, zu bleiben und zu sterben.« Er war ein erfahrener Kämpe. Sein braunes Haar war kurz geschnitten und im Nacken rasiert wie das der gepanzerten Krieger, an deren Seite er gefochten hatte, als der König England erobert hatte. Zum Zeichen seiner kämpferischen Entschlossenheit hatte er seinen lila Mantel über die rechte Schulter geworfen, um das Schwert an seiner Hüfte freizulegen.
Der andere Mann, ein finster dreinblickender Kerl mit einer niedrigen Stirn, trat dem Gefangenen in die Seite. Er nickte beifällig, als er hörte, wie eine weitere Rippe brach und sein Opfer vor Schmerz aufheulte. Ivo Taillebois, jetzt Sheriff, hatte von König Wilhelm persönlich seinen Beinamen erhalten: der Schlächter. Er war schwarz gekleidet wie die Männer, die er befehligte, und wies weder die Extravaganz noch das aristokratische Profil seines Begleiters auf. Seine dunkle Haut und seine groben Züge sprachen von Generationen bäuerlicher Mühsal auf dem Land. Doch durch einen starken rechten Arm, seine tierische Verschlagenheit und eine grausame Natur hatte er sich zu ungeahnten Höhen aufgeschwungen. »Wer den König verrät, muss dafür bezahlen«, knurrte er den gebrochenen Dorfbewohner an. »Wie schwer ist es für euch Engländer, diese Lektion zu lernen?« Er drehte sich um und rief etwas in die Dunkelheit.
Ein Krieger kam herbeigelaufen, ein Mann mit blutbeflecktem Wams. »Ich hätte dich auspeitschen sollen, weil du dich von den Engländern hast gefangen nehmen lassen«, sagte der Schlächter zu dem Mann, den Hereward kurz zuvor freigelassen hatte. »Aber du hast uns auf den Weg geführt, den diese Rebellen genommen haben, und wir haben sie jetzt im Würgegriff. Somit sollte ich dir, wie es scheint, eine Belohnung geben.« Er setzte einen Fuß auf den wimmernden Dorfbewohner und stieß ihn den kleinen Hügel hinunter. »Mach ihn kalt und wirf ihn ins Moor. Und du könntest einen Beutel Wein auf deinem Bett finden, wenn wir wieder in Lincoln sind.«
Der Krieger grinste. Er packt den Gefangenen an seinem Kittel und schleppte den schreienden Mann hinaus in die Dunkelheit.
»Bringt mir Hereward lebendig!«, befahl Wilhelm von Warenne, nachdem die Schreie verklungen waren. »Ich werde ihn vor den Engländern zerbrechen, bis er wie ein Kind schluchzt und um sein Leben bettelt. Dann werden wir sehen, wie viele noch die Waffen gegen uns erheben.«
»Du wirst deinen Wunsch bekommen. Es war immer nur eine Frage der Zeit, bis er fallen würde.«
Die beiden drehten sich um und schauten zu, wie ihre Männer dem englischen Pöbel auf den Leib rückten.
All dies sah auch der Mann, der sich im Dunkel eines nahe gelegenen Gehölzes verbarg. Das Feuer spiegelte sich auf seinem Helm wider und glühte aus den schwarzen Tümpeln der Augenlöcher. Sein wildes Haar und sein Bart waren rot gefärbt. Und unter seinem Kettenhemd stank er nach Schweiß: der Geruch eines echten, ehrenwerten Mannes.
Harald Rotzahn nahm die Münze des Königs als Söldner, aber das bedeutete nicht, dass er Respekt vor seinen normannischen Herren hatte. Sie kannten keine Ehre, nur den Wert der Dinge, die sie mit Gewalt nehmen und wie Elstern stehlen konnten – doch die Ehre, wie sein Vater ihm immer wieder gesagt hatte, war alles. Obwohl der Wikinger seine Axt an jeden verkauft hatte, der dafür zahlen konnte, seit er als Kind seine Heimat im kalten Nordland verlassen hatte, war das immer sein Gesetz gewesen: Auge um Auge, Blut für Blut.
Und wenn jemand Hereward den Kopf abschlagen würde, dann nur er.
Weiter nördlich, in einer Lichtung im Wald, brachen weitere Flammen aus. Noch ein Dorf, das von den Rebellen angezündet wurde. Was war in sie gefahren? Wollten sie ihren eigenen Untergang entfesseln?
»Du wirst deine Rache erhalten, Ivar«, murmelte Rotzahn und zupfte an den Schädeln von Vögeln und Nagetieren, die an seinem Kettenhemd hingen. Sein Blick huschte zu der grauen Gestalt, die ihm überallhin folgte, unsichtbar für alle anderen Lebenden. Er hatte sich an den starren Blick seines toten Gefährten gewöhnt, der einst von Hereward in den nordhumbrischen Weiten lebendig verbrannt worden war. Der Schatten schreckte ihn nicht. Er war eine Erinnerung an seine Pflicht, mehr nicht. »Durch Grim, meine Axt, wird Hereward fallen, und mit diesem Mönch werde ich ebenso verfahren. Hätte er sich dem Gesetz, meinem Gesetz, damals unterworfen, wäre ich nicht hier, und du wärst nicht tot«, raunte der Wikinger. »Der Mercier hat dir durch die Art, wie er dir das Leben nahm, die Halle der Erschlagenen verweigert, Ivar. Aber ich habe geschworen, die Fesseln zu brechen, die dich an diese Welt binden, und das werde ich auch tun.«
Er beobachtete Wilhelm von Warenne und den Schlächter, wie sie ihr weiteres Vorgehen besprachen. Beide waren Christen, die in ihren steinernen Kirchen beteten. Ihr Leben war wie diese kalten, trostlosen Stätten. Wo waren bei ihnen das Fest und die Lieder? Wo war das heiße Blut des Lebens, das über das Kinn strömte?
»Ihr möchtet jetzt mit dem alten Mann reden?«, sprach Taillebois mit seiner grollenden Stimme.
Wilhelm nickte, und der Schlächter schrie etwas in die Nacht hinein. Einen Moment später eskortierte eine normannische Wache eine gebeugte Gestalt den kleinen Hügel hinauf. Der Mann stützte sich auf einen knorrigen Stab; seine Haut war aschfahl, sein Gesicht hohlwangig, sein Körper unter dem schäbigen Wollumhang dürr wie ein Schlehdorn im Winter. Sein schütteres Silberhaar und seine gebrechliche Erscheinung ließen einen Mann vermuten, der viel älter war als die fünfzig Sommer, die er tatsächlich zählte.
»Willkommen, Asketil Tokesune«, begrüßte ihn Wilhelm in einem fröhlichen Ton, der keinen Hehl aus dem ihm innewohnenden Spott machte. »Auch wenn Ihr nicht mehr Thegn seid, tragt Ihr Euch immer noch wie ein Mann von Rang. Es ist schön, das zu sehen.«
»Was gibt’s Neues?«, krächzte der Alte. Seine Stimme klang wie das Knirschen von Kieselsteinen auf Eis.
»Dein Sohn ist so gut wie tot«, knurrte Taillebois.
Trotz der schroffen Worte nickte Asketil beifällig. »Dann ist alles gut.«
»Wir stehen in Eurer Schuld«, sagte Wilhelm lächelnd. »Ohne Eure Hilfe hätten wir weder die geheimen Pfade in dieser Gegend entdeckt noch die Absichten Eures Sohnes verstanden.«
»Sprecht nicht mehr von meinem Sohn. Er wäre besser bei der Geburt erwürgt worden. Wie ein tollwütiger Hund war er, von dem Moment an, als er sich aus seiner Mutter rauszwängte. Er hat seine eigenen Leute ausgeraubt, gekämpft, getötet, und es gab nichts, was ich tun konnte, um ihn zu zähmen.« Die Knöchel des alten Mannes traten weiß hervor, wo er den Stab umklammerte. »Seinetwegen musste seine Mutter sterben. Er war ein Schandfleck auf der Ehre meiner Sippe. Tot und vergessen soll er sein, dann kann ich meinen Kopf noch einmal hochhalten.«
»Ihr wart uns ein guter Freund«, fuhr Wilhelm fort, »und unser König hat verfügt, dass alle Freunde unter den Engländern gut belohnt werden. Das gilt auch für Euch, Asketil.«
Der Alte knurrte.
»Bring ihn zurück in die Halle und gib ihm das zu essen, was von der Gans übrig geblieben ist«, wies Taillebois den Wachmann an. Wilhelm von Warenne und der Schlächter warteten nicht einmal, bis der alte Mann außer Sichtweite war, bevor sie loslachten.
Von allen Leuten dort verachtete Rotzahn diesen Asketil am meisten. Der alte Thegn hatte sein eigen Fleisch und Blut verraten, obwohl die Normannen seinem jüngsten Sohn den Kopf abgehauen, seine Halle und sein ganzes Gold gestohlen hatten.
Und obgleich sie ihm alles, was er in seinem langen Leben erworben hatte, geraubt und ihn zu einer kümmerlichen Existenz herabgewürdigt hatten, bettelte er um die Reste vom Tisch seiner neuen Herren. Harald Rotzahn spuckte aus. Dieser Mann hatte keine Ehre.
Aus einem dritten Dorf schoss eine Flammensäule empor, deren goldene Funkenspirale fast bis zu den Sternen zu reichen schien. Der Wikinger lehnte sich an eine Eiche und ließ die Augen über die drei Feuersbrünste schweifen. Sie waren ein seltsames Volk, diese Engländer unter Herewards Befehl. Der Mercier hatte diese Schlammkriecher und feisten Kaufleute sowie die ihm zugelaufenen Söldner schneller zu einer Armee geformt, als Rotzahn es je für möglich gehalten hätte. Aber sobald Hereward tot wäre, wäre auch die Rebellion vorbei, und König Wilhelm könnte etwas ruhiger schlafen.
Während von Warenne und Taillebois lachten und Pläne schmiedeten, schlich sich der Wikinger aus dem Gebüsch und schlüpfte durch die schwankenden Weiden an den Rand eines stillen Teichs. Zwischen den braunen Schilfrohren hockte er sich nieder und zog dann eine Handvoll lederartiger, getrockneter Fliegenpilze aus dem Beutel an seiner Hüfte. Die cremefarbenen Lamellen der weiß gepunkteten Scharlachkappen schienen im Dunkeln zu leuchten. Er steckte sich zwei Fliegenpilze in den Mund und rümpfte die Nase über den bitteren Eisengeschmack. Bald würde er an den Ufern des großen dunklen Meeres wandeln. Und wenn die Götter gewillt waren, könnte er mit dem Wissen zurückkehren, das er an jenen Gestaden erwerben würde.
»Geh mit mir dorthin, Ivar«, flüsterte er zum raschelnden Schilf. »Und ich werde dir erneut meinen Schwur ablegen. Rache und Blut – um dich von den Fesseln dieser Welt zu befreien.«
Als die Nacht voranschritt, spürte Harald Rotzahn die vertraute Übelkeit, die ihm den Magen umdrehte, und dann das Zittern und den Schweiß. Zu guter Letzt senkte sich Frieden auf ihn herab. Er spürte, wie sich in den Weiden um ihn herum die Alfar regten. Ihre Augen verbrannten das Dunkel, als sie ihr Urteil über ihn fällten. Flügelschlag hüllte ihn ein, und er flog mit den Raben und schwebte hoch über die schwarzen Moore mit ihren leuchtenden dunklen Spiegeln, die den Weg zu anderen Welten öffneten. Er sah auf die drei brennenden Dörfer hinab, in denen sich die Flüchtigen zusammenkauerten. Er sah die eiserne Flut auf sie zukommen. Und er stieg hoch und höher, weit über Land und Meer.
Monate vergingen, dann Jahre; und auch wenn er seinen Vater nicht sah, sprach er lange mit Ivar und den anderen, die er an diesem stillen Gestade traf, bis es ihn mit unwiderstehlicher Kraft zurückzog.
Er hatte das Gefühl, durch dunkles Wasser nach oben zu schwimmen, und tauchte in seinem zusammengekrümmten Körper zwischen den Binsen auf. Sein Magen war so rau, als hätte er saure Äpfel gegessen. Er hatte viel gelernt, was ihm in den nächsten Tagen und Wochen dienlich sein würde. Aber als seine Sinne wiederkehrten, merkte er, dass etwas nicht stimmte. Von allen Seiten gellten Schreie in normannischer Sprache zwischen den Bäumen.
Seine Pupillen waren so geweitet, dass seine Augen fast schwarz wirkten, als Harald Rotzahn sich aus dem Schilf hochstemmte und wieder den Hang hinaufstieg. Er packte seine Axt, Grim, und ließ sich ganz und gar vom Tod erfüllen.
Von dem höher gelegenen Land aus blickte er über die nächtlichen Sümpfe und Gräben in die Richtung, wo die drei brennenden Dörfer schimmerten. Das Getöse des Feuers erfüllte seine Ohren. Draußen im Dunkeln bewegte sich etwas. Er fragte sich kurz, ob er die Türen der jenseitigen Welt offengelassen hatte und die Toten nun einmarschierten, um das Leben zurückzugewinnen, das sie einst kannten. Aus den Wasserläufen und Sümpfen stiegen Erscheinungen auf. Sie trugen Schädelgesichter wie die kreischenden Horden der Hel, die gekommen waren, um alle Menschen in die ewige Qual hinabzuziehen. Die übernatürliche Streitmacht drang hervor aus den Schatten der Nacht, ihre Totenköpfe glühten in der Finsternis.
Sieh dich vor!, riefen die Alfar. Sieh dich vor!
KAPITEL 5
Aus der Dunkelheit des Waldes stiegen die Todesgeister hervor. Aus den Gräben, dem Sumpf und den stillen Tümpeln, wo sie gewartet hatten. Durch eine Landschaft, die nur wenige Augenblicke zuvor leer erschienen war, schwärmten die Gespenster. Stirn und Wangen waren mit weißer Asche beschmiert, die Augen dunkel umrandet, und der schwarze Schlamm der Moore bedeckte Arme und Beine und die nackten Oberkörper, sodass sie mit der Nacht verschmolzen. Die Normannen hielten verstört inne. Ihre Blicke flackerten über die Erscheinungen hinweg. Das hier war keine sterbliche Armee. Es war ein Teufelsheer, das mit der Nacht und dem Nebel kam und nur noch Knochen hinter sich zurückließ.
Als sie vorrückten, wurden die englischen Rebellen von den Flammen, die durch die Bäume emporloderten, von hinten angeleuchtet: ein höllischer Anblick, den kein Mann dort je vergessen würde.
Eine Axtklinge sang. Ein Kopf sprang von seinen Schultern. Ein mit grimmiger Gewalt nach vorn gestoßener Speer drang durch ein Kettengeflecht und bohrte sich in das weiche Fleisch darunter hinein. Blut spritzte in einem glitzernden Bogen.
Hereward schmierte nasse Asche auf sein eigenes Gesicht und grinste, als er den Schrecken in den Gesichtern der Normannen sah.
Deren Vormarsch war ins Stocken geraten, und nun gerieten sie in Verwirrung. Wie er es von langer Hand geplant hatte, hatten die Feuer und der freigelassene Gefangene seinen Feind an den Ort gelockt, wo er ihn haben wollte. Die Engländer hatten sich in ihren Schlupfwinkeln gut verborgen, sich tief in den Gräben und Wäldern versteckt, waren still und wachsam geblieben, bis das letzte verwüstete Dorf in Flammen aufgegangen war.
Hereward zückte sein Schwert. Kurz blickte er zu Alric, der von der Flamme orange angeleuchtet wurde, und ein Lächeln huschte über seine Lippen, als er den erstaunten Gesichtsausdruck des Mönchs sah. Er hatte niemandem seine Pläne offenbart, nicht einmal seinem engsten Gefährten. Zu viele Menschenleben standen auf dem Spiel, um auch nur das geringste Risiko einzugehen.
Er warf den Kopf zurück und brüllte einen Schlachtruf, der das Blut seiner Feinde gerinnen ließ. Dann sprang er weg vom Knistern und Brüllen sowie der Hitze und hinein in die sumpfig stinkende Nacht.
Seine Augen gewöhnten sich schnell an die Dunkelheit. Die Männer des Königs stolperten planlos durch das Röhricht und die Weiden. Einige gerieten in den Sumpf und schrien, als der bodenlose Grund sie in die todbringende Tiefe zog. Andere platschten in unsichtbare Fluttümpel oder taumelten in Gräben und Wasserläufe, wo sie aufgrund ihrer verlangsamten Reaktionen leichte Ziele für Speere abgaben. Doch die Überraschung würde ihre Magie nur für eine Weile wirken. Die Normannen waren zu erfahren und zu gut ausgebildet, um sich längere Zeit einfach so abschlachten zu lassen.
Hereward rannte einen schmalen Pfad entlang und sprang mit einem Schrei von einer Uferböschung. Unter ihm prallte ein Normanne vor dem Phantom zurück, das aus der Nacht auf ihn zuschoss. Während der Soldat noch mit seinem Langschild kämpfte, schwang Hereward Hirnbeißer in einem weiten Bogen. Die Klinge durchtrennte den freiliegenden Hals des Gegners, und der Kopf flog davon.
Funken sprühten, als er mit dem nächsten Krieger die Schwerter kreuzte. Als sein Feind zurücktaumelte und ihm der Helm verrutschte, schmetterte Hereward seine Stirn in das Gesicht des Mannes. Die Wange zerplatzte. Mit einem wütenden Knurren spaltete er den Kopf des Mannes in zwei Hälften.
Das Monster in ihm schrie vor Freude über die Tötung des Feindes. Er ließ es zu, dass dieser Blutrausch ein wenig stärker von ihm Besitz nahm.
Er rannte den Pfad entlang und aus der Deckung der Bäume heraus bis zu dem Ort, wo sich schmale Streifen festen Landes wie Finger in die Ränder der tödlichen Moorgebiete vortasteten. Er kannte jede Furche, jedes Sumpfloch, jede Lache – wie alle seine Männer. Auf seinen Befehl hin hatten sie die letzten Tage damit verbracht, die Umgebung zu erkunden, während sie auf seine Ankunft warteten. Sein Blick schweifte über die wabernden Lichter der normannischen Fackeln und deren glitzernde Spiegelungen im Wasser. Das Licht bewahrte sie zwar vor falschen Schritten, es machte sie jedoch zu einer leichten Beute für die getarnten Engländer.
Im Lärm der Schlacht hörte er Taillebois’ wütende Befehle. Sie hatten eine gewisse Wirkung. Die tanzenden Fackellichter begannen, sich entlang eines schmalen, grasbewachsenen Streifens zwischen Sumpf- und Waldrand zu sammeln. Hereward grinste. Die Normannen dachten immer noch, sie befänden sich in den Hügeln von Wessex. Als der Hauptmann den Befehl zum Rückzug und zur Neuformierung brüllte, stolperten die eisengepanzerten Invasoren zurück in den Wald. Aber das Unterholz war zu dicht, die Stämme standen zu eng beieinander, als dass man mühelos hindurchmarschieren konnte.
»Bögen!«, rief Hereward.
Die Männer, die er mit ihren Jagdbögen trainiert hatte, legten ihre Pfeile an. Die grauen Nachtgestalten stemmten den hinteren Fuß fest in den Untergrund und hoben ihre Waffen, wie er es immer wieder auf den Schlachtfeldern von Flandern gesehen hatte. Die Fackeln schwankten entlang der Baumgrenze, während die Normannen sich in den Wald hineinmühten.
»Los!«
Die erste Salve sauste durch die Luft. Mit grimmiger Genugtuung lauschte Hereward den Schreien, als die Pfeile ihr Ziel fanden. Fackeln fielen zu Boden und setzten das trockene Gras und das Unterholz in Brand. Während die Flammen emporleckten, gab er seinen Männern den Befehl zum Vorrücken. Die Normannen hatten die Besten Englands abgeschlachtet. Jetzt war die Zeit der Vergeltung gekommen. Wenn die Echos dieser Nacht durchs ganze Land widerhallten, würde dem König nichts anderes übrig bleiben, als diesem Geschehen Beachtung zu schenken.
Die englischen Krieger mit den Totenkopfgesichtern stürmten vor und trieben einen Keil in das Zentrum der königlichen Truppen. Hereward warf einen Blick zur anderen Seite des Sumpfes hinüber, wo die rechte Flanke des Feindes in ein Moor abgedrängt wurde, das den Anschein trockenen Landes erweckte. Im Wald hatte der Rest der Truppe inzwischen seinen Fehler erkannt und wandte sich nun gegen die Rebellen, aber die Kampfkraft der Normannen konnte sich zwischen den Bäumen nicht richtig entfalten.
Hereward bahnte sich einen Weg durch seine Männer, um das Zentrum der Schlacht zu erreichen. Einige waren noch Jungen, andere grauhaarig und hohlbrüstig, aber alle hatten einen wilden Glanz in den Augen. Zu beiden Seiten tauchten vertraute Gesichter aus der Nacht auf. Da war Guthrinc, mehr Bär als Mann, der seine Schmiedehammerfaust in ein normannisches Gesicht rammte und lachte, als Knochen zerbarsten. Da war Hengist; seine blassen Augen waren eiskalt, sein aschgraues Gesicht erfüllt von der Bitterkeit eines Mannes, der mit angesehen hatte, wie seine Familie und Nachbarn von den Eindringlingen niedergemäht wurden. Der Wikinger Kraki, einst der gefürchtetste Krieger unter den Hauskarlen Earl Tostigs von Nordhumbrien, schwang zähneknirschend seine Axt. Keine positive Empfindung erhellte seine Gesichtszüge; der Kampf war wie das Leben ein ernstes Geschäft.
Und dann erblickte Hereward Apfelbäckchen und einen Schopf gelockten braunen Haars: ein Ausdruck von Unschuld, den nicht einmal die gebleckten Zähne überschatten konnten. Redwald, sein Bruder in allem außer im Blut. Obwohl er kein Kämpfer war, stach er mit seinem Speer so wütend um sich wie alle anderen. Ihre Blicke trafen sich. In der Hitze des Gefechts wirkte Redwalds Gesicht seltsam leer. Doch als er Hereward in die Augen schaute, grinste er und machte eine Schau daraus, wie er seinen Speer in die Kehle eines Normannen bohrte.
Eine Flammenwand erhob sich knisternd entlang der Baumgrenze. Panik breitete sich in den Gesichtern der Männer des Königs aus. Das höher gelegene Gelände war zundertrocken, und Hereward sah, wie seine Feinde zu erkennen begannen, dass sie, wenn der Wald Feuer fing, zwischen zwei verschiedenen Formen der Hölle eingeschlossen sein würden.
Die Hitze brachte sein Gesicht zum Glühen, und sein Atem beschleunigte sich. In diesem Augenblick wollte er sehen, wie der Brand sie alle, vielleicht ganz England, verzehren und die Finsternis und das Elend in den reinigenden Feuern verglühen ließ. Lange Momente stand er ruhig da, gefangen im Zauber der Flammen, während um ihn herum die Schlacht tobte. Er hörte kein Klirren von Eisen, keine Schreie von Sterbenden. Er sah nichts als Gold, Bernstein und Scharlachrot.
Dann hörte er undeutlich von irgendwo eine Stimme seinen Namen rufen. Er riss sich aus seinem Wachtraum heraus und sah, wie Kraki auf etwas jenseits des Gewimmels von Leibern zeigte. Hereward blickte in die Richtung. Gegen den flammenden Hintergrund hob sich eine vertraute Gestalt ab, die Axt hochgereckt in der Rechten, die Linke zu einer Faust des Trotzes geballt.
Der Tod, dachte er.
Ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, trieb Hereward seine Klinge in den Hals eines Feindes. Er räumte den sterbenden Normannen mit einem Tritt aus dem Weg und drängte sich durch das Handgemenge. Seine Männer wussten alle, dass sie ihn darauf aufmerksam machen sollten, wenn sie auch nur das geringste Anzeichen von dem verhassten Söldner Harald Rotzahn erblickten. Niemals würde er vergessen, wie der Wikinger seinem Freund Vadir – jenseits des Walwegs in Flandern – den Kopf abgeschlagen hatte. Und niemals würde er diese Tat vergeben. Nur der Tod konnte ihre Blutfehde beenden.
Der Zorn übermannte ihn. Sein Schwert wirbelte über seinen Kopf hinweg, ohne auch nur einen Moment nachzulassen. Zwei weitere Normannen fielen blutüberströmt zu Boden. Hengist gab ihnen mit Speerstößen den Rest. Erst als niemand zwischen ihm und seiner Beute stand, verlangsamte Hereward seine Bewegung. »Rotzahn!«, brüllte er über das ohrenbetäubende Getöse des Feuers hinweg.
Der Wikinger wandte sich ihm zu. Die sengende Hitze schien ihm nichts auszumachen. Verkohlte Zweige zuckten im Lichte winziger Flammen, die überall um den Söldner herum von den brennenden Ästen herabregneten. Seine Pupillen wirkten ganz schwarz, als wäre er vom Teufel besessen. Inmitten seines gefärbten roten Bartes tat sich eine Wunde auf: Abgebrochene, gefärbte Zähne bleckten sich zu einem zufriedenen Grinsen. Er senkte die Schultern und ließ ein bestialisches Knurren hören.
Die beiden Männer gingen aufeinander los. Harald Rotzahn schwang seine schartige, blutbefleckte Axt und zielte auf den Hals des Merciers. Hereward duckte sich und stieß mit Hirnbeißer zu. Das Schwert glitt funkensprühend von dem zerhauenen Kettenpanzer ab. Hereward drehte sich blitzschnell auf dem Ballen des rechten Fußes und ließ sich von seinem eigenen Gewicht so weit nach vorn wirbeln, dass er in den Rücken des schwereren, kleineren Söldners gelangte. Sogleich schwang er die Klinge in hohem Bogen nach oben, um sie auf den Nacken des Wikingers niedersausen zu lassen.
Doch Harald Rotzahn schien den Schlag zu ahnen. Er senkte rasch den Kopf, als das Schwert nach unten stieß. Es hinterließ eine glatte Rille, die quer über seinen zerkratzten Helm verlief. Ohne einen Blick zurückzuwerfen, schwang der Wikinger seine Axt nach hinten. Hereward sprang im letzten Augenblick zurück. Die Klinge fegte nur um Haaresbreite an ihm vorbei – fast hätte sie ihm den Bauch aufgeschlitzt.
Lange Zeit kämpften sie wie Wölfe, die sich gegenseitig die Kehle herausreißen wollten. Schweiß durchtränkte Herewards Hosen, und seine Haut brannte feuerrot von der Ofenhitze. An den Stellen, wo brennende Zweige auf seine Haare gefallen waren, stiegen dünne Rauchfahnen auf. Wunden erblühten auf beiden Körpern, und Blutspritzer zischten auf brennende, herabgefallene Äste. Der Schmerz einer Schnittverletzung über seinem Auge ließ Hereward die Zähne zusammenbeißen; und der Wikinger wischte mehrmals das klebrige Blut von der linken Wange, die von Herewards Schwert aufgeschlitzt worden war.
Ein donnerndes Krachen hallte durch den äußeren Bereich des Waldes. In einem Sturzbach brennender Äste zersplitterte eine Esche und begann, zu Boden zu stürzen. Hereward riss den Kopf hoch. Ein Feuersturm rollte auf sie zu. Wenn Harald Rotzahn sich der Gefahr bewusst war, so achtete er nicht darauf. Seine schwarzen Augen verengten sich, und mit einem wölfischen Grinsen schwang er seine Axt und zielte auf Herewards Hals.
Goldenes Feuer regnete herab, als die Klinge heransauste. Hereward schloss die Augen und begriff, dass dies sein Ende war. Das Tosen ließ nach. Die Hitze versengte seine Haut nicht mehr. Die Zeit schien stillzustehen, als der Friede sein Herz füllte. Aber der Axthieb fand nie sein Ziel.
Stattdessen prallte das volle Gewicht von Harald Rotzahn gegen ihn, und die beiden Männer flogen rückwärts. Die brennende Esche stürzte nur eine Speerlänge entfernt zu Boden. Der Erdboden bebte. Flammende Zweige umgaben Hereward. Die Hitze versengte ihm die Lungen.