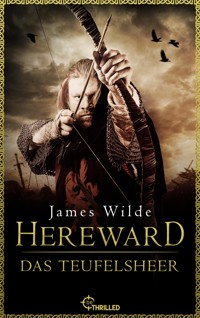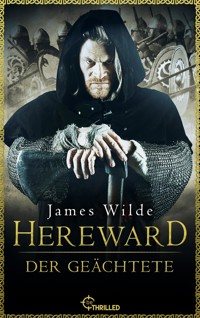
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hereward-Serie
- Sprache: Deutsch
Nur auf dem Schlachtfeld werden Helden geschmiedet und Legenden geboren!
1062. Den Angelsachsen erscheint das Ende aller Tage nah. Denn jenseits des grauen Meeres wartet William der Bastard nur darauf, den kranken englischen König zu stürzen. Dessen Berater sind zerstritten, und so ruhen Englands Hoffnungen auf Widerstand allein auf einem Mann: Hereward. Für manche ist er der Teufel in Menschengestalt, die anderen bewundern ihn als erbarmungslosen Krieger. Doch ausgerechnet jetzt haben ihn seine Gegner zum Geächteten erklärt. Um das Land zu retten, das er liebt, zieht Hereward eine blutige Schneise von den Hügeln Northumbrias bis zu den Wiesen Flanderns.
Ein actionreiches Historienepos über die große Legendengestalt des englischen Mittelalters: den Widerstandskämpfer Hereward. Beste Lektüre für alle Fans von Bernard Cornwell und David Gilman.
Band 1: Hereward der Geächtete
Band 2: Hereward: Das Teufelsheer
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Karte
Danksagung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Nachwort des Verfassers
Über den Autor
Weiterer Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
1062. Den Angelsachsen erscheint das Ende aller Tage nah. Denn jenseits des grauen Meeres wartet William der Bastard nur darauf, den kranken englischen König zu stürzen. Dessen Berater sind zerstritten, und so ruhen Englands Hoffnungen auf Widerstand allein auf einem Mann: Hereward. Für manche ist er der Teufel in Menschengestalt, die anderen bewundern ihn als erbarmungslosen Krieger. Doch ausgerechnet jetzt haben ihn seine Gegner zum Geächteten erklärt. Um das Land zu retten, das er liebt, zieht Hereward eine blutige Schneise von den Hügeln Northumbrias bis zu den Wiesen Flanderns.
James Wilde
HEREWARD
DER GEÄCHTETE
Aus dem britischen Englisch von Evelyn Pesch
DANKSAGUNG
Für Unterstützung und Hinweise bin ich Dr. Richard Hall, Director of Archaeology, York Archaeological Trust for Excavation and Research, und dem York Visitor Information Centre zu Dank verpflichtet.
KAPITEL 1
Nordhumbrien29. November 1062
Es war der Anfang vom Ende der Welt.
Schwarzer Schnee stach in das Gesicht des jungen Mannes. Knietief versank er in der weißen Decke des Hanges, während er ihn hinabschlitterte, und kniff zum Schutz gegen den peitschenden Sturm die Augen zusammen. Verzweifelt bemühte er sich, in der wilden Landschaft aus hohen Hügeln und dichtem Wald einen Pfad zu erkennen. Der bittere Geschmack auf seiner Zunge bestätigte seine Befürchtungen: Asche, die in den wirbelnden weißen Flocken trieb. Er kam zu spät. Im Heulen des Schneesturms konnte er das Prasseln des Feuers voraus vernehmen, und über dem Hügelkamm sah er eine schwarze Wolke emporquellen, während in seinem Rücken die Schreie der Verfolger lauter wurden, die immer näher kamen, je mehr er ermüdete. Aus der Hölle in die Hölle.
Mit tauben Fingern zog Alric den groben wollenen Umhang enger um die schwarze Kutte, aber seine Zähne klapperten dennoch, aus Angst ebenso wie vor Kälte. Er war gerade erst achtzehn geworden, sein Gesicht noch ungezeichnet von den Mühsalen des Lebens. Haselbraunes Haar hing ihm nass und strähnig in das schmale Gesicht; seine Tonsur wuchs bereits wieder zu, und unter seinen Augen lagen dunkle Ringe. In diesem Augenblick schienen die Sicherheit und der Friede der Abtei von Jarrow der Erinnerung einer anderen, unschuldigeren Person anzugehören, die nicht von abgrundtiefer Verzweiflung befallen war. Er dachte an seine Eltern, die ihn als Kind ins Kloster geschickt und zum lebenslangen Dienst an Gott bestimmt hatten. Was würden sie von ihm denken, wenn sie wüssten, wie schrecklich er sie enttäuscht hatte?
Mit einem krächzenden Gekreische wie das Schreien verlorener Seelen erhoben sich die Raben in einer schwarzen Wolke aus dem Geäst, als er den nächsten Hang hinaufstolperte. Der Atem brannte in seiner Brust, und seine Glieder schmerzten, aber er quälte sich weiter und packte immer wieder nach Zweigen, um sich an ihnen durch die Schneewehen hochzuziehen. Schließlich ließ der Schneesturm nach. Wenig später jedoch bemerkte Alric, dass seine Fußspuren hinter ihm deutlich zu erkennen waren. In der menschenleeren Landschaft würden sie sich meilenweit über die verschneiten Hügel ziehen. Die Verfolger konnten sie nicht übersehen.
Kurz vor dem Hügelkamm machte er den Fehler, abermals zurückzublicken. Scharf umrissen gegen den dräuenden grauen Himmel stand auf der Hügelkuppe eine halbe Meile hinter ihm der Tod, die Kriegsaxt Grim in der rechten, einen Speer in der linken Hand. Harald Rotzahn hielt nur kurz inne, während der Wind seinen Umhang blähte, bevor er sich den Hügel hinabstürzte und zwischen den Bäumen verschwand. Wie ein Rudel Wölfe kamen seine Männer hinter ihm über die Kuppe geschwärmt, ohne einen Laut von sich zu geben. Sie witterten, dass die Beute nahe war.
Voller Panik taumelte Alric über den Hügelkamm, nur um sogleich entsetzt im Schnee auf die Knie zu fallen, als er das Unheil sah, das auf das Dorf herabgekommen war, welches er zu seiner Heimstatt gemacht hatte.
Ein schwarzes Leichentuch bedeckte die Lichtung im Wald, und rotgoldene Flammen leckten aus jedem strohgedeckten Haus, das es in Gedley gab. Nur das Prasseln des Feuers und das hungrige Krächzen der Vögel waren zu hören – keine Hilferufe, keine Schreie von Müttern, die nach ihren Kindern suchten, oder von Männern, die gegen ihr Schicksal aufbegehrten. Es war auch nichts von denen zu sehen, die Harald Rotzahn vorausgeschickt hatte.
Mein Fehler, dachte Alric, bevor Zorn und Hass auf sich selbst sein Schuldgefühl unter sich begruben. Alles mein Fehler!
Er lief wieder los, den Hang hinunter. Seine müden Beine trommelten immer schneller, bis er die Kontrolle über sie verlor. Er geriet ins Stolpern, fiel und krachte gegen den Grenzpfosten am Bach.
Mit weiß eingestäubten Haaren, Kleidern und Augenbrauen rappelte er sich wieder auf und rannte zwischen den Bäumen weiter, wobei er die Namen aller Bewohner von Gedley rief, einen nach dem anderen.
Keine Antwort.
Er hätte genauso gut selbst die Häuser in Brand setzen und einen Speer in die Brust jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes rammen können. Ob Gott ihm vergeben konnte? Ob er sich selbst je vergeben würde? Umgeben von dem erstickenden Qualm, fragte er sich, ob er nicht einfach stehen bleiben sollte. Sollte Harald Rotzahn ihn doch auch töten! Er hatte es nicht besser verdient.
Der Mönch schrie auf, als in dem ätzenden Rauch die Gestalt eines Mannes vor ihm auftauchte, mit ausgestreckten Armen wie der Herr am Kreuz, die Augen weit aufgerissen. Im nächsten Moment erkannte Alric, dass der Mann tot war, und nach einem weiteren Stolperschritt zeigte sich, dass der Leichnam in den Dornenzweigen eines Weißdornstrauchs hing. Wildes Haar und ein wirrer Bart, beide tiefblau gefärbt, bildeten einen grässlichen Kranz um das schmerzverzerrte Gesicht. Der Tote trug einen rostigen Kettenpanzer, der Kerben von vielen Hieben aufwies. Helle Narben aus alten Schlachten zogen sich über Gesicht und Arme. Alrics Blick wurde von einer Vision dessen überschattet, was hier geschehen sein musste, und er schwankte angewidert zurück: Der Leichnam war vom Brustbein bis zur Scham aufgeschlitzt und die Kehle durchschnitten worden, als ob es nicht gereicht hätte, den Mann bloß einmal zu töten. Der Boden unter dem Dornstrauch war von Blut durchtränkt.
Der abgeschlachtete Mann gehörte nicht zu den Einwohnern von Gedley, wie der Mönch sogleich erkannte. Sechs Monate lang hatte Alric mit allen aus dem Dorf das Brot gebrochen und sich ihrer Bedürfnisse und Sorgen angenommen, und der Tote hier war kein Bauer, sondern ein Kämpfer gewesen. Er konnte nur vermuten, dass es einer aus Harald Rotzahns Bande war.
Aber wer hatte ihn getötet? Die Leute von Gedley waren keine Krieger.
Verstört stolperte er weiter durch den Rauch. Nach ungefähr fünfzig Schritten schrie er erneut auf. Ein abgehackter Kopf steckte auf der Spitze eines Grenzpfahls. Der Hals war sauber durchtrennt. Ein Rabe krallte sich in das dichte braune Haar und pickte nach einem der weißen Augen. Panik schnürte Alric die Kehle zu. Konnte dies ein weiterer Mann aus der Horde des Wikingers sein? Nordhumbrien war ein gesetzloses Land, aber nie zuvor hatte er solche Brutalität gesehen. Vage erinnerte er sich an Legenden der Dörfler von den bösen Wuduwasas, welche die verwunschenen Wälder durchstreiften und an Knochen nagten, und an die Schattengeister, die zwischen den Bäumen auf unachtsame Wanderer lauerten. Der Mönch bekreuzigte sich, um den bösen Blick aus dem Dunkel abzuwehren.
Aber dann riss ihn das Prasseln des Infernos in die Gegenwart zurück, und er blinzelte die heißen Tränen der Scham weg. Sollten der Wikinger und seine Männer doch kommen: Sein eigenes Leben war nicht von Belang, sofern er die Möglichkeit hatte, auch nur einen Überlebenden zu retten. Aber obwohl er sein Gesicht gegen die Flammen abschirmte, versengte die Hitze seine Kehle und trieb ihn zurück. Deprimiert fiel er auf die Knie und begann zu schluchzen.
Als sich dieser Anfall von selbstquälerischer Niedergeschlagenheit gelegt hatte, hob er die Augen zum Himmel und bat Gott um Vergebung für seine Sünden. Plötzlich nahm er an der Grenze seines Gesichtsfeldes das Blitzen einer Bewegung wahr, aber der Rauch verbarg das Wesen, das sich dort befand, fast genauso schnell, wie es zum Vorschein gekommen war. Sein Herz klopfte wild. Eine weitere flüchtige Bewegung folgte – und dann noch eine.
Der Selbsterhaltungstrieb forderte schließlich sein Recht, und Alric raffte sich auf. Er taumelte vom Feuer weg und, wie er hoffte, auf den Weg zu, der tief in die dunkle Sicherheit des Waldes führte.
Ein Schrei erscholl, gefolgt von einer Antwort aus größerer Entfernung.
Alric erbleichte. Sie hatten ihn gefunden.
Er rannte los, stolperte über eine Baumwurzel und schlug der Länge nach auf den gefrorenen Boden hin, wobei er sich den Schädel anschlug und die Wange aufschürfte. Er wusste, er verdiente es nicht zu leben; dennoch wollte er nicht sterben. Das Dilemma brachte einen weiteren Schwall von Schluchzern hervor, aber sie erstarben in seiner Kehle, als er sich vom Boden hochstemmte.
Der flache Teich am Rande des Dorfes war jetzt ein See aus Blut.
Auf der anderen Seite des Tümpels lagen die Leichen der Dorfbewohner. Man hatte sie abgeschlachtet wie Vieh und wie Feuerholz zu einem Stapel aufgeschichtet. Ihr Blut rann in den aufgewühlten Matsch. Entsetzt starrte Alric auf die höllische Szene, bis ein Laut hinter ihm ihn herumfahren ließ. Zu spät! Einen blutverschmierten Speer schwenkend, trat einer der Verfolger aus dem Rauch; sein wirres Haar und dichter Bart waren mit Schnee bereift. Seine hasserfüllten Augen brannten.
»Wer bist du?«, krächzte Alric.
»Du weißt, wer ich bin«, erwiderte der Wikinger mit einem Grinsen, das seine Zahnlücken enthüllte.
Ja, Alric wusste es. Der, dem die Raben folgten; die Knochengestalt mit der Sichel, die alle Menschen niedermähte: sein eigener persönlicher Tod.
Der Mann packte Alric an der Kutte, riss ihn hoch und schlug ihm so hart ins Gesicht, dass der Mönch Sterne sah. Als sich sein Blick klärte, fand er sich erneut auf dem gefrorenen Boden wieder, den Blutsee direkt vor Augen.
Unter dessen Oberfläche bewegte sich etwas.
Zuerst dachte er, es wären nur Wellen, die der eisige Wind hervorrief. Aber dann durchbrach eine Luftblase die klebrig wirkende Oberfläche, dann eine weitere. Eine wildäugige Kreatur stieg aus der Tiefe auf, von Kopf bis Fuß in Rot getaucht.
»Der Teufel!«, keuchte Alric.
KAPITEL 2
»Viel schlimmer.« Die blutige Erscheinung grinste den Mönch an, der vor dem Ausdruck in dem rot verschmierten Gesicht zurückschreckte. »Ich bin Hereward.«
Während der Recke aus seinem Versteck auftauchte, schwenkte er sein Schwert in einem weiten Bogen, sodass rote Tropfen von der Klinge in den Schnee spritzten. Der Wikinger zögerte und bleckte die Zähne, dann hob er seine Waffe. Eine Woge von Euphorie überkam Hereward. Zu langsam, dachte er. Er konnte am Gesichtsausdruck des Kriegers die Fragen ablesen, die sich ihm stellten, und den Anflug von Unsicherheit in seinen Augen erkennen. Dem Nordmann gelang es nicht auf Anhieb, sich auf das, was er sah, einen Reim zu machen. Er verlagerte sein Gleichgewicht und schickte sich mit unbeholfenen Bewegungen an, seinen Gegner mit dem Speer zu durchstoßen.
Hereward trat über den am Boden liegenden Mönch hinweg und hieb den Schaft entzwei; gleich darauf ließ er einen weiteren beidhändig geführten Schlag folgen. Doch der Wikinger taumelte zurück, sodass das Schwert nur eine Spur goldener Funken auf seinem Kettenpanzer schlug, statt ihn aufzuschlitzen. Er verlor das Gleichgewicht und brach auf ein Knie nieder.
»Er ist wehrlos«, stammelte der Mönch.
»Gut so.« Hereward richtete die Spitze seines Schwertes gegen den Kettenpanzer und trieb die Klinge in die Brust des Mannes, bis sie im Rücken wieder herausdrang. Der Nordmann röchelte, seine Augen traten weit hervor. Als Hereward die Klinge aus dem Oberkörper des Wikingers herauszog, rann heißes Blut aus der Wunde und dampfte in der eisigen Luft.
»Du musstest ihn nicht töten«, sagte der Mönch entsetzt.
»Er hätte dich umgebracht, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Und er hat mitgeholfen, all die Leute hier umzubringen.« Hereward wies auf den Leichenhaufen jenseits des Tümpels.
Mit erstickter Stimme versuchte der Sterbende nach seinen Gefährten zu rufen. Hereward enthauptete ihn mit einem einzigen Hieb. Er hob den Kopf an den Haaren auf und betrachtete ihn einen Augenblick lang verächtlich, bevor er ihn weit in den Wald hineinschleuderte.
»Was bist du?«, fragte der Mönch angewidert.
»Dein Retter.« Hereward spürte, wie die Ekstase des Tötens bereits verebbte, und die lautlose Stimme in seinem Innern rief nach mehr Blut. Sie pulsierte in seinem Kopf und vibrierte in seinen Knochen: das hungrige Drängen des Triebs, der seit seiner Kindheit sein ständiger Begleiter war. Einen Augenblick lang hielt er inne und lauschte, ob sich von irgendwoher Schritte näherten. Diese Söldner, dachte er, sind hart und kalt wie ihre Heimat im hohen Norden und kampferprobt. Sie würden sich nicht durch Gefühle oder Furcht von etwas abhalten lassen. Er hatte wie ein Geist aus dem Wald denjenigen aufgelauert, die sich von der Truppe entfernten, als sie das Dorf in Brand steckten, und die anderen hatten allenfalls einen flüchtigen Blick auf ihn erhascht. Im Kampf Mann gegen Mann war er ihnen überlegen. Aber wenn sie zu mehreren kämen, wäre er im Nachteil. »Sie werden uns bald finden«, sagte er mit gesenkter Stimme, während er angestrengt durch den dichten Rauch spähte. »Ich habe noch mindestens vier weitere Männer gezählt, die sich hier aufhalten. Vielleicht sind noch mehr unterwegs.«
»Ja … das stimmt.«
»Du musst dich entscheiden: hierbleiben und Futter für die Raben werden oder mit mir kommen.« Er konnte sehen, dass der Mönch beide Möglichkeiten gleichermaßen abstoßend fand, und mit einem Achselzucken wandte er sich um und verschwand im verschneiten Wald. Er war noch nicht weit gekommen, als er das Keuchen des Mönchs hinter sich hörte.
»Sag mir, dass du keinen von den Dörflern ermordet hast.« Zorn schwang in der Stimme des Mönchs mit; doch gleichzeitig war sein Gesicht voller Trauer, und er kämpfte gegen die Tränen an.
»Keinen einzigen.«
»Du bist nicht aus Gedley. Was hast du mit Rotzahns Truppe zu schaffen?«
»Rotzahn? Das ist der Name ihres Anführers?« Hereward zuckte mit den Schultern und wischte sich das klebrige Nass aus der Stirn. »Ich bin ein Mercier. Ich war auf dem Weg nach York und machte hier im Dorf Rast. Als die Nordmänner anfingen, die Dorfleute abzuschlachten, machten sie den Fehler, auch mich töten zu wollen.« Hereward trat wieder das Bild vor Augen, wie er noch schlaftrunken aus dem Haus getorkelt und mitten in das Getümmel geraten war. Die Angreifer rannten zwischen den brennenden Häusern umher und schlugen alle nieder, die ihren Weg kreuzten. Sein erster Gedanke war gewesen, dass die Männer, die ihm von London gefolgt waren, ihn nun endlich gefunden hatten. Als er sich dann zur Flucht wenden wollte, traf ihn ein Anblick, der wie ein Messer in der offenen Wunde seines Herzens wühlte. Eine Frau schrie auf, als eine Axt ihren Schädel spaltete; und ein kleines Kind hing schluchzend an ihrem Arm. Hereward erstarrte. Die Szene hatte Erinnerungen an zwei andere Frauen wachgerufen, die zu seinen Füßen lagen und ihn aus blicklosen Augen anstarrten. In diesem Moment war sein mörderischer Zorn hochgekocht, und danach erinnerte er sich nur noch an den Eisengeruch von Blut, das Brechen von Knochen und die gellenden Schreie, die dem Tanz seines Schwertes folgten.
Von fern aus dem Nebel des Brandes drang das Trappeln rennender Füße, und es erscholl ein überraschter Ruf, dem sogleich eine laute Antwort folgte. Man hatte den kopflosen Leichnam des Wikingers entdeckt, vermutete Hereward. Er packte den Mönch am Arm und zerrte ihn mit sich. »Kämpf weiter mit deinem Gewissen, wenn du nicht gerade in Gefahr bist, den Kopf zu verlieren.«
Der Mann stolperte auf müden Beinen neben Hereward her. »Sie werden nicht aufgeben, bis sie uns finden. Harald Rotzahn wird uns auf den Fersen bleiben, selbst wenn die Wälder, in die wir fliehen, noch so groß und undurchdringlich sind …«
»Schweig«, zischte Hereward. »Wenn du die ganze Zeit brabbelst, dann lass ich dich zurück.«
Der Mönch funkelte ihn an. »Harald Rotzahn wird nicht ruhen, ehe wir tot sind.«
»Und ich werde nicht ruhen, bis er tot ist. Entscheide dich – ich oder er. Nur einer von uns wird übrig bleiben, wenn diese Sache zu Ende ist.«
Die wütenden Rufe der Verfolger hinter ihnen wurden lauter. Ohne auf eine Antwort des Mönchs zu warten, rannte Hereward in ein Gewirr von Eschen und Eichen hinein und bog um eine aufragende Felsnase, die sie für kurze Zeit vor ihren Verfolgern verbergen würde. Er sprang eine Böschung hinunter, direkt in einen eisigen Bach. Der erschöpfte Mönch folgte ihm dichtauf. Ihre Füße in den Lederschuhen wurden sofort zu Eis, aber diese Unannehmlichkeit war nur ein kleiner Preis dafür, dass sich auf diese Weise möglicherweise die Spuren ihrer Flucht verwischen ließen.
Während sie durch den Bach platschten, keuchte der Mönch: »Mein Name ist Alric. Ich komme aus dem Kloster Jarrow und bin weit gewandert, um das Wort Gottes zu verkünden.«
»Gott scheint diesen Ort verlassen zu haben.« Hereward konnte sehen, dass der Mönch in den bevorstehenden Kämpfen eine Belastung sein würde. Und sein Geplapper war so ärgerlich wie das ständige Summen einer Stechfliege. Hereward wog in Gedanken die Vor- und Nachteile ab, wenn er den Mönch bewusstlos schlagen und ihn für die Verfolger liegen lassen würde.
»Woran denkst du?«, schnaufte Alric.
»Frag mich später noch mal.«
An einer Stelle, wo der Bach über eine Anhäufung von Felsen hinabströmte, packte Hereward einen Ast, um sich aus dem Wasser zu ziehen. Er hielt inne und bedachte Alric einen Moment lang mit einem nachdenklichen Blick, bevor er die Hand ausstreckte, um ihm zu helfen. Anschließend bückte er sich und schöpfte mit den Händen von dem eiskalten Wasser, um sich das Blut aus dem Gesicht zu waschen. Darunter kamen Strähnen langen blonden Haars und ein kantiges Kinn zum Vorschein. Seine Augen waren von einem klaren Blassblau. Während er damit fortfuhr, sich von dem verkrusteten Blut zu reinigen, wurden auf den Oberarmen allmählich blauschwarze Kriegermale sichtbar: Spiralen und Kreise, die mit einer Ahle in die Haut gestochen und mit Asche gefärbt worden waren. Er sah, dass der Mönch die goldenen Armreife an seinen Unterarmen beäugte, aber er war nicht in der Stimmung, die Neugierde zu befriedigen, die er in den Augen seines Weggefährten erblickte.
Der Mönch entspannte sich ein wenig, als er sehen konnte, dass der fremde Krieger nicht der Teufel war, für den er ihn zuerst gehalten hatte. »Du bist kein gewöhnlicher Dieb«, stellte er fest. »Du verfügst über eine gewisse Bildung. Ich kann es deiner Stimme anhören.«
»Keine Fragen.«
»Ich wüsste gern, mit welchem Ungeheuer ich es hier zu tun habe«, entgegnete Alric trotzig.
Hereward drehte sich um und drückte dem Mönch die Klinge an den Hals. »Noch ein Wort, und ich schlitze dich mit meinem Schwert Hirnbeißer auf.«
»Du würdest einen Mann Gottes töten?«
»Ich würde jeden töten.« Der Mercier bedachte Alric mit einem scharfen Blick aus seinen blassen Augen und sah etwas, das ihn überraschte: Tief im Innern des Mönchs wünschte sich ein dunkler Teil von ihm den Tod.
»Du machst mir keine Angst«, sagte Alric und blinzelte die Tränen weg.
Hereward beachtete ihn nicht weiter und spähte den Bach entlang. Er nahm das schwindende Licht und den erneut stärker werdenden Sturm in Augenschein, und er erkannte, dass sie ohne ein schützendes Dach bald erfrieren würden. »Sie werden bald hier sein«, knurrte er, drehte sich um und blickte in die dunklen Tiefen des Waldes hinein, der vor ihnen lag. »Wie lange brauchen wir bis zum nächsten Dorf?«
»Mindestens einen halben Tag. Wir würden die Nacht nicht überleben.«
»Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo wir Schutz finden könnten?«
Alric zögerte. »Es gibt da eine Frau in der Nähe, die allein wohnt. Sie ist eine Wicce.«
»In welche Richtung müssen wir gehen?«
»Nein!«, protestierte Alric. »Sie betreibt Hexerei und beschwört böse Geister. Sie ist eine Heidin und glaubt nicht an Jesus Christus und die heilige Kirche.«
Aus der Ferne klangen die Rufe der Verfolger, die näher kamen. Hereward packte Alric bei den Schultern und rüttelte ihn. »Wir tun alles, was nötig ist, um zu überleben. Willst du lieber sterben, als das Brot mit einer Heidin zu brechen?«
Das war zu viel für Alric. Er stürzte sich auf den Recken und ging mit den Fäusten auf ihn los. Der Speichel flog ihm aus dem Mund, als er wütend schrie: »Es ist alles sinnlos! Sie werden uns verfolgen, bis wir vor Erschöpfung umfallen. Wir sind schon so gut wie tot.«
»Ja. Das sind wir. Wir alle«, knurrte Hereward und schickte den Mönch mit einem gezielten Hieb in das Reich der Träume.
Er schleifte seinen Begleiter über den verschneiten Felsboden zu einer dicken Eiche. Dort streifte er sein blutdurchtränktes Wams und die Beinlinge ab und band Alric damit an den Baumstamm. Sobald er den Mönch gefesselt hatte, versteckte er seinen Lederbeutel mit Münzen und ein Messer hinter einem Felsen. Nackt spannte er die Muskeln an, sodass die blauen Spiralen, die seinen Oberkörper bedeckten, sich im schwindenden Licht wellten, und dann stieß er ein donnerndes Gebrüll aus. Ein Augenblick der Stille folgte, dann brach ein Knacken und Bersten im Unterholz los, als Rotzahns Männer in Richtung des Schreis losstürzten.
Hereward eilte davon in die zunehmende Düsternis.
Der Mönch musste noch gerade rechtzeitig aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht sein, um ihn zwischen den Bäumen verschwinden zu sehen, denn der Recke hörte Alric brüllen: »Du Ungeheuer! Du bist der Teufel!«
Aus seinem Versteck beobachtete Hereward, wie zwei der Wikingersöldner den verschneiten Hang hinabgeschlittert kamen und sich Alric näherten. Der eine hielt eine Axt, der andere einen Speer. Zwei weitere folgten ihnen; sie trugen Helme und abgenutzte Kettenpanzer. »Es ist nur der Mönch«, sagte der Mann mit der Axt. »Der andere ist geflohen.«
»Er hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch aufhalte!«, schrie Alric. »Lauft ihm nach! Er kann noch nicht weit sein!«
Hereward sah, dass die beiden behelmten Krieger seiner Spur folgten; sie würden als Erste an die Reihe kommen. Der Wikinger mit dem Speer wandte sich an Alric. »Deine Schuld kann nur mit Blut beglichen werden.«
»Harald wird das selbst erledigen wollen«, erwiderte Alric verbittert.
»Ich werde ihm deinen Kopf bringen. Damit wird er zufrieden sein … und mich reich belohnen.«
Hereward sah, wie Alric die Augen schloss und den Herrn anrief, seiner Seele gnädig zu sein. Als das Gebet vom Wind fortgetragen wurde, war der Mercier bereits dabei, die zwei Männer zu umkreisen, die sich auf seine Fährte gesetzt hatten. Als sie sich trennten, um den Bereich ihrer Suche auszuweiten, schlug er zu. Ein markerschütternder Schrei hallte zwischen den Bäumen wider.
Die beiden Peiniger Alrics, die bei ihm geblieben waren, lachten laut auf. »Dein Freund ist tot«, sagte einer von ihnen.
»Er ist nicht mein Freund!«, schnappte Alric. »Er ist nichts als ein wildes Tier.«
In der Nähe brach der Gefährte des Getöteten durch das Unterholz. Die unterdrückten Flüche, die er dabei ausstieß, zeugten von der Angst, die ihn gepackt hatte. Erneut schlug Hereward mit der Schnelligkeit und Kraft eines Wolfs zu, verzögerte das Ende nur lange genug, um seinem Opfer einen weiteren Schrei zu entlocken. Der Laut übertönte den heulenden Wind, der durch die Bäume peitschte.
Hereward schlich zurück, bis er den Mönch und die beiden verbliebenen Angreifer wieder im Blick hatte. Die Gesichter der Wikinger waren jetzt bleich und verstört; jeder Hohn war daraus gewichen. Der Söldner mit der Axt machte Anstalten, sich in den Wald vorzuwagen, aber sein Gefährte hielt ihn am Arm zurück.
Alric ließ das Kinn auf die Brust sinken. »Er ist der Teufel«, flüsterte er.
Hereward wartete regungslos, ohne auf die Kälte zu achten. Er sah die Angst in den beiden Kriegern aufsteigen. Mit erhobenen Waffen umkreisten sie den Baum, als erwarteten sie einen Angriff aus allen Richtungen. Lange Augenblicke vergingen, in denen nur das Heulen des Windes und das Peitschen des Schnees zu hören waren. Düsternis breitete sich zwischen den Bäumen aus und hüllte sie ein.
Schließlich rührte sich Hereward in seinem Versteck. An ihren langen Haaren zusammengebunden, wirbelten die beiden Köpfe der Getöteten in hohem Bogen aus der Dunkelheit und krachten in einem Schauer von Blut vor den beiden Wikingern zu Boden.
Wutentbrannt über den Tod seiner Gefährten brüllte der Krieger mit der Axt einen Kampfschrei und rannte los. Die Warnung des anderen Nordmanns kam zu spät.
Wie ein Geist in der Düsternis trat Hereward hinter einer breiten Eiche hervor, schwang sein Schwert und zielte auf den Nacken des Angreifers. Bevor dessen Leichnam auch nur den Boden berührt hatte, war der nackte, blutbeschmierte Recke bereits auf den letzten Söldner zugesprungen. Eine Woge der Blutlust schoss in Hereward empor. Die Welt verengte sich auf die Augen seines Gegners und den Tanz der Klingen.
Der Nordmann duckte sich unter dem ersten Schlag weg, musste dabei aber zurückweichen. Wie ein Wirbelwind aus Eisen schnellte Herewards Schwert nach rechts und nach links, hoch nach dem Schulterblatt, seitwärts nach dem Brustkorb. Der in die Defensive gedrängte Söldner wich rasch den Schlägen aus und versuchte, seine eigene Waffe zur Geltung zu bringen.
Mehrere Minuten lang drehten sich die beiden Männer um den gefesselten Alric herum. Sie hatten Mühe, auf dem trügerischen Boden Halt zu finden. Hereward, ganz im Bann seiner wilden Kampfeswut, achtete nicht auf den tiefer werdenden Schnee. Fluchend stürzte er auf ein Knie. Der Söldner sah die Chance zum tödlichen Angriff und stach mit dem Speer zu.
Hereward warf sich blitzschnell zur Seite und hämmerte seinem Gegner die linke Faust zwischen die Beine. Als der Wikinger sich vor Schmerz zusammenkrümmte, sprang der Engländer auf und rammte ihm das Knie ins Gesicht. Der Söldner krachte bewusstlos zu Boden.
Hereward holte tief Luft. Als sein Blick sich klärte, verstummte das Flüstern in seinem Kopf, und seine Wut verebbte. Er trat an den Baum heran, um den Mönch loszubinden.
»Sie hätten mich töten können! Du wusstest nicht, ob ich noch am Leben wäre, wenn du zurückkommst!«, schrie Alric.
»Das stimmt.« Der Recke wedelte verärgert mit der Hand, als wollte er eine Fliege vertreiben. »Du glaubst wohl, dass es mich kümmert, ob du lebst oder stirbst.«
Sobald Alric frei war, zog Hereward dem bewusstlosen Krieger Kettenpanzer, Wams und Hosen aus und streifte sie sich selber über. Seine Arme und Beine waren taub vor Kälte, aber das würde sich bald geben. Mit der blutgetränkten Kleidung, mit der er den Mönch gefesselt hatte, band er den nackten Söldner an den Baum.
Alric hatte sich auf einen umgefallenen Baum sinken lassen und vergrub das Gesicht in den Händen. Er murmelte etwas, das sich nach einem verzweifelten Gebet anhörte.
»Bete nicht für mich. Ich bin seit Langem verdammt«, knurrte Hereward, während er die Festigkeit der Knoten prüfte.
»Ich bete nicht für dich.« Mit rot geränderten Augen warf der Mönch einen gequälten Blick in Richtung Gedley.
Der Mercier konnte sehen, dass es nicht nur der Gedanke an die toten Dorfbewohner war, der seinen Gefährten plagte. »Wer bezahlt diese Nordmänner? Und warum suchen sie nach dir?«
Der junge Mönch wischte sich mit dem Handrücken den Rotz von der Nase. »Keine Fragen«, sagte nun auch er.
Hereward zuckte mit den Schultern. »Dann haben wir beide unsere Geheimnisse.«
Bibbernd vor Kälte begann der Söldner langsam wieder zu Bewusstsein zu kommen. Hereward holte sich seinen Lederbeutel und das Messer zurück, die er hinter dem Felsen versteckt hatte. Er prüfte die Schärfe der Klinge mit dem Daumen.
Misstrauisch sah Alric von seinen Gebeten auf. »Was hast du vor?«
»Ich werde ihm die Haut abziehen wie einem Reh. Und entweder werden seine Schreie Harald Rotzahn hierherlocken, wo ich auch ihn abschlachten kann, oder sie werden ihn von hier fernhalten.«
Entsetzt sprang Alric auf. »Das kannst du nicht tun.«
»Furcht ist es, was die Menschen in dieser Welt antreibt. Wer Furcht verbreitet, gewinnt.«
»Nein«, beschwor ihn der Mönch. »Nicht Furcht, sondern Liebe.«
Hereward lachte. »Als die Nordmänner das erste Mal in ihren Drachenbooten nach England segelten, besiegten sie uns, indem sie Furcht in uns weckten, wie es heißt. Sie haben unsere Klöster geplündert und unsere Frauen vergewaltigt, und wir Engländer sind wie aufgescheuchte Hasen weggelaufen. Die guten Christen wecken Furcht in den Heiden, um sie zu vertreiben. Und dein eigener Gott bedroht uns mit dem Teufel und den Feuern der Hölle, wenn wir vom Weg der Rechtschaffenheit abweichen.«
»Was hat dich so gemacht?«
Mit einem Stöhnen kam der Söldner wieder zur Besinnung. Als Hereward sich mit dem Messer über ihn beugte, entrang sich der erste Schrei aus seiner Kehle, noch bevor das kalte Metall seine Haut auch nur berührt hatte.
Alric übertönte die Schreie mit seiner Stimme. »Du steigst aus dem Blut der Unschuldigen auf. Du tötest ohne Schuldgefühle, als hättest du keine Seele. Ich frage dich noch einmal: Was hat dich so gemacht?«
»Gott hat mich so gemacht.«
KAPITEL 3
Der markerschütternde Schrei hallte durch den nächtlichen Wald und wurde von Augenblick zu Augenblick schriller, bis er nicht mehr menschlich klang. Dafür waren Harald Rotzahns Männer beinahe dankbar; denn sie konnten sich so einreden, dass es sich um irgendeine wilde Bestie oder ein schreckliches Ungeheuer handelte, das im Dunkel des Waldes umherging. Aber als der Schrei einfach nicht enden wollte, hielten sie sich die Ohren zu und konnten trotzdem nicht die Bilder von ihrem offenkundig gemarterten Kameraden aus ihren Köpfen verdrängen.
Harald Rotzahn lauschte den Schreien ungerührt, ohne eine Miene zu verziehen. Er war ein Söldner und nahm das Geld eines jeden an – ob von einem Händler, Thegn oder König –, der einen todbringenden Auftrag schnell und brutal erledigt haben wollte; und sein furchterregender Anblick unterstrich diesen Ruf. In den Augenlöchern seines verbeulten Helms spiegelten schwarze, geweitete Pupillen die tanzenden Flammen von Gedley wider. Sein wildes Haar und sein wirrer Bart waren rot gefärbt mit dem Saft, den sein Volk aus der Hagebutte gewann, und sein grob gewebter Wollumhang war mit eingefetteten Fellen gefüttert, welche die Kälte abhielten. Drunter trug er seinen von Kämpfen zernarbten Kettenpanzer, rostig und blutbefleckt, und ein nach Schweiß stinkendes Wams. Von der Brünne baumelten Schädel von Vögeln und Kleintieren an Lederschnüren. Seine Axt, Grim, hing an seiner Seite.
»Es ist immer noch Zeit, ihn zu retten«, murmelte Ivar, sein Unterführer.
»Er ist längst tot«, entgegnete Rotzahn. »Was du hörst, sind nur die Echos, die nachhallen, während sein Geist den Körper verlässt.«
Ivar schlang seinen wollenen Umhang enger um den Körper, um besser gegen das Schneetreiben geschützt zu sein, und ging dabei in Gedanken all ihre brutalen Raubzüge und blutigen Überfälle der jüngeren Zeit durch, doch an etwas ähnlich Widerwärtiges und Übelerregendes konnte er sich nicht erinnern. »Warum schneidet ihm der Hundsfott nicht einfach die Kehle durch und lässt es damit gut sein?«
»Er versucht, uns von hier wegzulocken, in den Wald hinein – bei Nacht, wo der Vorteil auf seiner Seite ist.«
»Und was ist mit dem Mönch?«
»Die Spuren deuten an, dass er mit dem Fremden gegangen ist. Wenn dies zutrifft, sollte er inzwischen tot sein, oder es wird nicht mehr lange dauern. Wir werden bei Tagesanbruch nach seiner Leiche suchen.«
Der Schrei lotete weiter die Tiefen der Qual aus. Harald Rotzahn lauschte gebannt und entdeckte eine Melodie, die kein anderer hörte: das Lied des Lebens, das unter der Oberfläche von allem pulsierte, mit einem Herzschlag als Trommel, um den Takt anzugeben, bis das Lied endete. Er begann, leise mitzupfeifen. Ivar warf ihm einen beunruhigten Blick von der Seite zu und trat unbewusst einen Schritt von ihm weg.
Der Mönch war Geschäftssache, eine leicht zu erledigende Arbeit für eine Handvoll Münzen. Aber der Fremde war etwas völlig anderes. Wer war dieser Recke, der mit solcher Brutalität und Leidenschaft kämpfte? Und warum mischte er sich in eine Sache ein, die ihn nichts anging?
Wir sind hier das Gesetz, sagte Rotzahn zu sich selbst. Wir entscheiden, wer überlebt und wer stirbt. Der Fremde wird Nordhumbrien nicht lebend verlassen.
Geistesabwesend streckte er eine offene Hand aus. Ivar griff in seinen Beutel und legte ihm ein paar von den getrockneten Pilzen in die Handfläche. Mit Sorgfalt betrachtete Rotzahn die roten Köpfe mit den weißen Punkten und die langen cremeweißen Lamellen.
»Es ist der Blod-Monath«, sagte er nachdenklich. »Wir haben unsere Opfer dargebracht, wie es unsere Ahnen einst taten, aber der Blutmond verlangt mehr. Der Winter ist früher gekommen und strenger als sonst, und jetzt ist noch dieser Fremde aufgetaucht … Ich wüsste gern, was das alles zu bedeuten hat.« Er hielt inne. »Die Seher raunen von Vorzeichen … Omen … einem nahenden Ende …«
»Ist dies der Fimbulwinter vor der großen Schlacht, die Ragnarök und dem Ende aller Dinge vorausgeht?«, fragte Ivar.
»Vielleicht. Selbst die Christen sehen solche Zeichen.«
»Es heißt, ein Rabe hätte mit Earl Tostig gesprochen, und er wäre erbleicht und hätte sich in seiner Halle versteckt und sich geweigert, irgendjemandem zu sagen, was der Rabe ihm verkündet hat«, erinnerte sich Ivar mit einem Schaudern.
Rotzahn steckte sich einen großen und einen kleinen Pilz in den Mund. »Wir werden hier ein Lager aufschlagen, wo es warm genug ist, dass wir die Nacht überstehen. Geh jetzt und lass mich allein, denn ich reise weit über die Grenzen von Midgard hinaus zum Gestade des großen dunklen Meeres. Sollte ich sterben, bevor ich zurückkehre, bist du der neue Anführer.«
Ivar nickte und ging fort. Mit lauter Stimme gebot er den anderen, ein Lager zu errichten. Sie kannten alle die Gefahren des Rituals, auf das Rotzahn sich eingelassen hatte. Manchmal erlaubten es die Geister dem Reisenden nicht, mit dem Wissen, das er am Ufer jenes großen Meeres oder in dem dunklen, endlosen Wald der Nacht erlangt hatte, in die Welt der Menschen zurückzukehren. Aber Rotzahn hatte bei mehr als einer Gelegenheit zuvor mit den Mächten gerungen und war immer unversehrt zurückgekehrt, während ihm die Worte der Vættir noch in den Ohren klangen.
Das Ritual ist wichtig, dachte Rotzahn mit zunehmender Heftigkeit. Die alten Wege starben aus. Mittlerweile gaben in seinem Heimatland die Christen den Ton an, mit ihren Gebeten und Kirchen und ihrem einen, wahren Gott. Aber sein Vater hatte ihn in die Wälder mitgenommen, als er noch ein Junge war, und ihn die Bedeutung des silbernen Hammers gelehrt, den er an einer Lederschnur um den Hals trug. Er hatte den Daumen des jungen Harald mit seinem Messer geritzt, und sie hatten ihr Blut vereinigt, und danach hatten sie mit ihren Äxten ein wild dreinblickendes Pony geschlachtet und sich dessen Essenz auf ihre Gesichter geschmiert. Als sie dann zusammen am Lagerfeuer saßen, hatte der Junge erfahren, dass eben dieses Ritual vom Vater seines Vaters und von dessen Vater und so weiter durchgeführt worden war, bis zurück zu der Zeit, als der erste Mann und die erste Frau aus der Achselhöhle des Riesen Ymir entsprungen waren. Der Wikinger spuckte aus. Die Vergangenheit bestimmte, wer man war – man konnte sie nicht gegen ein neues Leben eintauschen.
Er ließ das Lager hinter sich und ging hinüber an den blutgefüllten Teich am Ende des Dorfes. Während er darauf wartete, dass seine Reise begann, hockte er sich an den Rand des Teiches und starrte in dessen Tiefe hinein.
Die Zeit verging. Das Prasseln des Feuers wurde sachter, und das Schreien des Gefolterten in der Ferne steigerte sich zu einem letzten Höhepunkt und brach dann abrupt ab. Selbst der Wind legt sich, sodass ringsum nur der sanft fallende Schnee die Welt mit seinem Schweigen erfüllte. Es war ein Zeichen. Die Führer der Anderswelt hatten ihn gehört.
Übelkeit stieg in ihm auf, aber sie legte sich bald, gefolgt von einem Ausbruch von Schweiß, der auf seiner Stirn gefror. Als auch dieser verging, überkam ihn ein tiefer, bleibender Friede.
Er wandte sich zu den Flammen um, die noch aus der Asche dessen züngelten, was einmal ein Dorf gewesen war. In den Flammen sah er Gesichter, die ihn beobachteten. Die Vættir regten sich.
»Ich werde die Vergangenheit nie sterben lassen«, versprach er ihnen.
Durch die schwankenden Äste der kahlen Bäume erspähte er die Alfar, die von ihren Heimstätten im tiefen Wald herbeigezogen kamen. Ihre Augen glühten mit einem inneren Licht, das von dem Land jenseits des Meeres sprach.
»Durch Blut und Feuer werde ich die Träume meiner Ahnen lebendig halten«, sagte er ihnen.
Ein Augenblick der Spannung legte sich über die Umgebung, und Rotzahn spürte, dass eine höhere Macht gekommen war, auch wenn er niemanden sehen konnte. Eine Stimme rief laut und klar in den Tiefen seines Kopfes: »Folge mir zu den Gestaden des großen dunklen Meeres, und ich werde dir viele Geheimnisse offenbaren. Ich werde dir von der nahenden Endzeit erzählen und von dem Fremden und der Rolle, die er dabei spielen wird.«
Der Wikingersöldner sah sich um, bis sein Blick auf einen Raben fiel, der auf einer der Leichen auf der der anderen Seite des blutigen Teichs hockte. Einen Augenblick lang hielt der Rabe ein dunkles Knopfauge auf ihn gerichtet, und dann flog er auf und verschwand im wirbelnden Schnee und in der Schwärze der Nacht.
Blut und Feuer erfüllten Rotzahns Kopf, und er tauchte darin ein.
KAPITEL 4
»Lauf!«, schrie Hereward, als er Alric durch den weißen Wald trieb. Ihr heißer Atem bildete Schwaden in der bitterkalten Nachtluft, und ihre Fußtritte knirschten im Takt ihrer pochenden Herzen.
Ein Heulen erscholl von irgendwo zu ihrer Linken und anschließend auch zu ihrer Rechten. Das Wolfsrudel kreiste sie ein.
Auf dem gewundenen Weg zwischen Eschen und Eichen rutschten die Männer Abhänge hinunter, sprangen über Felsen und stolperten durch Büschel von braunem Farngestrüpp. An einigen Stellen lag der Waldweg unter einer dicken Schneeschicht verborgen, doch Alric erschien zu benommen, um nach Orientierungspunkten Ausschau zu halten.
»Er war ein Mensch«, flüsterte er im Laufen. Sein verquollenes, tränengerötetes Gesicht war erfüllt von bleibendem Entsetzen. »Ein Geschöpf Gottes. Was du ihm angetan hast, war ein Gräuel.«
»Es hat dein Leben gerettet.«
»Mein Leben ist nicht wertvoller als seins.« Alric packte den Arm seines Gefährten und brachte ihn zum Stehen. Sein Blick flackerte. »Wie konntest du solche Qual mit ansehen und trotzdem weitermachen?«
Hereward schaute sich um. In der Düsternis erspähte er graue Gespenster; der einzige Laut, den sie von sich gaben, war das leise Tappen ihrer Pfoten, wenn der Wind etwas nachließ. Er stieß den Mönch vorwärts, entlang einer Schneise zwischen den Bäumen. Wenige Momente später versperrte ein weiterer Bach ihnen den Weg. »Du hast recht – dein Leben ist nicht wertvoller als seins«, blaffte er. »Wenn ich dich nicht bräuchte, um einen Unterschlupf zu finden, würde ich dich hier liegen lassen, und du könntest sehen, wie du zurechtkommst.«
Aber Alric wollte ihn nicht so einfach davonkommen lassen. »Du musst für deine Sünden büßen.«
»Und was willst du tun? Mich mit einer Bibel schlagen?« Ein grauer Schatten vor dem weißen Grund – geduckt, schleichend. Noch einer. »Jetzt such gefälligst den Weg zum Haus der Wicce, damit wir nicht alle beide sterben.«
»Vielleicht wäre es so das Beste. Ich verdiene mir meine Erlösung, indem ich die Welt vor einem Ungeheuer wie dir bewahre.«
In Hereward stieg der Zorn auf. Er hätte den winselnden Kerl einfach dalassen sollen – und fertig. Er zog sein Schwert und wich an eine Eiche zurück. »Dann entscheide dich. Noch sind wir am Leben.«
Alric zögerte. Hereward sah seinem Gesicht an, wie der Mönch mit sich kämpfte. Mit einem Aufstöhnen wirbelte Alric herum, bis er einen Baum erblickte, den er wiedererkannte. Er wies mit einem zitternden Finger darauf. »Da lang!«, sagte er wütend. »Und möge Gott mir meine Schwäche vergeben!«
Hereward rannte den Bach entlang auf den Baum zu, aber er wusste schon, dass es zwecklos war. Er konnte das Haus nirgendwo im Waldesdunkel sehen, und die Wölfe würden ihm auf der Spur bleiben, angelockt von dem Geruch des Blutes, das an ihm haftete.
Er sprang über einen gefallenen Baumstamm, rutschte unfreiwillig einen Abhang hinunter und landete in einer Senke voll mit Dornengestrüpp und den Überresten eines vom Blitz gefällten Baumes. Als ihm klar wurde, dass dies so ziemlich die schlechteste Position für einen Kampf war, die man sich denken konnte, hatten die Wölfe bereits am Rand der Mulde Aufstellung genommen; ihre Umrisse waren gegen den Schnee deutlich zu erkennen.
»Verdammtes Pack!«, fauchte er und blickte zu Alric, der den Hang hinuntergeschlittert kam und in eine Schneewehe stolperte. »Sieht so aus, als hätte Gott deine Gebete erhört!«
Er hackte sich den Weg durchs Unterholz in die Mitte der Senke frei und drehte sich dann langsam im Kreis, in Erwartung des ersten Angriffs. Er schätzte, dass mindestens zehn Tiere um den Rand schlichen, und vielleicht waren dahinter noch mehr.
Alric schrie auf, als der erste Wolf hinuntersprang. Einen Augenblick später kamen sie alle auf einmal. So schnell wie die angreifenden Tiere blitzte Herewards Schwert auf und nieder. Der Recke erschlug zwei von ihnen, ehe er in einer Masse von dunklen Leibern und geifernden Fängen verschwand. Er kämpfte mit Faust und Ellbogen, ließ sein Schwert sausen, sobald er Platz genug hatte, um es zu schwingen. Blut sickerte aus seinem zerfetzten Fleisch, und er wankte unter der Wildheit des Angriffs.
Drei weitere Wölfe fielen in schneller Folge mit aufgeschlitzten Leibern. Bevor Hereward Atem holen konnte, sprang ein weiterer nach seiner Kehle. Der Recke warf sich zur Seite, und das Tier verbiss sich in seinen Oberarm. Hereward ignorierte den Schmerz und stürzte sich auf den Hals der Bestie. Er schlug die Zähne in das nasse Fell und riss dem Tier die Kehle heraus. Ein Schwall von hellem Blut tränkte sein Gesicht, als der Wolf zur Seite fiel und in Todeszuckungen um sich schlug.
Er erhaschte einen Blick auf den totenbleichen Mönch, der sich zwischen die Wurzeln des umgestürzten Baums geflüchtet hatte.
Aber schon im nächsten Moment griffen die verbliebenen Wölfe alle auf einmal an. Hereward tötete zwei mit schnellen Hieben von Hirnbeißer und zerschmetterte einem dritten den Schädel, doch der letzte Wolf erwischte ihn auf dem falschen Fuß. Die Wucht seines Angriffs schleuderte ihn rücklings in das Dornengestrüpp, und als er auf den harten Boden prallte, flog ihm das Schwert aus der Hand.
Im nächsten Augenblick war der Wolf über ihm. Hereward gelange es gerade noch, die zuschnappenden Fänge eine Handbreit von seiner Kehle fernzuhalten, aber er spürte, wie seine Kräfte nachließen.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie Alric aus seinem Unterschlupf hervorkroch und zum Rand der Senke hochkrabbelte. Oben angekommen hielt der Mönch kurz inne und schaute mit einem finsteren Gesichtsausdruck noch einmal zurück. Dann war er verschwunden.
Näher und näher kamen die Fänge des Wolfs. Heißer Atem blies in Herewards Gesicht, Geifer spritzte gegen seine Haut. Seine Arme zitterten. Er konnte seinen Blick nur noch auf die kalten, juwelenfunkelnden Augen der Bestie richten, und schließlich füllten sie sein ganzes Gesichtsfeld aus.
Ein plötzlicher Schlag schleuderte den Kopf des Wolfs zur Seite. Hereward schreckte zurück. Als der Schock nachließ und er sich wieder gefasst hatte, sah er das Tier mit eingeschlagenem Schädel auf dem blutbefleckten Schnee liegen. Ein großer, blutiger Stein lag daneben.
Einen Schritt weiter entfernt stand Alric. Er hatte die Hände auf die Knie gestützt und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Er tauschte einen Blick mit Hereward, sagte aber nichts, sondern brachte nur ein Nicken zustande.
»Warum?«, fragte Hereward, als er sich ein Stück weit hochstemmte und seinen Kopf drehte, um nach seinem Schwert Ausschau zu halten.
»Weil ich besser bin als du«, keuchte Alric. »Und weil ich mich der Aufgabe stelle, die Gott mir gegeben hat.«
Hereward streckte seine Hand aus in der Hoffnung, dass der Mönch sie ergreifen und ihm beim Aufstehen helfen würde. Doch Alric warf nur einen Blick darauf, bevor er sich abwandte und abermals aus der Mulde herauskletterte. »Ich bin nicht dein Hüter«, sagte er.
Hereward entdeckte sein Schwert und benutzte es anschließend als Stütze, um den Hang hinaufzusteigen. Blut rann aus zahlreichen Wunden, aber keine schien so schwerwiegend zu sein, dass er den Marsch zu ihrem Unterschlupf nicht überleben würde. Alric wartete oben auf ihn.
»Glaub nicht, ich stünde jetzt in deiner Schuld, weil du mir das Leben gerettet hast«, erklärte Hereward.
»Nein, du würdest mich opfern, ohne mit der Wimper zu zucken, wenn es dir einen Nutzen bringt. Ich bin schließlich nicht blind.« Alrics Blick ging zu den roten Tropfen im Schnee, die neben Herewards Fußspuren zu sehen waren. »Das ist geradezu eine Einladung für alle anderen Wölfe, die hier in der Gegend umherstreifen. Wir sollten uns lieber beeilen.«
Sie setzten ihren Weg schweigend fort, wobei Alric nach Orientierungspunkten suchte und Hereward sich auf sein Schwert stützte. Der Schneesturm wurde wieder stärker, bis sie kaum mehr als zwei Armlängen weit sehen konnten. Der Recke spürte, wie es immer kälter wurde. Er wusste, dass es nur eine Sache der Zeit war, bis der Wärmeschlaf sie überkommen würde.
»Habe ich einem Narren vertraut, sodass ich nun dafür mit meinem Leben bezahlen muss?«, murmelte er.
»Dein Leben gehört jetzt mir, und ich kann damit machen, was ich will«, gab Alric zurück. Er hielt plötzlich inne und spähte durch das windgepeitschte Astwerk. »Da – ist das dort ein Haus?«
Als Hereward mit seinem Blick dem ausgestreckten Finger des Mönchs folgte, wurde erneutes Heulen hinter ihnen laut. Hereward stieß seinen Gefährten weiter und humpelte hinter ihm her, so schnell er konnte. Er war nicht vor den Hunden des Königs geflohen und hatte sich nicht durch halb England gekämpft, um hier im Schnee als Wolfsbeute zu enden. Die beiden Männer kletterten über Felsen und umgestürzte Bäume. Schneeschauer regneten von den Ästen auf sie herab. Das Knacken und Brechen im Unterholz hinter ihnen wurde immer lauter, als die Wölfe näher kamen.
Hereward glaubte schon, dass der Mönch sich geirrt hatte, als plötzlich ein niedriges Fachwerkhaus mit strohgedecktem Dach aus der Dunkelheit auftauchte. Auf den ersten Blick sah es so baufällig aus, als drohte es jeden Moment zusammenzukrachen. Tief eingebettet zwischen Bäumen und Felsvorsprüngen wirkte es fast wie ein natürlicher Teil des Waldes.
Der Mönch trommelte verzweifelt gegen die hölzerne Tür, bis schließlich von drinnen eine Stimme ertönte: »Geht weg!«
»Bitte«, flehte er. »Die Wölfe kommen.«
Einen Augenblick später schwang die Tür auf, und Alric und Hereward stürzten in das von Rauch erfüllte Innere. Hereward schlug die Tür mit der Schulter zu und ließ den Riegel herunterfallen. Er presste die Stirn gegen das raue Holz und spürte, wie der letzte Rest seiner Kraft aus ihm wich.
»Fort! Ich dulde keinen Kirchenmann in meinem Haus!« Aus dem Dunkel des einzigen Raums schlug eine Frau mit einem Reisigbesen nach Alric. Ihr Gesicht war hohlwangig und ihr Haar strähnig und grau, aber ihr Schlag hatte eine solche Wucht, dass der Mönch auf den gestampften Lehmboden stürzte.
Hereward taumelte einen Schritt nach vorn und fing den nächsten Streich des Besens mit der Hand ab. »Halt ein.«
Mit flammenden Augen musterte die Alte den blutverschmierten Recken.
»Wir zahlen gut für eine Nacht«, sagte er und ließ die Münzen in seinem Beutel klingeln. »Bis Sonnenaufgang, dann ziehen wir weiter.«
»Der nicht.« Sie wies mit einem zittrigen Finger auf Alric. »Seine Art hat uns seit Generationen gequält und geplagt. Erst kommen sie mit einem Lächeln, dann mit einem Stirnrunzeln, schließlich kommen sie mit Stöcken und Speeren.«
»Wenn er dir zu nahe rückt, kriegt er von mir eins drüber.« Hereward musste sich an der Tür abstützen. Er bereute es, dass er sich auf diese Sache eingelassen hatte. Sie lenkte ihn von seinem Vorhaben ab, und jetzt war er hier, geschwächt und verwundet, und bis nach York waren es noch viele Meilen. Er wusste, allein würde er die Stadt nie erreichen.
»Wer bist du, dass du wie ein Schlächter hier auftauchst?«, fragte die Alte.
»Mein Name ist Hereward, und ich danke dir für deine Hilfe. Der Mönch hört auf den Namen Alric. Lass uns bis Tagesanbruch hier auf dem Fußboden schlafen, und dann sind wir wieder weg.«
»Woher weiß ich, dass ihr nicht die Absicht habt, mich zu töten und alles zu stehlen, was ich habe?«
Hereward sah sich in dem fast kahlen Raum um. Es gab ein Strohlager direkt neben dem Feuer und einige wenige schäbige Kochtöpfe. Bündel von getrockneten Kräutern waren an einer Wand aufgestapelt. Er roch den süßen Duft von Lavendel und Ampfer. Sein Blick glitt schließlich über die großen und kleinen Tierschädel – Dachs, Hase, Maus, Schaf –, die an geflochtenen Schnüren hingen.
»Weil du eine Hexe bist und uns verfluchen wirst!«, rief Alric aus und rappelte sich auf.
»Ja, genau!« Die Alte zeigte erneut mit ihrem knochigen Finger auf ihn; hastig wich er einen Schritt zurück.
Seufzend packte Hereward den Mönch und stieß ihn unsanft gegen die Wand. »Wir brauchen Schutz für die Nacht«, zischte er. »Jetzt verdirb es nicht mit deinem dummen Geschwätz. Oder soll ich sie lieber umbringen, damit du deine Ruhe hast?«
Alric blickte von Hereward zu der Alten und furchte besorgt die Stirn. »Also gut«, flüsterte er.
Hereward fischte einen Silberpfennig aus seinem Beutel und warf ihn der Frau zu. »Reicht das für eine Nacht?«
Die Alte fing die Münze geschickt auf und nickte. »Ihr könnt Brot haben«, sagte sie. »Und Wasser. Auch habe ich Kräuter, die deine Wunden schneller heilen lassen.« Sie wies auf eine Ecke des Raumes, die weiter weg vom Herd war. »Dort könnt ihr euch hinlegen. Aber ich werde immer ein Auge auf euch haben, auch wenn ich schlafe.«
Die beiden Männer rafften einen Armvoll schmutzigen Strohs zusammen und verstreuten es in der Ecke. Die bittere Kälte drang dennoch vom Lehmboden herauf und durch die dünne Fachwerkmauer, aber das Feuer bot eine gewisse Wärme, und zumindest waren sie nicht mehr dem beißenden Wind ausgeliefert. Nachdem Hereward seine Verletzungen mit Wasser ausgewaschen hatte, zerstampfte die Alte ein paar Kräuter in einem Mörser und vermischte sie mit etwas Schweinefett, damit er sie sich als Salbe auf die Bisswunden auftragen konnte. Es brannte zunächst, aber bald setzte eine leicht betäubende Wirkung ein.
Während der Recke seine Wunden versorgte, saß Alric wie benommen da, die Arme um die Knie geschlungen. Sobald die Frau sich hingelegt hatte und laut schnarchte, fragte er: »Wohin geht es jetzt weiter?«
»Wohin ich gehe, weiß ich«, gab Hereward zurück. »Nach York.«
»Ich könnte ins Kloster zurückkehren und um Sanktuarium bitten, aber …« Die Worte des Mönchs erstarben.
»Du wirst deine Sünden beichten müssen.«
Alric funkelte den Recken an, bis ihm klar wurde, dass Hereward nichts Bestimmtes damit gemeint hatte. Er ließ seine Schultern hängen. »Ich kann nicht zurück. Hierbleiben kann ich auch nicht. Harald Rotzahn wird nicht aufgeben, bis er mich gefunden hat.«
Mit dem Messer in der Hand legte Hereward sich nieder. Er spürte die Erschöpfung in den Knochen. Der Weg durch den Schnee nach York würde noch mehrere Tage in Anspruch nehmen und sehr beschwerlich sein. »Schlafe«, sagte er. »Im Augenblick sind wir sicher. Und bei Licht sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus.«
Der Rabe flog zurück zur Erde, und Harald Rotzahn kehrte mit ihm heim.
Ein paar Augenblicke lang musste er sich erst einmal sammeln; immer noch wurde er von dem Gefühl des Fliegens beherrscht. Als die Erinnerung an seinen Gang am Gestade jenes großen dunklen Meeres ein wenig verblasst war, machte er sich auf den Rückweg zu dem behelfsmäßigen Lager und brüllte: »Ho! Alle Mann zu mir!«
Schlaftrunken krochen die Männer aus ihren Unterständen im treibenden Schnee hervor und versammelten sich um ihn.
»Brecht das Lager ab. Wir machen uns auf die Suche nach dem fremden Krieger«, knurrte Rotzahn.
Ivar schlang die Arme um den Oberkörper, um sich zu wärmen, und meinte: »Es ist noch lange nicht Morgen.«
»Unsere Pläne haben sich geändert.« Harald Rotzahn zog sich die Hose herunter und urinierte in ein Gefäß aus einem der verbrannten Häuser. »Trinkt das!«, befahl er. »Möge der Saft des Pilzes euch mit der Kraft eurer Ahnen erfüllen.«
Er reichte den dampfenden Krug an Ivar und dann an die anderen Männer weiter. Die Macht des Pilzes lebte in seinem Urin weiter, aber seine Reise hatte das Gift herausgezogen, das sie am Gestade des großen dunklen Meeres hätte gefangen halten können.
»Hört den Ruf eurer Ahnen«, sagte er. »Spürt den Sog der Gezeiten und das aufsteigende Feuer in eurem Bauch. Jetzt ist die Zeit gekommen, auf die Jagd nach dem Fremden zu gehen. Jetzt ist die Zeit, um zuzuschlagen.«
KAPITEL 5
Westminster
Der Mann mit der Kapuze ritt direkt gegen den peitschenden Schnee an; sein jungenhaftes Gesicht war gefühllos vor Kälte. Schneeflocken bedeckten seinen grauen Wollumhang, desgleichen die braune Mähne seines Pferdes und das Packpferd hinter ihm, das mit einem der Geheimnisse Gottes beladen war. Er konnte nicht einmal den Kopf wenden, um nach den zwei bewaffneten Wachen zu sehen, die ihn auf der Reise zu dem kleinen Dorf bei Winchester und hierher zurückbegleitet hatten.
Der weiße Vorhang verhüllte London mit seinen Türmen, Kirchen und dreckigen Gassen, doch gelegentlich drang von ferne Fackelschein durch die Düsternis. Taub vom Heulen des Windes überhörte er, wie einer seiner Begleiter etwas schrie, bis der Mann zu ihm vorpreschte, ihn an der Schulter packte und nach vorn wies. Vor ihnen zeichnete sich im Sturm die hohe Holzpalisade ab, die den Königspalast umgab. Ein vermummter Wachtposten stand auf einer Plattform über dem großen Tor und hielt eine Laterne hoch, um zu sehen, wer sich da näherte.
»Ich bin’s, Redwald«, rief er mit frosttaubem Mund, »im Auftrag der Königin!«
Die Torflügel öffneten sich ruckweise, als der Wachtposten und ein weiterer Mann sie gegen den treibenden Schnee aufzerrten.
»Teufel noch mal, ich hoffe, sie belohnt dich gut dafür, dass sie dich bei diesem Wetter rausschickt«, rief der Wachtposten, als der junge Mann vorüberritt.
Innerhalb der Umfriedung war der Wind nicht mehr so stark, aber die beißende Eiseskälte drang Redwald durch Mark und Bein. Zumindest hatte er seine Aufgabe erfüllt, und sie würde ihn mit Sicherheit dafür belohnen, wenn nicht jetzt, dann später. Redwald unterdrückte ein Grinsen und schlug seine Kapuze zurück. Darunter kam sein Gesicht zum Vorschein, das immer noch viele kindliche Züge aufwies. Das lockige braune Haar, die apfelroten Wangen und die vollen Lippen erweckten einen Eindruck von Unschuld, den er im Umfeld des Hofes zu seinem Nutzen einsetzte. Er hatte selbst schon erfahren, wie hart es an diesem Ort zuging, wo es so viele starke, gerissene Männer und Frauen gab, die alle in einem ständig wechselnden Schattenspiel ihren eigenen Vorteil suchten. Aber er würde darin nicht untergehen. Er würde überleben.
Der junge Mann saß ab, stampfte den Schnee von den Lederschuhen und rieb sich die Hände, um sie zu wärmen. Die Wachen hatten bereits das Weite gesucht, in der Hoffnung auf ein Feuer und einen Krug Met. Ihre Fußstapfen vermischten sich mit den Trampelspuren, die zu den Türen der neu errichteten Fachwerkhäuser führten, welche sich in der Umfriedung drängten. Ihre strohgedeckten Dächer ächzten unter der Last des gefallenen Schnees. Der Palast von Westminster – König Eduards neues Heim und Höhepunkt von Jahren frommer Träume – erstreckte sich über den Großteil von Thorney, einer von den Ausläufern der Mündung des Tyburn gebildeten Insel am Themseufer südwestlich von London. Die Earls und Thegns des Königs klagten über den eisigen Wind, der im Winter vom Fluss heraufzog, aber Redwald hatte gehört, dass Eduard von Gott angewiesen worden war, hier eine Kirche zu bauen.
Und wenn er auf die riesige Silhouette blickte, die jenseits der Palastgebäude aufragte, konnte der junge Mann es beinahe glauben. Die Geschichten hierzu waren in seinem Gedächtnis eingebrannt: dass ein Fischer an dieser Stelle eine Vision des heiligen Petrus gehabt hatte, dass der alternde König Engel gehört und sich mit einer Energie an den Bau eines Monuments für Gott gemacht hatte, welche die Tatkraft weit jüngerer Männer in den Schatten stellte. Redwald erinnerte sich an das Gerücht, dass der Monarch nie zwischen den Schenkeln seiner Frau gelegen hatte und dass die neue Abtei St. Peter, seine künftige Grabstätte, alles war, was den König in diesem Leben noch interessierte. Beim Blick auf das hoch aufragende Bauwerk konnte er die Gedanken seines Herrschers nachvollziehen. Jeden Tag hatte Redwald den besten Steinmetzen aus ganz Europa bei der Errichtung der höchsten Kathedrale Englands zusehen können, welche die alte Kirche der Benediktiner ersetzen sollte, und Eduard hatte die Arbeit am Bau Säule um Säule, Bogen um Bogen überwacht. Selbst im Dunkeln war zu erkennen, dass das Werk sich seiner Vollendung näherte; nur das Dach und ein Teil des Turms waren noch nicht fertig.
Redwald überlief ein Schauder, bei dem sich ihm die Nackenhaare sträubten. Dieser Bau war mehr als ein Heiligtum, er war ein Zeichen der Macht – irdischer Macht. Wer so etwas schaffen konnte, dem war schlichtweg alles möglich.
»Habt Ihr es?« Eine aufgeregte Frauenstimme schnitt durch das Heulen des Windes.
Redwald wandte sich um und sah die Königin erwartungsvoll durch den Schnee gestapft kommen. Ein dicker roter Wollumhang schützte sie vor den Elementen. Wenngleich Edith ihr dreißigstes Jahr schon vollendet hatte, konnte der junge Mann bei ihr immer noch die Schönheit ihrer Jugend erkennen, die etliche Männer angelockt hatte. Manche würden den König, der fast doppelt so alt ist wie sie, als glücklichen Mann bezeichnen, dachte er. Aber er gehörte nicht dazu; denn auch wenn sie hinter dem Thron stand, so hätte sie doch genauso gut darauf sitzen können. Er erinnerte sich an ihre scharfe Zunge, wenn sie ihre Zofen zurechtwies, und an den Ausdruck kalter Entschlossenheit in ihrem Gesicht, den sie manchmal in ihren stilleren Momenten zeigte. Aber schließlich war Edith eine Tochter Godwins von Wessex, und viele glaubten, dass sie und ihre Brüder die eigentlichen Herrscher Englands waren.
»Ja«, gab Redwald mit einem raschen, Lob heischenden Lächeln zurück, »aber es war nicht leicht.«
»Dann kommt, schnell. Bringt es nach drinnen.« Edith drehte sich auf dem Fuß um und marschierte zurück zur königlichen Halle.
Redwald rief nach einem der Burschen, damit dieser die Reittiere in den Stall führen sollte, dann machte er sich mit klammen Fingern daran, die kleine Eichentruhe vom Rücken des müden Packpferds loszubinden. Fast erwartete er, dass der Kasten aufleuchten oder zumindest eine innere Glut ausstrahlen würde, aber die eisernen Beschläge waren unerträglich kalt. Er presste die Truhe an seine Brust und schritt vorsichtig über den vereisten Pfad zur Halle.
Er schlüpfte durch den Eingang und seufzte dankbar, als Wärme ihn einhüllte. Ein Feuer loderte in dem großen runden Herd, der das Zentrum des hohen Raumes bildete. Zwei Sklaven legten ständig Holzscheite nach, um den Winter fernzuhalten. Der orangerote Schein strich über die gestickten Teppiche, welche die Wände schmückten – ihre besondere Wertarbeit, als Opus Anglicanum bekannt, hatte nirgendwo in Europa ihresgleichen –, aber das Licht der Flammen erreichte nicht die Schatten, die zwischen den tiefen Deckenbalken hingen. Nach den Entbehrungen der Reise hatte der Anblick der Kunstwerke in der Halle etwas Erhebendes: die atemberaubende Malerei an der Ostwand mit der Darstellung des Kreuzwegs Christi; die Truhe aus Fischbein; das mit Juwelen besetzte und mit feinen Ziselierungen verzierte goldene Geschirr; das Elfenbeinkreuz, in das Engel geschnitzt waren. Gewiss sagten die Gäste des Königs, wenn sie dies alles sahen, dass es auf der ganzen Welt keinen prächtigeren Hof gab als den von England.