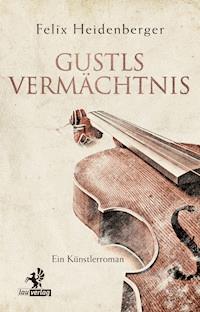5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Altphilologe und Geschichtsprofessor Dr. Guido Hermes reist von München nach Leipzig, um auf der Buchmesse seinen Roman "Der Mischkrug" vorzustellen, in dem er versucht hat, die Idealvorstellungen aus Platons philosophischen Dialogen erzählerisch aufzubereiten. Der Roman findet kaum Interesse beim Publikum. Das im gleichen Verlag erschienene Sachbuch "Die Materie lebt" des Hirnforschers Dr. Eliya Singh wird dagegen als Bestseller gefeiert. Beide Autoren verfallen der erotischen Ausstrahlung der Fernsehjournalistin Dr. Herma Schäfer, die sich ihrerseits von der Altersreife des Professors genauso angezogen fühlt wie vom Forscherdrang des Neurowissenschaftlers, der in der Glaubensabhängigkeit die Ursache für alles menschliche Leid sieht. Die Gegensätze der Kontrahenten spitzen sich zu: Professor Hermes, gläubiger Katholik, verfolgt mit Sorge die Experimente des Rivalen, vor allem, weil dieser die Journalistin Herma für seine Forschungen zu manipulieren scheint. Aktueller Hintergrund des Romans: Die letzten Geheimnisse unseres Gehirns sollen endlich gelüftet werden. Eine internationale "BRAIN-Initiative" fordert alle Hirnforscher der Welt dazu auf. Die Europäische Union will mit einem eigenen "Human-Brain-Projekt" bis 2020 das menschliche Gehirn endgültig "in Action" erforscht haben. Es geht unter anderem um die Klärung der äußeren Einflüsse, durch die neuronale Aktivitäten in und zwischen den Gehirnzellen ausgelöst werden und unser Denken, Fühlen und Handeln steuern: die multimediale Beeinflussung durch Funk und Fernsehen, durch Internetnetzwerke, durch Bücher und Publizistik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Ähnliche
Felix Heidenberger
Hermes oder Die Macht der grauen Zellen
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Buch 1 – Das Böse
1
2
3
4
5
6
7
8
Buch 2 – Das Geheimnis der Amygdala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Buch 3 – Ahura Mazda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Epilog
Hinweis
Anhang
Impressum neobooks
Buch 1 – Das Böse
Der Herr sprach: Schreib auf, was du siehst, schreib es deutlich auf Tafeln, damit man es mühelos lesen kann. Denn erst für eine bestimmte Zeit gilt, was du siehst; es eilt der Erfüllung zu und wird nicht enttäuschen.
Das Buch Habakuk (2,2–3)
1
Der ICE nach Leipzig rollte aus dem Münchner Hauptbahnhof. Professor Guido Hermes, emeritierter Ordinarius für Geschichte des Altertums und Autor gern gelesener Werke über die alten Griechen und Römer, sah nicht aus dem Fenster. Vergebens suchte er in der Literaturbeilage der Morgenzeitung seinen Namen oder den Titel seines neuen Romans. Enttäuscht legte er das Blatt beiseite. Sein Blick fiel auf den Mann ihm gegenüber. Erstmals nahm er den Fremden zur Kenntnis. Ganz in Schwarz gekleidet sah er aus wie ein Kleriker. Nur der weiße Kragen, das runde Kollar, fehlt, dachte Hermes. Der blank polierte Glatzkopf würde zu einem Mephisto passen.
„Professor Hermes?“, sprach ihn der Herr mit leichter Verbeugung an. Er deutete auf den Namen des Reservierungsschildes über dem Platz des Professors. „Welche Ehre! Sie fahren auch nach Leipzig – zur Buchmesse?“
Hermes betrachtete den Mann in seiner hochgeknöpften, halbpriesterlichen Verkleidung genauer. Der Kahlkopf gefiel ihm durchaus nicht.
„Ich darf mich vorstellen: Krumbiegel! Ich hatte auch reserviert. Welch ein Zufall! Fühle mich wirklich geehrt.“
Hermes warf einen Blick auf das Namensschild gegenüber. Der Name Krumbiegel sagte ihm nichts, schien aber passend zu dem Mann. Er schätzte ihn auf etwas über dreißig. Könnte mal Student bei mir gewesen sein, überlegte er.
„Sie kennen mich nicht?“ Die Frage klang provozierend. „Macht nichts. Sie lesen keine Kriminalromane?“
„Tut mir leid.“ Hermes’ Interesse für derartige Literatur hatte bei Agatha Christie und George Simenon aufgehört, Sherlock Holmes war für ihn unübertroffen, Donna Leon nur als Film erträglich – wegen der Musik und des Venedig-Ambiente.
„Macht nichts“, wiederholte Krumbiegel. „Ist ja wohl auch eine Generationsfrage. Allerdings“, er hob den Zeigefinger, „eine Statistik in Altenheimen hat ergeben, dass auch dort Krimis am meisten gefragt sind.“
„Wohl eher eine Geschmacksfrage“, konterte der Professor. Dieser Pseudokleriker sah ganz so aus, als schriebe er solche Sachen.
„Über Geschmack lässt sich ja gut streiten“, meinte Krumbiegel, das Zitat verdrehend. „Was halten Sie von Dostojewski? Der schrieb auch Kriminalromane. Die Brüder Karamasow … und so.“
Hermes schüttelte den Kopf. „Das ist Literatur.“
Herr Krumbiegel lächelte diabolisch. „Immerhin, da geht’s auch um Mord und Totschlag. War mal ’n Bestseller. So was ist noch immer gefragt.“
„Da haben Sie allerdings recht. Das Böse hat Konjunktur.“ Der Professor griff nach der Literaturbeilage. „Zur Abwechslung mal wieder als Märchen.“ Er hielt seinem Gegenüber die Zeitung hin. „Haben Sie das gelesen? Ist für den Kinderbuchpreis nominiert.“
Krumbiegel nahm die Zeitung und warf einen Blick auf den Titel: Fingerli und das Böse – ein Märchen, aus der Hand zu lesen [s. Anhang].
Mit dem geschärften Blick des Kriminalisten überflog der Erfolgsautor die abenteuerliche Geschichte des kleinen Fingers, der sich von seinen vier handsamen Brüdern löst, um eigenhändig den Unterschied von Gut und Böse zu entdecken, dabei in die Fänge der Versuchung gerät und am Ende erfahren muss, dass sich das Böse immer in Menschengestalt versteckt.
„Interessant!“ Der Kriminalschriftsteller reichte die Zeitung zurück. „Könnte von mir sein. Ist aber nicht mein Stil.“ Er stand auf. „Werde mich mal im Zug umsehen. Vielleicht sind noch Kollegen aus der Branche da.“ Er grinste und verschwand.
Professor Hermes atmete auf, froh, den Mann los zu sein. Möchte nicht wissen, was der für Mordgeschichten schreibt, dachte er. Bildet sich ein, ein zweiter Dostojewski zu sein! Gewohnheitsmäßig zupfte er an seinem eisgrauen Lippenbärtchen, das er sich am Morgen noch leicht gestutzt hatte. Die männliche Zier hatte er sich seit seiner Promotion vor dreißig Jahren stehen lassen, um sich ein würdigeres Aussehen zu geben. Seine Doktorarbeit über Die Deutung von Kriegsursachen anhand der Geschichtsschreibung des Thukydides hatte ihm damals viel Lob eingetragen.
Er lehnte sich zurück, schloss die Augen, versuchte, seine Gedanken neu zu sammeln. Das arrogante Geschwätz seines Gegenübers hatte nicht dazu beigetragen, seine Missstimmung aufzubessern, die ihn seit dem Frühstück mit Cornelia, seiner Frau, befallen hatte.
„Ich verstehe nicht, Guido, warum du dir das antust, auf diese Messe zu fahren“, hatte sie gemeint. „Es bringt ja doch nichts.“
Cornelia verstand es nicht, verstand vieles nicht, hatte ihn eigentlich nie richtig verstanden. Hermes hatte sie nach einem kurzen Anfall von Leidenschaftlichkeit und den sich daraus ergebenden Folgen getreu seiner konservativen, gut katholischen Erziehung geheiratet. Die Ehe war nicht wirklich schlecht gewesen, aber es war bei dem einen Kind geblieben, einem Sohn, der längst den Reifegrad eines Kindes der Zeit erreicht hatte, was bedeutete, dass die geistigen Welten, in denen die beiden zu Hause waren, endgültig auseinandergedriftet waren. Eine Folge nicht zuletzt der Unfähigkeit des Vaters, seine Erzieherpflichten in den Kindheitsjahren wahrzunehmen und ein vertrauensvolles Verhältnis zum Sohn aufzubauen. Wäre sein Kind ein Mädchen geworden, hätte sich bestimmt manches anders entwickelt, sagte er sich oft. Guido hatte schon als Kind eine Schwäche für alles Weibliche gehabt. Als unschuldsvoller Jüngling war er, ohne Erfahrungen gesammelt zu haben, allzu früh Cornelias verführerischen Reizen verfallen. Er hatte für Liebe gehalten, was doch nur biologische Anziehungskraft gewesen war. Das Bekenntnis des Chorus mysticus aus Faust II: „Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“, war ihm Bestätigung seiner eigenen Empfindungen geworden. Alles männliche Gehabe, alle Kraftprotzerei, alles Militärische auch war ihm zuwider. Was ihn, obwohl grundlos, bald in zweifelhaften Geruch brachte. Ob der Versuch, diese Thematik in einem Roman mit dem vieldeutigen Titel Mischkrug abzuhandeln, sinnvoll war, erfüllte ihn im Nachhinein mit Zweifel. Selbst der Verlag, der bisher seine Sachbücher mit Erfolg herausgebracht hatte, hatte den Roman nur zögerlich ins Programm genommen.
Während in seinem Kopf all diese Gedanken kreisten, hatte Hermes begonnen, in der Hamburger Wochenzeitung zu lesen, die er sich am Bahnhof gekauft hatte. Wie auf getrennten Schienen verlief beides – das Lesen und die reflektierenden Gedanken – nebeneinanderher. Er hätte nicht mehr zu sagen gewusst, was er eben gelesen hatte. Er legte die Zeitung beiseite, schaute zum Fenster hinaus. War Albert Einstein seine Idee zur Relativitätstheorie nicht erstmals beim Blick aus dem Fenster eines fahrenden Zuges gekommen? Auf einem Feldweg, in einiger Entfernung parallel zum Gleis, sah Hermes ein Pärchen auf dem Fahrrad eng nebeneinanderfahren. Der Mann hatte einen Arm um die Schulter der Frau gelegt, mit dem anderen hielt er seinen Lenker. Hatten sie keine Angst, sich gegenseitig zu behindern? Vorbeihuschende Bäume löschten das Bild. Was hätte wohl Einstein gesagt? Ich sitze, bewege mich nicht; der Zug bewegt sich, von links nach rechts; die Landschaft bewegt sich, am Fenster, von rechts nach links; in der Landschaft bewegen sich zwei Radfahrer, von links nach rechts fahrend: In welchem Verhältnis stehen da Zeit und Geschwindigkeiten zueinander?
Die Gleichzeitigkeit des Denkens mit unterschiedlichem Sehen und Handeln wurde ihm bewusst. Wie beim Autofahren, sagte er sich: Du fährst mal nach links, mal nach rechts, achtest auf den Verkehr − und denkst dabei an ganz etwas anderes.
Hermes schloss die Augen, lehnte sich zurück. Ein anderes Bild leuchtete auf: Herma! Die Erinnerung an diese Frau hatte ihn nicht mehr losgelassen. Vergangenes Jahr war er erstmals auf der Buchmesse gewesen. Sein Verlag hatte ihn eingeladen, sein neues Buch über die Frauenfrage im alten Rom persönlich vorzustellen. Das Buch war ein bescheidener Erfolg geworden. Die Pressekonferenz mit anschließender Signierstunde hatte den Auftakt gegeben. Im Handumdrehen waren die Freiexemplare für Journalisten vergriffen gewesen. Als Letzte war Herma gekommen, hatte sich als Redakteurin vom MDR ausgewiesen und um ein Autogramm gebeten. Schon während der Pressekonferenz war ihm die junge Frau aufgefallen. Diese vollen, kirschrot geschminkten Lippen waren nicht zu übersehen gewesen. Unverwandt hatte sie ihn angestarrt. Ihre Augen hatten sich getroffen. Kurz nur. Doch es war der Anfang gewesen.
Als Fragen zum Buch gestellt wurden – unsinnige Reporterfragen über Tempelprostitution im alten Rom, die Rolle der Sklavin als Nebenfrau und mit welcher Politikerin von heute der Herr Professor die Agrippina vergleichen würde –, hatten sich Hermas schöne Lippen verächtlich gewölbt. Dann war sie vor an seinen Tisch gekommen, das Freiexemplar aufgeschlagen für ein Autogramm hinhaltend, und hatte leise gesagt: „Ich bewundere Sie!“
Noch jetzt, ein Jahr später, spürte Hermes Herzklopfen bei der Erinnerung. Wie sie ihn angeblickt hatte! Hingebungsvoll, dass es ihm einen Stich versetzt hatte. Unter seinen Studentinnen waren oft junge Frauen gewesen, die ihn angehimmelt hatten. Und er hatte den Reiz ihrer weiblichen Ausstrahlung gespürt. Die Versuchung, sich da auf etwas einzulassen, war groß gewesen. Doch die Vernunft war immer stärker. Diesmal jedoch war er nahe daran gewesen, sich dem so lange unterdrückten Verlangen auszuliefern. Lag es an seinem Alter von über sechzig? Durfte er jetzt schwach werden?, hatte er sich gefragt. Es war nicht dazu gekommen. Wie würde es diesmal sein?
Professor Guido Hermes fuhr zwar zur Buchmesse nach Leipzig. In Wahrheit jedoch fuhr er zu Herma, die Versuchung noch einmal zu wagen.
2
Während Hermes den Ereignissen entgegenrollte, drängte an diesem Eröffnungstag bereits das Publikum durch die Hallen der Buchmesse wie Verhungernde auf der Suche nach Nahrung. Für jeden Geschmack gab es etwas. Die Wissbegierigen fanden in der Sachbuchabteilung ihr Futter; diejenigen, die es mehr nach Fleischlichem verlangte, suchten bei Belletristik; die vom Gutsein Gelangweilten nach knallhart Gewürztem aus der Unterwelt; für nach Liebe Dürstende – oder was man so nennt – war reichlich Buntes im Angebot; nach Seelenspeise Hungernde trafen sich in der Esoterikabteilung. Überraschend großer Andrang herrschte bei den Wortabstinenzlern, wo statt Sprache das Bild als virtuelle Nahrung verspeist werden konnte.
Am Stand des C. H. Buchmann Verlages strömte die Menge vorbei. Nur hin und wieder streifte ein Blick die Reihe der Neuerscheinungen. Der Name Guido Hermes auf einem der Titel fiel manchem auf. Sein Werk über die Frauenfrage im alten Rom war letztes Jahr fast ein Bestseller gewesen. Doch das Gedränge schob die Menschen weiter. Schließlich blieb ein älterer Herr stehen und ließ sich das neue Buch von Guido Hermes zeigen.
Der Titel Mischkrug sagte ihm nichts. „Ein Roman?“, stellte er überrascht fest. „Wusste gar nicht, dass Hermes auch Romane schreibt.“
„Sein erster!“, erklärte die junge Dame vom Verlag, die den Stand betreute.
Der Herr blätterte ein wenig, kehrte schließlich zur Widmung am Anfang zurück und las:
Es ist gleich ungesund, unvermischten Wein oder pures Wasser zu trinken. Wein mit Wasser vermischt hingegen schmeckt vorzüglich. Ähnlich hängt es auch vom Aufbau der Erzählung ab, ob sie den Geist des Lesers erfreut. (2 Makk 15, 39)
„Worum geht’s in dem Buch?“, fragte der Herr unsicher. „Ums Trinken?“
„Oh nein“, flötete die junge Dame. „Es ist ein philosophisches Werk. Spielt im alten Athen.“
Er reichte das Buch zurück. „Aha!“, sagte er und entfernte sich.
Eine Dame, aufmerksam geworden, trat näher und bat, sich das Buch ebenfalls ansehen zu dürfen. Auch sie blätterte darin, las kopfschüttelnd die Widmung und den Text auf der Umschlagrückseite.
Der Kratér, der tönerne Mischkrug, in dem nach altgriechischem Brauch der Wein mit Wasser vermischt wurde – der Bekömmlichkeit willen und der Trunkenheit vorzubeugen –, ist dem Altphilologen Guido Hermes auch Maßstab für gerechte Ausgewogenheit im Umgang der Menschen miteinander wie auch im Verhältnis der Völker und Staaten zueinander. In der romanhaften Bearbeitung von Platons Dialogepos Politeia (Der Staat) entwickelt sich das Kräftespiel der Gegensätzlichkeiten zu einem spannenden und unterhaltsamen Wettstreit der Meinungen. Ein philosophisch tiefgründiges Werk von zeitloser Gültigkeit.
Die Dame las es noch einmal. Scheu lächelnd legte sie das Buch beiseite. „Ist nicht das, was ich suche“, sagte sie. „Schade.“
Lebhafter ging es am anderen Ende der Halle zu, wo Krimiverlage einen Gemeinschaftsstand hatten. Eine Menschentraube hatte sich vor der Nische gebildet, in der Kameras und Scheinwerfer aufgebaut waren. Ein bekannter Autor sollte interviewt werden. Das Opfer sah allerdings nicht so aus, als könne es die grausigen Geschichten geschrieben haben, die seinen Namen berühmt gemacht hatten. In seinem schlichten Konfektionsanzug mit gestreifter Krawatte glich er eher einem kleinen Beamten. Vom Scheinwerferlicht geblendet blinzelte er ins Publikum. Nervös rückte er die umrandete Brille zurecht, die ihm ständig auf die Nase rutschte.
„Kommissar Vanderbilt – ist das Ihr wirklicher Name?“, eröffnete der Fernsehmann das Gespräch.
„Ein Pseudonym“, antwortete der Autor unwirsch.
„Ihren richtigen Namen wollen Sie uns nicht sagen?“
„Nein. Der spielt keine Rolle.“
„Aber Sie sind – oder waren einmal – Polizeikommissar?“
„Nein. Der Titel gehört zum Pseudonym.“
„Gut. Dann bleiben wir bei Vanderbilt.“ Der Kulturredakteur schmunzelte verbindlich. „Herr Vanderbilt, können Sie uns erzählen, wie Sie darauf kamen, Kriminalromane zu schreiben?“
Der Pseudokommissar schob die Brille hoch. Zufrieden, endlich zur Sache kommen zu können, fing er an: „Nach dem Tod meiner Eltern vor einigen Jahren fand ich auf dem Speicher einen Karton mit solchen Heften. Sie wissen schon: diese billigen Hefte, die es früher mal gab. Es waren die Abenteuer von Tom Shark und seinem Freund Pit Strong. Offenbar hatte sie mein Vater in seiner Jugend gelesen und dann vor mir versteckt. Es waren Kurzkrimis, geschrieben von Pit Strong, dem Assistenten von Tom Shark, einem Privatdetektiv. War natürlich auch ein Pseudonym. Vorbild für die beiden dürften Sherlock Holmes und sein Partner Dr. Watson gewesen sein. Das hat mich darauf gebracht, auch so etwas zu schreiben.“
„Das heißt, Sie haben nachgemacht, was ein anderer schon vor Ihnen nachgemacht hatte?“
„Nein. Ich habe nichts nachgemacht. Ich brauchte keinen Partner. Ich schreibe alles selbst.“
„Ja. Kommissar Vanderbilt erlebt alles selbst. Sie schreiben ja in der Ich-Form. Wie schaffen Sie das?“
„Man braucht doch nur in die Zeitung zu schauen. Lug und Betrug, Mord und Totschlag sind an der Tagesordnung. Ist wie eine Speisekarte. Ich wähle mir einen Fall aus, der Rest ist dann Fantasie.“
„Ihre Fantasie ist in der Tat beachtlich. Aber diesen unheimlichen Jack Mori, Präsident der Unterwelt, der in all Ihren Romanen vorkommt, haben Sie nicht erfunden. Der kommt schon bei Sherlock Holmes vor. Da heißt er allerdings Professor Moriarty. Ist es nicht so?“
„Richtig. Doch Moriarty ist verschwunden. Ich hab ihn wiederentdeckt. Jetzt nennt er sich nur noch Jack Mori. Er ist unsterblich.“
„Ohne dieses Verbrechergenie scheinen Sie nicht auszukommen. Mori bleibt aber immer im Hintergrund – wie die Spinne im Netz, die die Fäden der Handlung knüpft. Keiner hat Mori je zu Gesicht bekommen. Sie beschreiben nicht, wie er aussieht. Warum?“
„Er ist das personifizierte Böse.“ Vanderbilt setzte sich in Positur, als müsse er die Feststellung unterstreichen.
Der Redakteur beugte sich vor und betrachtete sein Gegenüber, als sehe er ihn zum ersten Mal. „Sind nicht vielleicht Sie selbst dieser Jack Mori?“
„Was fällt Ihnen ein!“ Vanderbilt gab sich entrüstet. „Verwechseln Sie nicht den Autor mit den Figuren seines Romans!“
„Nun – Sie selbst haben sich ja zu einer Romanfigur gemacht, Kommissar Vanderbilt“, konterte der Fernsehmann. „Im Roman betonen Sie immer wieder – als Kommissar Vanderbilt –, Sie könnten einen Fall nur lösen, wenn Sie sich ganz in die Person des Täters versetzten. Es geht so weit, dass Kommissar Vanderbilt in einem Fall sogar schon kurz davor ist, den gleichen Mord zu begehen, den er aufklären will.“
„Ganz recht.“
„Das ist Ihre Masche, wenn ich so sagen darf. Das Rezept Ihres Erfolges. Ihr eigenes Rezept?“
„Ich weiß, worauf Sie anspielen. Es war auch die Methode von Father Brown, einer Kunstfigur von Chesterton. Aber diesem Pater Braun – die Figur spukt ja noch immer herum – ging es um die Seele des Täters. Er wollte den Verbrecher unbedingt katholisch machen. Deshalb musste er sich seiner Seele bemächtigen. Kommissar Vanderbilt will keine Seelen retten. Er will das Böse vernichten.“
„Dabei verzichtet er auf die forensischen Hilfsmittel, wie sie bei Kriminalromanen heute üblich sind: Computernetzwerk, DNA-Analysen, Lügendetektor und all den technischen Schnickschnack, wie er sonst in Krimis vorkommt. Warum?“
„Wie gesagt – oder habe ich es noch nicht gesagt? –, den Kampf gegen das Böse, gegen das Verbrechen kann man nicht mit Waffen und auch nicht mit raffiniertesten technischen Mitteln gewinnen, sondern allein, indem man die Wurzel des Bösen im Menschen bloßlegt.“
„Das geht aber bei Ihnen offensichtlich nicht, ohne dass Sie sich in Ihren Romanen ausführlich mit der Beschreibung der schlimmsten, gemeinsten und abscheulichsten Untaten beschäftigen.“
„Man muss das Böse beim Namen nennen. Finden Sie nicht?“
„Nun ja. Jedenfalls schätzen das Ihre Leser.“
Das Publikum spendete Beifall. Der Redakteur nahm die Unterbrechung wahr, das Interview zu beenden. „Herr Vanderbilt, ich danke Ihnen für das kurze, aufschlussreiche Gespräch.“
Die beiden Herren erhoben sich von ihren Sitzen und verschwanden hinter der Kulisse einer Bücherwand. Das Gedränge der Zuschauer löste sich auf. Nur wenige harrten aus, um vielleicht noch einen Blick auf den Autor zu erhaschen oder gar ein Autogramm.
Zwei junge Leipzigerinnen, die gestutzten Haare grell gefärbt, lila die eine, giftgrün die andere, hatten auch applaudiert, zögerten aber unentschlossen. „Wie findst’n den?“, wandte sich die Lilagefärbte an ihre grüne Begleiterin. „Ich find’n gut. Seine Romane hab’ch alle gelesen. Den letzten verfilmen se sicher wieder.“
„Man sieht’s ihm gar nich an“, sagte die Grüne. „Hatte mir den Kommissar Vanderbilt andersch vorgestellt. So wie im Film – als richtchen Kerl.“
„So wie hier is er aber in echt“, meinte die andere. „Der Kommissar is ja nur ne Erfindung.“
„Wie der Jack Mori, der Präsident der Unterwelt. Im Film is der immer nur ’n Schatten.“
„Vielleicht gibt’s den gar nich.“
„Doch, sicher“, meinte die Grüne. „Der kommt doch in jeder Geschichte vor.“
„Ja, aber nur als Einbildung.“
„Das personifizierte Böse. So hat er gesagt.“
„Ebende“, gab Lila zu. „So was gibt’s ja in Wahrheit gar nich.“
Jemand stand dicht hinter den beiden Frauen und machte sich bemerkbar. „Entschuldigen Sie, dass ich mitgehört habe. Sie lesen wohl viel Kriminalromane?“
Die Punkys wandten sich um, leicht erschrocken über das Aussehen des Fremden. Die grauen Haare hingen ihm in Strähnen bis über die Schultern, der buschige Schnurrbart verdeckte den Mund. Ein grün gestreifter Kapuzenmantel ließ ihn wie einen Mönch oder Gesundheitsapostel erscheinen. Die Augen blickten starr, als wolle er die Frauen hypnotisieren.
„Ja. Warum?“, antworteten beide.
„Das sollten Sie nicht“, sagte er eindringlich. „Sie vergiften sich mit dem Bösen.“
Beide lachten. „Keene Angst“, sagte Lila, die etwas Ältere. „Bis jetze hat’s mer noch nich geschadet.“
„Mir ooch nich“, pflichtete Grün bei.
„Oh – Sie merken es erst, wenn es zu spät ist“, sagte der Apostel. „Sie müssen gute Bücher lesen: über das Schöne in der Welt – und über die Liebe!“ Er schnalzte mit der Zunge.
„Hauen Se ab! Sie belästigen uns“, herrschte ihn Lila aufgebracht an. Sie sah, dass der Kapuzenmann ein Bündel Zettel in der Hand hielt – Werbung für Porno oder Erotikzeug, wie sie vermutete.
Der Mann reichte ihr einen der Zettel. „Sie denken Schlechtes über mich“, sagte er betrübt. „Ich sehe es Ihnen an. Ein Zeichen, wie sehr Sie schon vergiftet sind. Hier – lesen Sie das!“ Er drängte ihr den Zettel auf. „Es ist nichts Schlechtes.“ Damit verschwand er in der Menge.
Gemeinsam warfen die Frauen einen Blick auf den Zettel. Es war ein buntes Flugblatt. Auf hellgrünem Grund leuchteten mit Blättern umkränzte Blumen, im Gezweig zwitscherten Vögel. So umrandet stand dort mit zierlicher Handschrift:
Wir bewundern die Schönheit der Natur, die Schönheit einer Rose, auch wenn sie Dornen hat; die Schönheit eines Tigers, auch wenn er ein Raubtier ist; die Schönheit von Bergen und Seen: Die ganze göttliche Schöpfung ist schön. Sie ist schön, weil sie gut ist – im Gleichgewicht immer, harmonisch, zweckmäßig.
Auch der Mensch, Krone der Schöpfung, ist schön in seinem Körper, solang er gesund ist, denn er ist Teil der Natur. Wird er krank, wandelt sich das Schöne zum Schlechten, das Gute zum Bösen. Deshalb wacht der Mensch über seinen Körper, damit er gesund bleibt. Auch über seinen Geist muss er wachen, denn der Geist – sein Verstehen, Denken und Leiten – herrscht über sein Handeln. Lässt er Schlechtes einfließen in seinen Geist, wird schnell auch sein Denken schlecht und böse sein Handeln. Deshalb soll sein Denken immer nur gut sein und verschlossen gegen das Schlechte und Böse. Dann geht es auch ihm gut. Dabei helfen will Ihnen
Ramatullah Kashmir
Naturarzt und Heilkundiger
Halle 4, Esoterik-Stand
„Ne Werbung“, stellte Lila fest. „Der schreibt wahrscheinlich Bücher über so’n Quatsch.“ Sie wollte den Zettel wegwerfen, die Freundin nahm ihn ihr ab.
„Lass mal! Ich schau mir das mal an in Halle 4.“
3
Als der ICE aus München in Leipzig eintraf, begann es bereits zu dunkeln. Professor Hermes nahm sein Handgepäck, um auszusteigen. Sein Reisebegleiter, der so merkwürdig in Schwarz gekleidete Herr Krumbiegel, war vorzeitig aufgestanden, damit er als Erster an der Tür war. Er schien es eilig zu haben, war schon außer Sicht, als Hermes den Bahnsteig betrat. Der Mann hatte während der Fahrt bald gemerkt, dass Hermes wenig Wert auf seine Gesellschaft legte. Beide hatten abwechselnd den Speisewagen aufgesucht, um sich aus dem Weg zu gehen, und sich während der Zeit des Einander-Gegenübersitzens mit Reiselektüre beschäftigt.
Ein letzter Versuch des Kriminalschriftstellers, mit dem wortkargen Professor ins Gespräch zu kommen, war bereits kurz hinter Ingolstadt gescheitert, als Krumbiegel ihn wenig geistreich gefragt hatte, welche Automarke er bevorzuge – BMW oder Audi? Hermes hatte den Mann groß angeschaut, nur gemurmelt: „Haben Sie etwas gesagt?“ Da hatte Krumbiegel aufgegeben.
Im vergangenen Jahr war Professor Hermes im Hotel Leipziger Hof abgestiegen. Er hatte auf gut Glück gebucht, in der Annahme, es müsse etwas Ähnliches sein wie der Bayerische Hof in München. Als ihn dann das Taxi vor dem Eingang absetzte, hatte er geglaubt, der Fahrer habe sich in der Adresse geirrt. An der grauen Fassade des vierstöckigen Mietshauses prangte weder ein Hotelschild, noch stand ein livrierter Portier bereit, ihn zu begrüßen.
Wie sich herausstellte, hatte hier ein Hausbesitzer aus der Hotelnot in der wieder aufstrebenden Messestadt eine Tugend gemacht und den Altbau in eine Herberge der besonderen Art verwandelt. Aus den Wohnräumen waren nummerierte Einzel- und Doppelzimmer geworden, es gab nur Frühstück, kein Restaurant – als besonderen Clou aber eine monatlich wechselnde Bildergalerie im Treppenhaus und in allen Zimmern. „Hier schlafen Sie mit einem Original“, lautete der originelle Werbeslogan für das Hotel. Der Besitzer, offensichtlich Kunstliebhaber, gab sich als bescheidener Mäzen. Die beinahe familiäre Atmosphäre des Hauses hatte dem Professor schließlich so gut gefallen, dass er wieder hier gebucht hatte – diesmal allerdings ein Doppelzimmer.
Der Mann in gestreifter Dienerweste am Rezeptionstisch erkannte Hermes sofort wieder. „Willkommen, Herr Professor“, strahlte er. „Schön, dass Sie wieder zu uns kommen. Diesmal mit Frau Gemahlin?“ Er äugte nach der Tür, die Frau erwartend.
„Ach, meine Frau konnte leider nicht mitkommen“, sagte Hermes betrübt. „Ist plötzlich krank geworden.“
Der freundliche Empfangschef hatte bereits den Schlüssel für das Doppelzimmer vom Brett genommen. Er zögerte. „Möchten Sie umbuchen? Wir haben gerade ein Einzelzimmer frei. Zufällig.“
„Nein, nein. Nicht nötig“, sagte Hermes schnell. „Ich bleibe schon dabei. Das Doppel ist ja doch geräumiger.“
Der Mann nahm ihm die Reisetasche ab und geleitete ihn zum Lift. „Reiner Zufall, dass noch was frei ist“, meinte er. „Der Gast musste plötzlich abreisen. Ein Todesfall, glaube ich. Wir sind ja fast immer ausgebucht, zur Messezeit sowieso.“
Sie fuhren gemeinsam nach oben, erster Stock. Hermes kannte sich aus. Neben dem Lift ging es ins Treppenhaus, eine Stufenspirale nach unten und oben. Farbige Bilder zierten die Wand. Die Anordnung der Zimmer war wie in einem Wohnhaus. Ein kurzer Gang führte zu Tür Nummer 15, dem Doppelzimmer, davor die Türen Nummer 11 und Nummer 12 waren Einzelzimmer. Dazwischen hingen bunte Grafiken mit abstrakten Motiven. „Eine junge Künstlerin, Afghanin!“, erklärte der Hoteldiener. „Sehr interessant. Hat schon Preise gewonnen.“
Er öffnete Nummer 15 und ließ den Gast eintreten. „Wünsche wieder angenehmen Aufenthalt, Professor Hermes. Frühstück ab sieben im Speiseraum, wie immer.“
Den Euroschein, den Hermes in die gestreifte Weste schob, ignorierend, verschwand der Mann.
Guido Hermes warf sich auf das Ehebett, die Augen geschlossen. Endlich! Bin wieder da! Herma! Sie weiß, dass ich komme, hat im Verlag angerufen, sich den Mischkrug schicken lassen, will wieder ein Interview – wie voriges Jahr, hat sie gesagt.
Damals war er, erschöpft vom Trubel auf der Messe, ins Hotel zurückgekommen, zu müde, um noch zum Essen zu gehen. Plötzlich hatte das Zimmertelefon geklingelt. An der sanften Stimme hatte er sie wiedererkannt: die junge Journalistin vom MDR mit den vollen Lippen, die ihn auf der Pressekonferenz so merkwürdig angeschaut hatte und mit der Bitte um ein Autogramm kaum hörbar geraunt hatte: „Ich bewundere Sie!“
Ob sie noch zu einem kurzen Interview vorbeikommen dürfe, hatte sie am Telefon gefragt. Er hatte ihren Namen nicht verstanden, hatte nur einfach Ja gesagt, so überrascht war er gewesen.
Wenige Minuten später war sie auch schon da, zu seiner Enttäuschung ohne Kamerateam. Er hatte sie daraufhin in das Chinalokal in der Seitenstraße gegenüber dem Hotel geführt. Im Hotel wäre zu so später Stunde kein geeigneter Raum zur Verfügung gewesen. Außerdem hatte ihr Besuch seinen Appetit geweckt.
Die Erinnerung an diesen Abend mobilisierte auch jetzt seinen Magen. Seit dem kleinen Menü im Speisewagen hatte er nichts mehr gegessen. Er beschloss, wieder zu dem Chinesen zu gehen. Vorher rief er noch Cornelia an, seine Frau in München. „Bin gut angekommen. Alles in Ordnung.“ Vielmehr hatten sie sich nicht zu sagen.
Er machte sich auf zum Chinarestaurant, allein diesmal – in Gedanken aber noch einmal mit Herma.
„Ich habe auch Hunger“, hatte sie damals gesagt, als sei es ganz selbstverständlich, mit ihm zum Essen zu gehen. Hermes fand wieder den Platz, wo sie an dem Abend gesessen hatten. Diesmal war das Lokal noch fast leer. Aber die schummerige Atmosphäre mit den roten Lampions über jedem Tisch und dem Duftgemisch aus Parfüm und fremdartigem Gewürz umfing ihn sofort wieder. Er bestellte das gleiche Reisgericht, das sie gemeinsam ausgewählt hatten, auch den grünen Tee und den gleichen Rotwein dazu. Es sollte alles so sein, als säße ihm Herma gegenüber.
Die ersten Worte, die sie gewechselt hatten, klangen ihm noch nach.
„Danke, dass ich kommen durfte, dass Sie mir Zeit schenken wollen“, hatte sie das Gespräch eröffnet.
„Ich muss dankbar sein“, hatte er verlegen erwidert – im Stillen dankbar für jede Minute, die sie ihm schenken würde –, „für die Gelegenheit, mit Ihnen über mein neues Buch sprechen zu dürfen.“
Beide hatten gelacht. Über den Tisch hinweg hatte sie ihre Hand auf die seine gelegt. „Wir müssen nicht nur über Ihr Buch reden, lieber Professor Hermes“, hatte sie mit ihrer sanften Stimme gesagt und ihm tief in die Augen geblickt.
Was will diese Frau von mir?, hatte er sich gefragt, betroffen und verunsichert. Er hatte ihren Namen nicht mehr gewusst, hatte ihn vielleicht überhört. Nur als „die Journalistin vom MDR“ hatte sie sich am Telefon in Erinnerung gebracht.
„Wie heißen Sie eigentlich?“, hatte er gefragt.
„Sagen Sie einfach Herma zu mir“, hatte sie vorgeschlagen, die vollen Lippen wie zum Kuss geformt.
Hermes vergaß, dass er achtundsechzig war. Wilde Gedanken und Empfindungen hatten ihn durchjagt. Ein Schub Jugendkraft war in ihn gefahren, die Lust an einem Abenteuer geweckt − auch die Angst vor einem möglichen Fehltritt. Ich kann mich doch nicht auf etwas einlassen mit dieser Frau, hatte er sich zur Ordnung gerufen. Eine Journalistin! Es könnte einen Skandal geben. Vielleicht ist sie gar darauf aus? Oder spielt mir nur etwas vor, um mich zu testen.
Sie hatte ihm seine Verunsicherung angemerkt. „Ich war in Amerika“, hatte sie wie beiläufig gesagt. „Da ist es üblich, sich mit Vornamen anzureden. Nicht nur unter Kollegen. Sogar politische Gegner … Für mich sind Sie natürlich Professor Hermes. Keine Angst, werde Sie nicht Guido nennen.“
„Oh, bitte! Hätte nichts dagegen“, war es ihm rausgerutscht.
Sie lachte: „Hermes und Herma – namensmäßig sind wir ja beinahe verwandt.“ Ihre vollen Lippen hatten sich zum Lächeln gekräuselt. Hingerissen hatte er geantwortet: „Also gut, Herma. Bleiben wir dabei. Und Sie dürfen ruhig Guido sagen.“
„Der Name Hermes geht ja auf den Götterboten zurück. Meiner? Ich weiß nicht. Gab es eine weibliche Herma?“
Sie hatte den Altphilologen in ihm geweckt. Herma sei das altgriechische Wort für Stein, hatte er sie belehrt. Wegemarkierungen – eine Art Meilensteine – nannte man Hermen. Vielleicht habe der Zeussohn daher seinen Namen bekommen, weil er immer als Bote unterwegs gewesen war.
„Demnach wäre ich also eine Wegemarke“, hatte sie festgestellt. „Wusste ich noch gar nicht. War’s vielleicht mal für meine Eltern, als sie mir den Namen gaben.“
Die vieldeutige Anspielung war ihm ein erneutes Warnzeichen gewesen. Wegemarke − Wegweiser? Das bedeutungsvolle Wort hatte ihn so in Verwirrung gebracht, dass er schnell auf die weiteren Zuständigkeiten des Götterboten zurückkam, der unter anderem auch Schutzgott der Wissenschaften und der Redekunst gewesen sei.
„Aber auch der Diebe!“, hatte sie zwischenbemerkt, was ihn vermuten ließ, dass sie sich auf das Thema sehr wohl vorbereitet hatte.
Während des Essens – Herma hatte sich Stäbchen geben lassen, mit denen sie geschickt umzugehen wusste – war es dann nur noch um den Göttersohn, seine olympische Verwandtschaft mit Bruder Apoll und seine vielseitigen Aufgaben gegangen. Sie war es dann gewesen, die seine zahlreichen Liebschaften ins Spiel brachte. „Hat er’s nicht auch mit Männern gehabt? Und mit Aphrodite, mit der er einen Sohn zeugte? Einen Zwitter – halb Mann, halb Frau?“
Er hatte sie belehrt, dass dies ein Mythos sei, ausgehend wohl von der Tatsache, dass auch schon im Altertum bekannt gewesen war, dass sich im Menschen männliche und weibliche Eigenschaften mischen können.
Damals, bei diesem Gespräch mit Herma, war ihm im Unterbewusstsein die Idee zu seinem Roman gekommen, der unter dem Titel Mischkrug jetzt auf der Messe war. Geschickt hatte Herma das Gespräch auf sein jüngstes Buch über die Frauen im alten Rom gebracht und ihn zu Huldigungen der Fraulichkeit und aller weiblichen Vorzüge verleitet, die er in dem Buch an Beispielen beschrieben hatte. Erst gegen Ende war ihm das kleine Tonbandgerät aufgefallen, das Herma hinter dem Brotkörbchen versteckt hatte. Sie arbeite für Hörfunk und Fernsehen, hatte sie gestanden. Einiges werde sie vielleicht noch kürzen müssen, aber es werde sicher morgen in der Messerundschau des Hörfunks gesendet. Zu der Zeit war Hermes schon wieder auf der Rückfahrt nach München gewesen, aber Herma hatte ihm eine CD geschickt und sich nochmals für das Interview bedankt. Als er sich die Aufzeichnung anhörte, war auch Cornelia mit im Zimmer gewesen. Am Ende hatte sie gelacht: „Wenn ich nicht deine Stimme erkannt hätte, würde ich sagen, da hat ganz ein anderer gesprochen.“
Hermes hatte die CD im Laufe des Jahres noch oft im stillen Kämmerlein abgespielt, nur um Hermas Stimme zu hören. Gedankenverloren stocherte er jetzt im Reis seiner Pekingente. Er hatte sich Stäbchen geben lassen, um Hermas Nähe zu beschwören. Sicher hat sie auch den Roman inzwischen gelesen, sagte er sich. Ob sie gemerkt hat, wie präsent sie darin ist?
Zurück in seinem Hotelzimmer blickte er auf das Gemälde einer nackten Venus über dem Doppelbett, passend zu dem Werbespruch des Hotels: „Hier schlafen Sie mit einem Original.“ Er schlug das Bett auf und wünschte sich eine leibhaftige Präsenz.
4
Im Frühstücksraum waren bereits nahezu alle Tische belegt, als Professor Hermes eintrat. Die Mehrzahl der Gäste schienen ebenfalls Messebesucher zu sein, so kam es ihm vor: kulturbeflissene ältere Herrschaften, paarweise oder einzeln, aber immer seriös, dazwischen auch jüngere Damen, bebrillt, in strengem Kostüm manche, andere in Jeans und schlichter Verhüllung.
Er holte sich einen Teller mit dem Nötigsten vom Büffet und steuerte auf den letzten noch freien Zweiplätzetisch zu.
Ein anderer Herr kam ihm zuvor. „Verzeihung! Ich dachte, hier sei noch frei“, sagte er.
Zu spät erkannte Hermes die hagere Gestalt. Es war kein anderer als der schwarz berockte lästige Krimiautor Krumbiegel. Nicht gerade erfreut blickten sie einander an.
„Nicht mehr!“, sagte Hermes, stellte den Teller ab und setzte sich.
Krumbiegel tat es ihm nach. „Immerhin sind ja zwei Stühle da“, sagte er mit falschem Grinsen, das Hermes schon kannte.
Er kam sich vor wie Müller-Lüdenscheidt aus dem Loriot-Sketch, war versucht, darauf zu bestehen, dies sei seine Badewanne. Stattdessen bemerkte er nur: „Sie verfolgen mich!“
„Sieht fast so aus“, erwiderte Krumbiegel ungerührt.
Ein Serviermädchen brachte Kaffee, wollte einschenken. „Ich nehme Tee“, entschied Hermes spontan und hielt die Hand schützend über seine Tasse. Kaffee aus der gleichen Kanne mit diesem Mann widerstrebte ihm.
„Heißes Wasser und Teebeutel gibt’s am Büffet“, erklärte die Maid und bediente freundlich sein Gegenüber.
„Sie müssen schon entschuldigen, verehrter Professor Hermes, wenn ich Ihnen wieder lästig falle“, hob Krumbiegel an. „Ich hatte eigentlich im City am Bahnhof gebucht, hab aber versäumt, gleich nach Ankunft dort einzuchecken. Bin sofort mit dem Taxi zur Messe gefahren. Man hatte mich erwartet. Wie’s dann so geht: Man hat sich um mich gerissen – meine Lesergemeinde, Sie verstehen. Eins kam zum anderen. Der Verlag hatte irgendwo am anderen Ende der Stadt einen Empfang vorbereitet. Man hat mich dahin verschleppt. Wirklich wahr! Es wurde fast Mitternacht, bis ich endlich loskam und meinen Koffer fand, den man mir vorsorglich abgenommen hatte. Im City hieß es dann, mein Zimmer sei anderweitig vergeben. Die hatten nicht mehr mit meinem Kommen gerechnet. Nach einer Umfrage in der Bettenzentrale wurde ich dann hierherverwiesen.“
Hermes hatte sich seinen Tee geholt und widerwillig zugehört. Was geht mich dieser Mensch an?, fragte er sich. Er soll zum Teufel gehen – zu seiner Fangemeinde! Der Tag war ihm verdorben. Dabei war er doch mit Vorfreude auf das Wiedersehen mit Herma aufgewacht.
Um seinen Widerpart möglichst rasch loszuwerden, beeilte er sich mit dem Frühstück. Als er aufstand, erhob sich Krumbiegel ebenfalls, als folgten beide einem geheimen Mechanismus.
„Ich habe ein Taxi bestellt“, sagte er. „Wir können gemeinsam fahren. Um diese Zeit ist es ja schwer, ein Taxi zu bekommen.“
Es half nichts. Er musste froh sein, das Taxi mitbenutzen zu dürfen. Um Distanz bemüht, setzte sich Hermes vorn neben den Fahrer. Was Krumbiegel jedoch nicht abhielt, ihn vom Rücksitz aus weiter zu belästigen.
„Kennen Sie die Verkaufszahlen von Ihrem neuen Roman?“, fragte er, nur um sich mit eigenen Zahlen brüsten zu können. „Mein Todesengel hat die Zehntausend schon überschritten! Muss trotzdem um elf Uhr eine Lesung machen. Der Verlag besteht darauf. Im großen Saal. Werden Sie kommen? Ich lasse Ihnen einen Platz reservieren.“
Hermes tat, als habe er nicht zugehört. Zehntausend verkaufte Exemplare! Diese Auflage würde sein Roman nie erreichen. Seine Verlegerin, Frau Buchmann, hatte für heute Nachmittag einen Präsentationstermin angesetzt. Hermes hatte nur auf ihr Drängen hin telefonisch zugesagt – und in der Hoffnung, Herma dabei zu sehen. Dass der Roman ein Erfolg werden würde, so wie sein Buch im vergangenen Jahr, glaubte er schon lange nicht mehr. Zu viel Herzblut steckte darin, zu viel persönliches Anliegen – zu wenig Handlung, keine Spannung, zumindest nicht im äußeren Ablauf des Geschehens. Die innere Dramatik war kein Roman: das Ringen um Wahrheit, die Sehnsucht nach Frieden zwischen dem Ewig-Gegensätzlichen – nach der Harmonie der Liebe.
Krumbiegel plapperte unentwegt weiter. „Es gibt Leute, die lesen keine Krimis. Ich verstehe das. Das sind Leute, die sich nachts im Wald fürchten, die Flugangst haben. Wissen Sie was, Professor: Das sind Leute, die ein schlechtes Gewissen haben. Die würden auch mal ganz gern so’n Ding drehen oder auch mal einen umbringen. Aber dazu sind sie zu feige. Aber die Polizeiberichte in der Zeitung, die verschlingen sie, Prozessberichte, wo’s um Verbrechen geht – um Gewalttaten oder auch nur um spektakulären Steuerbetrug –, so was lesen sie gierig. Warum? Ich sag es Ihnen, Professor: Das sind die Leute, die Möchtegerns, die’s nie zu was bringen. Die lesen Liebesromane, Fantasiegeschichten, die immer gut ausgehen, utopisches Zeug über eine Welt, die es nicht gibt. Krimis? Pfui!
Sie gehören natürlich nicht zu dieser Art Leute, Professor. Sie lesen alles, auch mal ’nen Krimi, wenn er gut ist. Ich geb’s zu: Das meiste, was da heute auf dem Markt ist, ist primitives Zeug. Abklatsch von der alten Masche: Whodunit – Jagd nach dem Täter, wobei sich dann herausstellt, der Gärtner war’s. Oder so hirnrissige Fantasiegeschichten à la James Bond, die nur fürs Kino gut sind. Und fürs Fernsehen. Da gibt’s ja am Abend nur noch Krimis. Das meiste ist stumpfsinniger Quatsch aus Amerika. Aber ein Beweis, dass Krimis gefragt sind. Deswegen schreib ich ja welche. Und weil sie Geld bringen …“
Er kicherte und tippte Hermes auf die Schulter. „Sie hören mir gar nicht zu. Woran denken Sie, Professor? Wie schlecht die Welt ist? Da haben Sie recht. Aber nicht nur die Welt ist schlecht. Die Menschen sind’s vor allem. Ich weiß, wovon ich rede. Lesen Sie meine Bücher! Kommen Sie zu meiner Lesung, heute um elf.“
Das Taxi war im Stau stecken geblieben. „Ega das Gleiche um die Zeit!“, stöhnte der Fahrer. „De Leude fahrn wie bleede!“
Auf der Messe angekommen, trennten sich ihre Wege. Krumbiegel suchte seinen Verlag auf, Hermes ließ sich ziellos durch das Büchermeer von Halle zu Halle treiben. Eine Sintflut in Papier, so kam es ihm vor. Ein Tsunami! Ein Hekatombenopfer geistiger Ausgeburten zur Weihe des Konsums! Wer sollte all das lesen? Der Pilgerstrom, der ihn mitriss, bestimmt nicht. Hier wurde nicht gelesen, nicht gekauft. Hier wurde nur geschaut. Wohin das Auge fiel, lockten bunte Titel. Die Sprache der Bilder war lauter als das gedruckte Wort. Warum schreiben die Menschen so viele Bücher?, fragte er sich. Weil so viele Menschen Verlangen danach haben? Oder doch nur, weil sie sich mitteilen wollen – ihr Herz ausschütten, ihren Verstand – zum Preis von 19,90? Warum schreibe ich denn? Doch nicht, weil man danach fragt. Niemand zwingt mich. Nicht wegen des Geldes. Doch auch nur, weil ich mir einbilde, einiges besser zu wissen, weil ich mein Licht nicht unter dem Scheffel der Wissenschaft lassen will, sondern leuchten lassen zum Ruhm meiner Weisheit. Welch ein Selbstbetrug! Ihm wurde plötzlich klar: Ich hätte den Roman niemals schreiben sollen. Er geht unter in dieser Flut hier. Niemand legt Wert auf meine Weisheiten, meine Fantasien …
Jemand sprach ihn an. „Professor Hermes! Sie auch hier!“ Der Herr hob die Hand zur Begrüßung. Hermes wusste nicht, wer er war. „Hab Ihr Buch gesehen, drüben in Halle 4. Gratuliere! Werd es mir kaufen.“ Er verschwand in der Menge.
Die unerwartete Bestätigung seiner Existenz als Autor schreckte Hermes auf, als sei er aus einem Albtraum erwacht. Entschlossenen Schrittes, auf einmal, strebte er der nächsten Halle zu, wo der C. H. Buchmann Verlag seinen Stand hatte.
Lilott Buchmann, rüstige Witwe des Verlagserben Curt Heinrich Buchmann, empfing ihn mit gespielt vertraulicher Herzlichkeit. „Schön, dass Sie da sind, lieber Guido!“ Sie umarmte ihn und vollzog das Kussritual, ihm die Wange reichend – links, rechts, links –, obwohl sie die Abneigung des gelehrten Mannes gegen jede Art von Gefühlsregung kannte. Was sie nicht davon abhielt, ihn mit Vornamen anzureden, wenn es um Persönliches ging. Es desgleichen zu tun, widerstrebte ihm. Lilott! Welch unmögliche Karikatur eines Namens! Noch dazu bei der fülligen Figur!
„Wir müssen reden. Kommen Sie!“ Sie zog Hermes hinter die dekorative Bücherwand, wo ein behelfsmäßiges Büro mit zwei Sitzgelegenheiten eingerichtet war. Die Prinzipalin wollte auch während der Messe die Zügel ihres Verlages stets in der Hand haben.
Was gab es da noch zu reden?, fragte sich Hermes misstrauisch. Sein Pessimismus, was den Erfolg seines Mischkrug betraf, war keineswegs gewichen. Wie berechtigt, zeigte sich gleich.
„Wir müssen etwas tun für den Roman“, sagte die Verlegerin. „Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze, Professor Hermes. Nicht nur als unseren bewährten Autor. Auch als Mensch! Das ganz besonders!“ Sie drückte ihm freundschaftlich die Hand, während sie sich setzten. „Ihre fundiert wissenschaftlichen Sachbücher, die wir herausgebracht haben, waren immer ein Erfolg“, begann sie. „Nicht immer Bestseller – aber sie haben die Unkosten gedeckt. Sie haben eben Ihr eigenes, festes Publikum. Aber …“ Sie griff sich an den Hinterkopf, als müsse sie ihren Haarschopf zurechtrücken – eine typische Handbewegung, die alle im Verlag kannten: ein Signal, dass jetzt etwas Unangenehmes kam, das auszusprechen ihr schwerfiel. „Das neue Buch geht an Ihrem Publikum vorbei. Das sind keine Romanleser …“
Hermes wollte sie unterbrechen. Ihm war selbst klar geworden, dass er kein Romanschriftsteller war.
Doch Lilott Buchmann duldete keine Unterbrechung. „Wenn es wenigstens ein guter Roman geworden wäre“, fuhr sie gnadenlos fort, „mit einer stringenten Handlung, mit erotischen Details, dann bräuchten wir uns keine Sorgen zu machen, dann würde er seinen Weg gehen. So aber nicht. Es wird da ja immer nur geredet.“ Sie seufzte, schlug sich auf die straff geschnürte Brust. „Es ist meine Schuld. Ich hatte Sie ja dazu ermutigt. Es war mein Fehler. Nehme alle Schuld auf mich. Ich hätte wissen müssen … Ach, lassen wir das jetzt!“ Sie wischte das heuchlerische Eingeständnis mit einer Geste beiseite. „Wir müssen jetzt nach vorn schauen. Das Beste daraus machen.“
Lilott Buchmann setzte wieder ihr eingeübtes Lächeln auf. „Kein Grund, traurig zu sein, lieber Guido! Es gibt Hoffnung. Wie ich Ihnen schon am Telefon sagte, diese Redakteurin vom MDR, Dr. Herma Schäfer, hat sich den Mischkrug vom Verlag kommen lassen. Offensichtlich ist sie sehr angetan davon. Sie schätzt Sie, Guido. Voriges Jahr hat sie die glänzende Besprechung Ihres Rom-Buches gebracht. Jetzt will sie unbedingt wieder ein Interview mit Ihnen. Ich hab’s ihr zugesagt. Sie wird gegen vier heute Nachmittag hier am Stand sein. Wappnen Sie sich, lieber Hermes! Sie kennen die Dame ja bereits. Seien Sie nett zu ihr! Wenn sie eine Sendung mit Ihnen macht, wird der Mischkrug nicht zu Bruch gehen.“
Als der Name Dr. Herma Schäfer gefallen war, hatte es den Professor heiß durchfahren. Schäfer hieß Herma also, und promoviert hatte sie! In neuem Licht erschien sie ihm plötzlich. Distanzierter, nicht so vertraut wie in seinen Träumen.
„Ich sehe es Ihnen an“, sagte Lilott. „Die Aussicht auf das Interview hat Sie aufgemuntert.“ Sie erhob sich. „Jetzt schauen Sie sich noch ein wenig auf der Messe um. Wenn Sie wollen, können wir mittags zusammen einen Snack im Restaurant nehmen. Ich hab einen Tisch reserviert.“ Sie geleitete Hermes wieder nach vorn, wo einige Neugierige vor der Bücherwand mit den Neuerscheinungen des Verlages standen. Von dem älteren Herrn nahmen sie keine Notiz.
Hermes überlegte, ob er noch zum Friseur gehen sollte, sich die Haare schneiden lassen. Die Erwartungsfreude, die ihn vorübergehend verlassen hatte, war zurückgekehrt. Unentschlossen schweifte er noch mal durch die Halle, wo sich die Hörbuchverlage etabliert hatten. Leute hockten da herum mit riesigen Kopfhörern über den Ohren, den Blick verloren ins Nichts gerichtet. Er ließ sich zeigen, was es da zu hören gab.
„Alles, was Sie wollen“, erklärte die Hüterin der Kopfhörer. „Die neuesten Bestseller, Krimis, Liebes- und Abenteuerromane, Erotisches vielleicht …?“ Sie schaute ihn kritisch an. „Wenn Sie wollen, auch Gedichte.“
Er verzichtete. Für ihn waren Bücher zum Lesen da, nicht zum Hören. Jedes Buch daheim in seiner Bibliothek war für ihn sichtbarer geistiger Besitz.
Als Historiker und Altphilologen war ihm aber auch bewusst, dass sich in der Blütezeit Athens und im alten Rom das Geistesleben weniger im gedruckten als viel mehr im gesprochenen Wort offenbarte. Die Beherrschung der Redekunst war wichtiger als die Handfertigkeit der Skribenten. So hatte er auch seinen Roman angelegt: als lebendigen Austausch von Gedanken und Meinungen, in Rede und Gegenrede, Argument und Gegenargument, nach dem Vorbild von Platons Dialogen. Die Überzeugungskraft des gesprochenen Wortes – ob als Lüge oder Wahrheit –, wenn nur der Redner die Kunst beherrschte, Sinn und Bedeutung in die gewünschte Richtung zu drehen. So kann sowohl Liebe geweckt wie Hass geschürt werden. Das hatte er darstellen wollen. Aber angesichts der überwältigenden Bücherflut hier und Lilotts unverhohlenem Urteil gab es keinen Zweifel mehr für ihn, dass ihm dies nicht gelungen war. Einziger Lichtblick war jetzt nur noch das bevorstehende Wiedersehen mit Herma.
Im Weitergehen geriet Hermes in das Reich von Amazon, der weltweit größten Internetbuchhandlung, wie da zu lesen stand. Hier fand er tatsächlich alles feilgeboten, was je geschrieben wurde, gleich in welcher Sprache. Von dem virtuellen Angebot hatte er selbst schon Gebrauch gemacht.
An einem besonderen Stand hielt ihm eine der herumschwirrenden Hilfskräfte das neueste Kindle entgegen. „Haben Sie schon eines?“, fragte sie herausfordernd. Mit geschultem Blick hatte sie in Hermes einen Intellektuellen der älteren Generation erkannt.
„Ich brauche so was nicht“, sagte er, das schwarze Täfelchen zurückweisend.
„Sie haben sicher eine eigene große Bibliothek zu Hause. Stimmt’s? Die können Sie bestimmt nicht auf Reisen mitnehmen.“
„Brauche ich auch nicht“, gab er zurück und wollte weitergehen.
„Nun – was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Sie kennen das Zitat?“
Hermes lachte. „Wer kennt es nicht!“
„Könnten Sie es korrekt im Wortlaut wiedergeben, in ganzer Länge?“ Sie tippte auf das schmale Tablet in ihrer Hand und schaute ihn dabei herausfordernd an.
„So ungefähr, vielleicht“, sagte er. „Aber wozu?“
„Nur als Beispiel.“ Ein weiteres kurzes Tasten aufs Display, dann erschien schon das Originaltitelbild: Johann Wolfgang von Goethe – Gesammelte Werke.
Der Finger wischte hin und her, als würde sie in dem Gesamtwerk blättern. Schon war sie bei Faust I. Ein paar Wischer noch. „Da, schauen Sie!“ Sie reichte ihm das Kindle, auf dem zu lesen war:
Schüler:
Das sollt Ihr mir nicht zweimal sagen!
Ich denke mir, wie viel es nützt;
Denn was man schwarz auf weiß besitzt,
Kann man getrost nach Hause tragen.
„Na schön“, sagte Hermes. „Aber nach Hause tragen kann ich das Buch trotzdem nicht.“
„Selbstverständlich können Sie das“, versicherte die junge Dame. „Mit dem Kindle in Ihrer Westentasche haben Sie die gesamte Weltliteratur immer griffbereit. Das meiste sogar kostenlos. Sie brauchen es nur abzurufen.“
Hermes betrachtete den Zauberspiegel, ungläubig. Um eine Probe aufs Exempel zu machen – und um die Dame in Verlegenheit zu bringen –, forderte er sie auf: „Zeigen Sie mir Platons Dialog Phaidros. Ich möchte eine Stelle nachlesen.“
„Kein Problem“, sagte sie, tippte wieder ein paarmal aufs Display, schon stand da:
Platon – Phaidros
Übersetzung von Friedrich D. E. Schleiermacher
Einleitung: Gewöhnlich führt dieses Gespräch noch die zweite Überschrift: „Oder vom Schönen“; ist auch wohl sonst bisweilen „Von der Liebe“ und „Von der Seele“ genannt worden …