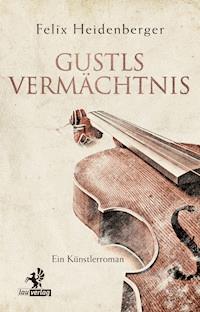
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lau Verlag & Handel KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Die Geschichte des Wiener Opernsängers, Dirigenten und Künstler-Agenten Gustav Pohl (1860-1937) spiegelt authentisch den Zeitgeist wider, der die Menschen in den Schicksalsjahren des vergangenen Jahrhunderts beherrschte. Gustl, musikalisch begabter Sohn eines armen jüdischen Handwerkers aus dem k.u.k. böhmischen Pohrlitz, beginnt seine Karriere als Dorfschullehrer. Statt mit den Kindern das Rechnen zu üben, spielt er ihnen auf der Geige vor, die für ihn der Schlüssel zum Königreich der Musik ist. Dort ist er mehr zu Hause als im wirklichen Leben. Die plötzliche Entdeckung, "jüdisch" zu sein, wird für die nichts ahnenden Nachkommen ein schwerer Schlag. Die Geschwister Alex und Käthe ahnen noch nichts von dem drohenden Schicksal, als sie das Traumschloss-Aquarell eines Möchtegern-Architekten A. H. in Händen halten, nicht wissend, dass dieser "Künstler" einmal ihr Leben bestimmen und die Welt in Brand setzen wird. Im Kampf ums Überleben in der NS-Diktatur finden sie in der Musik die hilfreiche Brücke, über die sie dem Ungeist der Zeit entfliehen können. Schauplätze des Romans sind das Wien der Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg, Berlin in den rauschenden und turbulenten 1920er und 1930er Jahren und die Kunst- und Musikstadt Dresden im Schatten der braunen Diktatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Ähnliche
Felix Heidenberger
GUSTLS VERMÄCHTNIS
Felix Heidenberger
GUSTLSVERMÄCHTNIS
Ein Künstlerroman
Felix Heidenberger begann 1946 nach Heimkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft bei Radio München als Reporter, u. a. als Berichterstatter von den KZ-Prozessen im Lager Dachau. Nebenbei studierte er Zeitungswissenschaften und Germanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität. Als Journalist, Redakteur und Dozent gestaltete er maßgeblich die Entwicklung des Fernsehens im In- und Ausland mit und war Nachrichtenredakteur beim Bayerischen Rundfunk und leitender Redakteur beim Bayerischen Fernsehen.
ISBN 978-3-95768-166-9
© 2015 Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek/München
Internet: www.lau-verlag.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Joseph Lammertz
Umschlagentwurf: Atelier Versen, Bad Aibling
Titelabbildung: © istockphoto/Vadmary
Satz und Layout: Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek
„Jeder Mensch ist nicht nur er selber, er ist auch der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal so und nie wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig, ewig, göttlich, darum ist jeder Mensch, solange er irgend lebt und den Willen der Natur erfüllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit würdig.“
(aus Hermann Hesse, „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“)
INHALT
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
I.
„Wo steckt er denn wieder, der Bub! Hast ihn net gsehn?“ Die Mutter rang die Hände.
„Was willst denn, Hanni?“, beruhigte sie der Vater und zuckte mit der Schulter. „Der Gustl wird net weit sein. Umschaun werd er sich halt. Reg di net auf!“
Doch die Mutter ließ sich nicht beruhigen. Die Sorglosigkeit, mit der ihr Mann das Verschwinden des Fünfjährigen hinnahm, regte sie erst recht auf. Und sie machte sich selbst Vorwürfe. Sie war es ja gewesen, die zu diesem Ausflug in die Bezirksstadt nach Brünn gedrängt hatte. Die Jahrhundertfeier zur Krönung von Kaiser Joseph II. wollte sie sich nicht entgehen lassen. Vor allem war es eine Gelegenheit, nach langer Zeit wieder einmal aus dem eintönigen Leben im Dorf heraus und unter Menschen zu kommen und Verwandte zu besuchen. Das Jubiläum der Kaiserkrönung interessierte sie dabei weniger. Aber an so einem Festtag würde es hoch hergehen in der Stadt. Von überallher würden die Menschen nach Brünn kommen, um bei den Feiern dabei zu sein.
Am frühen Morgen waren sie von daheim in Pohrlitz mit dem Fuhrwerk aufgebrochen, hatten Pferd und Wagen dann in der Stadt beim Postgasthof untergestellt und sich der Menge angeschlossen, die in Richtung zum Markt und zum Rathaus strömte. Es gab viel zu schauen: die mit Fahnen und Girlanden geschmückten Häuser, die in Tracht herausgeputzten Menschen, und die Luft war erfüllt mit Rufen und Singen. Von fern tönte Blasmusik. Alles schob und drängte voran – und auf einmal war der Bub nicht mehr da!
Wo war er, der Gustl? Er hatte sich mittreiben lassen mit einer Schar lärmender Kinder, hinaus nach Slawikowitz am anderen Ende der Stadt. Einfach so. Wie sie dort ankamen, war plötzlich alles ganz still. Auf einer Wiese, umstellt von Bauernwagen, war eine Tribüne aufgebaut. Ein Mann im schwarzen Anzug und schwarzen Zylinder hielt eine Rede.
Der Gustl verstand kein Wort. „Was sagt er denn?“, fragte er einen älteren Buben neben ihm.
„Woast as eh“, sagte der und schaute auf den Kleinen herab. „Grad do is as gwesn, wia da Koasa vor hundert Joar an Bauern sein Pflug hot aus di Händ gnomma und hot’n soiba übers Foid gfiehrt. So aner is a gwesn, da Koasa Joseph. Woast as jo eh.“
Der Gustl wusste es – seit heut früh. Der Vater hatte die Geschichte erzählt, wie sie am Morgen von daheim weggefahren sind. Was er aber erst noch begreifen musste, war das Glück, das er diesem klugen und weitblickenden Kaiser Joseph II. zu verdanken hatte: dass er im habsburgisch-österreichischen Pohrlitz auf die Welt gekommen war und nicht im polnischen Schlesien. Nur der Familienname Pollak erinnerte noch daran, woher der Urgroßvater eingewandert war, nachdem der Kaiser ein Toleranzedikt erlassen hatte, wonach sich jüdische Familien in Böhmen und Mähren ansiedeln durften. Seitdem war die Hälfte der Einwohnerschaft von Pohrlitz „mosaischen Glaubens“, wie in den Geburtsmatrikeln der Gemeinde vermerkt war. Sie hatten ihr eigenes Rathaus, und ihre Sprache war deutsch – ein böhmisches Deutsch, das die Wiener spöttisch „Böhmakln“ nannten. Die andere Hälfte im Dorf sprach tschechisch.
Wie der Gustl an jenem Nachmittag zum Postgasthof zurückfand, empfing ihn die Mutter mit einer Watschn. Erst dann nahm sie den Blondschopf in die Arme, schluchzend. Auch der Bub zerdrückte ein paar Tränen – wegen der Watschn. „Was woanst’n, Mama?“, stieß er hervor. „Is do nix gschehn.“
In Wien regierte jetzt der Kaiser Franz Joseph, der die bayerische Prinzessin Elisabeth, genannt Sissi, geheiratet hatte. Diesen Kaiser mit dem strengen Blick und dem buschigen Backenbart kannte der Gustl von dem Bild her, das in der Tischlerwerkstatt des Vaters hing. Es blieb auch noch da, als im Jahr darauf – Gustl hatte im Februar seinen sechsten Geburtstag gefeiert – preußische Soldaten als Einquartierung ins Haus kamen. Die lachten über den bärtigen Kaiser an der Wand. „Da hängt man besser unsern Willem uff!“, witzelten sie.
Papa Leopold fand das gar nicht lustig. Diese preußischen Soldaten hatten die Österreicher in einer blutigen Schlacht bei Königgrätz besiegt. Das war nur möglich gewesen, weil sie dieses neue Zündnadelgewehr hatten, mit dem man schneller schießen konnte. Die österreichischen Soldaten waren noch immer auf die alten Vorderlader angewiesen. „Ehscht a mol hoscht nochgloden, hot der Preiß scho drei mol gschossen“, hat ihm ein Tiroler Kaiserjäger verraten, der auf der Flucht vorbeigekommen war.
Leopold Pollak fühlte sich persönlich betroffen. Er war kaisertreu und bekannte sich – wie alle, die deutsch sprachen – als Österreicher. Und wenn der Gustl mit den preußischen Landsern, deren Deutsch so komisch klang, scherzte, war’s dem Vater gar nicht recht. Nur die Tschechen, die Pohorelice sagten statt Pohrlitz, hatten die fremden Soldaten freudig begrüßt. Jetzt werden wir von der Herrschaft der Österreicher befreit, jubelten sie. Zu früh allerdings. In Nikolsburg, nur zwanzig Kilometer weiter nach Süden auf der Straße nach Wien, machten die Preußen Halt und schlossen Frieden mit dem Kaiser. Sie zogen wieder ab – und in Pohrlitz blieb alles beim Alten.
Als Gustl zehn Jahre alt war, durfte er nach Brünn auf die Realschule gehen. Er wohnte beim Onkel Brunner, einem Bruder der Mutter. Gustl schloss gleich Freundschaft mit dem Sohn, seinem Cousin Arnim. Der war um einige Jahre älter, und Gustl bewunderte ihn. Arnim stand kurz vor dem Schulabschluss und wollte dann gleich zum Studium nach Wien. „Du musst auch nach Wien kommen, Gustl“, wiederholte er oft. „Nur in Wien kannst was werden.“
Es sollte noch sieben Jahre dauern, bis es so weit war. Denn nach der Realschule musste er erst die Lehrerausbildungsanstalt Augarten besuchen. Der Onkel Brunner hatte dazu geraten, und die Mutter hatte zugestimmt. Wäre es nach dem Vater gegangen, hätte Gustl das Tischlerhandwerk erlernen sollen, um recht bald die Werkstatt zu übernehmen. Der Vater hatte es schwer mit den Augen. Selbst die dicken Brillengläser halfen nicht mehr. Er war erst knapp fünfzig, aber schon fast blind. Die Aufträge blieben aus, und wenn nicht die Brunners in Brünn, die reichen Verwandten, ausgeholfen hätten, wäre die Familie in bittere Not geraten. Nach dem Gustl war noch ein Schwesterchen auf die Welt gekommen, die Sali, und solange Gustl beim Onkel in Brünn wohnen konnte, war ein Esser weniger im Haus. Mit einer festen Anstellung als Lehrer, so meinte die Mutter, würde Gustl eines Tages für die Familie sorgen können.
Der Bub hatte eine schnelle Auffassungsgabe, das Lernen machte ihm Spaß. Er konnte lange Gedichte auswendig aufsagen und mit seiner hellen Knabenstimme die schönsten Lieder vortragen, auch wenn er sie erst einmal gehört hatte. Die meiste Freude hatte er, wenn er am Klavier sitzen durfte. Das war ihm aber nur erlaubt, wenn der Onkel nicht zu Haus war, denn der spielte selbst wunderschön und konnte es nicht ertragen, wenn sich der kleine Neffe so ganz nach Herzenslust auf den Tasten austobte.
Um nicht länger des Onkels Missfallen zu erregen, brachte sich Gustl das Notenlesen bei. Cousin Arnim besorgte ihm Notenhefte und erklärte ihm die Tonleiter und die Punkterln und Stricherln, die auf den Notenlinien auf und ab hüpften. Gustl fand das alles recht lustig und bastelte sich einen Papierstreifen, auf dem er gewissenhaft die schwarzen und weißen Tasten nachmalte, genau wie sie auf dem Klavier waren. Darauf übte er dann heimlich in seinem Zimmer, ließ die Finger über die gemalten Tasten huschen und summte dazu die Töne vom Notenblatt. Der Musiker war geboren!
Eines Tages setzte er sich in Anwesenheit der ganzen Familie Brunner ans Klavier und intonierte fehlerlos die erste Strophe der Kaiserhymne „Gott erhalte Franz, den Kaiser …“ Da war der Bann gebrochen. Gustl durfte künftig auch ans Klavier, wenn der Onkel zu Hause war. Er hörte dem Buben zu, ermunterte ihn sogar und sparte nicht mit guten Ratschlägen. Das Üben auf seiner Papiertastatur behielt Gustl noch lange bei, auch als Vetter Arnim nach Wien übergesiedelt war, um Jurisprudenz zu studieren.
Nach drei Jahren in der Lehrerausbildungsanstalt traf eines Tages ein Brief von Arnim ein. In dem Haus, wo er wohnte, sei im ersten Stock eine Wohnung frei geworden, sehr günstig zu mieten. Der Gustl solle doch gleich nach Wien kommen. In der Rasumovskygasse, ganz in der Nähe, gebe es auch eine Lehrerbildungsanstalt, da könne er weiterstudieren, und mit einem Abschlusszeugnis von diesem Wiener Institut seien die Aussichten, eine gute Anstellung zu bekommen, gewiss viel besser als in Brünn.
Arnim schilderte das alles so in rosigen Farben, dass Gustl sofort zusagen wollte. Der Cousin hatte inzwischen sein Universitätsstudium mit der Promotion beendet, nannte sich „Dr. jur.“ und war Mitarbeiter der Neuen Freien Presse.
Sein Brief war gerade zu dem Zeitpunkt eingetroffen, da der Herr Mohacek, dem der Vater die Werkstatt verpachtet hatte, ein Angebot zum Kauf von Haus und Werkstatt unterbreitet hatte. Papa Leopold war jetzt völlig blind. Doch von seinem Häusl, in dem er sich im Dunkel genauso zurechtfand wie am hellen Tag, wo ihm jedes Eck und jede Stufe vertraut war, wollte er sich nicht trennen. Die Mutter jedoch – schon immer die treibende Kraft in der Familie – sah in Arnims Brief einen Wink des Himmels.
„Warum“, sagte sie und strich mit ihrer kräftigen Hand glättend über den Brief, „warum ziehen wir nicht gleich alle nach Wien? Was uns der Mohacek fürs Haus und die Werkstatt zahlt, davon können wir gut einige Zeit in Wien leben. Und der Gustl wird bald selber Geld verdienen, und die Sali lernt was Gscheits auf der Schul in Wien.“
Sie nickte der zarten, immer etwas schüchternen Kleinen an Gustls Seite aufmunternd zu.
„Freilich, Sali“, rief der Bruder. „Wirst sehen, wie schön’s da is, wo der Kaiser wohnt. Der Arnim sieht ihn fast jeden Tag.“
Das stimmte zwar nicht, aber Gustl war so begeistert von der Aussicht, bald wieder mit dem bewunderten älteren Freund zusammen zu sein, dass die Phantasie mit ihm durchging.
Aller Widerstand des Vaters blieb vergebens. Die Mutter redete mit sanftem Druck, wie es ihre Art war, so lange auf ihn ein, bis er nachgab und den Vertrag mit dem Mohacek blind unterschrieb – nicht ohne dass die Mutter zuvor genau geprüft hatte, dass alles ordnungsgemäß so da stand wie vereinbart.
Im Sommer 1877 war es dann so weit, dass die ganze Familie in die Hauptstadt an der Donau übersiedelte. Gustl, inzwischen ein hübscher Jüngling von siebzehn Jahren, ging gleich in die Rasumovskygasse, um sich bei dem Lehrerbildungsinstitut anzumelden. Er gab seine Personalpapiere ab und erhielt Bescheid, am nächsten Tag wiederzukommen, da er sich beim Direktor vorstellen müsse.
Tags drauf las er an der Tür des Direktors den Namen Niedergesäß. Er musste sich ein Lachen verkneifen. Frohgemut trat er ein. Gleich verging ihm das Lachen. Der Direktor wusste, wie Neuankömmlinge auf das Namensschild reagieren. Er empfing ihn mit stechendem, Autorität forderndem Blick. Der kantig gestutzte schwarze Kinnbart unter verkniffenen Lippen ließ das blassgelbe, hagere Gesicht noch blasser erscheinen.
„Pollak, Gustav?“, schnarrte er. „Das also sind Sie!“ Verachtung lag in der Stimme. Patschend schlug die Hand auf die Personalpapiere. „Der Herr Dr. Brunner hat Sie akklamiert …“ Wie ein Stück Vieh, das er kaufen solle, taxierte er den Kandidaten vom Kopf bis zu den Füßen. „Er bürgt für Sie, der Dr. Brunner. Sonst kämen Sie hier nicht in Frage.“ Die schmalen Lippen verzogen sich. „Sind a Jud.“
Dem Gustl wurde schwindlig. Am liebsten wäre er davongelaufen.
„Morgen acht Uhr beim Professor Weinwurm in der Klasse fangens an“, raunzte er. „Acht Uhr pünktlich! Hier wird nicht gschlampert!“
Mit Naserümpfen und einer Handbewegung, als müsse er einen üblen Geruch verscheuchen, schickte er den Kandidaten hinaus.
Enttäuscht und nicht mehr ganz so frohgemut wandte sich Gustl an seinen Cousin. Den Eintritt in das Lehrerbildungsinstitut hatte er sich anders vorgestellt. Arnim beruhigte ihn.
„Der Niedergesäß is a antisemitischer Depp“, sagte er. „Wie ich ihm erzählt hab, dass ich für die Presse schreib und vielleicht einen Artikel über sein hervorragendes Institut bringen könnt, da ist er ganz klein worden.“ Arnim lachte. „Die Leut san ja so blöd. Wannst ihnen sagst, sie kommen in die Zeitung, fressen’s dir aus der Hand.“
Noch immer mit gemischten Gefühlen meldete sich Gustl am nächsten Tag schon um Viertel vor acht beim Professor Weinwurm. Auch wieder so ein komischer Name! Er machte sich auf alles gefasst. Doch der Professor war genau das Gegenteil vom strengen Direktor. Alles an ihm war rund: von den schneeweißen Lockerln über der Stirn, der knolligen Nase und den weinroten Backen bis zum Bäuchlein und herab zu den braunen, leicht nach oben gebogenen Schuhen, die aussahen wie die Kähne auf der Donau.
Der freundliche Herr hielt eine Geige in der Hand. Gustl starrte auf die Wurstlfinger, die den Geigenhals umspannten. „Was schaugst so? Soll ich dir was vorspielen?“ Das war eine andere Art von Begrüßung. Gustl atmete auf.
Professor Weinwurm klemmte die Geige unters Kinn und fiedelte ein paar schwungvolle Takte. „Pädagogik, Musik und Gesang, das kannst bei mir lernen“, sagte er. „Hast a Stimm? Lass hören!“
Gustl räusperte sich. Dann legte er fröhlich los. „Kommt ein Vogerl geflogen …“
Der Professor nickte zufrieden. „A schöne Stimm hast“, lobte er. „Da lässt sich was draus machen. Wir werden üben miteinand.“
Es begann eine Zeit, an die Gustl sein Leben lang mit Dankbarkeit zurückdenken sollte. Alles, was Musik bedeutete, hatte er hier bei dem gutherzigen und weisen Professor Weinwurm gelernt. Bisher war das Singen und Klavierspielen mehr so ein Spaß nebenher gewesen. In Brünn, während der Zeit in der Ausbildungsanstalt Augarten, galten die Grundfächer Deutsch, Mathematik, Geschichte, Erdkunde viel wichtiger als der Musikunterricht. Erst jetzt, unter der behutsamen Anleitung des Pädagogen, begriff Gustl, welch Königreich die Musik war, in das einzudringen Begabung allein nicht genügte. Erst mit viel Wissen, mit Fleiß und vor allem ständigem Üben würden sich die Pforten zu den himmlischen Gefilden dieses Reichs eröffnen. So predigte es ihm der Professor, und Gustl hing an seinen Lippen und vertraute sich seiner kundigen Führung an.
Dann kam der große Tag, an dem ihm der Lehrer die Geige in die Hand drückte. Er zeigte ihm, wie er den Bogen halten und führen müsse, wie die Geige so zwischen Schulter und Kinn ruhen müsse, dass die Finger der linken Hand ganz locker die Saiten auf dem Griffbrett ertasten konnten.
Gustl war ein gelehriger Schüler. Schon nach wenigen Übungsstunden hatte er im wahrsten Sinn den Bogen raus. Noch gab es Kratzer und Patzer, doch während er den Bogen führte, wurde ihm klar, warum ihn der Professor zur Geige gedrängt hatte: um der Erfahrung und des Glücksgefühls willen, die Töne förmlich mit den Händen zu greifen, zu erspüren, hervorzulocken – die Musik in den Händen zu halten.
Getrübt wurde diese schöne Zeit der Zusammenarbeit mit Professor Weinwurm nur durch die ständigen Sticheleien des Direktors. Er warf Gustl vor, die anderen Fächer zu vernachlässigen, und ließ keine Gelegenheit aus, ihn merken zu lassen, dass er hier nur geduldet sei. Gehässige Bemerkungen vor versammelter Klasse – wie: „So einer, wie der Jud da“ – nahmen im Lauf der Zeit zu, geschürt wohl durch die Enttäuschung, dass der versprochene Artikel in der Presse noch immer nicht erschienen war. Dabei konnte er froh sein, dass dies nicht der Fall war. Mit Rücksicht auf seinen Cousin hatte Arnim davon Abstand genommen, denn er hätte nicht die Unwahrheit schreiben können. Das verbot ihm sein journalistisches Gewissen. Der Artikel wäre wenig schmeichelhaft für den arroganten und eigentlich für sein Amt unfähigen Direktor ausgefallen.
Was die Vernachlässigung der anderen Unterrichtsfächer betraf, so hatte Niedergesäß nicht ganz unrecht. Gustl besuchte zwar alle Kurse ordnungsgemäß, doch die Musik war nun einmal sein Ein und Alles. Und mit der Geige brachte er es schon bald zu solcher Virtuosität, dass der Professor staunte. Dazu trug bei, dass ihm Arnim zum achtzehnten Geburtstag im Februar eine wertvolle Violine geschenkt hatte. Sie stammte aus dem Nachlass eines verarmten Künstlers. Arnim hatte sie günstig ersteigern können.
Das Jahr war um und noch immer stand nichts in der Zeitung über das Institut in der Rasumovskygasse. Direktor Niedergesäß kam sich betrogen vor. Er fühlte sich in seiner Meinung über das „Judengesindel“ bestätigt. Kurzerhand eröffnete er Gustl am Semesterschluss, die Zeit sei abgelaufen. Gustl nahm es mit Erleichterung auf, so schwer ihm auch der Abschied von Professor Weinwurm fiel.
Zu Hause musste er sich Vorwürfe der Mutter anhören. „Was glaubst denn, wie’s jetzt weitergehen soll? Keinen ordentlichen Abschluss hast. Wie willst da noch als Lehrer unterkommen?“
„Ich hab doch die Geign“, beteuerte Gustl. „Die bringt mich scho weiter.“
Es war eine fromme Wunschvorstellung, an die weder die Mutter noch der blinde Vater glauben mochten. Papa Leopold dachte noch immer wehmütig an sein Häusl und seine Werkstatt in Pohrlitz zurück. „Wärst a Tischler wordn, wär gscheider gwesen“, hielt er Gustl vor.
Der gute Professor Weinwurm, mit dem Gustl weiter Kontakt hielt, wusste bald Rat. In Gänserndorf, eine Bahnstunde nördlich von Wien, war eine Stelle als Hilfslehrer frei geworden. Weinwurm hatte es von einem ehemaligen Schüler, der jetzt Hauptlehrer war, erfahren. Er schickte Gustl mit einer Empfehlung hin. Es gab fünfundzwanzig Gulden Monatsgehalt bei freier Kost und freiem Logis.
Gustl nahm das Angebot an – nicht gerade begeistert. Doch er durfte nicht undankbar sein. Die geliebte Geige nahm er mit. Ein ganzes Jahr hielt er es aus in Gänserndorf. Er wäre schon früher davongelaufen, hätte er nicht so viel Freude mit den Schulkindern gehabt, die den lustigen Herrn Hilfslehrer lieb gewonnen hatten, weil er mit ihnen fröhliche Lieder sang und ihnen oft auf der Geige vorspielte, statt Rechenaufgaben zu machen.
Es kam aber der Tag, da las Gustl in der Zeitung, die berühmte Sopranistin Adelina Patti komme nach Wien und werde im Ringtheater auftreten. Die Patti war zu der Zeit der berühmteste Gesangstar. Ihre Koloraturen begeisterten das Publikum in Mailand und London, in Paris und sogar in New York, wo auch immer. Die muss ich sehen, die muss ich singen hören!, sagte sich Gustl, nahm den Geigenkasten unter den Arm und fuhr nach Wien.
Am Ringtheater angekommen, verlangte er an der Kasse nach einer Karte im Stehparkett. Mehr hätte er sich nicht leisten können. Doch der Kassierer hatte nur ein mitleidiges Lächeln. Er wies auf das Taferl über seinem Fenster: ALLE VORSTELLUNGEN AUSVERKAUFT!!
Hilfe suchend schaute sich Gustl um, ob es nicht doch vielleicht noch eine Möglichkeit gab, die Patti zu erleben. Sein Blick fiel auf das Schwarze Brett gegenüber dem Kassenschalter. Da hing ein Zettel: Tutti-Geiger für Orchester gesucht. Interessenten melden sich Zimmer 112, pm. Etage.
Wie der Wind sprang er die Stufen hinauf und klopfte an der Tür zum Zimmer 112.





























