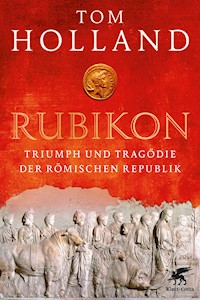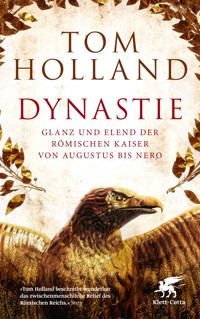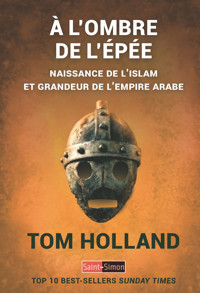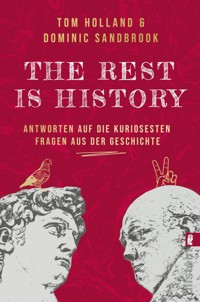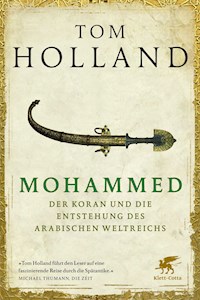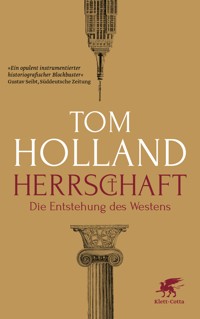
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wurde der Westen zu dem, was er heute ist? Welches Erbe schlägt sich in seiner Gedanken- und Vorstellungswelt nieder? Mit unvergleichlicher Erzählkunst schildert Tom Holland die Geschichte des Westens ausgehend von seinem antiken und christlichen Erbe. Dabei zeigt er, dass genuin christliche Traditionen und Vorstellungshorizonte auch in unserer modernen Gesellschaft sowie ihren vermeintlich universellen Wertesystemen allgegenwärtig sind – sogar dort, wo sie negiert werden: etwa im Säkularismus, Atheismus oder in den Naturwissenschaften. Holland schlägt einen großen erzählerischen Bogen von den Perserkriegen, den revolutionären Anfängen des Christentums in der Antike über seine Ausbreitung im europäischen Mittelalter bis hin zu seiner Verwandlung in der Moderne. In packenden Szenen schildert der Autor welthistorische Ereignisse und zeichnet in lebendigen Porträts die zentralen Akteure oder auch die Antagonisten des Christentums (u. a. Jesus, Paulus, Abaelard und die Heilige Elisabeth, Spinoza, Darwin, Nietzsche und die Beatles). Über große zeitliche Distanzen hinweg macht Holland Verknüpfungen und Parallelen aus und zeigt auf diese Weise, wes Geistes Kind die westliche Kultur noch immer ist. Stimmen zum Buch: »Tom Hollands neues Buch ist der Höhepunkt seiner Erzählkunst. Ein Meisterwerk historischer Darstellung.« John Gray, New Statesman
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1143
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
TOM HOLLAND
Herrschaft
Die Entstehung des Westens
Aus dem Englischen von Susanne Held
Klett-Cotta
Wie wurde der Westen zu dem, was er heute ist? Welches Erbe schlägt sich in seiner Gedanken- und Vorstellungswelt nieder? Anschaulich und mit erzählerischer Finesse schildert Tom Holland die Geschichte des Westens ausgehend von seinem antiken und christlichen Erbe. Dabei zeigt er, dass genuin christliche Traditionen und Vorstellungshorizonte auch in unserer modernen Gesellschaft sowie ihren vermeintlich universellen Wertesystemen allgegenwärtig sind – sogar dort, wo sie negiert werden: etwa im Säkularismus, Atheismus oder in den Naturwissenschaften. Holland schlägt einen großen erzählerischen Bogen von den Perserkriegen, den revolutionären Anfängen des Christentums in der Antike über seine Ausbreitung im europäischen Mittelalter bis hin zu seiner Verwandlung in der Moderne. In packenden Szenen schildert der Autor welthistorische Ereignisse und zeichnet in lebendigen Porträts die zentralen Akteure oder auch die Antagonisten des Christentums (u. a. Jesus, Paulus, Abaelard und die Heilige Elisabeth, Spinoza, Darwin, Nietzsche und die Beatles). Über große zeitliche Distanzen hinweg macht Holland Verknüpfungen und Parallelen aus und zeigt auf diese Weise, wes Geistes Kind die westliche Kultur noch immer ist.
TOM HOLLAND, geboren 1968, studierte in Cambridge und Oxford Geschichte und Literaturwissenschaft. Der Autor und Journalist hat sich mit BBC-Sendungen über Herodot, Homer, Thukydides und Vergil einen Namen gemacht. Er ist Bestsellerautor für Fiction und Historisches Buch und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u. a. 2004 den »Hessel-Tiltman Prize for History« für »Rubicon« und 2006 den »Runciman Award« der Anglo-Hellenic League für sein Buch »Persisches Feuer«.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Dominion. The Making of the Western Mind.«
im Verlag Little, Brown, London 2019
Copyright © Tom Holland 2019
Für die deutsche Ausgabe
© 2021, 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Übernahme des Originalentwurfs von Little, Brown Book Group. Illustrationen © iStock, shutterstock, Kamira
Liedtext aus »All you need is love« von John Lennon und Paul McCartney auf S. 7: © Sony/ATV Music Publishing LLC.
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98745-4
E-Book: ISBN 978-3-608-12030-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Inhalt
Vorwort
ANTIKE
I
Athen
II
Jerusalem
III
Mission
IV
Glaube
V
Nächstenliebe
VI
Himmel
VII
Exodus
CHRISTENTUM
VIII
Bekehrung
IX
Revolution
X
Verfolgung
XI
Fleisch
XII
Apokalypse
XIII
Reformation
XIV
Kosmos
MODERNITAS
XV
Geist
XVI
Aufklärung
XVII
Religion
XVIII
Wissenschaft
XIX
Schatten
XX
Liebe
XXI
Woke
Anhang
Danksagungen
Anmerkungen
Bibliographie
Namen- und Ortsregister
In Erinnerung an Deborah Gillingham. Sehr geliebt, sehr vermisst.
Liebe – und tu, was du willst.
Augustinus von Hippo
Dass du aber dies und jenes Urteil als Sprache des Gewissens hörst – also, dass du etwas als recht empfindest, kann seine Ursache darin haben, dass du nie über dich nachgedacht hast und blindlings annahmst, was dir als recht von Kindheit an bezeichnet worden ist.
Friedrich Nietzsche
All you need is love
John Lennon und Paul McCartney
Vorwort
Ungefähr drei oder vier Jahrzehnte vor Christi Geburt wurde auf dem römischen Esquilin(1) Roms(1) erster beheizter Swimmingpool erbaut. Die Wohnlage direkt vor den alten Stadtmauern war erstklassig. Sie sollte für einige der reichsten Menschen der Welt Modellcharakter entwickeln: ein riesiges Areal aus Luxusvillen und Parks. Allerdings gab es einen Grund, warum das Land vor der Porta Esquilina(1) so lange unerschlossen geblieben war. Über viele Jahrhunderte hinweg, seit den frühesten Tagen Roms, war es ein Ort der Toten gewesen. Als die Arbeiter mit der Arbeit am besagten Swimmingpool begannen, hing noch immer Leichengestank in der Luft. Ein Graben, einst Teil des ehrwürdigen Verteidigungssystems der Stadt, war angefüllt mit den Leichen derer, die zu arm waren, um in Grabstätten beigesetzt zu werden. Hier wurden die Leichen der Sklaven hineingekippt, »nachdem sie aus ihren engen Zellen hinausgeworfen worden waren«.[1] Geier, die sich hier in solchen Scharen sammelten, dass man sie auch als »die Vögel des Esquilin« bezeichnete,[2] pickten die Leichname sauber. An keiner anderen Stelle Roms(2) vollzog sich der Prozess der Gentrifizierung ähnlich dramatisch. Die Marmorfassaden, die rauschenden Springbrunnen, die wohlriechenden Blumenbeete: All das war auf den Rücken der Toten errichtet.
Allerdings nahm der Prozess der Rückgewinnung viel Zeit in Anspruch. Jahrzehnte nach der ersten Erschließung des Gebiets vor der Porta Esquilina(2) konnte man dort noch immer Geier über dem sogenannten Sessorium kreisen sehen. Dieses war nach wie vor das, was es schon immer gewesen war: »der für die Hinrichtung von Sklaven reservierte Platz«.[3] Das Sessorium war – im Unterschied zu den Arenen, wo Verbrecher zur Ergötzung der johlenden Mengen umgebracht wurden – kein glamouröser Ort. Aufsässige Sklaven nagelte man hier an Kreuze und setzte sie wie Fleischstücke, die an einem Marktstand aufgehängt waren, den Blicken der Öffentlichkeit aus. Selbst als man damit begann, in der entstehenden Parkregion des Esquilin(2) aus fernen Ländern importierte Sämereien auszubringen, blieben diese nackten Stämme als Hinweis auf die düstere Vergangenheit stehen.
Kein Tod war qualvoller und zugleich verächtlicher als Kreuzigung. Nackt am Kreuz zu hängen, »in langem Todeskampf, angeschwollen mit hässlichen Schwielen auf Schultern und Brust«,[4] hilflos den kreischenden Vögeln ausgeliefert: ein solches Schicksal, da waren sich die römischen Intellektuellen einig, war an Schrecklichkeit nicht zu überbieten. Und genau das machte es zu einer so passenden Bestrafung für Sklaven. Fehlte eine solche Strafe, brach womöglich die gesamte öffentliche Ordnung zusammen. Der glanzvolle Luxus, dessen Rom(3) sich rühmen konnte, war letztlich davon abhängig, dass man dafür sorgte, dass diejenigen, die ihn aufrechterhielten, den ihnen zugewiesenen Platz nicht verließen. »Wir haben ja schließlich Sklaven aus allen Enden der Welt in unseren Häusern, die seltsamen Bräuchen frönen und fremden Kulten, oder überhaupt keinem – und nur mit Terror können wir hoffen, diesen Abschaum in Schranken zu halten.«[5]
Doch obwohl der heilsame Effekt der Kreuzigung auf jene, die andernfalls die Ordnung des Staates hätten gefährden können, allgemein anerkannt wurde, war die Einstellung der Römer zu dieser Strafe von Ambivalenzen durchzogen. Wenn sie abschreckend wirken sollte, musste sie natürlich in aller Öffentlichkeit vollstreckt werden. Nichts gab beredteres Zeugnis von einer gescheiterten Revolte als der Anblick von hunderten Kreuzen, an denen Leichen hingen, ob diese aufgereiht an einer Landstraße standen oder geballt vor einer aufrührerischen Stadt, nachdem man auf deren umgebenden Hügeln einen Kahlschlag sämtlicher Bäume veranstaltet hatte. Selbst in Friedenszeiten machten Henker, indem sie ihre Opfer auf diverse originelle Arten aufhängten, eine Show aus ihnen: »Einer mit dem Kopf nach unten, ein anderer mit einem durch die Schamteile getriebenen Pfahl, wieder ein anderer mit ausgestreckten, an einem Joch befestigten Armen.«[6]
Allerdings lauerte in der Auslieferung der Gekreuzigten an die Schaulust der Öffentlichkeit ein Paradox. Der Aasgestank ihrer Schande war so ekelerregend, dass sich viele bereits durch den Anblick einer Kreuzigung beschmutzt fühlten. Die Römer sahen zwar in dieser Maßnahme die »äußerste Bestrafung«,[7] wehrten sich jedoch gegen die Vorstellung, sie könne womöglich von ihnen erfunden worden sein. Nur ein Volk, das für seine barbarische Grausamkeit berühmt war, konnte sich überhaupt eine solche Quälerei ausdenken: die Perser(1) vielleicht, oder die Assyrer(1), oder die Gallier(1). Alles, was mit der Praxis zusammenhing, einen Mann an ein Kreuz – eine »crux« – zu nageln, war widerwärtig. »Allein das Wort klingt für unsere Ohren ja schon brutal.«[8]
Dieser von der Praxis der Kreuzigung allgemein hervorgerufene Abscheu erklärte, warum zum Tode verurteilte Sklaven auf dem gemeinsten, verrufensten Stück Land außerhalb der Stadtmauern hingerichtet wurden; und warum damals, als Rom(4) über seine alten Grenzen hinauswuchs, nur die exotischsten und wohlriechendsten Pflanzen der Welt diesen Makel überdecken konnten. Außerdem erklärt dieser Abscheu, warum sich nur wenige überhaupt mit der Kreuzigung auseinandersetzten, obwohl sie in der römischen Welt allgemein üblich war. Ordnung – von den Göttern geliebt und von Amtsträgern aufrechterhalten, die mit der ganzen Autorität der größten Macht auf Erden ausgestattet waren – diese Ordnung war es, was zählte, und nicht die Eliminierung von Geschmeiß, das sich erdreistete, sie in Frage zu stellen. Kriminelle, die an Folterinstrumenten einen grausamen Tod starben: Warum sollten in behüteten Verhältnissen aufgewachsene, zivilisierte Männer sich mit solchem Unrat auseinandersetzen? Es gab Todesarten, die so abscheulich, so erbärmlich waren, dass man sie am besten vollständig mit einem Mantel des Schweigens bedeckte.
Überraschend ist also nicht so sehr, dass wir in antiken Quellen so wenig detaillierte Beschreibungen davon finden, worin eine Kreuzigung in der Praxis bestand, sondern dass es überhaupt eine solche Beschreibung gibt.1 Die Leichen der Gekreuzigten wurden, nachdem sie eine Zeitlang als Futter für hungrige Vögel gedient hatten, in ein Massengrab geworfen. In Italien wurden sie von rotgekleideten Leichen-Entsorgern, die sich mit Glockenläuten bemerkbar machten, an Haken dorthin geschleift. Dann verschwanden sie im Vergessen – wie unter der Erde, die über ihre gemarterten Leiber geschaufelt wurde. Auch das gehörte zu ihrem Schicksal. Allerdings gibt es in diesem allgemeinen Schweigen eine gewichtige Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Vier detaillierte Berichte des Vorgangs, mit dem ein Mann dazu verurteilt werden konnte, gekreuzigt zu werden und dann seine Strafe zu erleiden, haben aus der Antike überlebt. Bemerkenswerterweise beschreiben sie alle dieselbe Hinrichtung: eine Kreuzigung, die ungefähr sechzig oder siebzig Jahre nach dem Bau des ersten beheizten Swimmingpools in Rom stattfand.
Allerdings war nicht der Esquilin der Schauplatz, sondern ein anderer Hügel; er lag vor den Mauern Jerusalems(1): Golgatha(1), »das heißt Schädelstätte«.[9] Das Opfer, ein Jude namens Jesus(1), ein Wanderprediger aus einem obskuren Städtchen namens Nazareth(1) in einer nördlich von Jerusalem gelegenen Region namens Galilaea(1), war wegen eines Kapitalverbrechens gegen die römische Ordnung verurteilt worden. Die vier frühesten Darstellungen seiner Hinrichtung, die wenige Jahrzehnte nach seinem Tod aufgeschrieben wurden, stellen detailliert dar, was das konkret bedeutete. Nach der Urteilsverkündung wurde der Verurteilte Soldaten zur Geißelung übergeben. Dann verspotteten ihn seine Wachen – er hatte von sich gesagt, er sei »der König der Juden«, weshalb sie ihn anspuckten und ihm eine Dornenkrone aufsetzten. Erst dann, ausgepeitscht, verschrammt und blutend, wurde er auf seine letzte Reise geführt.
Er schleifte sein Kreuz mit sich und stolperte seinen Weg durch Jerusalem(2) – ein Schauspiel und eine Mahnung für alle, die ihn sahen – und weiter, aus der Stadt hinaus, die Straße nach Golgatha(2) hinauf.2 Dort wurden Nägel durch seine Hände und Füße getrieben, und er wurde gekreuzigt. Nach seinem Tod wurde ein Speer in seine Seite gestoßen. Es gibt keinen Grund, die wesentlichen Bestandteile dieses Berichts anzuzweifeln. Selbst die skeptischsten Historiker neigen dazu, sie für wahr zu halten. »Der Tod von Jesus(2) von Nazareth am Kreuz ist ein feststehendes Faktum, möglicherweise das einzige im Zusammenhang mit ihm feststehende Faktum.«[10] Selbstverständlich waren seine Leiden nichts Außergewöhnliches. Schmerz und Erniedrigung und das lang sich hinziehende Grauen »der elendigsten aller Arten zu sterben«:[11] All das war ein Schicksal, das im Lauf der römischen Geschichte viele teilten.
Ganz sicher nicht entsprach dem Schicksal vieler allerdings das, was anschließend mit den Leichnam Jesu(3) geschah. Nachdem er vom Kreuz abgenommen wurde, blieb ihm ein Massengrab erspart. Ein wohlhabender Anhänger erbat sich den Leichnam, und dieser wurde ehrfürchtig für die Beisetzung vorbereitet und in ein Grab gelegt, das mit einem mächtigen Felsblock verschlossen wurde. Das berichten jedenfalls alle vier der frühesten Darstellungen vom Tod Jesu – Erzählungen, die auf Griechisch als euangelia bezeichnet wurden: »frohe Botschaften« – Evangelien.3 Die Berichte sind nicht unplausibel. Wir wissen aus archäologischen Funden, dass dem Leichnam eines Gekreuzigten tatsächlich hin und wieder ein würdiges Begräbnis in den Ossuarien außerhalb der Mauern Jerusalems gewährt werden konnte.
Sehr viel erstaunlicher, um nicht zu sagen unerhört, waren allerdings die Geschichten von dem, was dann geschah. Dass Frauen, die zum Grab gekommen waren, den Stein weggewälzt gefunden hatten. Dass Jesus(4) im Lauf der folgenden vierzig Tage seinen Jüngern erschienen war, nicht als Geist oder wiederbelebter Leichnam, sondern auferstanden zu einer neuen, herrlichen Form. Dass er in den Himmel aufgefahren war, und dass er wiederkommen werde. Später sollte er nicht nur als Mensch, sondern auch als Gott verehrt werden. Indem er ein Schicksal erduldete, wie es sich entsetzlicher nicht vorstellen lässt, besiegte er den Tod. »Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf dass im Namen Jesu sich jedes Knie beuge im Himmel, auf der Erde und unter der Erde …«[12]
Die außerordentliche Befremdlichkeit dieser Ereignisse lag für die große Mehrheit der Menschen in der römischen Welt nicht in der Vorstellung, dass ein Sterblicher zu einem Gott werden konnte. Die Grenze zwischen Himmel und Erde galt überwiegend als durchlässig. In Ägypten(1), der ältesten Monarchie, wurden die Könige seit unermesslichen Zeiten angebetet. In Griechenland erzählte man sich Geschichten von einem »Gotthelden«[13] namens Herakles(1), einem muskelbepackten Monsterkiller, der nach einem Leben spektakulärer Taten aus den Flammen eines von ihm selbst errichteten Scheiterhaufens in den Himmel aufgenommen wurde, um sich den Unsterblichen anzuschließen. Bei den Römern erzählte man eine ähnliche Geschichte über den Stadtgründer Romulus(1). In den Jahrzehnten vor der Kreuzigung Jesu hatten derartige Beförderungen in den Rang eines Gottes zugenommen. Der römische Machtbereich hatte sich so extrem ausgedehnt, dass jeder, der es schaffte, mit dieser Macht fertigzuwerden, mehr wie ein Gott als wie ein Mensch wirkte.
Dass einer aus dieser Gruppe, ein Kriegsherr namens Julius Caesar(1), in den Himmel aufsteigen werde, wurde vom Erscheinen eines Kometen am Himmel angekündigt; der Aufstieg eines zweiten, des Adoptivsohns Caesars, der für sich den Namen Augustus(1) erlangt hatte, davon, dass man, wie bei Herakles, einen Geist aus einem Scheiterhaufen aufsteigen sah. Selbst wenn Skeptiker die Möglichkeit verschmähten, dass ein sterblicher Zeitgenosse tatsächlich zu einem Gott werden könne, waren sie gerne bereit, die Zweckmäßigkeit dieser Vorstellung für das Gemeinwesen anzuerkennen: »Denn der menschliche Geist, der meint, er sei göttlichen Ursprungs, wird dadurch zum Anpacken gewaltiger Taten ermutigt, er wird sie tatkräftiger zu Ende bringen und aufgrund seiner Unbeschwertheit erfolgreicher in ihrer Ausführung sein.«[14]
Göttlichkeit war also den Größten der Großen vorbehalten: Siegern, Helden und Königen. Den Maßstab gab deren Fähigkeit ab, ihre Feinde zu quälen, nicht aber, selbst zu leiden: sie an die Felsen eines Gebirges zu nageln, in Spinnen zu verwandeln oder ihnen die Augen auszustechen und sie zu kreuzigen, nachdem man die Welt erobert hatte. Dass ein Mann, der selbst gekreuzigt worden war, als Gott verehrt werden könnte, musste unweigerlich von Menschen überall in der römischen Welt als skandalös, obszön, grotesk empfunden werden. Den schlimmsten Anstoß erregte es jedoch bei einem bestimmten Volk, nämlich demjenigen, zu dem Jesus(5) selbst gehörte.
Die Juden(1) glaubten im Unterschied zu denen, die über sie herrschten, nicht daran, dass ein Mensch Gott werden könne; sie glaubten, dass es nur den einen einzigen allmächtigen, ewigen Gott gab. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wurde von ihnen als der höchste Gott, der Herr der Heerscharen, Herrscher über die ganze Welt verehrt. Ihm unterstanden Reiche; Berge schmolzen vor ihm wie Wachs. Dass ausgerechnet ein solcher Gott einen Sohn haben könnte, und dass dieser Sohn das Schicksal eines Sklaven erduldete und an einem Kreuz zu Tode gefoltert wurde – solche Behauptungen waren so haarsträubend wie, für die meisten Juden(2), abstoßend. Eine schockierendere Umkehrung ihrer frommsten Grundannahmen war überhaupt nicht vorstellbar. Das war nicht nur Blasphemie, das war Wahnsinn.
Doch selbst diejenigen, die in Jesus(6) den »Christos« erkannten, den Gesalbten des Herrn, schreckten teilweise davor zurück, die Art seines Sterbens in all ihrer Grausamkeit zu realisieren. Die sogenannten »Christen« kannten das, was mit einer Kreuzigung assoziiert wurde, ebenso gut wie alle anderen auch. »Das Geheimnis des Kreuzes, durch das wir von Gott berufen sind, ist etwas Geschmähtes und Beschimpftes.«[15] Das schrieb Justin(1), der bedeutendste christliche Apologet seiner Generation, eineinhalb Jahrhunderte nach der Geburt Jesu. Die Folter des Sohnes des allerhöchsten Gottes war ein so grauenerregender Schrecken, dass er visuell gar nicht darstellbar war. Wenn Kopisten die Evangelien abschrieben, zeichneten sie hin und wieder über das griechische Wort für »Kreuz« zarte Piktogramme, die auf den gekreuzigten Christus verwiesen. Ansonsten jedoch blieb es Hexern oder Satirikern vorbehalten, seine Hinrichtung zu illustrieren. Das war allerdings für viele in der römischen Welt gar nicht ein gar so tiefes Paradox, wie es vielleicht den Anschein haben könnte. Einige Geheimnisse waren so unergründlich, dass den Sterblichen nichts anderes übrigblieb, als sie unter einem Schleier zu verbergen. Es war menschlichen Augen nicht möglich, den Glanz der Götter unverhüllt zu schauen, ohne zu erblinden. Doch obwohl niemand erblindet war, der zugesehen hatte, wie der Sohn des höchsten Gottes zu Tod gefoltert worden war, hatten Christen zwar die Gewohnheit, sich als Zeichen der Frömmigkeit zu bekreuzigen und sich mit staunender Ehrfurcht in die Darstellung der Leiden ihres Retters in den Evangelien zu versenken, doch sie in physischer Form anzuschauen, davor scheuten sie eher zurück.
Erst Jahrhunderte nach dem Tod Jesu – als erstaunlicherweise sogar die Caesaren dahin gekommen waren, ihn als den Christus anzuerkennen – kristallisierte sich allmählich seine Hinrichtung als Thema für bildende Künstler heraus. Um 400 n. Chr. wurde das Kreuz nicht mehr als etwas Schändliches angesehen. Konstantin(1) hatte Jahrzehnte zuvor die Kreuzigung als Bestrafung verboten, und das Kreuz war nun für das römische Volk zum Emblem des Sieges über Sünde und Tod geworden. Ein Künstler, der die Szene in Elfenbein schnitzte, konnte Jesus(7) im knappen Lendenschurz eines Athleten darstellen, mit einem ähnlich muskulösen Körperbau wie einer der alten Götter. Selbst als die Westhälfte des Reichs der Herrschaft der Caesaren zu entgleiten begann und in die Hände barbarischer Angreifer geriet, versprach in der Osthälfte, wo die Macht nach wie vor in römischen Händen lag, das Kreuz einem bedrängten Volk, dass es letztlich den Sieg davontragen werde. Die Todesqualen Christi verwiesen auf seinen Sieg über das Böse. Deshalb wurde er selbst inmitten der Qualen, die ihm angetan wurden, nie so dargestellt, als litte er Schmerzen. Er strahlte Gelassenheit aus und brachte damit seine Herrschaft über das Universum zum Ausdruck.
So kam es, dass in einem Reich, das nie aufhörte, sich als römisch zu verstehen – obwohl wir es heute als byzantinisch bezeichnen –, ein Leichnam zu einer Ikone majestätischer Erhabenheit wurde. Byzanz(1) war allerdings nicht das einzige christliche Reich. Im lateinischsprachigen Westen braute sich über ein Jahrtausend nach der Geburt Christi eine weitere Revolution zusammen. Es gab immer mehr Christen, die ihren Blick nicht von dem entsetzlichen Horror der Kreuzigung abwandten, sondern vielmehr danach verlangten, ihre Augen ganz gezielt darauf zu richten. »Warum, o meine Seele, warst du nicht da, um von einem Schwert des bitteren Kummers durchbohrt zu werden, weil du die Durchbohrung der Seite deines Heilands mit einem Speer nicht aushalten konntest? Warum ertrugst du es nicht, zu sehen, wie die Nägel die Hände und Füße deines Schöpfers durchbohrten?«[16] Dieses um das Jahr 1070 herum entstandene Gebet wandte sich nicht einfach an den Gott, der hoch oben im Himmel in Herrlichkeit herrscht, sondern an den wie einen Verbrecher Verurteilten, der er gewesen war, als er diesen erniedrigenden Tod erdulden musste.
Der Verfasser des Gebets, ein grandioser Gelehrter aus Norditalien namens Anselm(1), stammte aus einer vornehmen Familie: Er war Briefpartner von Gräfinnen und Vertrauter von Königen. So sah es aus, wenn man ein Fürst der Kirche war, ein Fürst der ecclesia oder »Versammlung« des christlichen Volkes. Anselm war ein Mann, bei dem hohe Geburt, Begabung und ein berühmter Name zusammenkamen. Und trotzdem, selbst in der Zeit, da er sich darum bemühte, das Schicksal des Christentums zu beeinflussen, konnte er nicht anders, als sein hohes Ansehen als grauenvoll zu empfinden. Als ihm die Aufgabe übertragen wurde, die englische Kirche zu leiten, war er so bestürzt, dass er sofort furchtbares Nasenbluten bekam. »Schon das Wort Privateigentum war für ihn entsetzlich.«[17] Als er einen in die Enge getriebenen Hasen sah, brach er in Tränen aus und bat darum, das erschrockene Tier laufen zu lassen. Ganz gleich wie hoch er im Weltgeschehen aufstieg, vergaß er nie, dass sein Heiland ihn als Erniedrigter, seiner Kleider Beraubter und Verfolgter gerettet hatte. In seinem Gebet zum gekreuzigten Christus, das im gesamten lateinischen Westen abgeschrieben und gebetet wurde, formulierte Anselm(2) ein neues, folgenreiches Verständnis des christlichen Gottes: ein Verständnis, bei dem der Schwerpunkt nicht auf seinem Triumph, sondern auf seinem Leiden als Mensch lag.
»Mit dieser Klage sehen wir uns plötzlich und erschreckenderweise mit einem Bruch konfrontiert …«[18] Der Jesus(8), wie ihn mittelalterliche Künstler darstellten – mit verrenkten Gliedern, blutend, sterbend, war ein Opfer der Kreuzigung, so wie ihn auch seine Henker gesehen hatten: nicht länger abgeklärt und siegreich, sondern gequält von unerträglichen Schmerzen, genau wie jeder andere gefolterte Sklave. Die Reaktion auf dieses Schauspiel sah jedoch ganz anders aus als die Mischung aus Ekel und Verachtung, die für die Menschen der Antike angesichts einer Kreuzigung typisch gewesen war. Wenn Männer und Frauen auf das Bild ihres Herrn schauten, der am Kreuz hing, auf die Nägel, die durch die Sehnen und Knochen seiner Füße getrieben waren, auf die Arme, die so weit ausgestreckt waren, dass sie aus ihren Gelenken herausgerissen schienen, auf sein dornengekröntes, auf die Brust herabgesunkenes Haupt, dann fühlten sie nicht Verachtung, sondern Mitleid und Furcht.
Und es gab sicher genug Christen in Mitteleuropa, die sich mit den Leiden ihres Gottes identifizieren konnten. Noch immer trampelten die Reichen auf den Armen herum. Galgen standen auf Hügeln. Die Kirche selbst konnte – zum größten Teil dank der Bemühungen von Männern wie Anselm – Anspruch auf die alte Vorrangstellung Roms erheben, und, wichtiger noch, sie konnte diese auch behaupten. Allerdings hatte sich etwas sehr Fundamentales tatsächlich geändert. »Geduld in der Bedrängnis, die andere Wange hinhalten, für seine Feinde beten, diejenigen lieben, die uns hassen«:[19] darin bestanden die christlichen Tugenden nach der Definition Anselms(3). Alle waren sie von den überlieferten Reden Jesu hergeleitet. Kein Christ, nicht einmal der kaltschnäuzigste oder gedankenloseste, konnte sie also mehr ignorieren, ohne mit seinem Gewissen in Konflikt zu geraten. Die Überlegung, dass der Sohn Gottes, von einer Frau geboren und zum Tod eines Sklaven verurteilt, von seinen Richtern nicht erkannt worden war, musste selbst dem überheblichsten Monarchen zu denken geben. Dieses Bewusstsein, das im Herzen der mittelalterlichen Christenheit lebte, ging zwingend mit einem folgenreichen Verdacht einher: dass Gott näher bei den Schwachen war als bei den Mächtigen, näher bei den Armen als bei den Reichen. Jeder Bettler, jeder Verbrecher konnte Christus sein. »Die letzten werden die ersten, und die ersten werden die letzten sein.«[20]
Auf die römischen Aristokraten, die in den Jahrzehnten vor der Geburt Jesu damit begannen, den Esquilin(3) mit ihren Marmorfassaden und ihren Blumenbeeten zu besiedeln, hätte ein solcher Gedanke grotesk gewirkt. Und doch hatte er sich durchgesetzt. Nirgends wurde davon beredteres Zeugnis abgelegt als in Rom(5) selbst. 1601 wurde in einer Kirche, die ursprünglich errichtet worden war, um den Geist Neros(1) auszutreiben, eines besonders schrillen und bösartigen Caesaren, ein Gemälde angebracht, das den Anfängen des Christentums unter den Erniedrigten und Beleidigten Tribut zollte. Der Künstler, ein junger Mann aus Mailand namens Caravaggio(1), hatte den Auftrag erhalten, eine Kreuzigung zu malen: nicht diejenige von Christus selbst, sondern die Kreuzigung seines obersten Jüngers. Von Petrus(1), einem Fischer, der nach Darstellung in den Evangelien sein Boot und seine Netze verlassen hatte, um Jesus(9) nachzufolgen, hieß es, dass er der »Aufseher« – der episcopus oder »Bischof« – der ersten Christen in Rom(6) geworden war, bevor Nero(2) ihn hinrichten ließ. Seit der Hinrichtung des Petrus hatten über zweihundert Männer das Bischofsamt innegehabt, das mit dem Primatsanspruch über die gesamte Kirche verbunden war sowie mit dem Ehrentitel Pappas oder »Vater« – »Papst«.
Im Verlauf der mehr als fünfzehn Jahrhunderte, die seit dem Tod des Petrus vergangen waren, hatte die Autorität der Päpste zu- und wieder abgenommen, aber sie waren auch zu Lebzeiten des Caravaggio(2) noch eine respektheischende Instanz. Doch der Künstler hütete sich, ihren Pomp, ihren Glanz, ihren Reichtum zu feiern. Die irdische Größe des Papsttums wurde buchstäblich auf den Kopf gestellt. Es heißt, Petrus(2) habe verlangt, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, um sich nicht anzumaßen, das Schicksal seines Herrn nachzuahmen. Und Caravaggio, der sich als Sujet genau den Moment gewählt hatte, als das schwere Kreuz umgedreht wird, porträtierte den ersten Papst als genau das, was er tatsächlich gewesen war – ein einfacher Fischer. Kein Künstler der Antike hätte es sich einfallen lassen, einen Caesaren dadurch zu ehren, dass er ihn darstellte, wie Caravaggio(3) Petrus(3) präsentierte: gequält, erniedrigt, fast all seiner Kleider beraubt. Doch in der Stadt der Caesaren war es ein Mann, der einem solchen Schicksal unterworfen wurde, der als der Bewahrer »der Schlüssel des Himmelreichs« verehrt wurde.[21] Die Letzten waren tatsächlich die Ersten geworden.
Die Beziehung des Christentums zu der Welt, in der es entstand, ist also paradox. Der Glaube ist sowohl das nachhaltigste Vermächtnis der klassischen Antike als auch der Anzeiger für deren extreme Umwandlung. Geformt aus einem gewaltigen Zusammenfluss von Traditionen – persischen und jüdischen, griechischen und römischen –, hat es den Zusammenbruch des Imperiums, aus dem heraus es sich entwickelte, lange überlebt, um »das mächtigste aller hegemonialen kulturellen Systeme der Weltgeschichte« zu werden, so die Formulierung eines jüdischen Gelehrten.[22] Im Mittelalter stimmte keine Zivilisation in Eurasien so lückenlos mit einem einzigen dominanten Satz an Glaubensinhalten überein wie der lateinische Westen mit seiner ihm eigenen charakteristischen Form des Christentums. Anderswo, sei es in den Ländern des Islam, in Indien oder in China, gab es unterschiedliche Vorstellungen des Göttlichen, sowie zahlreiche Institutionen mit dem Ziel, diese zu definieren; in Europa jedoch, in den Ländern, die den Primat des Papstes anerkannten, waren es nur hin und wieder Gemeinden von Juden(3), die das ansonsten totale Monopol der römischen Kirche aufbrachen.
Diese Exklusivität wurde streng überwacht. Jene, die sie störten und sich weigerten zu bereuen, mussten damit rechnen, zum Schweigen gebracht, ausgestoßen oder getötet zu werden. Eine Kirche, die zu einem Gott betete, der von rücksichtslosen Autoritäten hingerichtet worden war, herrschte über ein Gebilde, das zutreffend als eine »verfolgende Gesellschaft« bezeichnet worden ist.4 Hier, in der Überzeugung, dass Glaubensinhalte dazu dienten, genau zu bestimmen, wie ein Mann oder eine Frau zu sein hatten, hat man einen weiteren Hinweis auf den verwandelnden Einfluss der christlichen Revolution. Dass Christen bereit gewesen waren, als Zeugen für ihren Glauben, als Märtyrer zu sterben, war genau das, was sie in den Augen der römischen Autoritäten so böse und abnormal erscheinen ließ. All das hatte sich jedoch geändert. Im Lauf der Zeit hatte das Subversive gesiegt. Im Christentum des Mittelalters wurden die Gebeine der Märtyrer sorgsam gehütet, und die Kirche überwachte den Glauben. Mensch sein hieß Christ sein; und Christ sein hieß glauben.
Zu Recht bezeichnete sich die römische Kirche als »katholisch«(1), also »universell«. Es gab kaum einen Lebensabschnitt, der nicht von ihr definiert wurde. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihren Untergang, vom Hochsommer bis in den tiefsten Winter, von der Stunde ihrer Geburt bis zu ihrem letzten Atemzug wurden die Männer und Frauen im Europa des Mittelalters mit den Glaubensinhalten der Kirche imprägniert. Selbst als im Jahrhundert vor Caravaggio die katholische Christenheit sich aufzuspalten begann und sich neue Formen des Christentums herausbildeten, blieb die Überzeugung der Europäer, dass ihr Glaube universell sei, tief verwurzelt. Er inspirierte sie zu ihrer Erkundung von Kontinenten, von denen ihre Vorväter keine Ahnung gehabt hatten – zur Eroberung derer, die sie sich aneignen konnten, um sie als ein Gelobtes Land neu zu weihen; und zu ihrem Versuch, die Einwohner jener Regionen zu bekehren, die sie nicht ohne Weiteres in Besitz nehmen konnten. Ob in Korea oder in Feuerland, in Alaska oder in Neuseeland(1) – das Kreuz, an dem Jesus zu Tod gequält worden war, entwickelte sich zum bekanntesten Gottessymbol aller Zeiten.
»Du hast Völker bedroht, den Frevler vernichtet, ihre Namen gelöscht für immer und ewig.«[23] Der Mann, der 1945 die Nachricht von der japanischen Niederlage mit Worten aus der Heiligen Schrift begrüßte und Christus dafür pries, war nicht Truman, nicht Churchill, auch nicht de Gaulle, sondern der chinesische Staatsführer Chiang Kai-shek(1). Selbst noch im 21. Jahrhundert, während die westliche Dominanz spürbar zurückgeht, strukturieren Inhalte, die aus Europas ererbtem Glauben stammen, weiterhin die Art und Weise, wie die Welt sich organisiert. Sei es in Nordkorea oder in den Kommandostrukturen dschihadistischer Terrorzellen – es gibt nur sehr wenige, die dem Westen ideologisch so feindselig gegenüberstehen, dass sie nicht hin und wieder verpflichtet wären, sich des internationalen Datierungssystems zu bedienen. Jedes Mal, wenn sie das tun, werden sie unterschwellig an das erinnert, was das Christentum über die Geburt Jesu sagt. Die Zeit selbst wurde christianisiert.
Warum übte ein Kult, der von der Hinrichtung eines obskuren Verbrechers in einem längst untergegangenen Reich inspiriert war, einen derart verwandelnden und anhaltenden Einfluss auf die Welt aus? Eine Antwort auf diese Frage zu versuchen, wie ich es mit diesem Buch unternehme, bedeutet nicht, eine Geschichte des Christentums zu schreiben. Statt einen panoramaartigen Überblick über seine Entwicklung zu liefern, will ich stattdessen jenen Strömungen christlichen Einflusses nachgehen, die sich am weitesten ausgebreitet haben und die bis zum heutigen Tag am wirksamsten geblieben sind. Deshalb habe ich beschlossen – obwohl ich andernorts ausführlich über die östlichen und orthodoxen Kirchen geschrieben habe und in ihnen zahlreiche wundervolle, faszinierende Themen finde –, deren Entwicklung nicht über die Antike hinaus weiterzuverfolgen. Meine Zielsetzung ist sowieso schon anmaßend genug: herauszufinden, wie es dazu kam, dass wir im Westen wurden, was wir sind, und so denken, wie wir denken.
Der moralische und weltanschauliche Umbruch, der dazu führte, dass Jesus durch dieselbe imperiale Ordnung, die ihn zu Tode gefoltert hatte, als Gott verehrt wurde, beendete nicht die Fähigkeit des Christentums, umwälzende gesellschaftliche Veränderungen zu inspirieren. Ganz im Gegenteil. Bereits als Anselm(4) im Jahr 1109 starb, war das lateinische Christentum auf einem so spezifischen Weg, dass das, was wir heutzutage als »den Westen« bezeichnen, weniger sein Erbe ist als vielmehr seine Fortsetzung. Mit Sicherheit ist der Traum von einer Welt, die durch eine Reformation, eine Aufklärung oder eine Revolution verwandelt wird, nichts ausschließlich Modernes. Im Gegenteil: Das ist vielmehr eben genau die Art, wie Visionäre im Mittelalter träumten – die Art eines Christen.
Heute, in einer Zeit seismischer geopolitischer Verschiebungen, da sich herausstellt, dass unsere Werte nicht annähernd so universal sind, wie viele von uns angenommen haben, müssen wir dringender als je zuvor erkennen, wie kulturell kontingent diese Werte sind. Wer in einem westlichen Land lebt, lebt in einer Gesellschaft, die nach wie vor mit christlichen Vorstellungen und Voraussetzungen durchsetzt ist. Das gilt für Juden oder Muslime ebenso wie für Katholiken oder Protestanten. Zweitausend Jahre nach der Geburt Christi muss man nicht an seine Auferstehung glauben, um von dem beachtlichen, um nicht zu sagen unausweichlichen Einfluss des Christentums geprägt zu sein. Sei es nun die Überzeugung, dass die Wirkungsweisen des Gewissens die sichersten Bestimmungsfaktoren einer guten Gesetzgebung sind, oder dass Kirche und Staat zwei voneinander zu scheidende Einrichtungen sind, oder dass die Vielehe inakzeptabel ist – Spurenelemente des Christentums sind überall im Westen zu finden. Selbst wenn man darüber in einer westlichen Sprache schreibt, benutzt man Wörter, die mit christlichen Konnotationen besetzt sind. »Religion«, »säkular«, »Atheist«: Keines dieser Wörter ist neutral. Sie alle stammen zwar aus der klassischen Vergangenheit, doch sie sind beladen mit dem Vermächtnis des Christentums. Wer das verkennt, läuft Gefahr, anachronistisch zu werden. Obwohl die Kirchenbänke leer sind, ist der Westen nach wie vor fest in seiner christlichen Vergangenheit verankert.
Einige werden sich über diese These freuen; andere werden entsetzt sein. Das Christentum ist vielleicht das nachhaltigste und einflussreichste Vermächtnis der antiken Welt, und seine Herausbildung die transformativste Entwicklung innerhalb der westlichen Geschichte. Allerdings stellt es auch für einen Historiker als Thema die größte Herausforderung dar. Im Westen, vor allem in den USA, dürfte das Christentum nach wie vor die dominante Glaubensrichtung sein. Weltweit bekennen sich knapp zweieinhalb Milliarden – fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Planeten – zum Christentum. Im Unterschied zu Osiris, Zeus oder Odin ist der christliche Gott immer noch erfolgreich. Die Tradition, die Vergangenheit zu interpretieren, indem man von seiner Hand vorgezeichnete Muster aufspürt – eine Tradition, die bis ganz in die Anfänge des Glaubens zurückreicht –, ist alles andere als tot. Die Kreuzigung Jesu war für all die vielen Millionen, die ihn als den Sohn Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde, verehren, nicht lediglich ein geschichtliches Ereignis, sondern die Achse, um die sich das Universum dreht.
Historiker allerdings haben – unabhängig davon, wie offen sie für die Macht dieses Verständnisses sein mögen und die Art und Weise, wie es den Lauf der Welt beeinflusst hat – nicht die Aufgabe, darüber nachzudenken, ob dieses Ereignis tatsächlich wahr ist. Sie studieren das Christentum nicht um dessen willen, was es über Gott, sondern was es über die menschlichen Belange auszusagen vermag. Nicht weniger als bei jedem anderen Aspekt von Kultur und Gesellschaft wird bei Glaubensinhalten davon ausgegangen, dass sie menschlichen Ursprungs sind und durch den Lauf der Zeit geprägt werden. Wer auf der Suche nach Erklärungen für das, was in der Vergangenheit geschah, auf das Übernatürliche schaut, betreibt Apologetik: eine durch und durch seriöse Betätigung, aber nicht Geschichte, wie sie heutzutage, im modernen Westen, verstanden wird.
Wenn allerdings Historiker des Christentums den Glauben überwinden müssen, dann müssen sie auch den Zweifel überwinden. Es sind nicht nur Gläubige, deren Interpretation der christlichen Geschichte dafür anfällig ist, mit zutiefst Persönlichem zusammenzuhängen. Dasselbe kann auch auf Skeptiker zutreffen. 1860 mokierte sich in einer der ersten öffentlichen Diskussionen von Charles Darwins(1) gerade veröffentlichtem Werk Über die Entstehung der Arten der Bischof von Oxford(1) auf berühmt-berüchtigte Weise über die Theorie, dass Menschen womöglich ein Produkt der Evolution sein könnten. Heute hat sich das Blatt gewendet. »Da wir alle Menschen des 21. Jahrhunderts sind, können wir alle einem recht weit verbreiteten Konsens zustimmen bezüglich dessen, was richtig und was falsch ist.«[24] So die Erklärung von Richard Dawkins(1), dem evangelikalsten Atheisten(1) weltweit. Zu argumentieren, dass sich im Westen der »recht weit verbreitete Konsens bezüglich dessen, was richtig und was falsch ist«, überwiegend aus christlichen Lehren und Annahmen ableitet, kann Gefahr laufen, in Gesellschaften, in denen viele und keine Glaubensrichtungen präsent sind, fast anstößig zu wirken. Selbst in Amerika(1), wo das Christentum eine sehr viel lebendigere Macht als in Europa ist, wächst die Anzahl derer, die im altehrwürdigen Glauben des Westens etwas eher Unzeitgemäßes sehen: ein Überbleibsel aus früheren, abergläubischen Zeiten. So wie sich der Bischof von Oxford einst weigerte, auch nur in Erwägung zu ziehen, dass er von einem Affen abstammen könnte, so widerstrebt es heute vielen im Westen, darüber nachzudenken, dass ihre Werte bis hin zu ihrem fehlenden Glauben womöglich auf christliche Ursprünge zurückzuführen sein könnten.
Ich kann das mit einiger Sicherheit behaupten, da ich bis vor gar nicht langer Zeit dieses Widerstreben teilte. Obwohl mich meine Mutter als Jungen jeden Sonntag mit in die Kirche genommen hat und ich abends andächtig meine Gebete sprach, durchlebte ich bereits früh etwas, das ich heute nur als eine nahezu viktorianische Glaubenskrise bezeichnen kann. Ich erinnere mich genau an den Schock, den ich empfand, als ich eines Tages im Religionsunterricht eine Kinderbibel aufschlug und auf der ersten Seite auf eine Illustration von Adam(1) und Eva(1) mit einem Brachiosaurus stieß. Ich hatte durchaus Respekt vor den biblischen Geschichten, von einer Sache aber war ich – zu meinem Bedauern – felsenfest überzeugt: Kein menschliches Wesen hatte je einen Sauropoden gesehen. Dass dem Lehrer dieser Irrtum gleichgültig zu sein schien, steigerte nur mein Gefühl der Empörung und Verwirrung. Hatte es im Garten Eden(1) Dinosaurier gegeben? Mein Lehrer wusste es offenbar nicht, und es interessierte ihn auch nicht. Ein zarter Zweifelsschatten hatte mein Vertrauen in die Wahrheit dessen verdunkelt, was mir über den christlichen Glauben beigebracht wurde.
Im Lauf der Zeit wurde dieser Schatten immer dunkler. Meine Besessenheit von Dinosauriern – prachtvoll, wild, ausgestorben – entwickelte sich nahtlos zu einer Besessenheit von antiken Imperien. Wenn ich die Bibel las, faszinierten mich nicht so sehr die Kinder Israels oder Jesus und seine Jünger als vielmehr deren Gegner: die Ägypter, die Assyrer, die Römer. Und obwohl ich nach wie vor verschwommen auch weiterhin an Gott glaubte, fand ich ihn unendlich viel weniger charismatisch als die Gottheiten der Griechen: Apollon, Athene, Dionysos. Ich fand es sympathisch, dass sie keine Gesetze erließen oder andere Gottheiten oder Dämonen verdammten; ich mochte ihren glamourösen Rockstar-Appeal.
Das hatte zur Folge, dass ich, als ich anfing, Edward Gibbon(1) und seine große Geschichte vom Verfall und Untergang des Römischen Reiches zu lesen, mehr als bereit war, mich seiner Interpretation vom Triumph des Christentums anzuschließen: dass dieser ein »Zeitalter des Aberglaubens und der Leichtgläubigkeit« eingeläutet hatte.[25] Mein Kindheitsinstinkt, den biblischen Gott als sauertöpfischen Feind von Freiheit und Spaß anzusehen, wurde rational legitimiert. Die Niederlage des Heidentums hatte die Herrschaft des Nobodaddy5 eingeleitet und all der diversen Kreuzfahrer, Inquisitoren und schwarzhütigen Puritanern, die als seine Gehilfen fungierten. Farbe und Spannung waren aus der Welt verschwunden. »Du hast gesiegt, bleicher Galiläer«, schrieb der viktorianische Dichter Algernon Charles Swinbourne(1), womit er die apokryphe Klage des Julian(1) Apostata wiederholte, des letzten heidnischen Kaisers von Rom(1): »Die Welt ist grau geworden unter deinem Atem.«[26] Instinktiv stimmte ich ihnen zu.
Im Lauf der beiden letzten Jahrzehnte hat sich meine Sichtweise jedoch verändert. Als ich meine ersten Bücher über Geschichte schrieb, nahm ich mir als Thema die beiden Zeitabschnitte vor, die mich als Kind immer am meisten gereizt und bewegt hatten: die persischen Invasionen in Griechenland und die letzten Jahrzehnte der römischen Republik. Die Jahre, die ich mit diesen beiden Studien zur antiken Welt verbrachte, als ich in enger Gemeinschaft mit Leonidas(1) und Julius Caesar(2) lebte, mit den Hopliten, die bei den Thermopylen gestorben waren, und den Legionären, die den Rubikon überschritten hatten, bestätigten mich in meiner Faszination: Denn Sparta(1) und Rom(2) behielten ihre glanzvolle Aura als Spitzen-Raubtiere, auch wenn sie akribischer historischer Forschung unterzogen wurden. Sie lebten in meiner Phantasie weiter wie zuvor: wie ein großer Weißer Hai, wie ein Tiger, wie ein Tyrannosaurus.
Aber gigantische Raubtiere, so faszinierend sie auch sein mögen, sind von Natur aus schreckenerregend. Je mehr Jahre ich mit dem Studium der klassischen Antike zubrachte, desto fremder fand ich sie. Die Werte des Leonidas(2), dessen Volk(2) eine besonders mörderische Form von Eugenik praktizierte und seine jungen Männer darin ausbildete, nachts aufmüpfige Untermenschen umzubringen, hatten nichts mit meinen eigenen Vorstellungen zu tun; ebensowenig wie diejenigen Caesars(3), der eine Million Gallier(2) umgebracht und eine weitere Million versklavt haben soll. Nicht nur solche extremen Auswüchse an Herzlosigkeit bereiteten mir Unbehagen, sondern das vollständige Fehlen eines Gespürs dafür, dass die Armen oder die Schwachen auch nur den geringsten Eigenwert haben könnten.
Warum fand ich das verstörend? Weil ich hinsichtlich meiner moralischen und ethischen Grundauffassungen nicht einmal ansatzweise ein Spartaner oder Römer war. Dass mein Gottesglaube im Lauf meiner Teenagerjahre verkümmert war, bedeutete nicht, dass ich aufgehört hatte, christlich zu sein. Über ein Jahrtausend lang war die Zivilisation, in die ich hineingeboren wurde, die Christenheit gewesen. Die Grundannahmen, mit denen ich aufgewachsen war – über die angemessene Organisation einer Gesellschaft und die Prinzipien, denen sie sich verschreiben sollte –, stammten nicht aus der klassischen Antike, noch weniger aus der »menschlichen Natur«, sondern ganz klar aus der christlichen Vergangenheit dieser Zivilisation. Der Einfluss des Christentums auf die Entwicklung der Zivilisation des Westens war so tiefgreifend, dass er unsichtbar geworden war. Die Revolutionen, an die man sich erinnert, sind die unvollendeten; das Schicksal derer, die triumphieren, besteht darin, dass man sie als Selbstverständlichkeit ansieht.
Mit Herrschaft möchte ich den Verlauf dessen nachverfolgen, was ein Christ im 3. Jahrhundert n. Chr. als »die Flut Christi« bezeichnete:[27] wie der Glaube, dass der Sohn des einen Gottes der Juden an einem Kreuz zu Tode gefoltert worden war, so nachhaltig und weit verbreitet werden konnte, dass heute die meisten Menschen im Westen die Wahrnehmung dafür verloren haben, wie skandalös dieser Glaube zu Beginn war. Mein Buch untersucht, wodurch das Christentum so subversiv und revolutionär wurde; wie vollständig es die Grundhaltung der lateinischen Christenheit imprägnierte; und warum in einer westlichen Welt, die häufig ein so kompliziertes Verhältnis zu religiösen Ansprüchen hat, so viele ihrer Instinkte nach wie vor – im Guten wie im Schlechten – durch und durch christlich sind.
Kurz: Es geht um die größte Geschichte aller Zeiten.
ANTIKE
I
Athen
479 v. Chr.: Hellespont
An einer der engsten Stellen des Hellespont(1), des schmalen Kanals, der sich von der Ägäis ins Schwarze Meer hinauf schlängelt und Europa von Asien trennt, ragte eine Landzunge, der sogenannte Hundeschwanz, von der europäischen Seite aus ins Meer hinein. Hier war 480 Jahre vor Christi Geburt eine so erstaunliche Tat vollbracht worden, dass es den Anschein erweckte, ein Gott habe gehandelt. Zwei Ponton-Brücken, die sich vom asiatischen Ufer hinüber zum Hundeschwanz erstreckten, hatten die beiden Kontinente zusammengespannt. Natürlich hatte nur ein Monarch, der über unendliche Mittel verfügte, die Meeresströmungen in einer so herrschaftlichen Art und Weise zähmen können. Xerxes, der König Persiens(2), herrschte über das größte Reich, das die Welt je gekannt hatte. Von der Ägäis bis zum Hindukusch marschierten sämtliche wimmelnden Horden Asiens nach seinem Befehl. Wenn er in den Krieg zog, konnte er Streitkräfte versammeln, die, so hieß es, ganze Flüsse leertranken. Nur wenige, die beobachteten, wie Xerxes den Hellespont überquerte, bezweifelten, dass ihm bald der gesamte Kontinent auf der anderen Seite gehören würde.
Ein Jahr später waren die Brücken verschwunden. Ebenfalls verschwunden waren die Hoffnungen des Xerxes(1), Europa erobern zu können. Bei seinem Vormarsch nach Griechenland hinein hatte er Athen(1) erobert, doch das Niederbrennen der Stadt sollte der Höhepunkt seines Feldzugs bleiben. Niederlagen zu See und zu Land erzwangen den Rückzug der Perser(3). Xerxes selbst kehrte nach Asien zurück. Am Hellespont, wo das Kommando über die Meerenge einem General namens Artayktes(1) übertragen worden war, herrschte verschärfter Alarmzustand. Artayktes war sich darüber im Klaren, dass er nach den Katastrophen in Griechenland besonders exponiert war. Und was er befürchtete, trat ein: Im Spätsommer des Jahres 479 kamen mehrere athenische Schiffe den Hellespont(2) hinaufgesegelt. Als sie am Hundeschwanz anlegten, verschanzte Artayktes sich zunächst im nächstgelegenen Stützpunkt; dann, nach einer längeren Belagerung, wagte er, begleitet von seinem Sohn, einen Ausbruch, um sich in Sicherheit zu bringen. Trotz einer erfolgreichen Flucht mitten in der Nacht kamen sie nicht weit. Vater und Sohn wurden gefasst und in Ketten zum Hundeschwanz zurückgeschleift. Dort wurde Artayktes an der äußersten Spitze der Landzunge von seinen Athener Häschern auf einem Holzbrett festgemacht, das dann aufgerichtet wurde. »Dort, vor seinen Augen, steinigten sie seinen Sohn zu Tode.«[1] Artayktes aber war ein Ende vorbehalten, das sich sehr viel länger hinzog.
Auf welche Weise schafften es seine Folterknechte, dass er an dem aufrecht stehenden Brett nicht abrutschte? In Athen(2) wurden Kriminelle, denen man besonders abscheuliche Verbrechen vorwarf, an einer Foltereinrichtung namens apotympanismos befestigt, einem Brett, das mit Schäkeln versehen war, die den Hals, die Handgelenke und Fußknöchel umschlossen. Allerdings weist nichts darauf hin, dass diese Vorrichtung von denen verwendet wurde, die Artayktes(2) umbrachten. Stattdessen ist im einzigen uns vorliegenden Bericht über seinen Tod davon die Rede, dass er mit passaloi an dem Brett festgemacht wurde: »Nägeln«.6 Die Folterknechte zwangen ihr Opfer, sich auf den Rücken zu legen, und trieben offenbar Nägel durch sein lebendes Fleisch, die sie tief ins Holz hinein hämmerten. Knochen rieb und schrammte gegen Eisen, als das Brett dann aufgerichtet wurde. Als Artayktes mit ansehen musste, wie sein Sohn zu Tode geschunden wurde, konnte er auch zum Himmel aufblicken und dort Vögel kreisen sehen, die ungeduldig darauf warteten, dass sie sich auf ihm niederlassen und seine Augen verspeisen konnten. Als der Tod ihn schließlich ereilte, kam er sicher als Erlösung.
Indem seine Häscher aus dem Leiden des Artayktes(3) ein so langgezogenes Spektakel machten, gaben sie auch ein Statement ab. Es war eine unmissverständliche Botschaft, dass sie ihn genau an dem Punkt hinrichteten, wo Xerxes(2) zuerst europäischen Boden betreten hatte. Den Diener des Großkönigs zu demütigen war gleichbedeutend mit der Demütigung des Großkönigs selbst. Die Griechen, die lange im Schatten Persiens(4) gestanden waren, hatten gute Gründe, Persien als Heimat ausgeklügelter Foltermethoden zu sehen. Die Perser waren, so die Annahme der Griechen, die ersten gewesen, die Kriminelle an Pfählen oder Kreuzen öffentlich auszustellen pflegten, so dass die Erniedrigung die Todesqualen noch verschlimmerte. Bestimmt waren die Strafen, mit denen jene belegt wurden, die sich der königlichen Würde widersetzten, ebenso qualvoll wie bedrohlich. Rund vierzig Jahre vor der Griechenland-Invasion des Xerxes hatte sein Vater Dareios(1) mit denen, die seinen Thronanspruch in Frage stellten, abgerechnet, indem er sie auf die denkbar öffentlichkeitswirksamste Weise foltern ließ. Ganze Wälder von Pfählen wurden errichtet, an denen seine Rivalen, die sich wanden und brüllten, wenn sie spürten, wie sich das Holz in ihre Innereien bohrte, gepfählt wurden. »Ich habe ihm seine Nase und seine Ohren abgeschnitten und eines seiner Augen ausgerissen und ihn an den Eingang meines Palastes gefesselt, wo alle ihn sehen konnten.« Damit brüstete sich Dareios in seiner detaillierten Darstellung der Behandlung eines besonders üblen Rebellen. »Dann ließ ich ihn pfählen.«[2]
Nicht jeder, der dem Zorn des Großkönigs(5) zum Opfer fiel, wurde aufgehängt oder gepfählt und zur Schau gestellt, während er starb. Die Griechen sprachen hinter vorgehaltener Hand mit dem Ausdruck größten Abscheus von einer besonders widerwärtigen Foltermethode: der skaphe oder dem »Trog«. Der Henker legte sein Opfer in ein Boot oder einen ausgehöhlten Baumstamm und befestigte dann einen zweiten »Trog« über ihm, so dass nur Kopf, Hände und Füße des Unglückseligen herausragten. Dann wurde der Verbrecher ständig mit fetter Nahrung gefüttert, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als in seinen Exkrementen zu liegen; außerdem über und über mit Honig beschmiert, konnte er sich der surrenden Fliegen nicht erwehren. »Würmer und Scharen von Maden entwickelten sich aus der Fäulnis und der Zersetzung der Exkremente; sie fraßen seinen Körper an und bohrten sich in seine Eingeweide.«[3] Das Opfer starb erst, wenn sein Fleisch und seine Organe fast vollständig aufgezehrt waren. Ein Mann, so wird glaubwürdig berichtet, hatte die skaphe siebzehn Tage überlebt, bevor er seinen letzten Atemzug tat.
Doch bei aller Grausamkeit einer solchen Folter – willkürlich war sie nicht. Wenn die Griechen dem Großkönig(6) rücksichtslose Zurschaustellung von Despotismus vorwarfen, dann verwechselten sie das Verantwortungsbewusstsein, das für dessen Sorge um Gerechtigkeit kennzeichnend war, mit barbarischer Grausamkeit. In Wahrheit, vom persischen Hof aus gesehen, waren die Griechen die Barbaren. Der Großkönig gewährte den von ihm unterworfenen Völkern zwar, dass sie ihre eigenen Gesetze beibehielten – vorausgesetzt natürlich, dass sie pflichtschuldigst gehorsam blieben –, doch zweifelte er nie am kosmischen Charakter seiner eigenen Privilegien und Verantwortlichkeiten. »Aufgrund der Gunst Ahura Mazdas(1) bin ich König«, erklärte Dareios(2)(7). »Ahura Mazda verlieh mir die Königsherrschaft.«[4] Der Größte der Götter, der weise Herr, der Himmel und Erde erschaffen und sich in die kristalline Schönheit des Himmels über den Schneebergen und Sandwüsten des Iran gekleidet hatte – er war der einzige Schutzherr, den Dareios anerkannte. Die Gerechtigkeit, die der Großkönig seinen Untertanen angedeihen ließ, war nicht sterblichen Ursprungs, sondern leitete sich ganz direkt vom Herrn des Lichts ab. »Den Mann, der treu ergeben ist, belohne ich; den treulosen Mann bestrafe ich. Aufgrund der Gunst von Ahura Mazda(2) anerkennen die Menschen die Ordnung, die ich aufrechterhalte.«[5]
Dareios(3)(8) war nicht der erste, der davon überzeugt war, dass die Herrschaft eines Königs so segensreich sein könne wie die eines Gottes. Dieser Glaube reichte vielmehr bis ganz an den Anfang der Dinge zurück. Im Westen des Iran erstreckten sich die von zwei mächtigen Strömen bewässerten Sumpfgebiete der Region, welche die Griechen als Mesopotamien bezeichneten: »Land zwischen den Strömen«. Hier, in Städten, die sehr viel älter waren als die persischen, hatten Monarchen seit Langem die Gewohnheit, den Göttern dafür zu danken, dass sie ihnen halfen, Gerechtigkeit zu vollstrecken. Über tausend Jahre vor Dareios hatte ein König namens Hammurabi(1) erklärt, er übe einen göttlichen Auftrag aus: »Die Regel der Rechtschaffenheit im Land durchzusetzen und die Frevler und Übeltäter zu zerstören, auf dass die Starken nicht die Schwachen schädigen.«[6]
Der Einfluss dieses Anspruchs, dass nämlich ein König seinem Volk am besten diente, indem er ihm Gleichheit verschaffte, sollte sich als dauerhaft erweisen. Babylon(1), die von Hammurabi(2) beherrschte Stadt, verstand sich als Hauptstadt der Welt. Und das war nicht nur Wunschdenken. Die Metropole, ebenso reich wie kultiviert, zog schon seit Langem die Besten der Besten an. Obwohl ihre Bedeutung im Lauf der Jahrhunderte zurückgegangen war, wurden die Größe und das Alter ihrer Traditionen in ganz Mesopotamien, wenn auch widerwillig, anerkannt. Selbst in Assyrien(2), einem Land nördlich von Babylon, das vor dem Zusammenbruch seines grausam militaristischen Regimes im Jahr 612 v. Chr. immer wieder Strafexpeditionen gegen die große Stadt unternommen hatte, wiederholten die Könige die Vorgabe des Hammurabi. Auch sie beanspruchten einen glanzvollen, einschüchternden Status für ihre Herrschaft. Einer von ihnen verkündete großspurig: »Das Wort des Königs ist so vollkommen wie das der Götter.«[7]
Im Jahr 539 v. Chr., als Babylon(2) von den Persern(9) erobert wurde, so wie Assyrien sieben Jahrzehnte zuvor von den Babyloniern(1) erobert worden war, hatten die Götter der besiegten Metropole nicht gezögert, den neuen Herrn über die Stadt als ihren Günstling zu begrüßen. Kyros(1), Begründer der Größe seines Volkes(10), dessen Eroberung der größten Stadt weltweit einem Leben voller erstaunlicher Siege das Siegel aufgedrückt hatte, hatte ihre Unterstützung huldvoll entgegengenommen. Der persische König rühmte sich, in Babylon(3) auf deren ausdrückliche Einladung eingezogen zu sein, ihre Tempel wiederhergestellt, sich täglich um den Kult bemüht zu haben. Kyros, als Propagandist ebenso gewieft wie als General effektiv, wusste genau, was er tat. Er begann seine Herrschaft als König eines bislang namenlosen Volkes(11); und er beendete seine Herrschaft als Herr über die größte Ansammlung von Territorien, welche die Welt je gesehen hatte – ein Ausmaß, das mit Sicherheit die wildesten Phantasien eines assyrischen oder babylonischen Monarchen überstieg. Wenn Kyros sich jedoch als Weltherrscher positionieren wollte, dann blieb ihm kaum etwas anderes übrig, als sich am Erbe Mesopotamiens zu orientieren. Keine andere Region der von ihm beherrschten Länder hatte ihm ein Modell des Königtums geboten, das so in der Vergangenheit verwurzelt und so absolut von sich selbst überzeugt war. »König des Universums, mächtiger König, König von Babylon«:[8] Das waren die Titel, die der persische Eroberer sich zu eigen zu machen gedachte.
Allerdings hatte sich die mesopotamische Tradition auf Dauer für die Bedürfnisse ihrer Erben als unangemessen herausgestellt. Obwohl Kyros(2) ihren Ansprüchen so weit entgegengekommen war, hatten die Babylonier sich nur widerwillig mit dem Verlust ihrer Unabhängigkeit abgefunden. Unter den Rebellen, die sich gegen Dareios(4) erhoben, als dieser, siebzehn Jahre nach dem Fall Babylons, den persischen(12) Thron bestieg, befand sich einer, der behauptete, der Sohn des letzten wahren Königs der Stadt zu sein. Der arme Mann und seine Feldherren wurden in der Schlacht besiegt und – wie nicht anders zu erwarten – umgehend gepfählt. Dareios gab sich darüber hinaus aber auch alle Mühe, den Ruf seines besiegten Rivalen aufzuspießen. Inschriften verkündeten der Welt das ganze Ausmaß der Betrügereien des angeblich rechtmäßigen Thronfolgers. Er war alles andere als ein Prinz von Geblüt, so hieß es, er war nicht einmal ein Babylonier, sondern ein Armenier namens Arakha(1). »Er war ein Lügner.«[9] Das war von den vielen Anschuldigungen, die ein Perser(13) gegen seinen Gegner erheben konnte, sicherlich die verheerendste.
Die Lüge, die Arakha(2) zur Last gelegt wurde, war nicht nur eine Beleidigung des Dareios(5), sondern ein Angriff auf die Beständigkeit des Universums. So allgütig und allweise Mazda(3), der Herr, war, so war doch seine Schöpfung nach Meinung der Perser(14) durch eine Dunkelheit bedroht, die sie als drauga bezeichneten: »die Lüge«. Indem er gegen Arakha und seine Mit-Rebellen kämpfte, hatte Dareios nicht nur seine eigenen Interessen verteidigt. Unendlich viel mehr stand auf dem Spiel. Wäre der sich ausbreitende Schmutz der Lüge nicht von Dareios weggeputzt worden, dann hätte die Lüge das Strahlen alles dessen, was gut war, mit dem Gift ihres Schmutzwassers bespritzt. Rebellen gegen seine Autorität als König waren zugleich Rebellen gegen die Autorität des allweisen Herrn. »In Unkenntnis über die Verehrung Ahura Mazdas(4)«[10] hatten Arakha(3) und seine Anhänger eine kosmische Ordnung angegriffen, die gleichbedeutend mit der Wahrheit selbst war. Bezeichnenderweise benutzten die Perser(15) denselben Namen, arta, für beide. Indem Dareios sich der Verteidigung der Wahrheit verschrieb, gab er allen, die ihm auf dem Thron nachfolgten, ein Beispiel. »Du, der Du später König sein wirst, bleibe auf der Hut vor der Lüge. Den Mann, der ein Gefolgsmann der Lüge ist – bestrafe ihn hart.«[11]
Und das hatten seine Erben auch getan. Wie Dareios(6), so war auch ihnen klar, dass sie in einen Konflikt verwickelt waren, der so alt war wie die Zeit und so umfassend wie das Universum. Zwischen Licht und Dunkelheit mussten sich alle entscheiden. Es gab nichts, das so klein gewesen wäre, nichts, das da kreuchte und fleuchte, dass es nicht als Lakai der Lüge hätte dienen können. Die Würmer und Maden, die sich, ausgebrütet in seinen Exkrementen, von einem Mann ernährten, der zur skaphe verurteilt war, bestätigten, indem sie sein Fleisch fraßen, dass sowohl sie als auch der Verurteilte Handlanger der Verlogenheit und der Dunkelheit waren. Und auch die Barbaren, die jenseits der Grenzen persischer Ordnung lauerten, außerhalb der Reichweite der Befehle des Großkönigs, waren Diener nicht von Göttern, sondern von Dämonen. Natürlich bedeutete das nicht, dass man Fremde, die nicht das Glück hatten, als Perser(16) zur Welt gekommen zu sein, dafür verantwortlich machte, dass sie Ahura Mazda(5) nicht kannten. Eine solche Politik wäre grotesk gewesen: ein Angriff auf alle geltenden Bräuche. Indem Kyros(3) die Tempel in Babylon(4) großzügig unterstützte, hatte er einen Weg markiert, dem seine Erben gewissenhaft folgten. Welcher Sterbliche, und sei er selbst der Großkönig, durfte sich anmaßen, die Götter anderer Völker zu verspotten? Dennoch – als derjenige, dem von Ahura Mazda die Aufgabe übertragen worden war, die Welt gegen die Lüge zu verteidigen, war der Großkönig dafür verantwortlich, dass die von Unruhen heimgesuchten Länder ebensosehr von Dämonen wie von Rebellen gereinigt und befreit wurden. So wie Arakha(4) die Leute von Babylon(5) zur Auflehnung verführt hatte, indem er vorgab, der Sohn ihres toten Königs zu sein, so bedienten sich auch Dämonen der Täuschung, indem sie den Anschein erweckten, Götter zu sein. Was blieb einem König, der mit einer solchen Gefahr konfrontiert war, anderes übrig, als Strafmaßnahmen zu ergreifen?
So kam es, dass Dareios(7), als er über die Länder jenseits seiner Nordgrenzen(17) nachdachte und alarmiert war über die aufsässige Art eines bestimmten Volkes – der Skythen(1) –, in ihrer Wildheit etwas Bedrohliches erkannte: eine Empfänglichkeit für die Verführungen der Dämonen. »Sie sind angreifbar, diese Skythen, durch die Lüge«[12] – weshalb Dareios als stets pflichtbewusster Diener Ahura Mazdas(6) für ihre Befriedung sorgte. Auf ähnliche Weise ordnete Xerxes(3) nach seiner Eroberung Athens(3) an, die Tempel auf der Akropolis mit Feuer zu reinigen; und erst dann, als er sicher sein konnte, dass sie rein waren und keine Dämonen mehr beherbergten, hatte er erlaubt, dass den Göttern der Stadt wieder Opfer dargebracht wurden. Ein solches Ausmaß an Macht, wie sie dem Großkönig zur Verfügung stand, hatte es bisher noch nie gegeben. Mehr als irgendein Herrscher vor ihm war er dazu in der Lage, allein aufgrund der unglaublichen Ausdehnung seines territorialen Besitzes davon überzeugt zu sein, dass er mit einer universalen Aufgabe betraut war. Bumi, das Wort, mit dem er sein Reich bezeichnete, bedeutete auch Welt. Als die Athener(4) dachten, sie würden dem Anspruch des Xerxes(4) auf Europa(18) trotzen, indem sie einen seiner Diener am Ufer des Hellesponts kreuzigten, bewiesen sie lediglich, dass sie Anhänger der Lüge waren.
Hinter dem äußeren Erscheinungsbild des gewaltigen Reichs(19) des Großkönigs, jenseits der Paläste und Heerlager, jenseits der Wegstationen an staubigen Straßen schimmerte eine sublime und folgenreiche Vorstellung: Das von Kyros(4) geschaffene, von Dareios(8) abgesicherte Reich war ein Spiegel des Himmels. Wer sich ihm widersetzte, es umzustürzen suchte, widersetzte sich der Wahrheit selbst. Nie zuvor hatte eine Monarchie mit dem Ehrgeiz, die Welt zu regieren, ihre Macht so explizit ethisch begründet. Die Reichweite der Macht des Großkönigs, die sich bis zu den äußersten Enden des Ostens und Westens erstreckte, warf ihr Licht sogar noch ins Grab. »So lauten die Worte von Dareios, dem König: Jeder, der Ahura Mazda(7) verehrt, wird mit göttlicher Gunst belohnt, sowohl im Leben als auch im Tod.«[13] Vielleicht konnte Artayktes(4), während er seine Todesqualen durchlitt, in diesem Gedanken ja Trost finden.
Die Nachricht von der Hinrichtung des Artayktes(5) bekräftigte also mit Sicherheit lediglich die Verachtung des Großkönigs für diese Athener(5) Terroristen. Wahrheit oder Lüge; Licht oder Finsternis; Ordnung oder Chaos: das waren Entscheidungen, denen sich die Menschen überall zu stellen hatten.
Und dieser Art, die Welt zu verstehen, war eine lange Zukunft beschert.
Tell me Lies
In Athen(6) sahen sie die Sache natürlich ziemlich anders. Im Jahr 425 v. Chr. machte ein Dramatiker namens Aristophanes(1) eine Komödie aus diesem Unterschied. 54 Jahre waren vergangen, seit Xerxes die Akropolis in Brand gesteckt hatte, und der Gipfel des Felsen war befreit vom Schutt und geschmückt mit »Zeichen und Denkmälern des Reichs«.[14] Er legte strahlendes Zeugnis vom Ausmaß der gelungenen Neubelebung der Stadt ab. Unterhalb des Parthenon(1), des größten und schönsten der Tempel, die jetzt die Athener Skyline zierten, versammelten sich die Bürger in jedem Winter in der natürlichen Aushöhlung des Abhangs, wo sie ihre Sitze in einem Theater zur jährlichen Theateraufführung einnahmen.7 In einem Jahresablauf, der durch den Rhythmus von Festen geprägt war, waren die Lenäen eigens der Komödie gewidmet – und Aristophanes stand zwar erst am Beginn seiner Karriere, hatte sich jedoch bereits als Meister seines Fachs profiliert. Im Jahr 425 gab er sein Debüt bei den Lenäen mit einem Stück, Die Acharner, das sich über alles lustig machte, womit es in Berührung kam – und zu seinen Zielen gehörte auch die Selbstbeweihräucherung des persischen Königs.
»Er hat viele Augen.«[15] Unweigerlich musste den Griechen der Anspruch ihres Erzfeindes auf universale Herrschaft höchst unheilvoll vorkommen. Man war überzeugt, dass innerhalb der Grenzen seines Reichs Spione eine ständige Überwachung durchführten. »Jeder fühlt sich beobachtet von einem König, der allgegenwärtig ist.«[16] Einem solchen Motiv konnte Aristophanes(3) nicht widerstehen. Als der Schauspieler, der in den Acharnern die Rolle eines persischen Gesandten spielte, die Bühne betrat, kam er mit einem riesigen Auge auf seinem Kopf daher. Auf die Aufforderung hin, die Botschaft des Königs vorzutragen, deklamierte er feierlich eine Zeile Gebrabbel. Sogar in seinem Namen – Pseudartabas(1) – steckte eine Pointe: Im Persischen bedeutete arta »Wahrheit«, im Griechischen war pseudes »lügnerisch«.[17] Aristophanes erkannte ein aufspießbares Ziel, wenn er es sah. Unverfroren lieferte er(4) die erhabensten Überzeugungen des Dareios und seiner Erben dem Gelächter des Athener(7) Publikums aus.
Dass die Wahrheit täuschen konnte, war ein Paradox, das den Griechen wohlvertraut war. In den Bergen nordwestlich von Athen, in Delphi(1), gab es ein Orakel; und dessen Enthüllungen waren so vieldeutig und rätselhaft, dass Apollon(1), der Gott, von dem sie stammten, den Beinamen Loxias hatte – »der Schräge«. Einen Gott, der Ahura Mazda noch weniger ähnelte, hätte man sich kaum vorstellen können. Griechische Reisende staunten über die Menschen in anderen Ländern, die Orakeln buchstabengenau folgten: Die Sprüche, die Apollon lieferte, waren ausnahmslos mehrdeutig. In Delphi(2) war Ambivalenz das Privileg des Göttlichen. Apollon, der Goldenste unter den Göttern, der später mit dem Wagenlenker der Sonne identifiziert werden sollte, blendete die, die er schändete. Einerseits rühmte man ihn wegen seiner Heilkräfte und für die magische Macht seines musikalischen Könnens; andererseits fürchtete man ihn als den Herrn des silbernen Bogens, dessen Pfeile in Pest getaucht waren. Das Licht, in dem die Perser(20) das gänzlich gute, gänzlich wahre Lebensprinzip des Universums sahen, war auch das wichtigste Merkmal Apollons; allerdings gehörte bei dem griechischen Gott auch ein Element von Dunkelheit dazu. Er und seine Zwillingsschwester Artemis(1)