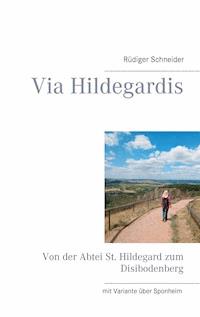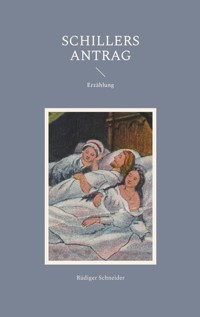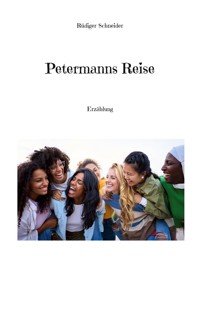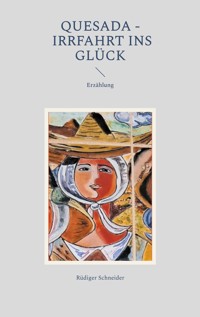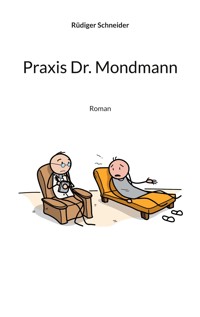5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herzschleifen - Vier Erzählungen. Ihr Thema: Das Herz und die Liebe. Was denn sonst!?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Personen und Handlung sind frei erfunden, Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit Namen rein zufällig.
Inhalt
Bar La Mula
An einem regnerischen Tag
Lissabon – Drei Tage
Herzflimmern oder ‚music is life’
Bar La Mula
1
Spätestens im November wird die Sehnsucht nach Sonne größer. Wenn Deutschland im Grau versinkt und das Wetter einem neben dem stündlichen Stakkato schlechter Nachrichten das Gemüt belastet. Meinen kleinen Buchladen am Bonner Konrad-Adenauer-Platz hatte ich aufgegeben, aufgeben müssen, da die Konkurrenz durch Medienkonzerne und das Internet übermächtig geworden war. Der Verkauf des Ladens und des dazu gehörenden Mietshauses bescherte mir ein kleines Barvermögen, und da ich gerade 65 geworden war, kam noch eine bescheidene Rente hinzu. Wie die Bremer Stadtmusikanten sagte ich mir: „Max, was Besseres als den Tod findest du allemale!“ Aber ich zog nicht wie die Märchenfiguren nach Norden, sondern nach Süden, nach Spanien an die Costa del Sol. Mir die Rente auf eine spanische Bank zu schicken, würde kein Problem sein. Es gab nur ein paar bürokratische Unannehmlichkeiten. So beschied mich zum Beispiel die Rentenkasse: „Sehr geehrter Herr Winter, wir benötigen eine jährliche Bescheinigung, dass Sie noch leben.“ Nun ja, dachte ich mir, das wird kein Problem sein und rief bei meiner zuständigen Rentenkasse an. „Reicht es, wenn ich mich einmal im Jahr bei Ihnen telefonisch melde?“ fragte ich die Sachbearbeiterin.
„Aber Herr Winter, ich bitte Sie! Da kann ja jeder anrufen. Wir brauchen das schriftlich. Da, wo Sie wohnen und gemeldet sind, gehen Sie zum Einwohnermeldeamt und lassen es sich bestätigen. Das schicken Sie uns zu. Sie müssen natürlich persönlich auf dem Amt erscheinen, Ihren Ausweis vorlegen, sonst geht das nicht. Die werden dann sehen, ob Sie noch leben oder nicht mehr.“
Ich zeigte mich einsichtig. Denn im Grunde hat die Rentenkasse recht. Sie können ja nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag Geld ins Ausland überweisen, wenn diejenigen, die der Heimat den Rücken gekehrt haben, schon lange abgenippelt sind.
Ach ja, Heimat. Darüber dachte ich nach. Was ist eigentlich Heimat? Ist es die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft? Möglich. Aber dann kommt es darauf an, mit wem man sich etwas zu sagen hat und worüber man redet. Auf diesem Gebiet sah es bei mir nach dem Verkauf des Buchladens ziemlich mau aus. Die paar Freunde, die ich hatte, hockten in biederen Ehen und mussten für Unternehmungen erst um Erlaubnis fragen. Ich selbst war unverheiratet und hielt es eher mit Goethes Spruch aus dem West-Östlichen Divan: „Denken in Besitz und Liebe machen mir die Sonne trübe.“
Eine Freundin hatte ich seit langem nicht mehr gehabt, wohl aber ein paar kurze Affären, von denen hier jedoch nicht die Rede sein soll. Bindungs- und beziehungsmäßig war ich also frei. Ein ausgeprägtes Nationalgefühl hatte ich auch nicht. Es beschränkte sich auf die Freude, dass Deutschland 2014 Fußballweltmeister geworden war. Gab es eine kulturelle Heimat? Goethe und Schiller waren tot. Was sie geschrieben hatten, konnte ich mit nach Spanien nehmen. Das war sozusagen ein unveräußerlicher Besitz, der überall zugänglich war. Dann gab es noch die fast komische Frage nach der religiösen Heimat. Die gab es in Deutschland nicht mehr. Das Christentum war abgeschafft. Gott wohnte nur noch im Supermarkt. Hatte ich eine politische Heimat? Auch nicht. Ich ging zwar alle vier Jahre wählen, machte auf dem Wahlzettel aber kein Kreuz, sondern schrieb nur den Namen des jeweiligen Papstes aufs Papier. So äußerte ich meinen Unmut darüber, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Außerdem dachte ich, Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Liebst du ein Eskimomädchen, kannst du auch in einem Iglu glücklich sein. In der Bilanz aller Dinge war ich also heimatlos, konnte leichten Herzens ein paar persönliche Dinge in meinen Wagen verfrachten und mich aus dem immer trüber werdenden Bonn verabschieden. Das Auto hätte ich mir bei meinem schmalen Verdienst als Buchhändler eigentlich nicht leisten können. Es war ein schon in die Jahre gekommener 2 CV, eine Ente also. Ich hing an dem Wagen, vermochte ihn nicht einzutauschen gegen ein moderneres Fahrzeug. Den Motor hatte ich schon zweimal erneuern lassen. Vieles andere wie Bremsen, Auspuff und so weiter auch. Ebenso war die Lackierung neu, kirschrot. Eigentlich war es ein gepflegter, schnuckliger Oldtimer, mit dem ich, war ich unterwegs, immer auffiel. Freunde hatten mir schon viel Geld dafür geboten, aber ich hatte immer abgewunken. „Verkauf ich nicht! Tausche ich auch nicht gegen einen Mercedes ein.“
2
Was mir die Liebe verdächtig machte beziehungsweise mich an ihrer Beständigkeit zweifeln ließ, war das Schicksal meines Freundes Paul Bernhardt, den wir alle nur Kongopaul nannten. Kongopaul war 68 und in Bonn-Duisdorf zu einer bezaubernd schönen Afrikanerin gezogen, die 39 Jahre jünger war als er. In einer kleinen Zweizimmerwohnung lebte er mit ihr und ihren fünfjährigen Zwillingen Ben und Micky zusammen. Es waren nicht seine Kinder, sondern eben ihre, die von einem Mann stammten, der sich abgesetzt hatte. Täglich gab es rasante Eifersuchtsszenen, das Vertrauen bröckelte. Alle drei Monate war Kongopaul auf der Flucht. Dann besuchte er einen der Freunde, bat: „Bitte helft mir!“, hatte aber stets sein Smartphone eingeschaltet und wartete auf das Signal zur Rückkehr. „Was soll ich bloß machen?“ meinte er. „Sie ist doch schön wie die junge Whitney Houston. Ich bin so stolz, wenn ich mit ihr spazieren gehen kann. Alle drehen sich nach uns um.“
Kongopaul blieb eine Nacht bei einem der Freunde, trug das Smartphone am Körper und kehrte am nächsten Tag dann dorthin zurück, wo das Dilemma begonnen hatte. Beim letzten Mal war er bei mir gewesen. Ich hatte versucht, ihn mit Bitburger zu trösten, hatte ihm auch vorgeschlagen mit nach Spanien zu kommen und hatte, als er wieder mit seiner Isabell telefonierte, verständnisvoll geäußert: „Ja, ja, es gibt eine Schönheit, die einen als Mann verwundet.“
Paul murmelte irgendetwas von Verfallensein. Fünf Minuten nach diesem Spruch war er weg. Ich weiß nicht, wie man in einem solchen Fall helfen soll. Ich kann den Paul ja schlecht anketten, und auch der Rat, sein Smartphone in den Rhein zu werfen, verfing nicht. So bringt er also wieder Ben und Micky in die Kita, fragt sich, wo seine schöne, junge Frau tagsüber ist, und ernährt seine exotische Familie mit seiner bescheidenen Rente. Dass das Glück heißer Nächte eine solche Aufgeregtheit besänftigen kann, bezweifle ich. Mir würde es die Schönheit des Tages trübe machen und so lasse ich lieber die Finger davon. Obgleich ich gestehen muss, dass auch ich diese Lust auf eine romantisch-heiße Liebe wie einen Virus in mir trage. Es könnte ja ausnahmsweise einmal gutgehen. Aber das ist genau der Punkt, wo meine Bedenken wurzeln. Nichts ist dauerhaft im Leben. Die Zeit und eben auch die Zeit des Verfalls hat noch niemand aufhalten können. Um diesen Pessimismus überwinden zu können, müsste ich wenigstens einmal die Ausnahme von dieser Regel gesehen haben. Vorher glaube ich nicht an die Beständigkeit der Liebe, vermute eher, dass einen dieser Affekt ins Unglück stürzt. So hatte ich also beschlossen, mich lieber in einem moderaten Schatten aufzuhalten, statt von einem Sonnenbad in Eiswasser zu stürzen. So zu leben ist natürlich kein Hit, aber es garantiert eine erträgliche Balance. Man durchlebt eine eher ruhige Gelassenheit, statt auf einer Achterbahn dahinzusausen. Sicher, es gibt auch bei mir Phasen von Langeweile. Aber die erschien mir erträglicher als das Schicksal des Kongopaul. Insbesondere vermeide ich Frauen, die einem wie ein Irrlicht ins Leben treten können. Als Buchhändler, der viel lesen musste und es auch gerne tat, kenne ich alle diese Fälle. Den armen Brentano hat es zwanzigmal erwischt. Goethe wusste sich nur durch raffinierte Fluchten zu entziehen. Mörike hat Zeit seines Lebens einer rätselhaften Zigeunerin nachgetrauert. Allein Odysseus wusste sich zu helfen und ließ sich von seinen Gefährten an den Mast binden, als sein Schiff am Felsen der Sirenen vorbeifuhr.
Außerdem, was soll es? Ich bin jetzt 65 Jahre, weder reich noch schön. Was kann mir in meinem Alter schon passieren? Da ist das mit der Liebe vorbei. Ich habe auch nie den Versuch unternommen, in einem Dating-Forum des Internet etwas zu finden, auch wenn ich hin und wieder dort vorbeigeschaut habe. Es war hoffnungslos. Allein die Texte im Profil hatten mich schon abgeschreckt. Was man als Mann alles können musste! Romantisch sein und mit beiden Beinen im Leben stehen. Keine Altlasten haben, aber über Erfahrung verfügen. Eine Powerfrau ertragen und im richtigen Moment eine starke Schulter haben zum Anlehnen für ihre schwachen Stunden. Was mein Äußeres und manche Eigenheiten betraf, hatte ich bei den meisten schon verloren. Raucher waren unerwünscht, ein gepflegtes Glas Wein - und um Himmels Willen nicht mehr! - am Kamin war zugestanden. Sportlichkeit und Fitness waren begehrt, ein Bäuchlein, eigentlich normal in meinem Alter, unliebsam ebenso wie Bart und fehlende Oberfrisur. Mit all diesen Wünschen konnte ich nicht dienen. Mit meinem Bart fand ich zur Weihnachtszeit eine Anstellung als Nikolaus, mein fehlendes Haupthaar hätte ich mit einer Mütze kaschieren, das Tabakaroma mit Menthol bekämpfen müssen. Und was das gepflegte Glas Wein am Kamin betrifft, wäre ich nachts aus dem Bett geschlichen, um den Rest der Flasche zu leeren. Das war mir zu viel Stress, zu viel Umerziehung. Außerdem liebte ich Mahlzeiten mit viel Knoblauch. Mich auf militante Veganerinnen einlassen mochte ich auch nicht. Ebenso fehlte mir der Zugang zur Esoterik. Dass man sich beim Universum die Lottozahlen bestellen kann, schien mir höchst zweifelhaft. Eine der abstrusesten Anzeigen stammte von einer Bildhauerin. Sie rühmte sich ihrer Ausstellungen in London und New York und schrieb: „Wenn du mir dienen willst, ist eine Beziehung möglich.“ Zugegeben, sie hatte ein attraktives Foto geschaltet, war groß, schlank und hatte jenes Bello Rosso im Haar, von dem schon Tizian geschwärmt hatte. Aber für eine Nacht der Zweisamkeit Gehorsam vorzutäuschen war mir nicht gegeben. So war ich also lange Zeit allein geblieben und niemand trauerte mir nach, als ich mich im November nach Spanien verabschiedete.
3
Während in Deutschland ein Tief das andere jagte, herrschte im November an der Costa del Sol schönstes Sonnenwetter bei 25 Grad. Ich hatte oberhalb von Torrox Costa, im sogenannten Campo, ein kleines Haus gemietet mit einer Terrasse und Garten. Von dort blickte ich auf das Mittelmeer. An ganz klaren Tagen konnte man fern am Horizont das Riffgebirge von Marokko sehen. Hinter mir, in der Ferne, lag die Bergkette der Sierre Almijara, die mit ihrer höchsten Erhebung, dem Navachica, auf über 1800 Meter kam.
Im Campo wurden Obst und Gemüse angebaut. Zum Beispiel Mangos, Apfelsinen, Zitronen, Avocados, Oliven, Paprika, Gurken, Tomaten und was weiß ich noch. Die Gewächshäuser waren mit Plastikplanen überzogen, was jedoch der Idylle meines Hochsitzes keinen Abbruch tat. Da konnte man eher über die Schönheit der Häuserblocks, die unten die Strandpromenade säumten, streiten. Aber stand ich auf der Terrasse, war der Himmel bis zum Horizont frei, hatte meist ein makelloses Blau und ein euphorisierendes Licht. Enge Sträßchen zogen sich durch das Campo. Die Kurven musste man behutsam angehen. Kam ein Farmer mit Traktor oder Pickup entgegen, waren geschickte Manöver notwendig. In früheren Zeiten zog sich das Ackerland bis dorthin, wo jetzt die Häuserblocks mit Hotels, Restaurants und Bars stehen, und im Campo selbst hatten Esel oder Maultiere für den Transport zu sorgen.
Unten an der Strandpromenade von Torrox Costa hielt ich mich selten auf. Ich bin zwar auch in die Jahre gekommen. Aber die gigantische Versammlung geflohener Rentner dort, die meisten kamen aus Deutschland, schlug mir irgendwie aufs Gemüt. Ich hielt mich lieber an einfache typisch spanische Bars oder Cafés, die abseits des touristischen Trubels lagen. Und so hatte ich zum Glück nach ein paar Tagen die Bar La Mula, die Eselsbar, entdeckt. Sie lag nur fünf Fußminuten von meinem Häuschen entfernt etwas versteckt unten am Campo, wo die Straße von Torrox Costa nach Torrox Pueblo verläuft. Es war eine ganz einfache, aber gemütliche Bar. Innen mit einer kleinen Theke, draußen mit einer von Wellblech überdachten Terrasse. Bereits um sechs Uhr morgens kamen die ersten Farmer, tranken ihren Schnaps oder Kaffee, begaben sich danach zu ihrer Arbeit. Gegen Mittag oder auch am Nachmittag fanden sich ein paar Deutsche ein, die auch in der Umgebung wohnten. Die Bar lag günstig wie eine Karawanenstation an der Seidenstraße und war Umschlagspunkt für die neuesten Nachrichten und allerlei Klatsch, an dem es in Torrox nie mangelte. Wer mit wem, wer hatte sich wieder getrennt, wen hatte man mit der Schubkarre von irgendwo nach Hause bringen müssen. Man brauchte keine Zeitung. Hier erfuhr man, was im Ort los war.
Ab und zu erschienen recht muntere Damen. So zum Beispiel die achtzigjährige Greta, die einen zwanzigjährigen Hippi aus einer Höhle aufgesammelt hatte und freudestrahlend mitteilte: „Ei, wie tanzen meine Hormone wieder!“ Sie trug ein Strohhütchen mit einer Indianerfeder, einen geblümten Rock, der bis an die Knöchel reichte, und hatte goldene Ohrringe, auf denen Papageien hätten schaukeln können. Abgesehen von meiner Skepsis gegenüber der Dauerhaftigkeit der Liebe wollte ich es in meinem Alter mit dem jungen Hippi nicht aufnehmen, klatschte aber innerlich Beifall darüber, dass die alte Dame statt im Altersheim zu vertrotteln sich noch einmal auf Abenteuertour begeben hatte. Greta tauchte allerdings nur selten in der Bar La Mula auf. Sie hatte zu Hause genug zu tun.
Ein anderer Fall war Frieda. Sie war schon 82, hatte auf einer Hüpfburg am Strand ihre Jugendlichkeit erproben wollen, sich dabei das Becken gebrochen und kam nun, während der Zeit der Rekonvaleszenz, mit dem Rollator in die Mula-Bar. Als ich sie einmal fragte: „Wie geht es deinem Mann?“ sagte sie nur: „Weiß ich nicht. Meine Augen sind Gott sei Dank schwächer geworden.“
4
Mit meinem Häuschen im Campo war ich recht zufrieden. Die Wohnfläche, also ohne Terrasse und Garten, betrug etwa 60 Quadratmeter. Es gab ein großes Wohnzimmer mit gemütlichem Kamin und einer Küchenzeile, ein Schlafzimmer mit geräumigem Doppelbett, ein Bad mit Dusche. Das alles für 400 Euro im Monat. Sogar ein Fernseher, der deutsche Programme empfing, war dabei. Aber das in die Ferne Sehen richtete ich mir anders ein. Ich hatte keine Lust auf die ewigen Krimis, den Dauertotschlag, der zu einer Manie geworden war, keine Lust auch auf Nachrichten und Krisen. So saß ich abends lieber in einer von Bougainvillea umrahmten Gartenlaube, die zum Grundstück dazugehörte und sah mir den Sonnenuntergang Richtung Málaga an. Wenn der Abendhimmel sich gelb und rot färbte und in der dunkler werdenden Dämmerung die Venus als erster und hellster Stern erschien. Unten in Torrox gingen die Lichter an. Die weißen Wände der Laube entlang huschten lautlos Geckos, die jetzt zum Abend aus ihren Verstecken gekommen waren. Ich genoss die friedliche Stimmung bei einem Glas Rotwein, drehte mir eine Zigarette und beobachtete, wie Stern um Stern am Firmament erschien. Manchmal, wenn es noch dunkel war, stand ich auch frühmorgens auf und blickte hoch zum Großen Wagen, der zu dieser Zeit genau über dem Haus stand. Diese Formation mit ihren sieben Sternen hatte etwas Beruhigendes, Besänftigendes, ja sogar Zeichenhaftes, als stünde hinter dem Universum nicht ein seltsamer Urknall, sondern ein Gott, der das alles erschaffen hatte. Ich sprach dann nicht mehr von einem Universum, sondern von einem Kosmos. Über Gott und das Leben nachzudenken, hielt ich allerdings für sinnlos, da man das mit dem Verstand nicht ergründen kann und letztlich beim Satz des Sokrates landet: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Die Ratio erleidet Schiffbruch, scheitert an einem Mysterium. Angenehmer war es, über das Naheliegende nachzudenken. So schön und friedlich die Abende auch waren, stellte ich mir insgeheim doch vor, die Schönheit dieser Augenblicke mit jemandem zu teilen, und ich ertappte mich einmal dabei, als gerade die Venus mit der Mondsichel aufzog, bei dem Spruch:
„Herr, schenke mir ein Weib!“
Sogleich aber verwarf ich diesen albernen Gedanken und sagte mir: „Max, bescheide dich mit dem, was du hast! Niemand stört deine Ruhe, nimmt dir den Frieden. Du kannst ins Bett gehen, wann immer du willst. Du kannst aufstehen, wenn dir danach ist. Du kannst die ganze Flasche Rotwein leeren, ohne dass jemand meckert und den Gesundheitsapostel spielt. Du kannst qualmen wie dein Kamin im Zimmer und musst kein Naserümpfen und besorgte Blicke befürchten. Du kannst sogar in voller Tageskleidung abends ins Bett gehen, so dass das Aufstehen am Morgen bequemer ist. Und außerdem weißt du ja, dass die Liebe ein romantischer Mythos ist, der letztlich nur Kummer bringt. Denke an den Kongopaul! Der ist in zwei oder drei Monaten wieder auf der Flucht. So schön kann keine Frau sein, um immer wieder fliehen zu müssen.“
Je länger ich aber in Spanien lebte, desto öfter ertappte ich mich bei diesem unbequemen Wunsch. Mag sein, dass es an der euphorisierenden Wirkung des Lichts lag, vielleicht aber auch an einer drohenden Langeweile. Irgendwann waren alle Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung gemacht. Nach Nerja, Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba und in die weißen Dörfer des Berglandes. Der Bücherstapel, den ich mir mitgebracht hatte, wäre auch bald durchgelesen, und der Schachcomputer, mit dem ich spielte, wiederholte immer dieselben dummen Fehler. Das „Schachmatt“ des eingebauten Lautsprechers kannte ich schon zur Genüge, und die freundliche Stimme, die dann beim Ausschalten sagte „Auf Wiedersehen!“ erheiterte mich nicht mehr. Aber sollte ich mich deswegen in verhängnisvolle erotische Abenteuer stürzen? „Nein, Max!“ sagte ich mir. „Du hast einen Knall. Die Liebe bringt nur Kummer.“
5
Es gibt es tatsächlich. Dieses Buch ‚Die Flucht vor dem Weib‘. Es ist von einem kanadischen Psychologen. Karl Stern heißt er. Ich war vor Jahrzehnten zufällig darauf gestoßen, hatte 50 Exemplare bestellt und meiner Kundschaft – es waren hauptsächlich Frauen – das Werk wärmstens empfohlen. Mit dem Hinweis der Titel sei eine unglückliche Übersetzung aus dem Englischen. Eher müsste es heißen ‚Die Flucht vor der Weiblichkeit – Zur Pathologie des Zeitgeistes‘. Der Hinweis fruchtete nicht. Die Kundinnen schüttelten den Kopf, entrüsteten sich. „Was ist das für ein Idiot, der statt von einer Frau von einem Weib spricht! Und das bei einem Buchtitel! Nein danke, Herr Winter! Können Sie nicht etwas anderes empfehlen?“ Ich versuchte zu erklären: „Weib ist hier als Elementarbegriff gemeint. So wie Sonne, Mond und Sterne. Es sind spannende Untersuchungen des Fluchtverhaltens von Goethe, Nietzsche, Descartes und vielen anderen. Casanova ist auch dabei. Außerdem betrifft die Pathologie beide, nämlich Mann und Frau. Es richtet sich vor allem gegen Stress und andere Unarten unserer Zivilisation. Das Buch könnte auch heißen ‚Indianer waren glücklicher‘.“
Meine Erklärungen halfen nicht. Innerhalb eines Jahres hatte ich nur fünf Exemplare verkauft und fünf Stammkundinnen verloren. Die restlichen Exemplare schickte ich an den Verlag zurück mit dem tröstenden Hinweis: „Ein wunderbares Buch, aber niemand will es haben.“ Auch die männliche Kundschaft, die erheblich kleiner war als die weibliche, hatte sich nicht dafür interessiert. Es gab nur abweisende Kommentare. „Herr Winter, ich lese nur Bücher, die ich verstehen kann.“ Oder mit Kopfschütteln:
„Ich hab‘ mit meiner Alten genug zu tun. Da muss ich nicht noch lesen, wie mies es anderen ergangen ist.“
Es ist das Schicksal eines Buchhändlers. 90 Prozent der Bücher, die über die Ladentheke gehen, sind Schund und man müsste den Baum beweinen, der für das Papier sein Leben gegeben hat. ‚Feuchtgebiete‘ habe ich in drei Monaten 800 Mal verkauft. Schillers ‚Räuber‘ in einem Jahr nur einmal. Aber die goldene Regel bei meinem Handwerk ist: „Mische dich nicht ein in den Geschmack deines Publikums!“ Und so schob ich mit einem freundlichen Lächeln die ‚Feuchtgebiete‘ über die Theke und antwortete auf die Frage „Wie finden Sie das Buch, Herr Winter?“ lakonisch: „Da müssen Sie sich selbst ein Urteil bilden. Ich verkaufe nur.“
Warmherziger und ausführlicher war mein Kommentar bei Hape Kerkelings ‚Ich bin dann mal weg‘. „Ein schönes Buch“, sagte ich. „Amüsant und tiefsinnig. Sie werden viel Freude daran haben.“ Es war sogar ein Buch mit Wirkung. Fünf meiner Kundinnen machten sich auf den Weg nach Santiago. Sie kamen begeistert zurück und meinten: „Herr Winter, das müssen Sie auch machen!“ Ich schüttelte bedauernd den Kopf, entgegnete: „Wer kümmert sich in der Zeit um die Buchhandlung? Nein, leider geht das nicht.“ In Wirklichkeit war der Buchladen nur ein vorgeschobener Grund. Mir war der Rummel um den Jakobsweg zuwider. Shirley McLaine hatte sich unterwegs erinnert, mit Karl dem Großen geschlafen zu haben. Coelho hatte einen Engel auf einer Kirchturmspitze gesehen und Santiago de Compostela, das Ziel des Weges, wurde mehr und mehr zu einem Kirmesplatz. Das war die Tragik aller berühmten Wallfahrtsorte. Allein der Hape hatte den notwendigen Humor gehabt, mit dem man von einem solchen Unternehmen erzählen kann. Nein, was mich betrifft, ich muss mir nicht die Füße wundlaufen, um fromm zu sein oder mich selbst zu finden. Auf meiner Fahrt nach Spanien, ich hatte mir dafür acht Tage Zeit gelassen, hatte ich hinter Lyon die Autobahn verlassen, war durch die Auvergne gefahren und die Landschaft des Aubrac, hatte in den Dörfern alte romanische Kirchen besucht. Da war mir still und warm ums Herz geworden. Nein, ich brauchte keinen Jakobsweg. Und was das Buch betrifft ‚Die Flucht vor dem Weib‘: Ein Exemplar habe ich behalten und lese ab und zu darin.
6
Mein Häuschen war schlicht und einfach, ein Cortijo eben, ein kleines Landhaus, das den Farmern oft auch als Geräteschuppen gedient hatte. Aber an der Haustüre hing zum Klingeln eine kunstvoll gegossene Schiffsglocke aus Bronze. Zog man an einem Strang, ertönte sie in einem lange nachhallenden C-Dur. Auf einem Messingschild über der Glocke war die Inschrift zu lesen „Vocem meam audi!“ – „Höre meine Stimme!“ Aber niemand zog an meiner Glocke. Ich bekam keinen Besuch. Wie auch! Neue Bekanntschaften oder Freundschaften zu schließen brauchte seine Zeit. Zwar kannte ich mittlerweile einige Leute, die sich regelmäßig in der Bar La Mula einfanden, mit Namen, aber es blieb meist bei einer netten Plauderei. Einen Schachpartner fand ich nicht, selbst eine Skatrunde kam nicht zustande. So begnügte ich mich, was das Spielen betraf, weiterhin mit meinem Computer, den ich schon auf die höchste Spielstufe eingestellt hatte und den ich, wenn ich nicht zu unaufmerksam war, regelmäßig mattsetzte. Das freundliche „Auf Wiedersehen!“ des Gerätes beim Ausschalten ging mir schon auf die Nerven. Aber was sollte ich tun? Ich hatte nichts anderes. So spielte ich täglich mit meinem Computer, brummte „Halt die Klappe!“, wenn ich ihn nach dem Matt ausschaltete, baute aber am nächsten Tag die Figuren wieder auf. In Rente zu gehen und nichts zu tun, war nicht so einfach. So lange man im Arbeitsprozess steckt, sehnt