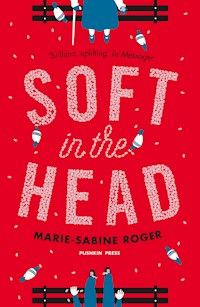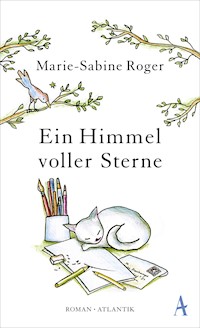Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist Mortimers 36. Geburtstag, und er wird sterben. So wie alle Männer aus seiner Familie mit 36 gestorben sind. Doch als Mortimer abends immer noch lebt, wird ihm klar: Der Fluch hat ihn verschont. Doch was nun? Sein Job und seine Wohnung sind gekündigt, und bisher hat er keine Ziele oder Ambitionen gehabt. Plötzlich muss er lernen zu leben! Dabei helfen ihm Paquita und Nassardine vom Crêpe-Stand an der Ecke. Und zum Glück ist da auch noch Jasmine, die manchmal auf Parkbänken sitzt und weint, damit es den Menschen besser geht ... Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte über den Sinn des Lebens.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie-Sabine Roger
Heute beginnt der Rest des Lebens
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
Atlantik
Für Samuel, Meltem und Mila
Für Antoine und Marion
Für Cécile
Morty stirbt
Man kann noch so sehr versuchen, das Unvorhersehbare vorherzusehen, es kommt immer etwas dazwischen, und zwar zum denkbar unpassendsten Zeitpunkt: Ich war gerade im Begriff zu sterben.
Sterben gehört zu den besonders intimen Momenten, bei denen man keine Zeugen gebrauchen kann.
Ich hatte mich lange auf diese letzten Augenblicke vorbereitet. Mein Mietvertrag war zum Monatsende gekündigt. Ich hatte geputzt, den Müll runtergebracht, Vorratsschränke und Kühlschrank geleert, Fenster und Böden ordentlich geputzt. Nach meinem Morgenkaffee hatte ich Gas und Strom abgestellt.
Meine Papiere waren alle in Ordnung. Ich konnte in Ruhe abtreten.
Zur Feier des Tages hatte ich mir sogar einen Traueranzug gekauft, samt passendem Hemd und Schuhen. Ich hatte nicht an Dunklem und Schwarzem gespart. Was die Socken anging, war mir die Entscheidung schwerer gefallen. Gemustert, mit diskreten Streifen? Nach langem Hin und Her hatte ich mir eine kleine Extravaganz geleistet: rote und gelbe Bärchen, Andy-Warhol-mäßig geklont, auf einem Hintergrund von ewigem Schnee.
Wenn schon sterben, dann wenigstens gut bestrumpft.
Ich liebte diese Socken.
Ich war früher aufgestanden als sonst. Schon um sechs Uhr. Es war ein bedeutender Tag, und ich wusste, dass ich sein Ende nicht erleben würde.
Ich holte mir beim Bäcker Croissants und kochte Kaffee. Ich blätterte meine Fotoalben durch. Ich wischte noch mal über meinen blitzblanken Herd, versuchte, mir einen Film anzuschauen, zu lesen – ohne Erfolg. Ich schaute zweihundertmal auf die Wanduhr. Es ist eigenartig, wie die Zeit sich zu verlangsamen scheint, wenn man auf etwas wartet. Die Stunden werden zähflüssig, die Minuten ziehen sich gummiartig dahin, klebrig wie ein langer Speichelfaden, der aus einem Hundemaul rinnt. Ich wartete schon so lange auf diesen Endpunkt. Dass ich mich freute, wäre wohl zu viel gesagt, aber ich war neugierig, was passieren würde. Ich ärgerte mich nur ein bisschen, dass es hier passierte. Im Laufe der letzten Jahre hatte ich mir tausend ausgefallene bis großartige Möglichkeiten ausgemalt: den Abgang in einer Opiumhöhle im tiefsten China zu machen. Zu den Klängen eines alten Didgeridoos bei den Aborigines. An den Hängen eines Vulkans. In den Armen von Jasmine im Herzen Manhattans. Natürlich hatte ich für all das nichts getan. Wie es meine Art war, hatte ich meine Zeit vertrödelt und die Wahl meines letzten Reiseziels immer auf den nächsten Tag verschoben. Mit dem Ergebnis, dass ich keinerlei Entscheidung getroffen hatte und wie Hinz und Kunz daheim sterben würde. Dieser letzte Vormittag war sehr enttäuschend, ich konnte sein Ende kaum erwarten.
Fünfzig Minuten vor der vorgesehenen Zeit legte ich mich, da ich nichts mehr mit mir anzufangen wusste und mich langsam ernsthaft langweilte, auf meine Schlafcouch, um mich etwas zu entspannen, in der berühmten »Totenstellung«, die allen Verstorbenen wie auch allen Yoga-Adepten wohlvertraut ist – Letzteres war ich seit drei Wochen. Handflächen Richtung Himmel geöffnet, Beine leicht gespreizt, Fußspitzen locker nach außen fallend, Zwerchfell entspannt, Atem langsam und ruhig fließend, die Augen starr auf die verdammte Wanduhr über der Abzugshaube gerichtet, die meinem Bett direkt gegenüber hing und nicht aufhören wollte, an meinen restlichen Sekunden zu nagen, mit der Diskretion einer alten Dame, deren Gebiss mit einem trockenen Brotkanten kämpft.
Es war schon zehn Uhr zwölf.
Um zehn Uhr dreizehn klopfte es energisch an der Tür, die gleich darauf aufflog und sofort wieder zuknallte. Wusste ich doch, dass ich etwas vergessen hatte: Ich hatte nicht daran gedacht, den Riegel vorzuschieben.
»Liegst du noch im Bett, du Faultier?«, rief mir Paquita zu, während sie flink durch meine Einzimmerwohnung lief wie eine dralle Antilope, die auf zwölf Zentimeter hohen Absätzen zum Wasserloch trippelt. Sie warf ihren Kunstpelz auf mein Bett, dann trat sie hinter die Theke, die die Küchenecke von meinem Wohn-Schlaf-Arbeitszimmer trennt. Paquita ist überall zu Hause, vor allem, wenn sie bei mir ist. Sie gehört zu diesen überaus elastischen Menschen, die sofort jeden Raum ausfüllen, ganz egal, wie groß er ist.
Sie fragte: »Weißt du, dass deine Klingel nicht geht?«
Klar, ich habe selber den Strom abgestellt.
Sie streifte mich mit dem Blick, und da war ihr doch eine leichte Überraschung anzumerken: »Schläfst du neuerdings im Anzug?«
Dann: »Was sind das denn für Socken? Warst du beim Roten Kreuz shoppen oder wie?«
Sie lachte über ihren eigenen Witz. In Sachen Humor ist sie nicht besonders anspruchsvoll.
Sie nahm eine Tasse aus dem Küchenschrank und meinte: »Ich hoffe, du hast noch Kaffee übrig? Ah, ja, Glück gehabt!«
Dann: »Na, du hast aber aufgeräumt! Hast dir wohl eine Freundin zum Valentinstag eingeladen, du alter Schlawiner?«
Nein.
Dann: »Dein Herd funktioniert ja auch nicht! Bei dir ist wohl eine Sicherung durchgebrannt, wie?«
Ich nehme an, ja. Bestimmt schon vor einer ganzen Weile.
Und dann: »Ist nicht schlimm, er ist noch warm.«
Und sofort darauf: »Himmel! Dein Kühlschrank ist ja leer wie die Wüste von Colorado, Schätzchen! Wenn Wind aufkommt, fegen da Graskugeln durch, wie im Western!«
Wohl kaum, die besagten »Graskugeln«, genannt tumbleweeds oder auch Steppenläufer – mit echtem Namen Salsola tragus –, sind nämlich überwiegend in den Wüsten des Nordens der Vereinigten Staaten zu finden und nicht in Colorado.
Im übrigen weht in einem Kühlschrank nie Wind. Vollkommen hirnrissig.
Aber Widerspruch ist zwecklos, Paquita hört selten zu, wenn man ihr etwas sagt. Ich habe nichts richtiggestellt, weder in Sachen Botanik noch in Bezug auf meine Kleiderwahl.
Ich liebte diese Socken. Punkt.
Und sie war sicher nicht die Richtige, um mich in Kleidungsfragen zu beraten: Paquita läuft herum wie eine Nutte. Das sage ich ohne jede Geringschätzung, das war ihre erste Berufung, und ich habe Respekt vor allen, die ein Lebensziel haben. Aber man macht eben nicht immer, was man gern gewollt hätte. Nassardine hat sie vom Strich geholt, bevor sie dort Fuß fassen konnte. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich hätte sie gern erzählt, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte.
Na gut, ich erzähle sie doch
Ich kenne Paquita und Nassardine seit über zwanzig Jahren. Paquita muss mir an die hundert Mal erzählt haben, wie sie sich begegnet sind, während Nassardine mit feuchten Hundeaugen dazu nickte und ihr an den ergreifenden Stellen die Hand tätschelte.
Es war im Frühling, mitten auf dem Rummel.
Paquita war siebzehn, sie arbeitete als Kellnerin – noch nicht mehr als das, aber es zeichnete sich schon ab – in einer Bar mit Wettbüro, die sich allmählich zum Puff entwickelte. Der Wirt war ehrgeizig, er schickte seine Frau und seine Töchter auf den Strich und träumte davon, seinen Stall zu vergrößern, um sein kleines Geschäft auszuweiten. Paquita brachte die idealen Voraussetzungen mit. Sie war ausdauernd, fröhlich, fleißig. Sie hatte einen umwerfenden Hintern und einen schwindelerregenden Vorbau. Außerdem war sie nicht schüchtern, und Ende des Sommers wäre sie volljährig. Lauter wertvolle und sogar unabdingbare Eigenschaften für ein Mädchen, das es in der Branche zu etwas bringen will.
Vor ihr lag eine strahlende Zukunft, wenn sie dem Wirt glauben wollte, der sie »mein Pferdchen« nannte und ihren Hintern begrapschte, um die Qualität seiner Ware zu überprüfen.
Nassardine war neunzehn. Er arbeitete auf einer Baustelle ganz in der Nähe. Sechs Monate zuvor war er mit dem Schiff aus Algerien gekommen und bekam nun zehnmal am Tag die Drohung zu hören, dass er dorthin zurückschwimmen konnte, wenn er nicht spurte. Er schlief in einem Gastarbeiterheim, zusammen mit lauter nostalgischen alten Nordafrikanern, die seit fünfzehn Jahren da lebten, ohne ihre Familie wiedergesehen zu haben, und sich die Zeit mit Schachspielen und Shisha-Rauchen vertrieben.
Wenn er nicht arbeitete, lief er aufs Geratewohl durch die Stadt, mit hellwachem Blick, wiegenden Schrittes, die Hände in den Taschen, zugleich schüchtern und selbstbewusst.
Als er an jenem Abend auf dem Rummel aufkreuzte, sah er zwischen den Süßigkeitenbuden und den orgelnden Karussells nur sie: Paquita. Ihre Marilyn-blonden Haare, ihren Atombusen, ihre Absätze wie Stelzen und dieses leichte Schwingen der Hüften, das ihren hübschen Stutenhintern sanft hin und her wogen ließ. Sie lief langsam zwischen den Ständen hindurch und turtelte mit dem Allerwertesten, ohne den liebestollen Soldaten, die sich hinter ihr her drängten, die geringste Beachtung zu schenken.
Nassardine stand wie vom Blitz getroffen da und sah zu, wie Paquita, an ihrem Liebesapfel leckend, auf ihn zukam. Als sie bei ihm angelangt war und so nah bei ihm stand, dass sie ihn fast berührte, blickte sie mit ihren schönen, großen, kurzsichtigen Augen auf ihn herab.
Nassardine betrachtete sie wie vom Donner gerührt, ohne ein Wort herauszubringen, das Gesicht zu dieser Erscheinung auf Stöckelschuhen erhoben, mit dem leicht dämlichen Blick junger Hirtinnen, denen plötzlich am Wegrand die Jungfrau Maria erscheint.
Nassardine war von der Gnade berührt worden. Nicht nur von dem wunderbaren Körper, der den Mittelseiten eines Männermagazins würdig wäre, sondern auch von den leuchtenden, vertrauensvollen, großen grünen Augen. Den sanften Augen einer Mutter oder eines kleinen Mädchens.
Und Paquita ihrerseits hatte in ihm nicht den mittellosen Einwanderer gesehen, der in der sinnlosen Hoffnung, ein Mädchen zu finden, einsam herumirrte, sondern einen Mann aus der Wüste, einen schönen wilden Krieger mit dunkelbraunen Augen, wärmer als eine Tasse Schokolade.
An der Stelle der Geschichte wird Paquita gewöhnlich heiser, und Nassardine putzt sich die Nase. Sie erinnern sich beide nicht mehr, was sie an dem Abend zueinander gesagt haben, da ist nichts zu machen. Sie wissen nur, dass sie Achterbahn und Autoscooter gefahren sind, ohne dabei auch nur eine Sekunde den Blick voneinander abzuwenden. Er hat ihr an der Schießbude einen großen Plüschhund geschossen, er hat seinen Lohn verjubelt und sein Herz verloren. Sie hat sich in ihn verliebt und schwebte plötzlich hoch über den Wolken. Seitdem hängt sie an seinem Arm.
Heute ist Paquita siebenundfünfzig und läuft immer noch herum wie eine Nutte, aus alter Gewohnheit und weil es ihr eben gefällt, aber man darf sich nicht täuschen lassen. Das Kleid macht keinen Mönch, genauso wenig, wie es eine Hure macht. Es gibt keinen treueren, keinen liebevolleren Menschen als sie.
Auch keinen eifersüchtigeren.
Abgesehen von den Kindern, die sie nie bekommen hat – der einzige Kummer ihres Lebens –, ist sie eine strahlende Frau. Und er, der mit seiner ausgebeulten Hose, seiner Anzugjacke mit den etwas zu langen Ärmeln, den gepolsterten Schultern und seinem Dreitagebart aussieht wie ein alter Araber aus dem Bilderbuch, ist der glücklichste Mensch der Welt, und der stolzeste. Er erzählt jedem, der es hören will, dass man sich vor ihm hüten solle, er sei ein gefährlicher Terrorist.
Und wenn man ihn fragt, warum, antwortet er verschmitzt: »Na, weil ich jeden Abend – hamdulillah! – eine Bombe in meinem Bett habe!«
Auch wenn die »Bombe« sich in einen dicken Knallfrosch mit zu kurzem Rock verwandelt hat – Nassardine sieht Paquita so, wie sie mit siebzehn war. Sie ist sein Wunder geblieben, seine Göttin, und nur darauf kommt es an.
Und wenn Paquita ihren Liebsten betrachtet, bemerkt sie weder die weißen Haare in seinem Bart noch die tiefen Falten oder die Stirnglatze. Sie sieht den schönen Algerier mit den glühenden dunklen Augen, dem sie damals vor der Süßigkeitenbude auf den ersten Blick verfallen ist.
Das alte Liebespaar vom Rummel ist nie wieder vom Karussell heruntergekommen. Zwei echte Glückspilze. Die Zeit vergeht, aber für sie spielt die Jahrmarktsorgel von morgens bis abends.
Und nun saß Paquita also auf meinem Barhocker, ein Bein in der Luft baumelnd, das andere graziös unter den Hintern geklemmt, wie ein dicker Flamingo mit Stringtanga, das konnte ich mühelos erkennen.
Paquita ist eine unwahrscheinliche Erscheinung. Ich habe mich daran gewöhnt, und wenn ich sie in einem knielangen Rock oder einem brav bis zum Hals zugeknöpften Oberteil sähe, dann würde mich das mehr schockieren, als sie wie immer aufgetakelt wie eine Fregatte auf Anschaffe zu sehen. Man kann nicht mal sagen, dass sie vulgär ist, nein, sie bewegt sich in einer anderen Dimension. Niemand anderes als sie könnte sich in ihrem Alter so aufbrezeln (abgesehen von ein paar Kleinbürgerinnen und pensionierten Huren).
Paquita ist unbeschreiblich. Sie ist rührend mit ihren Kilos und ihren Falten, ihren vor Tusche starrenden Wimpern, den zu kurzen Röcken und den Dekolletés, die ihrem absackenden Busen immer tiefer nach unten folgen. Wenn man sie sieht, weiß man sofort, dass sie arglos ist und das Leben liebt. Man spürt, dass sie jeden Moment alles stehen und liegen lassen könnte, um jemandem in Not zu helfen, außer vielleicht – aber weiß man’s? – einem schamlosen kleinen Luder, das ihrem geliebten Nassar zugezwinkert haben könnte.
Es gibt solche Leute. Die nichts Schlechtes in sich haben, nichts Schäbiges, nur ein paar kindliche Fehler – schusselig, unaufmerksam, leichtgläubig, voller Hoffnung, besitzergreifend, kapriziös. Zu aufrichtig.
Sie würde mir fehlen, wenn ich nicht mehr da wäre, meine prachtvolle Pâquerette-Tausendschön.
Vorerst aber trank sie unter lustvollen Grimassen und Seufzern meinen lauwarmen Kaffee.
»Aaaah! Du weißt wenigstens, wie man Kaffee kocht! Nicht wie Nassar!«
Das verdient, glaube ich, eine kurze Abschweifung.
Kurze Abschweifung
Als Nassardine sie kennenlernte, hatte Paquita zwei Talente: Sie war sehr gut im Bett, und sie konnte bretonische Crêpes backen. Da ausgemacht war, dass ihre erste Fähigkeit fortan ausschließlich ihrem Mann vorbehalten sein würde, galt es nun, ihre zweite Gabe zu nutzen.
Nassardine, der zu Recht misstrauisch war, hatte ihr nahegelegt, ihre Stelle als Kellnerin schnellstmöglich aufzugeben. Sie hatte also gekündigt, zum großen Verdruss von Monsieur Jeannot, der ihr das sehr übel genommen und noch auf dem Gehweg hinter ihr her geschrien hatte – dieses undankbare Miststück, das nicht kapierte, welche Chance er ihr bot, diese Schlampe, die sich weigerte, sich um die Kunden zu kümmern, und ihn einfach sitzenließ, und das alles wegen eines Kameltreibers!
Paquita war fröhlich, nett und arbeitswillig. Sie fand schnell einen Job in einer Crêperie am anderen Ende der Stadt. Sie nahm jeden Morgen den Bus und kehrte spätabends zu ihrem Nassar heim, der ebenfalls hart arbeitete und jede Menge Überstunden machte. Denn sie hatten ein gemeinsames Projekt. Ein schönes Projekt: Sie wollten sich einen Lieferwagen anschaffen und auf Frankreichs Straßen Crêpes verkaufen, vielleicht sogar über Frankreichs Grenzen hinaus.
Aber ein Lieferwagen kostet Geld.
Wenn es in dem Tempo weiterginge, hätten sie erst in zwanzig Jahren genug zusammengekratzt. Und wenn man zwanzig ist, sind zwanzig Jahre eine Ewigkeit. Da hatte Paquita beschlossen, ihre Eltern, die sich nie viel um sie gekümmert hatten, um Hilfe zu bitten. Eines Sonntagmorgens hatte Nassardine sich frisch rasiert, seine Ringellöckchen mit Pomade gezähmt und seinen besten (und einzigen) Anzug angezogen. Paquita hatte sich so schön gemacht, dass sie auf der Straße Tumulte hätte auslösen können. Und so waren sie Hand in Hand zu ihren Eltern gegangen.
Als sie ankamen, hängte ihre Mutter im Garten Wäsche auf, und ihr Vater bastelte am Motor seines Autos herum. Nassardine hatte Anweisung, am Gartentor auf seine Liebste zu warten. Er lehnte sich neben dem Briefkasten an die Mauer und drehte sich mit leicht zitternden Händen, klopfendem Herzen und weit aufgesperrten Ohren eine Zigarette.
Er sollte sich erst auf ihr Zeichen hin zeigen. Es sollte eine Überraschung werden.
Fröhlich und bewegt verkündete Paquita ihren Eltern, sie habe einen Liebsten, einen echten. Nein, nicht Johnny, auch nicht Juju oder Paulo, einen anderen, den sie noch nicht kannten. Aber sie hoffe von ganzem Herzen, dass sie ihn genauso lieben würden wie sie.
Ohne die Nase aus der Motorhaube zu heben, brummte ihr Vater: »Pah, wir haben uns an die anderen gewöhnt, da werden wir uns an den da auch gewöhnen. Solange du uns keinen Araber nach Hause bringst …«
»Ach, was du immer daherredest!«, meinte ihre Mutter darauf lachend, hinter der Bettwäsche hervor. »Einen Araber! Du hast Ideen, nee, also echt …!«
Nassardine setzte einen gleichgültigen Ausdruck auf und ging vor sich hin pfeifend davon. Zweihundert Meter weiter, an der Bushaltestelle, wartete er auf seine Liebste. Da fand sie ihn wieder, sie war in Tränen aufgelöst. Nassardine tröstete sie, sie würden es auch ohne die Familie schaffen. Er war nicht wirklich überrascht, seinen Eltern hätte es auch nicht gefallen, ihn mit einer Französin zu sehen.
So ist das Leben.
Sie arbeiteten etwas mehr, viel mehr, und schließlich kauften sie ihn, ihren Lieferwagen. Ganz alleine, ohne jede Unterstützung. Es war ein rostiger alter Peugeot J7, den Nassardine an Wochenenden und Feiertagen überholte und zur Crêperie umrüstete. Sie strichen ihn kunterbunt an und tauften ihn Chez Pâquerette, zu Ehren Paquitas, denn Pâquerette – Tausendschön – war sein Kosename für sie. Da Benzin teuer ist und ihr Wagen mehr davon schluckte, als ein Kalb Milch trinkt, kamen sie nie sehr weit. Nicht viel weiter als bis zur Ecke gegenüber des Lycée Mistral. Da stehen sie nun seit bald dreißig Jahren Tag für Tag, und es gibt dort mit Abstand die besten Crêpes der Stadt – und den schlimmsten Kaffee.
Womit wir also beim Kaffee wären.
Seit ich Nassardine kenne, misslingt ihm der Kaffee mit erstaunlicher Konsequenz, was ihn nicht davon abbringt, seinen Traum unverzagt weiterzuverfolgen: den genauen Geschmack des legendären Kaffees wiederzuerschaffen, den sein Großvater kochte. Zumindest in seinen Erinnerungen.
Er hat dabei alle Stadien durchlaufen, vom Blümchenkaffee bis zur pechschwarzen Plörre. Paquita regt sich darüber nicht mehr auf. Sie kauft sich Instantkaffee, den sie aus ihrer persönlichen Tasse trinkt, einem bonbonrosa Schweinchen, das sie wie eine Prinzessin mit abgespreiztem kleinem Finger zierlich am Schwanz hält. Oder aber sie kommt, wann immer es geht, zum Kaffeetrinken zu mir.
Nur noch wenige Kunden lassen sich darauf ein, Versuchskaninchen zu spielen. Entweder sind es neue, die noch ahnungslos sind, oder aber solche, die schon wissen, was sie erwartet, die sich aber aufopfern, weil ihnen der Kaffee so nett angeboten wird, mit einem so hoffnungsvollen Blick …
»Sie trinken doch ein Käffchen, während Sie auf Ihre Crêpe warten? Doch, doch, es ist mir ein Vergnügen! Sie werden sehen, diesmal – hamdulillah! – habe ich den Dreh raus!«
Doch das ist nie – nie – der Fall.
Als Gegenleistung für ihren guten Willen setzt sich Nassardine dann manchmal auf den Tritt des Lieferwagens und liest ihnen aus dem Kaffeesatz, den er schwungvoll in die Untertasse kippt, die Zukunft. Und in Anbetracht der Kaffeemenge, die er in den Topf zu werfen pflegt, gibt es da immer genug Stoff zum Deuten und Erzählen. Die Kunden sitzen ihm gegenüber und spucken diskret die winzigen Körnchen aus, die zwischen ihren Zähnen knirschen, sie hören zu und tun, als würden sie ihm glauben, beugen sich über die Untertasse, die Nassardine mit scharfem Blick betrachtet. Er erzählt ihnen von Reisen, Aufbrüchen, Begegnungen, während Paquita sich am Herd zu schaffen macht. Er erfindet für jeden ein Traumleben, und das mit so viel Poesie und Überzeugung, dass jedes hässliche Entlein fühlt, wie es sich in einen Schwan verwandelt. Es ist zwar nur eine Kaffeesatzzukunft, gelesen aus einer Untertasse aus billigem, bruchsicherem Glas. Aber die Kunden hören zu und bekommen vielleicht sogar etwas Hoffnung. Und egal, wenn sie ihre Crêpe kalt essen – wenn sie wieder gehen, ist ihnen etwas wärmer ums Herz.
Paquita schaut ihnen nach, mit einem gerührten Lächeln für die Männer und einem gereizten Schulterzucken für die Frauen, vor allem, wenn sie jünger sind als sie, und das sind sie etwas zu oft. Sie liebt ihren ewigen Charmeur so sehr, dass sie die Macht seiner heißen Hände und seiner braunen Samtaugen für unwiderstehlich hält, wenn er ihnen lächelnd die Tasse aus den Händen nimmt. Sie meint Wimpern flattern, Augen flackern, geschminkte Wangen erröten zu sehen. Dann wirft sie ihrem Mann tödliche Blicke zu, verwünscht die liederlichen Frauenzimmer, schlägt wütend Eier zu Schnee und murrt vor sich hin.
»… Kaffeesatz, wer’s glaubt! Schwarz in Schwarz, was soll man da schon draus lesen können?«
Paquita hängt an ihrem Nassar.
Seit über vierzig Jahren schikaniert sie ihn, macht ihm Szenen, verfolgt ihn mit wilden, verliebten Blicken, sobald er ihr den Rücken kehrt, umschlingt ihn wie eine Efeuranke und spielt ihm Gleichgültigkeit vor, wenn er ihr sagt, dass er sie liebt. Und er, der alte Fuchs, nimmt ihre Launen hin, tröstet sie, wenn sie sich selbst dumm findet, verzeiht ihr alle Macken und liebt sie immer nur noch mehr.
Wenn sie könnte, würde sie alle Frauen von fünfzehn bis sechzig Jahren, die sich ihm nähern, umbringen. Doch das wäre ein sinnloses Gemetzel.
Denn Nassardine ist treu und unsterblich in sie verliebt.
Ich lag immer noch auf meiner Schlafcouch und traute mich nicht aufzustehen vor lauter Angst, irgendwo im Raum tot umzufallen. Paquita thronte auf meinem Barhocker wie eine Fettpflanze auf ihrem Zierständer und trank in aller Ruhe ihren Kaffee, während sie mir die letzten Neuigkeiten aus der Welt erzählte, von der Theke des Crêpe-Wagens aus gesehen.
Sie redet gern vom Tagesgeschehen. Auf ihre ganz persönliche Art, sie sortiert die Ereignisse nach eigenen Kriterien, wobei Klatsch und Tratsch mehr Bedeutung beigemessen wird als den großen Konflikten der Weltpolitik.
Für sie ist der arabische Frühling eine Touristensaison, genau wie der sibirische Winter. Und ich habe den Verdacht, dass sie glaubt, Europa sei ein Land – das schließe ich aus der Art, wie sie sagt: »Ich möchte gern irgendwann mal bis nach Europa kommen«, wenn sie von den Reisen spricht, die sie mit Nassardine gern unternehmen würde, wenn sie im Ruhestand sind. Das heißt, wenn sie bettelarm sein werden und sicher nicht in Urlaub fahren können. Aber fragt man sie nach Neuigkeiten aus der Welt der Stars und Promis, wer wen geheiratet hat, wer sich scheiden lässt und warum, wer sich welcher Schönheitsoperation unterzogen hat und bei welchen Chirurgen, wie viele Kilos welche Schauspielerin abgenommen hat – da ist sie unschlagbar.
Das gehört zu den Dingen, die mir im Jenseits fehlen werden – mal angenommen, dass einem da überhaupt noch etwas fehlen kann.
Apropos Jenseits: Es ging mir mehr und mehr gegen den Strich, dass Paquita in einer knappen halben Stunde aus nächster Nähe miterleben würde, wie ich abnippelte. Und ehrlich gesagt wäre ich auch lieber in Ruhe gestorben.
Die Zeit lief – zehn Uhr zweiunddreißig, Paquita plapperte vor sich hin, und plötzlich fragte sie mich: »Weißt du, was wir heute für einen Tag haben?«
Ich hätte antworten können: »mein Geburtstag«, da ich nun mal leider am 15. Februar geboren wurde. Aber ich habe das Datum nie irgendjemandem verraten wollen, wohl um zu vermeiden, dass man mich daran erinnerte. Ich antwortete: »Galileis Geburtstag?«
»Kenn ich nicht. Ist das eine Sängerin?«
Ich verzichtete darauf, sie aufzuklären, da ich eindeutig nicht mehr genug Zeit hatte, ihr einen Abriss der Geschichte der Mathematik, der Physik und der Astronomie zu liefern.
Ich fuhr also fort: »Der Jahrestag der Krönung von Ludwig dem Blinden? Von Mohammed Alis Niederlage gegen Leon Spinks? Nat King Coles Todestag?«
»Quatsch! Was Ernstes!«
»Der Jahrestag des Begräbnisses von Georg dem Sechsten?«
»Ach was! Los, weiter!«
»Keine Ahnung.«
»Heute ist der Geburtstag von Marisa Berenson!«
»Man sieht ihr ihr Alter nicht an«, meinte ich.
»Das stimmt«, seufzte Paquita, die nur Frauen bewundert, die entweder viel älter sind als sie oder sehr weit weg leben.
Sie stand auf, um ihre Tasse abzustellen, und redete weiter über alles und nichts (vor allem über nichts). Ich traute mich nicht, sie zu unterbrechen. Paquita zu unterbrechen ist das sicherste Mittel, den ganzen Tag zu verschenken. Wenn man sie unterbricht, verliert sie den Faden, und wenn sie den Faden verliert, fängt sie noch mal von vorne an. Und ich hatte nicht den ganzen Tag Zeit.
Doch da ich sie gut kenne, war mir auch klar, dass es nichts nützen würde, ihr zu sagen: »Entschuldige, ich muss um elf Uhr sterben, könntest du mich bitte allein lassen?«
Im schlimmsten Fall würde sie antworten: »O.k., kein Problem, ich komme später noch mal vorbei. Um wie viel Uhr passt es dir?«
Oder im besten Fall: »Was ist das denn für ein Blödsinn?«
Wie sollte ich ihr erklären, dass ich mich, so wie ich in meinem schönen Spießeranzug auf dem Bett lag, zum Sterben anschickte, weil wir den fünfzehnten Februar hatten, weil es bald elf Uhr schlagen würde, und weil der fünfzehnte Februar um elf Uhr genau der Tag und die Stunde meiner Geburt waren.
Und dieser Geburtstag war nicht irgendeiner: Es war der schicksalhafte.
»Ach so, das wusste ich ja gar nicht! Herzlichen Glückwunsch, Schätzchen!«
Danke.
»Das müssen wir dann feiern, mit Nassar.«
Das wird schwierig, ich muss in ungefähr zwanzig Minuten sterben. Tut mir leid.
»Ach so – dann kommst du nächsten Sonntag nicht zum Essen?«
Tja, nein.
»Das ist ja blöd.«
Tja, ja.
Nichts zu machen, ich fühlte mich nicht in der Lage, mich einem Gespräch dieser Art zu stellen.
Nicht, dass ich deprimiert gewesen wäre, ich war nicht unvorbereitet, ganz im Gegenteil. Ich hatte alle Zeit der Welt gehabt, mich an die Sache zu gewöhnen. Seit meiner frühesten Kindheit hat man mir die Familiensaga wieder und wieder erzählt. Nicht einfach nur erzählt, nein: Ich habe sie mit der Muttermilch eingesogen, Tropfen für Tropfen war sie mir mit jedem Fläschchen verabreicht, mit meinen ersten Breichen in mich hineingelöffelt worden, und dann hat mein Vater sie bei jeder Gelegenheit wiedergekäut, bis ich fast zwölf war.
Denn es ist so: Alle Männer meiner Familie – väterlicherseits, wohlgemerkt – sind um elf Uhr vormittags geboren. (Elf Uhr sechs, was meinen Vater angeht, aber in der Familie hatte man immer den Verdacht, dass die Wanduhr falsch ging oder dass mein Großvater verzweifelt versucht hatte, das Schicksal durch eine Mogelei in der Geburtsurkunde auszutricksen. Ich muss dazu ergänzen, dass mein Großvater am Tag der Geburt meines Vaters volltrunken war, so wie am vorigen, am vorvorigen und an allen anderen Tagen auch, und wie er es auch alle weiteren Tage in seinem kurzen Leben mehr oder weniger blieb. Dies könnte eine leichte Verzögerung zur Folge gehabt haben, was den Blick auf die Uhr anging, um die genaue Stunde der Geburt seines Sohnes festzuhalten – auch wenn er sie logischerweise geahnt haben musste … Aber das ist nur eine Theorie, ich weiß nichts mit Sicherheit.)
Egal, auf welches Datum ihre Geburt fiel, alle Männer meiner Familie sind also um elf Uhr früh geboren. Und das Amüsante ist: Alle, ohne jede Ausnahme, sind an ihrem sechsunddreißigsten Geburtstag um ebendiese Uhrzeit gestorben, noch bevor sie ihre Kerzen ausgeblasen und ihren Kuchen gegessen hatten, denn elf Uhr morgens ist eine ungünstige Zeit. Jedenfalls was den Nachtisch angeht. Und als wäre das nicht genug, sind sie alle auf saublöde Art umgekommen:
Mein Ururgroßvater Morvan ist in einem Bidet ertrunken.
Mein Urgroßvater Morin endete zu Konfetti zerfetzt.
Mein Großvater Maurice wurde wegen eines Esels vom Blitz erschlagen.
(An den erinnere ich mich noch. Nicht an meinen Großvater, den habe ich nicht mehr gekannt, aber an den Esel, einen kräftigen Poitou-Zuchtesel, dessen Erektionen eines Obelisken würdig waren und der meinen Großvater um zwanzig Jahre überlebte. Man sollte zehnjährige Jungen niemals brünstige Esel sehen lassen. Zu wissen, dass es so etwas gibt, untergräbt ihr Selbstwertgefühl für alle Zeiten.)
Und mein Vater, Maury, der Letzte in der Reihe, wurde von einem Luftballon getötet.
Der Letzte jedenfalls bis heute Vormittag elf Uhr, die Zeit, um die ich ihn, wie in der Familie seit einigen Generationen üblich, ablösen werde, indem ich meinerseits dahinscheide.
Ich war genau zwölf Jahre alt, als mein Vater starb. Dann stand ich alleine da. Meine Mutter war schon kurz nach meiner Geburt abgehauen, wahrscheinlich aus Angst, sonst sechsunddreißig Jahre ihres Lebens auf den Tod ihres Sohnes zu warten, um ihn danach zu beweinen – und das Ganze als Witwe. Ich konnte es ihr nicht verübeln.
Im übrigen gab es in der Beziehung meiner Eltern noch jede Menge andere Probleme. Das nehme ich jedenfalls an, denn ich glaube nicht, dass ich meinen Vater je anders von meiner Mutter habe reden hören als mit Bezeichnungen wie: »die Schlampe«, »das Miststück« und dergleichen mehr – wenn er überhaupt mal von ihr sprach, was selten und wenn dann gegen Ende eines feuchtfröhlichen Abends vorkam.