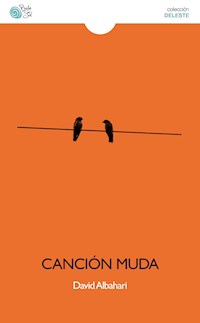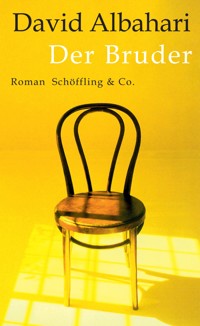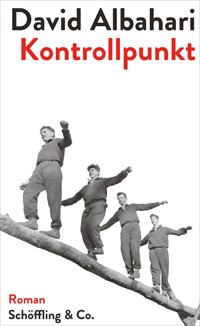14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Heute ist Mittwoch - der Tag, an dem ein Mann seinen älteren, an Parkinson erkrankten Vater zu Untersuchungen begleiten muss. Auf einem ihrer Spaziergänge am Donaukai des Belgrader Vororts Zemun entlang erblickt der bis dahin schweigsame Vater einen Mann, der in ihm böse Erinnerungen weckt, und beginnt aus seinem Leben zu erzählen. Einst gefürchteter Parteiaktivist und Geheimdienstmitarbeiter, hat er Menschen brutal und ohne Skrupel schikaniert. Als sich eines seiner Opfer rächt und ihn als Stalinisten anzeigt, verbannt man ihn in das berüchtigte Arbeitslager auf Goli otok in der Adria. Dass er so seinerseits zum Opfer wird, hält ihn später nicht davon ab, seine Familie zu tyrannisieren. Erst die Krankheit macht aus ihm ein Häufchen Elend. Während er den großspurigen Geschichten seines Vaters lauscht, muss der Sohn entscheiden, wie viel Glauben er ihm schenken kann, ob die Krankheit und das Erlittene ihn von seiner Schuld freisprechen oder nicht."Heute ist Mittwoch" ist der bisher vielleicht politischste Roman Albaharis über die Missetaten des kommunistischen Regimes gegenüber der Bevölkerung und die lange verschwiegenen grausamen Praktiken, die nach 1948 auf der "nackten Insel" herrschten. Zugleich stellt David Albahari mit schwarzem Humor und erzählerischer Raffinesse vermeintliche Wahrheiten über Täter und Opfer infrage.Sein Roman »Heute ist Mittwoch« wird mit dem Aleksandar Tišma International Literary Prize (2022) ausgezeichnet."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Heute ist Mittwoch, …
Autorenporträt
Übersetzerporträt
Über das Buch
Impressum
Heute ist Mittwoch
Heute ist Mittwoch, der zwölfte Juni, sieben Uhr morgens. Ich liege vollständig angezogen auf dem Bett und lausche den Geräuschen aus dem Nebenzimmer. Dort ist mein Vater. Mein Vater hat die Parkinson’sche Krankheit. Tausendmal habe ich ihm gesagt, er solle sich beim Anziehen der Unterwäsche hinsetzen, und er hat tausendmal versprochen, es zu tun. Das hat er natürlich tausendmal nicht getan, und ich traf ihn dann am Boden liegend an, hilflos und wütend, als sei ich an seinem Zustand schuld. Wie auch immer, wenn das geschieht, schweigt er trotzig und wartet darauf, dass ich ihn finde. Nie gibt er zu, selbst schuld zu sein, vielmehr behauptet er, alles sei die Folge uns noch unbekannter kosmischer Kräfte. Nichts wirkt lächerlicher, als wenn ein nackter, beleibter alter Mann mit in einer verblichenen Unterhose verhedderten Beinen großspurig das Schicksal des Weltalls erklärt und schaukelt, strampelt undvergebliche Verrenkungen macht beim Versuch, sich umzudrehen und seiner Tirade mehr Ernst zu verleihen. Am Ende ergibt er sich und überlässt sichmeinen Händen und Ratschlägen, aber ich weiß, dass ihm, sobald er wieder auf den Beinen ist, jedes Mittel recht sein wird, um meine Hilfe als unbedeutend abzutun.
»Helfen Sie ihm ruhig«, sagt mir sein Arzt, ein Neurologe, »geben Sie nichts auf seine Kommentare. Das ist nur seine etwas sonderbare Art, Dank auszudrücken. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen.«
»Warum sollte ich mir Sorgen machen«, sage ich, »das würde doch jeder für seinen Vater tun!«
Das Erstaunen des Neurologen ist echt. »Mann, wo leben Sie denn? Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, dass Ihnen die Haare zu Berge stehen!«
»Ich weiß nicht, welche Geschichten Sie meinen«, sage ich, »aber da Sie das Stehen der Haare erwähnen, fällt mir ein, worum ich Sie auf Wunsch meines Vaters bitten soll.«
»Worum«, fragt der Neurologe vorsichtig.
»Um ein Rezept für Viagra«, sage ich ihm.
»Ein Rezept für Viagra«, wiederholt der Neurologe, als seien das Worte einer Fremdsprache, die er gerade dabei ist zu lernen. Dann wendet er sich zur Tür des Nebenraums, wo meinem Vater Blut- und Urinproben entnommen werden, und sagt leise: »Ich wusste nicht, dass er noch sexuell aktiv ist! Warum hat man mir das bisher nicht gesagt?«
»Er schämt sich«, antworte ich. »Er schämt sich einer solchen Situation.«
»Unsinn«, sagt der Neurologe, »in seinem Alter ist das auch ohne die Parkinsonkrankheit eine ganz normale Erscheinung.«
»Es gibt da noch etwas«, füge ich hinzu und neige mich vertraulich zum Neurologen, »aber Sie dürfen ihm nicht sagen, dass Sie es von mir erfahren haben. Er findet großen Gefallen an Ihrer Nadica.«
Der Neurologe ist verwirrt. »Meine Nadica, wer soll das sein? Ich verstehe nicht.«
»Das ist doch die Krankenschwester auf Ihrer Station«, erkläre ich. »Sie heißt Nadežda, aber er nennt sie seine Nadica.«
Der Neurologe reibt sich die Stirn. »Natürlich«, sagt er. »Nadežda, Nada, Nadica. Ganz logisch.« Dann weiten sich auf einmal seine Augen. »Aber sie ist jetzt gerade mit ihm dort hinten und bereitet ihn auf die Laborproben vor …«
Da sehe ich die beiden sich schon langsam der offenen Tür des Untersuchungszimmers nähern und flüstere dem Neurologen schnell zu, er solle meinem Vater gegenüber nichts erwähnen, drehe mich dann zu Vater und sage, ich hätte den Arzt nach dem Medikament gefragt, das ihn interessiere. »Er muss sich noch näher erkundigen, dann meldet er sich.«
In der Tat meldet er sich am Freitag, genau um Mittag, wenn Vater und ich meist an der Donau spazieren gehen. Läse ich auf dem Display meines Handys nicht seinen Namen – Dr. Stanković – würde ich ihn an seiner Stimme nie erkennen. Er klingt wie ein Greis, als sei er noch älter als mein Vater, obwohl er sogar jünger ist als ich. Wenn meine Rechnung stimmt, muss Dr. Stanković fast ein Vierteljahrhundert jünger sein als mein Vater, während der Altersunterschied zu mir wesentlich kleiner ist, nur etwa vier Jahre. Als mein Vater einmal von diesem kleinen Altersunterschied erfuhr, schäumte er vor Wut. »Da siehst du«, zeterte er, »was mit gutem Willen und hartnäckigem Einsatz zu erreichen ist? Du bist noch nicht mal mit deinem Studium fertig und er ist schon ein angesehener Arzt und Universitätsprofessor! Was habe ich dem lieben Gott bloß angetan, dass er mich mit einem Sohn wie dir straft?«
Gott ist in Vaters Vokabular ein Novum. Ich erinnere mich an die Zeiten, als man vor ihm nicht einmal den Buchstaben »G« aussprechen durfte, was meine Mutter, die Gott für alles und jedes beschuldigte, große Überwindung kostete. Bis heute ist mir nicht klar, wie meine Eltern überhaupt zueinanderfanden, und die Tatsache, dass sie am Ende auch noch die Ehe eingegangen sind, schien mir schon immer ganz und gar unbegreiflich. Es gab zwar eine Geschichte darüber, dass meine Mutter – damals noch eine Zöpfe tragende Göre – mit einer Bitte zu meinem Vater kam, der damals das Komitee zur Feststellung persönlicher und gesellschaftlicher Verantwortung leitete und damit einer der mächtigsten Männer der lokalen Parteiorganisation war, dass also meine Mutter, meine spätere Mutter, den Mut aufbrachte, ein solch hohes Tier um Gnade für ihren Vater zu bitten, einen örtlichen Obst- und Gemüsehändler, der der Kollaboration mit Staatsfeinden angeklagt war, weil er ihnen erlaubte, Lebensmittel in seinem Laden einzukaufen. Nachdem sie erlebt hatte, wie es Einwohnern ihres kleinen Ortes ergangen war, die wegen ähnlicher Übertretungen angeklagt waren, beschloss meine spätere Mutter, sich direkt an den Mann im Zentrum der Macht zu wenden, und schaffte es irgendwie, an seine Tür zu klopfen. Diese Kühnheit hätte ihr jedoch wenig genützt, wäre mein späterer Vater nach eigenem Geständnis nicht auf die Zöpfe fixiert gewesen. Es ist nicht bekannt, woher, von welchen Problemen in seiner Kindheit seine Abneigung gegen Zöpfe herrührte, aber wenn er einem Mädchen mit Zöpfen begegnete, ließ er ihm jedenfalls keine Wahl. »Die Zöpfe ab«, pflegte er dann mit strenger Stimme zu sagen, »oder die Hose runter.« Als er jedoch meine spätere Mutter vor dieses Dilemma stellte, erwiderte sie trotzig: »Die Zöpfe gebe ich nicht her und eine Unterhose habe ich nicht an!« Mein späterer Vater war dermaßen überrascht, dass seine Knie zu zittern begannen und sein Herz wild schlug, er wurde blass und erreichte torkelnd und nur mit Mühe seinen Stuhl hinter dem Schreibtisch. Ohne zu zögern holte meine spätere Mutter ein Glas Wasser, feuchtete ein Taschentuch an und legte es meinem späteren Vater auf die Stirn. Er stieß einen tiefen Seufzer aus, öffnete die Augen und fragte: »Und wo steckt jetzt deine Unterhose?« »Auf der Wäscheleine hinter unserem Haus«, sagte sie, »erst heute Morgen fiel mir ein, dass ich sie nicht gewaschen hatte, und jetzt ist sie noch nicht trocken. Wenn man zum Arzt geht oder zum Rathaus, muss man eine saubere Unterhose haben. Sie sollte wegen der Ansteckungsgefahr nicht schmutzig und wegen der Gefahr einer Erkältung nicht feucht sein.« Mein späterer Vater war baff. »Was für eine Erkältung denn«, fragte er, »was erzählst du da?« »Wieso?«, sagte meine spätere Mutter, »Jenes unten kann sich erkälten so wie alles andere auch.« Er aber fragte: »Welches unten?« Sie erwiderte: »Jenes.« Und er: »Welches denn?« Sie: »Eben jenes.« Darauf er: »Welches?« Und sie: »Wieso welches?« Und so, Wort für Wort, wie Mutter einmal erzählte, kamen sie sich näher als irgendjemand sonst auf der Welt, und als sie eine Stunde später das Gebäude des Komitees verließ, waren sie alle auf der sicheren Seite, ihr Vater und sie und auch die Goldstücke, die in einer wasserdichten Tüte unter dem Nussbaum vergraben waren.
Ich weiß nicht, wie Viagra auf meinen Vater wirken wird, bei mir weckt es sofort eine Menge Erinnerungen. Also höre ich Dr. Stanković aufmerksam zu, um meinem Vater seine Worte möglichst vollständig wiedergeben zu können. Zu dieser Zeit pflegt mein Vater Freundschaft mit den Zemuner Möwen. Tag für Tag bringt er ihnen altes, trockenes Brot, und zwar immer ungefähr zur gleichen Stunde wie heute – um Mittag herum –, sie merken sich das und kreischen wie verrückt, sobald er an das Donauufer tritt. Zuerst fliegen sie hoch und kommen dann im Sturzflug zu ihm herunter. Das ist ein Zeichen der Dankbarkeit, wie ich in einem Buch über das Verhalten der Vögel gelesen habe, aber diese Information genügt nicht, mir meine Besorgnis zu nehmen, denn die Möwen erinnern mich dabei unweigerlich an die Szenen aus Hitchcocks Die Vögel. Schon viermal haben sie ihm im Tiefflug die Mütze vom Kopf gestohlen: zweimal den schwarzen Hut, einmal die gestrickte Mütze und einmal die Schirmmütze. Heute ist er barhäuptig, und die Vögel reißen sich nur um das Brot und kreischen, als sollte die ganze Stadt sie hören. Als das Brot alle ist, kehrt Vater zufrieden zurück und setzt sich neben mich auf die Bank. Sofort fragt er: »Was hat er gesagt?«
Obwohl ich weiß, wen er meint, stelle ich mich dumm und antworte mit der Gegenfrage: »Wer?«
»Was heißt, wer?«, ärgert sich Vater. »Natürlich unser Arzt, der Doktor Stanković!«
»Seit wann ist er auch mein Arzt«, sage ich, »meiner ist Doktor Jelić vom Gesundheitszentrum.«
Die Hände meines Vaters beginnen zu zittern, sein Gesicht verzerrt sich zu einer grotesken Maske. Offensichtlich habe ich übertrieben, oder er befürchtet vielmehr, der Doktor habe seine Bitte abgeschlagen. Ich beruhige ihn und teile ihm mit, was sein Arzt wirklich gesagt hat. Er hat gesagt, sage ich, dass er sich mehrere ernsthafte Studien angeschaut hat, die alle zu der gleichen Feststellung kommen, an Parkinson Erkrankte könnten sie bedenkenlos nehmen. Die Ausnahme bildeten natürlich Personen mit hohem Blutdruck, die sie sowieso, ob mit der Krankheit oder ohne sie, nicht einnehmen dürften.
Vater klatscht in die Hände, freut sich wie ein Kind, das soeben erfahren hat, es bekomme zum Geburtstag sein heißersehntes Spielzeug, dann wird er plötzlich ernst, packt mich am rechten Handgelenk und fragt, wann er das Rezept bekomme.
»Du brauchst kein Rezept«, sage ich, »du kannst es in jeder Apotheke kaufen.«
Prompt denkt er natürlich nicht mehr an unseren Spaziergang. Stattdessen fragt er: »Wo ist die nächste Apotheke?«
Sie ist nicht weit von der Uferpromenade. Wir betreten sie wie von schlechtem Gewissen geplagt. Zuvor haben wir darüber diskutiert, wer von uns beiden die Apothekerin ansprechen solle. Vater beteuerte, er werde es tun, aber jetzt, da wir drin sind, schaltet er einfach auf stumm, und mir bleibt keine Wahl. Ich trage also der Apothekerin unseren Wunsch vor. Mit ungerührter Miene bückt sie sich und beginnt in irgendwelchen Schubladen zu kramen. Nachdem sie mehrere auf- und zugemacht hat, sagt sie schließlich, sie habe nur eine 100-mg-Packung da. »Aber«, sagt sie, jetzt wieder voll aufgerichtet, »für wen soll die eigentlich sein?«
Ihr Blick ist streng und wir trauen uns nicht zu antworten. Vater starrt vor sich auf den Fußboden, er wird rot im Gesicht.
Die Apothekerin fasst das als Antwort auf und wendet sich an mich. »Hat er«, fragt sie, »Probleme mit Bluthochdruck?«
»Soviel ich weiß«, sage ich, »nein.«
»Nein, nein«, bestätigt mein Vater, »die habe ich auch nie gehabt.«
Die Apothekerin verlangt dennoch von ihm, mit dem Gerät der Apotheke seinen Blutdruck zu messen. Als sie das Ergebnis sieht, klopft sie meinem Vater auf die Schulter. »Bravo«, sagt sie, »Sie sind ja noch ein junger Spund.«
So bekommen wir endlich in einem Tütchen aus undurchsichtigem weißem Papier die kleine Zauberschachtel ausgehändigt. In ihr steckt – das sehen wir später zu Hause – eine einzige blaue Tablette. Vater zeigt offen seine Enttäuschung. »Hätte ich das gewusst«, sagt er, »hätte ich dir gleich gesagt, noch mindestens zwei Stück zu kaufen.« Das bringt mich dazu, den Beipackzettel zu lesen, aber der ist in so winzigen Buchstaben gedruckt, dass ich es gleich aufgebe. Meine Augen beginnen vor Anstrengung stark zu tränen, es sieht aus, als weinte ich. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der beim Lesen des Beipackzettels von Viagra weint. Vater will mir helfen, er reicht mir ein Papiertaschentuch, das ich annehme, und seine Lesebrille, die ich ablehne. Ich trockne die Augen und das Gesicht, dann putze ich mir die Nase und schlage ihm vor, die Tablette zu halbieren. »Vielleicht kommst du auch mit nur fünfzig Milligramm aus und hast dann Viagra für zwei Mal.« Vater schlägt das aus. »Nimmt man das erste Mal nicht genug, wird das einem nie verziehen, was heißt, dass es zu einem zweiten Mal vielleicht gar nicht mehr kommt. Also kein Halbieren. Ich nehme den Hunderter, komme was da wolle.«
Ich reibe mir die Augen und schüttele den Kopf. Es ist kaum zu glauben, dass ich mit meinem Vater über sexuelle Probleme rede. Plötzlich verspüre ich Scham, jene tief verwurzelte Scham, die mich seinerzeit wie die meisten Kinder daran gehindert hat, mit den Eltern über solche Dinge zu reden, als es angebracht war. Ich erinnere mich zwar, dass mein Vater, vor allem während der Zeit vor ihrer Scheidung, die ich in meinen Notizen als die »stürmische Nacht« bezeichnete, versucht hat, mir zu erklären, dass nicht alle Anklagen bezüglich seiner zahlreichen sexuellen Abenteuer stimmten. Während Mutter und er miteinander stritten und ich hilflos am Esstisch saß, machte er mir gelegentlich Zeichen mit der Hand, den Augenbrauen oder dem Mund. Diese Gesten kommentierten die Behauptungen meiner Mutter meist auf zwei Weisen, entweder als abscheuliche Übertreibung oder als reinen Blödsinn. Ich nehme an, Vater dachte, ich sei auf seiner Seite, aber so war es nicht. Ich war eigentlich auf keiner Seite und während sie darüber stritten, zu wem ich gehörte, meistens bemüht, nicht in ihr Spiel hineingezogen zu werden. Dabei gehörte ich weder damals noch irgendwann jemand anderem als mir selbst.
Mancher meint vielleicht, ich kümmere mich deswegen so sehr um meinen Vater, weil ich mich doch für ihn entschieden hätte. Aber genauso gut könnte man sagen, ich wolle auf diese Weise mein Gewissen beruhigen, weil ich mich nicht genug meiner Mutter widmete, als sie ihren vergeblichen Kampf gegen den Tod führte. Nichts stimmt weniger als das. Ich wurde genauso wie sie von ihrer Krankheit überrascht. Diese adrette und immer zurechtgemachte kleine Frau verwandelte sich über Nacht in ein ausgedörrtes Geschöpf, das wie ein Außerirdischer aus Hollywood-Filmen anmutete, vor allem als sie sich den Kopf kahlrasieren musste. In der letzten Phase der Krankheit verbot sie uns, sie zu besuchen, weil sie das, wie sie sagte, mehr aufregte als beruhigte. Weder Vater noch ich hörten auf sie, wir besuchten sie sogar noch häufiger, aber sie drehte dann den Kopf von uns weg oder blieb nur reglos auf dem Rücken liegen und starrte die weiße Zimmerdecke an, bis wir fortgingen. Sowohl meinem Vater als auch mir fiel das, jedem auf seine Weise, schwer. Während wir auf den Bus warteten, murmelte Vater immerzu etwas in seinen Bart und jammerte, zunächst leise, später zu Hause lauter, bis ich ihn eines Tages anherrschte, er solle das falsche Getue lassen, mit dem er niemandem etwas vormachen könne. »Die ganzen Piesackereien, Zankereien, Flüche und Beleidigungen«, sagte ich ihm, »all das bleibt, und du schaffst es nicht dadurch aus der Welt, dass du dir an die Brust schlägst.« Mein Vater stand nur da und zwinkerte, und ich bin fest überzeugt, dass seine Krankheit in diesem Augenblick den letzten verbliebenen Widerstand überwand, den sein Körper noch mobilisieren konnte. Damals wusste ich es nicht, so wie ich auch jetzt nicht weiß, ob sie sich nicht schon bei mir eingenistet hat, aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. Wichtig ist nur, dass es Augenblicke gibt, in denen sich der Mensch völlig verändert, in denen er ganz anders wird – weder besser noch schlechter und dennoch jemand, der dem früheren nicht mehr ähnelt.
Das lässt mich daran denken, dass ich etwas Ähnliches einmal meinen Nichten sagte: »Ihr dürft niemandem von euch erzählen, es genügt, wenn ihr euren Namen und eventuell den Kosenamen sagt. Alles andere kann bis zum nächsten Morgen warten.« Meine Nichten protestierten laut. Ich sah sie an: Für mich waren sie noch immer kleine Mädchen, mit denen ich früher Sandkuchen backte, dabei sind sie schon erwachsene Personen. Sie können sich allein durch das Leben schlagen, einen Beschützer brauchen sie nicht.
»Ich auch nicht«, fügt mein Vater hinzu, »und du lässt mich trotzdem nicht in Frieden.«
Ich sehe ihn an und muss lachen. Er versucht nämlich, streng zu sein und mich böse anzugucken, aber die Krankheit hat seine Gesichtszüge erstarren lassen, und er sieht jetzt wie ein verheulter Clown aus und nicht wie das Ekel von Parteikommissar, den alle fürchteten und am liebsten nur von hinten sahen. Diese Zeiten sind längst vorbei und kommen, falls ich das so selbstbewusst sagen darf, nie mehr wieder. Die Geschichte hingegen bietet uns eine Fülle gegensätzlicher Beispiele, aber meine Schwester hat keine Zeit für Diskussionen über die historische Wirklichkeit. »Das Essen steht auf dem Tisch«, sagt sie, »lasst es nicht kalt werden.« Wir setzen uns folgsam in der üblichen Anordnung hin: Meine Schwester wie immer am Kopfende, mein Vater ihr gegenüber, die Töchter nebeneinander zu ihrer Rechten, ich nehme an ihrer linken Seite Platz. Diese Sonntagsessen – eigentlich finden sie einmal in zwei Wochen statt – sind für uns alle zu einem echten Ritual geworden. Ich füge gleich hinzu, dass es nicht immer so war, es musste zunächst zur Scheidung meiner Schwester und einige Monate später zum Tod unserer Mutter kommen, ehe meine Schwester uns zum Sonntagsessen einlud. Damals hatte sie als Vorspeise eine Suppe, eine fette und heiße, angeboten und während wir warteten, dass sie abkühlte, räusperte sie sich und sagte: »Von nun an werden wir für immer zusammenbleiben und niemand wird uns mehr auseinanderbringen können.« Dann begann sie bitterlich zu weinen und erzählte uns zwischen ihren Tränen und den Dampfschwaden über unseren Tellern, dass sie uns früher nie alle zusammen zum Mittagessen einladen durfte, weil ihr Mann, ihr ehemaliger Mann uns nicht mochte. Er habe uns für eine durch und durch merkwürdige Familie gehalten, deren Mitglieder durch abwegige Rituale aneinandergebunden seien, weswegen er meiner Schwester verboten hatte, uns einzuladen. Ich weiß noch, wie überrascht ich war, das zu hören. Mićko, den Ehemann meiner Schwester, kannte ich als einen zurückhaltenden, wohlwollenden Mann, allerdings zweifelte ich nie daran, dass jemand, der tagsüber ein Engel ist, während der Nacht, im Bett, zu einem richtigen Teufel werden kann. Aber alle akzeptierten diese Erklärung, zumal während der Ausführungen meiner Schwester ihre Töchter in zärtlicher Umarmung lagen, aus der nur zeitweise ein Klagelaut oder ein tiefer, abgehackter Seufzer ertönte. Dann kam meine Schwester auf unsere Mutter zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass meine Schwester jedes Mal, wenn unsere Mutter sie besuchte, in größte Panik geriet, weil ihr, wie sie sagte, »nichts gut genug war«. Sie ging hinter ihr her durch die Wohnung und hatte für alles einen sarkastischen Kommentar oder ein abwertendes Urteil. Von den Fliesen im renovierten Bad meinte sie, sie sähen aus, als hätte ein Elefant sie mit seinem Rüssel an die Wand geklatscht; sie fand Schmutz an frisch geputzten Fenstern und Türen; sie war überzeugt, alles am besten zu wissen, und sagte von einem Rezeptheft einer guten Freundin, es wäre von größerem Nutzen in einer öffentlichen Toilette als in deren kleiner Küche. Als meine Schwester einmal die Bemerkung fallen ließ, Mutter könne uns alle ruhig mal zu einem Gulasch einladen, wurde diese so böse, dass sie ein Stück von dem Glas abbiss, aus dem sie gerade Holundersaft trank. Vielleicht gefalle es nicht jedem, solche Dinge über einen Menschen zu hören, für den er bereit wäre, die Hand ins Feuer zu legen, sagte meine Schwester, aber wir seien allein geboren, jeder für sich, und genauso betrachteten wir jeder für sich die Welt. Egal ob es sich um Vater oder Mutter, Schwester oder Bruder, Freund oder Geliebten handele, im Laufe des Lebens werde jeder von ihnen zum Ballast, zu einer Bürde, die uns immer langsamer werden lasse, bis wir uns schließlich eingestünden, dass wir in einer Kloake stecken und uns nichts anderes übrig bleibt, als uns an deren Gestank zu gewöhnen. Da hülfen auch keine duftenden Kräuter, sagt meine Schwester und blickt mich bedeutungsvoll an, als sei ich das einzige Mitglied unserer Familie, das im richtigen Augenblick des Tages oder der Nacht gern einen Joint raucht.
Vaters Parkinsonkrankheit begann mit einem scheinbar unbedeutenden Schmerz in der linken Schulter. Eines Morgens eröffnete er uns, und zwar in so offiziellem Ton, als spräche er ein Urteil über uns, er wolle sich einigen fachärztlichen Untersuchungen unterziehen, um diesem Schmerz auf den Grund zu gehen. Mutter lebte damals noch und winkte, als sie Vaters Sermon hörte, nur verächtlich ab. Er aber hielt Wort und suchte binnen kurzer Zeit mehrere Ärzte auf, machte viele Röntgenaufnahmen, ging zur Physiotherapie, probierte verschiedene Hausmittel, Salben und Tees aus und musste schließlich zu einem Neurologen gehen, zum Arzt, der an der Quelle des Schmerzes sitzt, wie das einer der Rheumaspezialisten ausdrückte, von denen Vater sich beraten ließ. Der Neurologe hörte sich Vaters Geschichte über seinen Schmerz und über die Bemühungen, ihm zu entkommen, aufmerksam an, setzte sich dann ihm gegenüber auf einen Stuhl und forderte ihn auf, seine Bewegungen nachzumachen. Zuerst vollführte er verschiedene Bewegungen mit den Fingern und den Händen, dann stampfte er mit dem Fuß auf den Boden, und zwar in immer schnellerem Rhythmus. Vater machte folgsam alles nach, wobei er anfangs das furiose Tempo einhielt, dann aber immer langsamer wurde und am Ende ganz aufhörte. Da fasste der Neurologe ihn an beiden Händen und sagte mit Rührung in der Stimme, er wolle keinen Hehl daraus machen, dass alle Zeichen dafür sprächen, dass es sich um die Parkinsonkrankheit handele. Man müsse noch einige Untersuchungen und Analysen vornehmen, fuhr der Neurologe fort, aber was er gesehen habe, bestärke ihn in seinem Urteil. Vater, so erzählte er uns später, schloss darauf die Augen und dachte: »Ich werde nie Rio sehen.«
»Hast du wirklich nur diesen Gedanken gehabt?«, frage ich ihn bei einem unserer üblichen Spaziergänge.
Er denkt kurz nach, sagt dann: »Ja, nur der fiel mir ein.«
»Und an mich, meine Schwester und deren Mädchen hast du nicht gedacht? Hast du nicht den in Großbuchstaben geschriebenen Spruch vor dir gesehen: DER ABSCHIED VON DER FAMILIE TUT WEH?«
»Natürlich tut er weh«, gesteht Vater, »aber eine Reise nach Rio wäre mir doch lieber.«
Das ist das Zeichen dafür, dass es keinen Zweck hat, weiterzureden. Ich konzentriere mich auf die Promenade am Donauufer in Zemun: Während unserer Spaziergänge begegnete mein Vater nicht nur den Möwen, sondern auch Menschen, Bekannten aus verschiedenen Lebensabschnitten: »Der hat zusammen mit mir im Laden gearbeitet«, »Mit dem habe ich gemeinsam Diebe in der Fabrik verfolgt«, »Die dort hatte die Rolle des Doktorvaters in meiner Fakultät«, »Mit dem hatte ich eine Auseinandersetzung wegen seiner Frau«. Ich war nicht immer imstande, mir alles zu merken, hörte mir seine Bekenntnisse aber aufmerksam an. Natürlich fragte ich mich dann ständig, wie viel Wahres in diesen Geschichten steckte, wie groß dabei der Anteil der blühenden Fantasie meines Vaters war. Manchmal, wenn er müde wurde, setzten wir uns auf eine Bank. Er schloss dann die Augen, rieb mit den Händen über sein Gesicht und versank sofort in Schlaf. Seine Atmung wurde ruhig und tief; bald sank sein Kopf auf die Brust; sein Mund ging auf; die Spucke rann ihm aus dem Mundwinkel und fiel Tropfen um Tropfen auf seine Hose. Während dieser Zeit ließ ich meinen Blick nicht von ihm ab. Ich dachte, er musste erst so schwer krank werden, damit zwischen uns ein Gefühl der Nähe entsteht. Ein Viertelstündchen später öffnete Vater dann die Augen und blickte mich intensiv an, als kenne er mich nicht. Dann verzogen sich seine trockenen Lippen zu einem Lächeln, und ich holte, ebenfalls lächelnd, aus meiner Hosentasche ein gelbes Plastikdöschen. Es war an der Zeit, dass Vater sein Medikament nahm.
Nur einmal überwältigte auch mich der Schlaf auf einer Bank auf der Zemuner Uferpromenade. Das Schlimmste daran war, dass ich überhaupt nicht merkte, wann und wie das geschah, ich hatte einfach die Augen geschlossen und war in einen so tiefen Schlaf gesunken, dass uns jemand, wenn er es nur gewollt hätte, beide von der Bank hätte wegtragen können. Statt ihn zu beschützen und auf ihn aufzupassen, so warf ich mir vor, machte ich ihn noch verletzlicher, den dunklen Mächten der Welt noch zugänglicher.
Vater konnte meine Verzweiflung gar nicht verstehen. »Es ist doch keine Schande, ein wenig auszuruhen«, sagte er. »Und wer sollte uns übrigens wegtragen? Wer braucht zwei heruntergekommene Männer, von denen der eine schon weiß, was das Schicksal für ihn bereithält, und der andere erst erfahren muss, was ihn im Leben noch erwartet?«
Er hatte recht. Manchmal übertreibe ich wirklich. Ich stand auf und reichte ihm die Hand, um ihm beim Aufstehen zu helfen. Er schnaubte verächtlich, schob meine Hand beiseite und versuchte, sich allein zu erheben. Am Ende gelang ihm das, obwohl er jetzt außer Atem war und im Kreuz ganz bestimmt Schmerzen verspürte. Tausendmal habe ich ihm gesagt, er solle beim Aufstehen die angebotene Hilfe annehmen. Tausendmal hat er versprochen, es zu tun. Jetzt sage ich nichts mehr. Ich entferne ein welkes Blättchen von seiner Jacke, richte den Kragen an seinem Hemd und mache mich auf den Weg. Nach zwei, drei Schritten drehe ich mich um. Er steht noch immer da. »Was ist«, frage ich, »sollen wir nicht nach Hause gehen?« Er murmelt etwas und setzt sich in Bewegung, langsam, unsicher, wackelig, als wate er durch tiefen Schlamm; wenn er dann wieder sicherer auf den Beinen ist, gehen wir, manchmal ohne ein Wort zu sagen, zusammen nach Hause.
Fast alle wundern sich, wenn sie in unserer Stadt eine ältere, oft geschmackvoll zurechtgemachte Frau mit großem Hut in Begleitung eines jungen Mannes sehen, stellen aber beim näheren Hinsehen fest, dass es sich um Mutter und Sohn handelt. Viele dieser Söhne sind alt geworden und ausgebrannt in der Rolle des folgsamen Beschützers, obwohl sie sich eigentlich wie in einem Spinnennetz verstrickte Fliegen fühlen. Manch eine dieser allmächtigen Mütter verbirgt auf diese Weise vor den Leuten, aber auch vor sich selbst, die Tatsache, dass ihr geliebter Sohn zur Homosexualität neigt. Das gilt natürlich nicht für jeden, man darf es nicht verallgemeinern, es genügt aber, die Leute gelegentlich zu unangenehmen Kommentaren oder zu beleidigenden Schimpfwörtern zu veranlassen.