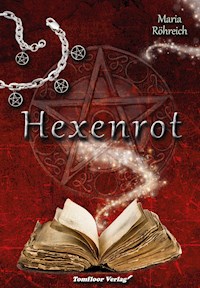
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tomfloor Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Zuerst verlierst du deine Hemmungen. Deine moralischen Ansichten, deine persönliche Grenze zwischen Gut und Böse wird zunehmend verwischen. Irgendwann wirst du töten, um zu bekommen, was du willst. Es wird wie eine Droge für dich sein.« Alice ist eine Hexe. Lange Zeit wusste die Sechzehnjährige nichts von ihren Kräften, doch nun ist sie voller Wissbegier und Eifer. Trotz aller Warnungen gibt sie sich mit Leib und Seele der Magie hin. Dabei vertraut sie auf den Schutz eines silbernen Armbandes und auf die Fähigkeiten ihrer Meisterin Luna. Ihr neues Leben verspricht perfekt zu sein. Doch die Macht hat ihren Preis. Freundschaften zerbrechen, Feindschaften entstehen und Misstrauen wächst. Alice muss erkennen, dass sie mehr und mehr die Kontrolle verliert. Schon bald kämpft sie nicht nur mit Verrat, Intrigen und einem Hexenmörder, sondern vor allem mit den düsteren Tiefen ihres eigenen Verstandes. Wie weit kann sie gehen, bevor sie alles verliert? Eine spannende und außergewöhnliche Fantasygeschichte mit einem Hauch von Romantik, in der nicht nur Hexen eine Rolle spielen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Titel
Impressum
Erster Teil - Wer mit dem Teufel tanzt …
Prolog
Kapitel 1 - Alice
Kapitel 2 - Ein einzelner Sonnenstrahl (Chris)
Kapitel 3 - Kein Tag wie jeder andere
Kapitel 4 - Das Erbe der Familie
Kapitel 5 - Die Sprache der Gelehrten
Kapitel 6 - Der stille Beobachter (Chris)
Kapitel 7 - Nur ein bisschen Kreide
Kapitel 8 - Hexenlehre
Kapitel 9 - Eine Spur (Der Jäger)
Kapitel 10 - Unendlichkeit
Kapitel 11 - Tante Dora
Kapitel 12 - Das ist mein Platz (Chris)
Kapitel 13 - Ein Fehler
Kapitel 14 - Die Wächter
Kapitel 15 - Zwei kaputte Seelen
Kapitel 16 - Unter Strom
Kapitel 17 - Schwarze Post (Chris)
Kapitel 18 - Darkness’ Geschichte
Kapitel 19 - Weil du alles bist
Kapitel 20 - Zorn
Kapitel 21 - Geliebt und verloren
Kapitel 22 - Frei, allein und mächtig (Der Jäger)
Kapitel 23 - Die Entscheidung
Zweiter Teil - … muss bereit sein, durch die Hölle zu gehen
Kapitel 24 - Alarm (Chris)
Kapitel 25 - Loderndes Feuer
Kapitel 26 - Abschied
Kapitel 27 - In Eile
Kapitel 28 - Bella Italia
Kapitel 29 - Die Verlockung der Magie (Chris)
Kapitel 30 - Klauen und Zähne
Kapitel 31 - Blutsauger
Kapitel 32 - Inmitten ihrer Dinge (Darkness)
Kapitel 33 - Zu Hause (Der Jäger)
Kapitel 34 - Im Haus der Werwölfe
Kapitel 35 - Nutzlos (Chris)
Kapitel 36 - Luigis Geschichte
Kapitel 37 - Die falsche Fährte
Kapitel 38 - Malcesine
Kapitel 39 - Von Fallen und Verrätern
Kapitel 40 - Zu spät (Darkness)
Kapitel 41 - Drei. Zwei. Eins.
Kapitel 42 - Ein Leben für das andere
Kapitel 43 - Der zweite Vampir
Kapitel 44 - Cascata Varone
Kapitel 45 - Ein toter Wächter (Darkness)
Kapitel 46 - Macht, Magie und Wahnsinn
Kapitel 47 - Racheengel
Epilog
Danksagung
Maria Röhreich
Hexenrot
Impressum
Ebook-Konvertierung und Titelbildgestaltung:
© T. C., Tomfloor Verlag
Umschlagbild:
Adobe Stock: @oksione, @jandix2, @Mara Fribus
Shutterstock.com: @Tukarem.Karve, @Jjustas
Freepik: @kjpargeter
ISBN 9783964640253 (epub)
ISBN 97839646401260 (mobi)
ISBN der gedruckten Ausgabe 9783964640246
Tomfloor Verlag
Thomas Funk
Alex-Gugler-Straße 5
83666 Waakirchen
https://tomfloor-verlag.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de
abrufbar.
ERSTER TEIL
Wer mit dem Teufel tanzt …
Prolog
10 Jahre zuvor
Eine Ratte huschte hastig davon, als die Schritte des Mannes durch die schmale Gasse hallten. Es war eine schäbige Gegend, irgendwo in Deutschland. Graffitis schmückten den grauen Putz der alten Häuser, die im Schatten einer schillernden Stadt standen. Kaum ein Außenstehender kannte das Viertel, denn die Reiseführer beschrieben natürlich nur die hübschen Gegenden. Eine schwache Laterne beleuchtete die Straße, aber in die verdreckte Nebengasse drang kein einziger Lichtstrahl. Müllsäcke stapelten sich an den Hauswänden und es stank nach Urin. Doch genau diesen Weg wählte der Mann.
Er bewegte sich durch die Gasse wie ein Schatten und hielt schließlich vor einer mit Graffiti beschmierten Hintertür. Normalerweise würde er Orte wie diesen meiden, aber er hatte Hunger. Leise öffnete er die Tür und stieg die knarrende Holztreppe hinunter. Was er dort finden würde, wusste er genau. Es war eine Mischung aus illegalem Casino, Bar und Bordell. Es widerte ihn an, aber es war billig und geheim – genau das, was er brauchte, denn er hatte weder viel Geld noch wollte er auffallen.
Er hatte sich vor Jahren für ein Leben im Schatten entschieden. Seit er zum ersten Mal jemanden getötet hatte, war er zu einem Phantom geworden. Jener erste Mord hatte in der Zeitung gestanden und sein Vorname war als der des unbeteiligten Zeugen erwähnt worden. Danach hatte es nie mehr einen Hinweis auf ihn gegeben. Er hatte seinen Namen abgelegt und sich stets verborgen gehalten. Seither lebte er als Schatten, erledigte gelegentlich schmutzige Aufträge und widmete sein Dasein der Forschung und dem Lernen. Seine Intelligenz war seine Waffe.
Am Fuß der Treppe stank es nach Zigarettenrauch und Dreck. Er sah die voll besetzten Spieltische, die Betrunkenen und die Mädchen, die viel zu jung aussahen, um hier zu arbeiten. Gläser klirrten, Männer grölten, lachten und lallten.
Ohne seine Kapuze abzunehmen, setzte er sich an die Bar und bestellte Bier und eine Kleinigkeit zu essen. Während er aß und trank, beobachtete er die Männer an den Spieltischen. Nach kurzer Zeit kam er zu der Überzeugung, dass hier gehörig betrogen wurde. Schnell durchschaute er den Schwindel. Sollte er mitspielen? Er war pleite und könnte viel Geld gewinnen.
»Du siehst es, stimmt’s? Den Trick?«
Erstaunt drehte er sich um.
Eine Frau hatte sich zu ihm gesetzt, aber es war keine von den Mädchen. Sie sah aus wie ein Model oder eine reiche Schauspielerin, doch solche Frauen verirrten sich selten in diese Einrichtungen. Ihr Gesicht war sehr hübsch, ihr Körper einfach atemberaubend und ihr Haar so rot wie Blut. Außerdem hatte sie einen berechnenden, verschlagenen Blick – das gefiel ihm.
»Wer bist du?«, fragte er.
Die Frau lächelte. »Möchtest du meinen Namen wissenoder den Grund, warum ich dich anspreche?«
Oh, sie war schlau.
»Letzteres.«
»Weil ich dich beobachte. Schon seit einem Monat.«
Das gefiel ihm schon weniger. Er war es, der andere be-obachtete. Der Schatten, das Phantom, das niemand fand. Er war unsichtbar und stolz darauf. Dass ihm jemand gefolgt war – und noch dazu ohne, dass er es bemerkt hatte –, verunsicherte ihn. »Was willst du von mir? Und für wen arbeitest du?«
Die Frau lachte. Ihm fiel auf, dass ihre Augen ebenso rot waren wie ihr Haar und er fragte sich, ob sie Kontaktlinsen trug.
»Ich arbeite für niemanden. Und was ich will? Ich habe einen Auftrag für dich.«
»Einen bezahlten Auftrag?«, fragte er interessiert.
Die Frau nickte.
»Was soll ich tun?«
»Das sage ich dir nicht hier. Komm mit mir.«
Ein paar Minuten später befanden sie sich in einem Zimmer ein Stockwerk höher im selben Haus. Das breite Bett und die sonstige Einrichtung ließen keinen Zweifel daran, wofür es eigentlich vorgesehen war. Gedämpftes Licht, rote Plüschkissen in Herzform und ein Tisch voller Seile und Handschellen sprachen eine klare Sprache. Er hasste dieses Zimmer von dem Augenblick, in dem er es betreten hatte. Es erinnerte ihn daran, dass es Dinge in der menschlichen Natur gab, die er nicht verstand, und das verunsicherte ihn.
»Also, wie lautet der Auftrag?«, fragte er mit harter Stimme. Die Rothaarige machte ihm Angst und er wollte auf keinen Fall, dass sie das in seinen Worten hören konnte.
»Glaubst du an Geistergeschichten?« Sie lächelte.
»Was meinst du?«
»Na an übernatürliche Wesen. Vampire. Werwölfe. Hexen.«
Bei ihren Worten setzte sein Herz einen Schlag aus. Er hatte sich an die Existenz der anderen Welt gewöhnt. Doch er hatte sie gemieden. »Was bist du?«, fragte er, nun nicht mehr so beherrscht.
Zur Antwort zündete sie ein rotes Herzkissen an, ohne es zu berühren. »Eine Hexe. Damit hast du doch kein Problem, oder?«
Er schloss die Augen und kämpfte gegen seine Angst. Und ob er damit ein Problem hatte! »Wie lautet der Auftrag?«, wiederholte er jedoch nur.
»Du sollst etwas finden. Vor vielen Jahren wurde mir ein Buch gestohlen. Ein wichtiges Buch. Ich will es zurück. Finde es, dann gewähre ich dir, was auch immer du dir wünschst. Unsterblichkeit, Reichtum, was du willst.«
Unsterblichkeit? Reichtum? Sein Interesse war geweckt. Und doch war er misstrauisch. »Was ist an dem Buch so wichtig?«
In nur einer einzigen Sekunde sprang die Hexe auf und packte ihn am Kragen. Er wollte sich wehren, aber das Weib hatte ihn irgendwie gelähmt, sodass er keinen Finger rühren konnte. So zerrte sie ihn zu dem staubigen Fenster. »Sieh hinaus!«, fauchte sie und bei ihrem Tonfall lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. »Diese Welt ist riesig und voller dummer Menschen. Keiner von ihnen versteht, worauf es im Leben ankommt, keiner von ihnen ist etwas wert. Sie leben und sterben ohne Sinn. Aber ich, ich will mehr!« Sie keuchte atemlos und redete schneller: »Ein Leben ist zu kurz, um die Welt zu entdecken! Ich lebe schon verdammt lange auf diesem Planeten und fange an, ihn zu verstehen! Ich weiß, wie man leben muss, um seine Ziele zu erreichen.«
Für ihn sah es nicht so aus, als wäre die Hexe bei klarem Verstand, aber sie schien sich ihrer Sache sicher zu sein.
»Ich will Diener, Untergebene, aber vor allem will ich leben! Und zwar für immer. Ich will Macht, die grenzenlos ist. Doch dazu brauche ich dieses Buch! Finde es für mich. Danach kannst du Teil meiner Macht sein. Sag mir nur, was du dir wünschst, und du bekommst es. Ich verspreche, dass ich für dich einen Zauber deiner Wahl sprechen werde. Aber bring mir das Buch!« Die letzten Worte hatte sie förmlich geschrien und endlich ließ sie ihn los.
Ruckartig stolperte er gegen die Wand, ohne den Blick von der Hexe zu nehmen. Inzwischen war nur noch wenig von ihrer Schönheit übrig geblieben, ihr Gesicht war zu einer Fratze verzerrt. Doch konnte sie ihm wirklich jeden Wunsch erfüllen? Was, wenn er sich die Weltherrschaft wünschen würde? Das klang nicht schlecht. Er könnte Jagd auf Werwölfe machen. Er könnte das Leben führen, von dem er immer geträumt hatte, und noch viel mehr. Er könnte alles haben … »Wie finde ich dieses Buch?«
Die Hexe griff in ihre Designerhandtasche und zog ein paar lose Blätter heraus. »Das Buch ist magisch, es hat also den Drang, sich selbst zu reparieren. Kommst du mit diesen Seiten in seine Nähe, führen sie dich zu ihm.«
Ein magisches Buch und lose Seiten, die ihm den Weg weisen sollten? Das klang nicht gerade vertrauenerweckend. Sein Verstand arbeitete, er suchte nach Haken in diesem Auftrag, nach dem Kleingedruckten im Vertrag, einem Fehler. »Warum suchst du es nicht selbst?«
»Die Hexe, die es mir gestohlen hat, hat sich und das Buch vor mir verborgen. Ich kann es nicht finden. Erst wenn du die losen Seiten wieder eingefügt hast, wird das Buch von selbst den Zauber brechen, der es vor mir versteckt. Außerdem ist die Suche zeitaufwendig und ich habe andere Pläne«, antwortete sie ruhiger. Der Wahnsinn war aus ihren Augen gewichen und sie hatte sich das Haar glatt gestrichen. Sie sah wieder aus wie die schöne Frau aus der Bar.
Er betrachtete nachdenklich die Blätter. Das Papier war alt und vergilbt, die Tinte verblasst. Die Worte darauf waren in Latein verfasst.
Während er noch eingehend die fremden Worte betrachtete, griff die Hexe ein zweites Mal in ihre Tasche. Sie reichte ihm ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit. Es hatte etwa die Größe einer Parfümflasche und war auch ähnlich geformt. »Sprüh dich damit ein und jeder wird dir vertrauen. Gib einer Person einen Tropfen davon ins Essen und sie wird dir alles sagen, was du wissen willst. Alles tun, was du verlangst.«
Er nahm die Flasche in beide Hände und beäugte sie misstrauisch. »Was ist das?«
»Man nennt es Elbenwasser. Es kommt aus einem See, der von Elben vergiftet wurde. Aber sei vorsichtig, es hat seine Tücken. Es wirkt nur bei Fremden. Wer dich kennt oder genug über dich weiß, um dir bewusst zu misstrauen, dessen Meinung wird das Wasser nicht ändern.« Die Hexe lächelte und trat einen Schritt näher.
Sie war zu nah. Der Mann spürte, wie er wieder zu dem Jungen wurde, der er einmal gewesen war. Verletzlich und schüchtern gegenüber Mädchen. Sie weckte etwas ihn ihm, das ihn schwach machte. Es fühlte sich wie eine Mischung aus Scham und Begierde an.
»Was sagst du? Bist du dabei? Denk an all die Macht!«
Kaum ein paar Zentimeter lagen zwischen ihnen und er hatte Mühe, seinen Atem unter Kontrolle zu halten. Das Angebot lockte ihn. Doch etwas in ihm wehrte sich auch gegen das Geschäft mit der Hexe. Er dachte lange nach. So lange, dass die Frau ungeduldig wurde. Das sah er an ihren angespannt zusammengepressten Lippen. Schließlich entschied er sich. »Ich finde das Buch. Aber ich will eine Vorkasse.«
Die Hexe lächelte, genauso verschlagen wie zuvor an der Bar. »Geld willst du … Typisch Mensch. Du sollst es haben.«
Sie kam noch näher und fast wäre er zurückgewichen. Ob sie Magie einsetzte, damit er sich so verwundbar fühlte? Er vertraute ihr nicht. Sie machte ihm Angst. Es gab so viele Argumente gegen diesen Auftrag. Und doch handelte er dieses eine Mal gegen seinen Verstand – und stimmte zu.
Kapitel 1
Alice
Der Tag begann trist und langweilig wie jeder Tag in meinem Leben.
Dichter Nebel hing in den Straßen und ließ alles verschwinden, was weiter als fünfzig Meter von mir entfernt war. Meine Füße versanken in tiefem Schnee und mein Atem hing in der Luft, als wollte er sich dem Nebel anschließen. Missmutig trat ich vor das Gartentor und landete prompt auf meinem Hintern. Lautstark die Eisschicht verfluchend, rappelte ich mich auf und blickte mich hastig um. Zum Glück war um diese Zeit noch niemand außer mir auf der Straße unterwegs. Kein Wunder. Ich wohnte in einem kleinen, beschaulichen Dorf voller Hunde und Gartenzwerge. Jeder kannte jeden, jeder half jedem und jeder lästerte über jeden. Es gab vermutlich nicht viel, was die Nachbarn nicht bemerkten, und kaum eine Neuigkeit, die nicht sofort am Zaun ausgewertet wurde. Im Sommer, wenn jeden Nachmittag die Rasenmäher röhrten, hing der Duft von Gegrilltem in der Luft und im Winter, so wie an diesem Tag, würden in etwa einer Stunde die Schneeschieber über die Wege kratzen. Es war, als hätte das Dorf einen gemütlichen Alltag, aus dem keiner der Bewohner ausbrechen konnte. Selbst die Bienen wirkten träge, wenn sie an den heißen Tagen des Jahres um die Obstbäume schwirrten. Und an den kalten Abenden leuchtete das Licht der Straßenlaternen so schwach, als würde es sich langweilen.
Frierend schlitterte ich den Fußweg entlang, immer darauf bedacht, nicht hinzufallen. So ein Wetter Ende März! Es sollten Frühblüher sprießen, doch stattdessen wurde jeder Tag kälter.
Ich hüllte mich enger in meinen grünen Schal und wünschte mir eine Mütze. Leider standen mir die Dinger aber überhaupt nicht, also galt für mich das Motto: Wer schön sein will, muss leiden.
Als ich das zweite Mal auf einer eisigen Stelle ausrutschte, wechselte ich entnervt vom Bürgersteig auf die Straße. Gestreut war allerdings auch dort nur provisorisch. Ein Gemeindearbeiter warf morgens eine Schaufel Kies auf jeden dritten Meter, aber es war trotzdem besser als nichts.
Durch diesen verdammten Schnee dauerte mein Weg zur Bushaltestelle etwas länger und ich sprang in allerletzter Sekunde in den brechend vollen Schulbus.
Der war erfüllt von vielen Stimmen und roch nach Schweiß und Schnee. Alle Sitzplätze waren belegt und auch die Gänge waren voll. In der Menge konnte ich den blonden Hinterkopf meiner Freundin Melinda ausmachen, aber es war zu eng, um zu ihr zu gelangen. Also blieb ich im Gang stehen und klammerte mich an einen der Haltegriffe.
Um mich herum befanden sich hauptsächlich Kinder. Die älteren und coolen Schüler saßen ganz hinten und hörten mit überlegenen Mienen Musik. Sie sahen mit ihren lässigen Klamotten und angesagten Frisuren aus wie aus einem amerikanischen High-School-Film. Viele meiner Klassenkameraden waren auch dort und einer von ihnen – Piet – bewarf die jüngeren Schüler mit zerbrochenen Stiften.
Wie immer weckte der Anblick dieser hinteren Plätze eine Mischung aus Abscheu und Sehnsucht in mir. Obwohl der Gesamtintelligenzquotient der Personen dort nicht höher sein konnte als der eines Eichhörnchens, waren sie alle selbstbewusst, beliebt und unantastbar. Sie wurden respektiert, gefürchtet und bekamen immer ihren Platz – ob auf den Schulhofbänken, der Cafeteria oder eben im Bus. Ich dagegen stand zwischen zwei Sechstklässlern mit fettigen Haaren und roten Nasen. Wie gern hätte ich dort hinten gesessen.
Die Fahrt zog sich scheinbar endlos hin durch verschneite Felder und Dörfer. Dieselben Häuser, dieselben Straßen und Bäume – sogar der Nebel schien derselbe zu sein wie jeden Tag. Mein Alltag bestand aus denselben Anblicken und Abläufen, Tag für Tag. Und allmählich hatte ich sie satt. Jeden Tag frühstückte ich dasselbe, stieg in den stickigen Bus, ertrug die Fahrt fern von den Sitzplätzen der beliebten Schüler. Ich überstand die Schultage im Kreis meiner wenigen Freunde, dann aß ich zu Hause eine Tiefkühlpizza. Mal telefonierte ich am Nachmittag, mal verbrachte ich ihn im Internet und mal sah ich fern. Treffen mit meinen Freunden fielen größtenteils auf Wochenenden und freie Tage, unter der Woche hatten sie oft keine Zeit. So verbrachte ich die meisten Nachmittage allein. Auch ein Hobby hatte ich nicht. Ich war einfach in nichts gut – weder in Sport noch in Musik oder Kunst. In meinem Alltag war nichts Spannendes, nur eine ewige Trägheit.
Je länger die Busfahrt andauerte, umso gereizter wurde ich, und ich glitt allmählich in wahrhaft düstere Gedanken. Ich hatte das Gefühl, dass in meinem Leben etwas fehlte, sogar dass ich etwas falsch machte. Was stimmte nur nicht mit mir, dass mein Leben so furchtbar langweilig war? Jeder hatte etwas, was ihn besonders machte, ich jedoch nicht. In der Schule war ich weder sonderlich gut noch außerordentlich schlecht. Ich bemühte mich um ein modisches und gepflegtes Äußeres, aber hübsch war ich nicht. Oft dachte ich, dass meine absolute Durchschnittlichkeit das einzig ungewöhnliche an mir war. Und es hinterließ einen bitteren Nachgeschmack.
Gefangen in diesen Gedanken seufzte ich tief, woraufhin mir ein paar Schüler amüsierte Blicke zuwarfen. Ich spürte, wie mir etwas Blut in die Wangen schoss, ignorierte aber die spöttischen Mienen um mich herum und wartete angespannt auf das Ende der Fahrt.
Ich war erleichtert, als sich die Türen mit einem Zischen öffneten und kalte Frühlingsluft in den stickigen Bus strömte. Melinda war schon am Ausgang, sie würde draußen auf mich warten, so wie jeden Morgen.
Ich wurde im Gedränge zur Tür geschoben und als ich die Stufe hinuntersteigen wollte, passierte es – ich landete zum zweiten Mal an diesem Morgen auf dem Boden. Diesmal hatte es aber nicht an Eis gelegen, sondern daran, dass mir jemand ein Bein gestellt hatte.
Zwischen Schnee und zerzausten Haaren hindurch sah ich Piet, der sich grinsend entschuldigte. Angeblich hatte er mich nicht gesehen. Pah! Er genoss die Aufmerksamkeit eindeutig zu sehr, um es ernst zu meinen.
Eine unbändige Wut loderte in mir auf, so heiß wie Feuer. Meine Muskeln verkrampften kurz, als wollten sie, dass ich Piet das Lachen aus dem Gesicht schlug.
Aber nicht nur er lachte, sondern die ganze Schule. Oder zumindest die Schüler, die sich zu diesem Zeitpunkt vor den Schultoren befanden, und das waren eine ganze Menge. Ein paar jüngere Mädchen kicherten zwar nur leise, aber die meisten machten kein Geheimnis aus ihrem Spott.
Mit feuerrotem Kopf rappelte ich mich auf und stürmte geradewegs auf das Mädchenklo.
Verdammt! Hastig wischte ich mir mit den kratzigen Papiertüchern den Schnee aus dem Gesicht und bemühte mich, nicht zu heulen. Das hätte gerade noch gefehlt! Warum war ich nur so schwach? Hätte ich Piet nicht einfach eine verpassen können? Aber nein, ich hatte mich selbst lächerlich gemacht, indem ich davongelaufen war, anstatt zu kontern. Ich hatte Piet kampflos das Feld überlassen, der jetzt seinen Sieg über mich genoss.
»Alice!«, rief meine Freundin Thea. Sie schlüpfte herein und schloss die Tür hinter sich. »Melinda hat mir erzählt, was passiert ist. Piet ist so ein Idiot! Ist mit dir alles in Ordnung?«
Thea, Theadora Alexandra von Austrien, war beliebt, hübsch, reich und extrem schlagfertig. Ihr wäre so etwas nie passiert.
»Ja, schon gut«, schniefte ich mit einem schwachen Lächeln. »Hättest du vielleicht Make-up?« Ein Blick in den Spiegel zeigte mir, dass ich aussah wie eine gebadete Katze.
Thea lächelte. Sie holte einen halben Schminkkoffer aus ihrer Jackentasche und bearbeitete damit eigenhändig mein Gesicht. Ja, schminken konnte sie auch. Man sah nach ein paar Minuten weder das verwischte Make-up noch, dass ich kurz davor gewesen war, zu heulen. Außerdem wirkte meine Haut glatter. Thea hatte die unreinen Stellen in meinem Gesicht wesentlich gründlicher vertuscht als ich zu Hause nach dem Aufstehen.
»Wow, das ist besser als alles, was ich je hinbekommen hätte!«, rief ich dankbar.
»Kein Problem.« Es war offensichtlich, dass sie stolz auf ihr Werk war. »Und jetzt komm. Der Unterricht fängt gleich an und Melinda wartet schon.«
Ich setzte mein schönstes Lächeln auf, hakte mich bei Thea unter und zusammen stolzierten wir durch die Schulflure zu unserem Klassenraum. Ich fühlte mich wie die Begleitung einer Schauspielerin und schon hellte sich meine Stimmung auf. An Theas Seite war ich so unantastbar wie sie selbst. Blicke folgten ihr, wohin sie ging, und sie genoss es. Ihre Wildheit und ihr Äußeres bildeten eine Ausstrahlung, die ihr Komplimente einbrachte. Und Thea brauchte diese Komplimente wie andere die Luft zum Atmen. Sie gedieh unter Bewunderung und ging ein, wenn ihr jemand widersprach. Es war leicht, mit ihr befreundet zu sein, denn sie teilte ihren Glanz, als wäre sie eine Sonne.
Ganz anders war Melinda. Sie war eine streng religiöse, überpünktliche Perfektionistin. Sie saß bereits an ihrem Platz, als wir das Klassenzimmer betraten, die Stupsnase in ein Buch gesteckt. Sie erinnerte mich an eine gute Fee, so umsichtig, gefühlvoll und sogar weise erschien sie mir.
»Alice, Thea!«, begrüßte sie uns erfreut und klappte das Buch zu. Ihre himmelblauen Augen blinkten und sie grinste bis über beide Ohren. »Mensch, Piet ist doch wirklich ein Mistkerl. Er hat dir absichtlich ein Bein gestellt. Aber ich glaube, ich kann dich aufmuntern.« Sie förderte eine Schachtel Schokoladenplätzchen zutage. »Mir war gestern Nachmittag langweilig und da habe ich gebacken«, erklärte sie und schob die Schachtel zu Thea und mir herüber.
Tatsächlich hatte sie recht, allein der Anblick der Plätzchen machte mich ein klein wenig glücklicher. Und der Geschmack erst! »Danke, Melli«, nuschelte ich kauend.
Melinda lächelte.
»Bekomme ich auch eins?«, fragte plötzlich jemand hinter mir.
Das Plätzchen blieb mir beinahe im Hals stecken, während sich unzählige, aufregende Gefühle in mein Herz schlichen. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, wer hinter mir stand. Diese Stimme gehörte eindeutig Tobias, dem wunderschönen, cleveren, charmanten, witzigen, gut gekleideten Tobias mit den schokobraunen Augen und dem hellbraunen Haar. Dem tollsten Typen der Schule.
Er hatte im letzten Jahr die zehnte Klasse wiederholen müssen. Warum, konnte ich allerdings nicht nachvollziehen – seine Intelligenz überstieg die der restlichen Kerle bei Weitem. Er war der einzige Junge in unserer Klasse, der wusste, wie man mit Mädchen redet, war der mit dem heißesten Körper – und außerdem leider der Freund meiner besten Freundin.
»Hi, Tobi«, begrüßte ich ihn neckend, weil er es hasste, so genannt zu werden. Es sei nur ein Name für Hunde, meinte er.
»Halt die Klappe, Feuermelder«, zischte er grinsend, bevor er Thea einen Kuss gab.
Das tat er jeden Morgen, aber trotzdem fuhr mir dabei immer noch ein eifersüchtiger Stich durchs Herz. Noch so ein Grund, warum ich den täglichen Ablauf meines Lebens nicht besonders mochte. Um das zu überspielen, nahm ich mir gleich zwei Schokoplätzchen.
Dass er mich Feuermelder nannte, störte mich dagegen weniger, schließlich hatte ich seit meiner Geburt rote Haare. Allerdings war es eigentlich kein Feuerrot, sondern eher ein Blutrot. Oft wurde ich nach meiner Tönung gefragt und sogar meine Friseurin war der Meinung, dieses dunkle Rot gäbe es als natürliche Haarfarbe gar nicht.
»Hat jemand von euch die Hausaufgaben gemacht?«, fragte Tobias, während er seine Arme um Theas Hüfte schlang.
»Natürlich«, antwortet Melinda.
»Hausaufgaben?«, fragte Thea. Sie sah mich ratlos an, aber ich zuckte die Schultern. Wir hatten gestern den ganzen Abend telefoniert und beide keinen Gedanken an die Schule verschwendet.
»Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige«, seufzte Tobias zwinkernd. »Ist eh zu spät.«
Tatsächlich dauerte es keine ganze Minute mehr, bis unsere Englischlehrerin hereinmarschierte und ihre abgewetzte Ledertasche auf das Pult knallte.
Thea und Tobias huschten auf ihre Plätze zwei Bänke weiter hinten und ich ließ mich auf meinen Stuhl neben Melinda fallen.
Der Duft von Tobias’ Deo hing noch in der Luft. Verdammt! Er war der Freund meiner besten Freundin. Ich biss die Zähne zusammen und fühlte, wie mir Melinda beruhigend über den Arm strich. Sie war die Einzige, die wusste, was in mir vorging, wenn er in der Nähe war.
»Schon gut, danke«, wisperte ich ihr zu.
Der Unterricht hatte bereits angefangen, aber ich hörte kein Wort von dem, was die Lehrerin erzählte. Mein Verstand kämpfte immer noch gegen die verbotenen Gefühle. Warum konnte man Verliebtheit nicht einfach abstellen?
Ich kannte Tobias seit vorletztem Herbst, als er in unsere Klasse gekommen war. Mir war sofort aufgefallen, dass er anders war als die anderen Typen. Er war weniger kindisch, seine Witze waren cool und er beleidigte jüngere Schüler nicht, um sich überlegen zu fühlen. Die Mädchen hatten ihn umringt, bewundert und kein Geheimnis daraus gemacht, was sie von ihm hielten. Viele hatten sich an ihn herangemacht, aber er hatte sich für Thea entschieden. Natürlich. Sie hatte diese offene Art, die man einfach lieben musste. Die beiden waren ein tolles Paar, fast schon zu toll und ein bisschen zu kitschig. Warum also konnte ich sie immer noch nicht zusammen ertragen?
»Alice!« Die vorwurfsvolle Stimme meiner Lehrerin riss mich in den Klassenraum zurück. Ich sollte irgendeinen Text vorlesen, doch ich hatte keine Ahnung, welchen.
Blitzschnell schob mir Melinda ihr aufgeschlagenes Buch hin und tippte auf die Stelle, die vorgelesen werden sollte.
Nicht einmal ich hörte mir zu, während ich den kurzen Text tonlos herunterratterte. Danach bemühte ich mich um Mitarbeit, aber ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Gedankenverloren malte ich Blümchen in mein Heft. Würde ich jemals jemanden finden, der so war wie Tobias? Der aber mich liebte, nicht Thea … Verdammt! Thea hatte es verdient, mit Tobias zusammen zu sein! Ich hatte ja wenigstens eine tolle Familie, die hinter mir stand, doch ohne Tobias wäre Thea allein gewesen, denn ihre Eltern arbeiteten Tag und Nacht und waren mehr mit sich selbst als mit ihrer Tochter beschäftigt.
Ich erschrak, als mich plötzlich etwas am Kopf traf. Verdutzt wirbelte ich herum und sah in Piets feixendes Gesicht. Na toll. Hörte das denn nie auf?
»Alice, geh zurück in dein Wunderland!«, knurrte er leise und bewarf mich mit einem weiteren Papierkügelchen.
»Jeder Ort ist ein Wunderland, solange du nicht dort bist!«, zischte ich zurück. Wenn der wüsste, dass mich meine Eltern tatsächlich nach der englischen Romanfigur benannt hatten.
Entnervt drehte ich mich wieder nach vorn. Leider stieß ich dabei Melinda an, die vor Schreck ihren Kugelschreiber fallen ließ. Klappernd landete er auf der Tischplatte und rollte dann auf der mir abgewandten Seite vom Pult. In derselben Sekunde spürte ich etwas Seltsames. Einen Adrenalinstoß, als säße ich in einer Achterbahn. Eine Mischung aus abgrundtiefem Hass und unbändiger Freude. Eine Energie wie von tausend Stromschlägen durchfuhr mein Herz. Die Abscheu, die ich gegenüber Piet empfand, der hilflose Zorn vom Morgen und all meine Gereiztheit sprangen an die Oberfläche wie die Lava bei einem ausbrechenden Vulkan. Ich fühlte mich als Teil der Welt und gleichzeitig war ich ganz woanders. Die Realität verschwand aus meinem Blick, als hätten die wilden Emotionen sie verdrängt. Es war einfach berauschend! Mein Geist verließ für einen Augenblick die Wirklichkeit, als würde ich von einem wilden Strudel mitgerissen werden, der mich ins Unbekannte trieb. Ich verspürte Sehnsucht, Gier und enorme Erleichterung zugleich. Im nächsten Augenblick hielt ich Melindas Stift in der Hand und alles war wieder wie zuvor.
Die beigen Wände des Klassenzimmers rückten wieder in mein Blickfeld und der Rausch in meinem Inneren war vorbei. Ich fühlte mich allerdings wesentlich besser als zuvor – so energiegeladen und wach wie lange nicht mehr.
»Wie hast du den denn gefangen?«, wisperte Melinda entsetzt und deutete auf den Stift.
Ich antwortete nicht. Ja, wie hatte ich das gemacht? Immerhin war das Ding auf der anderen Seite des Tisches heruntergefallen. Oder?
Mein Herz schlug zu schnell, mein Atem ging rasselnd, als wäre ich gerannt.
»Alles in Ordnung?«, fragte Melinda leise.
»Ja, alles gut.« Und es stimmte, ich fühlte mich wie berauscht und irgendwie … mächtig.
Mir war das schon öfter passiert. Ich vollbrachte dann unwahrscheinliche Taten und spürte genau dasselbe berauschende Hochgefühl. Ob ich beim Dartspiel mit meinem Vater genau in die Mitte traf, eine fallende Tasse im letzten Moment fing oder das Gleichgewicht verlor und doch nicht stürzte. Das Gefühl, dieser Rausch, brach in solchen Momenten immer über mich herein.
Einmal hatte ich sogar etwas erlebt, das wie eine Art Vision gewesen war. Kurz vor Weihnachten hatte ich in der Schule gesessen und urplötzlich eine Plätzchensorte vor mir gesehen. Noch niemals zuvor hatte ich diese Kekse gesehen, geschweige denn gegessen, aber am selben Abend hatte meine Mutter beschlossen, genau diese Plätzchen zu backen. Es war eine Kleinigkeit, nur etwas Gebäck. Doch das imaginäre Bild war mit dem seltsamen Machtgefühl gekommen und mir deshalb im Gedächtnis geblieben.
Aber noch nie war es so stark gewesen. Niemals hatte ich etwas so Unmögliches getan wie gerade. Ich hatte mich ja noch nicht einmal bewegt.
Ich bemerkte, dass mich Melinda noch immer beobachtete, und gab ihr schnell den Kuli zurück.
»Du hast gute Reflexe«, wisperte sie schulterzuckend.
Ja. Ja, das war es. Ich hatte einfach gute Reflexe. Doch warum fühlte ich mich dann so seltsam?
Im Laufe des Vormittags rückte der sonderbare Vorfall immer mehr in den Hintergrund und spätestens nach einem dreißigminütigen Film über Pflanzen in der letzten Stunde machte sich die übliche Langeweile und die Erleichterung darüber, dass der Unterricht vorbei war, in meinem Inneren breit.
Ich war in meine übliche Trägheit zurückgefallen, während meine Freundinnen mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren.
»Und was fangt ihr mit diesem wunderschönen Freitag noch an?«, fragte Melinda, während wir unsere Sachen zusammenpackten.
Ich warf einen schnellen Blick aus dem Fenster. Der Schnee war größtenteils zu Matsch geworden und der Himmel so grau wie das Fell einer Kanalratte.
»Ich habe sturmfrei und verbringe deshalb den ganzen Abend mit Tobias am Pool«, erzählte Thea begeistert. »Vielleicht bedienen wir uns noch am Champagner meiner Eltern – auf jeden Fall wird das der beste Abend meines Lebens!«
Ich war froh, dass sie uns nicht auch erzählte, was sie danach mit Tobias machen würde.
»Und du, Alice?«, fragte sie mich mit leuchtenden Augen.
»Ähm … Mein Opa hat Geburtstag. Also werde ich Kuchen essen, die Brille meiner Oma suchen und mir Vorträge darüber anhören, wie sehr ich doch gewachsen bin. Außerdem werde ich Fragen beantworten, ob ich endlich weiß, was ich mal werden will, und wie meine Noten sind«, antwortete ich missmutig. Ich verzweifelte nicht gerade bei Familienfeiern so wie einige meiner Klassenkameraden, aber es gab sicherlich spannendere Arten, einen Freitagnachmittag zu verbringen.
»Hm …«, seufzte Melinda, während wir langsam aus dem Schulgebäude spazierten, »ihr habt also alle etwas vor. Ich hatte gehofft, wir könnten mal wieder ins Kino gehen.«
»Nächste Woche«, versprach ich ihr.
Für Melinda und mich waren vereinzelte Ausflüge zum Kino der nächstgelegenen größeren Stadt die einzige Abwechslung zum Alltagstrott.
Gerade wollte ich sie nach einem Film fragen, da packte Thea meinen Arm und deutete in Richtung Schulhof. »Seht mal, wer wieder da ist«, zischte sie.
Überall standen Schüler, die aufeinander warteten und sich unterhielten, sodass ich zuerst nicht erkannte, wen sie meinte. Doch dann sah ich ihn: Chris.
Ganz allein trottete er vom Schulgelände. Sein schwarzes Haar fiel ihm beinahe bis auf die Schultern und bedeckte die Hälfte seines Gesichts. Sein Blick war zu Boden gerichtet, vermutlich hatte er uns nicht einmal bemerkt. Doch es war ein beeindruckendes Bild, wie er sich einen Weg durch die Menge bahnte. Er trug eine schwarze Lederjacke, einen schweren Nietengürtel und zerrissene schwarze Jeans. Allerdings sorgte nicht nur die düstere Kleidung für diesen Eindruck, sondern vielmehr die abweisende dunkle Aura, die von ihm ausging und die ihn irgendwie außergewöhnlich machte. Er war in der zwölften Klasse und hatte unter den Schülern den Ruf, gefährlich zu sein.
»Oh mein Gott! Was will der denn wieder hier? Und vor allem, wo war er?«, hauchte Melinda schockiert. Ihrem Blick nach zu urteilen, dachte sie an Gefängnisse, Psychiatrien und Friedhöfe. Als fürchtete sie um ihr Leben, trat sie einen Schritt zurück.
Sie war bei Weitem nicht die Einzige, die Angst vor Chris hatte. Jeder aus der Schule machte einen großen Bogen um ihn – jeder außer mir.
Wir waren einmal Partner bei einem klassenübergreifenden Projekt gewesen und seitdem verband uns so etwas wie Freundschaft.
»Ich frag ihn, wo er war«, verkündete ich.
»Alice, nein! Du redest nicht mit dem. Er ist nicht gut für dich.« Thea sah mich an, als wollte ich einen Menschenfresser zum Mädelsabend einladen. Aber ich kannte diese sinnlosen Warnungen und meine Freunde kannten meine Antwort. »Oh doch, das werde ich. Lauft einfach schon mal vor, ich komme nach«, rief ich noch über die Schulter. Dann ging ich trotz der entsetzten Blicke meiner Freundinnen zu Chris. »Hey, Massenmörder!«, rief ich.
Chris hob den Kopf und grinste. Er wusste, dass ich das nicht ernst meinte. »Hi, Alice. Wie geht’s?«
»Gut, aber was ist mit dir? Ich habe dich die letzten zwei Wochen kein einziges Mal gesehen.«
Chris holte Luft, um zu antworten, doch dann fiel sein Blick auf etwas hinter mir. Es waren Melinda und Thea, die in sicherem Abstand warteten, aber zu uns herüberstarrten. Chris schnitt ihnen eine Grimasse, dann zog er sich mit irrem Blick den Finger über die Kehle.
Ich schnaufte, während meine Freundinnen auf dem Absatz kehrtmachten und in Richtung Bushaltestelle liefen. »Das wird dein Image als potenzieller Amokläufer aber nicht gerade aufpolieren, wenn du mich fragst.«
»Vielleicht mag ich dieses Image ja«, antwortete er voller Sarkasmus.
»Klar, würde jedem gefallen. Nein, im Ernst jetzt. Wo warst du die letzten zwei Wochen?«
»Der Gebieter hat gerufen und ich musste für ihn ein paar Jungfrauen einsammeln. Ich war zwei Wochen lang ununterbrochen auf der Straße und habe meinen Charme spielen …«
»Deine Geschichte klingt außerordentlich glaubwürdig«, unterbrach ich ihn sarkastisch.
»Komm, die war gut. Wo lag der Fehler?«
»Du hast keinen Charme.«
Er dachte kurz nach, dann schnitt er erneut eine Grimasse. »Schade, dass du das so siehst. Du wärst die Nächste gewesen.«
»Die Nächste, die du dem Teufel auslieferst? Danke!«
Chris knickste spöttisch.
Kopfschüttelnd sah ich ihn an. »Und wo warst du nun wirklich?«
Chris strich sich das Haar aus der Stirn und ließ seinen Blick schweifen.
Vor einer Weile noch hätte ich mich umgesehen, doch inzwischen wusste ich, dass er nichts beobachtete, sondern mir einfach nicht in die Augen sehen wollte.
»Im Knast«, antwortete er schließlich. »Ich hab meine Mutter verprügelt.«
»Hast du nicht«, widersprach ich ärgerlich, aber er sagte nichts mehr. Kurz kam mir in den Sinn, nachzuhaken, ich ließ es aber. Die Knastgeschichte war sowieso schon im Umlauf, egal, ob wahr oder nicht. Gerüchte waren schneller und hielten sich länger als die Wahrheit. Sie verbreiteten sich wie Feuer und waren hartnäckig wie Brandflecken.
Ich hatte schon gehört, Chris sei wegen seiner Aggressionen in Therapie gewesen, seine Mutter sei Alkoholikerin und sein Vater im Gefängnis wegen Mordes. Und niemals hatte er eines dieser Gerüchte bestätigt oder ausgeräumt. Es kümmerte ihn nicht, was andere über ihn dachten, solang sie ihn in Ruhe ließen. Über seine Familie wusste ich nichts. Nur, dass er zu Hause nicht glücklich war, das sah man ihm an.
Chris zuckte mit den Schultern. »Ein paar Leute waren gestern da. Vielleicht darf ich dann endlich zu meinem Onkel ziehen. Aber hey, es ist Freitag, da spricht man über fröhliche Themen. Also, worüber reden wir? Lästern soll gerade sehr angesagt sein.«
Ich musste lachen. Dasselbe hatte er gefragt, als wir uns bei dem Projekt kennengelernt hatten. Worum es dabei gegangen war, wusste ich schon gar nicht mehr, aber an die Pausen erinnerte ich mich. Anfangs hatten wir nicht gewusst, worüber wir reden sollten, natürlich hatte mich sein Ruf verunsichert. Aber seine sarkastische Frage nach einem Gesprächsthema hatte mich schließlich zum Lachen gebracht, was ihn wiederum dazu angestachelt hatte, mir noch mehr sinnlose Fragen zu stellen. Seit diesem Tag verstand ich nicht mehr, warum andere ihm mit Angst und Abscheu begegneten.
»Erzähl mir später mal von den heißen Jungs im Knast, heute habe ich keine Zeit mehr. Ich muss jetzt zum Bus«, sagte ich.
»Soll ich dich vorher noch verprügeln, damit deine Freundinnen etwas zum Tratschen haben?«, fragte er.
Scherzhaft zeigte ich ihm den Mittelfinger und wollte gehen.
»Alice, warte.« Der heitere Ausdruck war von seinem Gesicht verschwunden. »Hältst du mich auch für gestört?«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete ich verwirrt. So etwas hatte er mich noch nie gefragt. Aber seine Stimmungen waren selbst für mich extrem schwer einzuschätzen. Da mir nichts Tiefsinniges und Philosophisches einfiel, versuchte ich es mit einem Scherz. »Würde ich sonst mit dir reden, so ganz ohne Todesangst?«
Er nickte langsam, dann lächelte er und schüttelte den Kopf, wobei sein dunkles Haar ihm wieder über die Augen fiel. »Danke, Alice. Bis Montag«, sagte er, dann ging er in entgegengesetzte Richtung davon.
Ich sah ihm noch kurz nach, dann lief ich zur Haltestelle, an der bereits der Bus stand. Schon wieder war ich spät dran und huschte in letzter Sekunde durch die Türen.
Kapitel 2
Ein einzelner Sonnenstrahl
Chris
Chris wohnte in demselben kleinen Ort, in dem auch die Schule war.
Seine Füße trugen ihn nur langsam die mit Kopfstein gepflasterten Gehwege entlang. Er hatte es nicht eilig, nach Hause zu kommen. In Gedanken ging er das Gespräch mit Alice noch einmal durch und lächelte. Sie war die Erste gewesen, mit der er seit Tagen überhaupt richtig gesprochen hatte. Also warum hatte er sie angelogen? Wahrscheinlich, weil die Lüge besser zu seinem Image passte. Image als potenzieller Amokläufer hatte Alice es genannt. Und nein, es gefiel ihm nicht, aber es beschützte ihn, also tat er nichts dagegen. Vielleicht hatten diejenigen, die ihn für gefährlich hielten, ja recht? Vielleicht war er gefährlich. Noch während er sich vorstellte, wie befriedigend es wäre, Jungen wie Tobias zu schlagen, erreichte er sein Elternhaus.
In seinem Magen bildete sich ein Kloß aus Angst, als er den Schlüssel ins Schloss schob. Er war achtzehn. Er könnte ausziehen. Doch wohin?
»Mama?«, rief er in den dunklen Flur, dann schloss er die Tür hinter sich. Kein Licht drang durch die abgedunkelten Fenster aus den angrenzenden Zimmern. Chris warf seinen Rucksack ab, schlüpfte aus der Lederjacke und tappte in die Küche. Dort zog er an den Rollläden, bis genügend Licht hereindrang. Er erschrak nicht, als er seine Mutter am Tisch sitzen sah, dürr und blass wie ein Geist, mit einer Puppe auf dem Schoß. Als er am Morgen das Haus verlassen hatte, war sie noch im Bett gewesen, und er vermutete, dass sie seit dem noch nichts gegessen hatte. Also öffnete er auf der Suche nach etwas Essbarem den Kühlschrank und die Schränke.
Während er wortlos am Herd hantierte, hob sie irgendwann den Kopf. »Wo warst du?«, fragte sie mit zitternder Stimme.
»In der Schule.«
»Wo ist deine Schwester?«
»Ich habe keine Schwester, Mama.«
»Ist es schon Morgen?«
»Es ist bereits Nachmittag.«
Sie machte ein überraschtes Gesicht und sah ihre Puppe an.
Chris stellte ihr einen Teller mit dampfenden Nudeln hin und kippte aus dem Topf Soße darüber, dann setzte er sich neben sie. Behutsam schob er ihr Löffel für Löffel zwischen die spröden Lippen. »Möchtest du es selbst probieren?«, fragte er, doch seine Mutter reagierte nicht.
»Bleibst du jetzt wieder bei mir?«, fragte sie, als der Teller leer war.
»Ich muss zur Schule. Wenn ich noch länger fehle, schaffe ich mein Abitur nicht«, erklärte er geduldig und begann selbst zu essen.
Seine Mutter schwieg und rührte sich auch nicht, als er Teller und Töpfe abspülte. Erst als er die Küche verlassen wollte, sah sie erneut auf. »Du verlässt mich wieder!«
»Ich war zwei Wochen ununterbrochen bei dir«, flüsterte er. »Du kannst auch allein klarkommen.« Dann huschte er, so schnell es ging, nach oben in sein Zimmer.
Er konnte seiner Mutter nicht noch länger dabei zusehen, wie sie immer mehr den Verstand verlor. Das ertrug er nicht. Sie war schon immer etwas fahrig gewesen, doch seit sein Vater sie vor Jahren verlassen hatte, ging es mit ihrer geistigen Gesundheit bergab. Sie weigerte sich, sich untersuchen zu lassen. Also konnte Chris nicht viel tun, nur für sie da sein, auch wenn ihn das von Tag zu Tag immer mehr auffraß. In den letzten beiden Wochen war sie so unstabil gewesen, dass er es nicht gewagt hatte, sie tagsüber allein zu lassen. Er hatte für sie gekocht, ihr auf seiner Gitarre vorgespielt und sie zu Bett gebracht. Doch jetzt konnte er einfach nicht mehr. Mit zitternden Fingern schrieb er auf seinem Handy eine Nachricht an seinen Onkel. Es war eine kurze Botschaft, weniger um etwas mitzuteilen, als vielmehr ein verzweifelter Hilferuf.
Ich kann sie nicht mehr pflegen.
Chris drückte auf Senden und warf das Handy auf sein Bett. Er hatte Angst vor der Antwort – Angst, dass sich nichts ändern würde. Um sich abzulenken, arbeitete er an diesem Nachmittag allen versäumten Stoff der letzten zwei Wochen nach. Es war nicht leicht gewesen, an alle nötigen Unterlagen zu gelangen, da ihm keiner aus seiner Klasse freiwillig die Aufzeichnungen geben wollte. Verdammt, sie hatten ja noch nicht einmal mit ihm reden wollen!
Ein bitteres Lächeln stahl sich auf seine Lippen, als er an die Scheu seiner Mitschüler dachte. Schließlich, nachdem er bei allen nachgefragt hatte, hatte er sein Image genutzt und einen Jungen so eingeschüchtert, bis er ihm Fotos der Mitschriften geschickt hatte. Eine seltsame Art, um Hilfe zu bitten, doch was für eine Wahl hatte er gehabt?
Chris arbeitete, bis es dunkel wurde. Dann drehte er seine Musik auf und holte seinen Skizzenblock hervor, um seinem Gehirn bloß keine Denkpause zu gönnen. Es sollte beschäftigt sein. Die düsteren Gedanken würden früh genug zurückkehren.
Er sah nicht auf sein Handy, verließ nicht das Zimmer und bemühte sich, sowohl die Außenwelt als auch seine Gedanken und Gefühle zu verdrängen.
Regen prasselte gegen die Fensterscheiben und Blitze erhellten immer wieder das Zimmer, doch er hörte keinen Donner durch die Musik.
Er war in seiner eigenen Realität, zeichnete eine Welt aus Dunkelheit, übertrug sie auf eine Leinwand und schuf sich einen Wald aus matten, düsteren Farben. Nur ein einzelner blassgoldener Sonnenstrahl brachte Licht in das Schwarz und düstere Grün. Es war ein gutes Bild. Chris meinte, darin Zweifel und Hoffnung ebenso deutlich zu sehen wie die gemalten Bäume. Und als er den letzten Farbtupfer auf seinen Lichtschimmer setzte, dachte er an Alice.
Inzwischen war es Nacht geworden. Das Gewitter war weitergezogen und die Musik ruhiger, doch sein Herz fürchtete sich immer noch davor, seinen Kopf ungestört denken und seine Gedanken wandern zu lassen. Also blätterte er trotz der späten Stunde die Seite in dem Skizzenbuch um und zeichnete ein Porträt, bis er darüber endlich einschlief.
Er träumte von einem anderen Leben, in dem er frei von seinen Pflichten und Sorgen war. Ein Leben, das seinem absolut unähnlich war.
Kapitel 3
Kein Tag wie jeder andere
Grau in Grau wie das Bild eines traurigen Malers. Nur ein einzelner blassgoldener Sonnenstrahl brachte Licht in das Schwarz und düstere Grün der Wälder. Er schien durch die Wolken und traf auf die Erde, um dem trüben Dunst zu trotzen, der sich seit heute Morgen so hartnäckig hielt.
Ich starrte aus dem Autofenster und betrachtete die vorbeirauschende Landschaft, die aus Bäumen und Feldern bestand. Große Pfützen hatten sich auf den Äckern gebildet, in denen sich der Himmel noch dunkler spiegelte, als wären sie Eingänge zu düsteren Welten. Die Straße schlängelte sich an den Feldern entlang, als wäre sie gebaut worden, um jedes einzelne besichtigen zu können. Hier, irgendwo im nirgendwo, war so gut wie kein Verkehr und mein Vater fuhr viel zu schnell, weil wir bereits spät dran waren.
Erst als wir nach einer langen Strecke durch Felder, Wald und Wiesen wieder ein Dorf erreichten, drosselte er das Tempo. Hier hingen schon bunte Plastikeier an den Bäumchen und in den Fenstern standen gelbe Osterglocken.
Meiner Mutter war das anscheinend ebenfalls aufgefallen. »Wir haben noch gar nichts für Ostern vorbereitet«, murmelte sie gedankenverloren.
»Oha!« Mein Vater schnaufte.
Meine Eltern diskutierten über die Vorbereitung des Osterfestes, während ich weiter aus dem Fenster sah und über den Vormittag nachdachte. Das seltsame Gefühl, was ich in der Englischstunde gehabt hatte, kam mir inzwischen übertrieben und kindisch vor. Ich hatte schließlich nur einen Stift aufgefangen. Vermutlich hatte ich mir den Umstand, dass er auf der anderen Seite des Tisches heruntergefallen war, nur eingebildet. Ja, so musste es gewesen sein. Langsam sollte ich wirklich aus meiner Fantasie aufwachen und lernen, erwachsen zu denken. Erst das kindische Gejammer wegen Tobias und dann auch noch von übernatürlichen Ereignissen! Das musste aufhören.
Wir ließen das kleine Dorf hinter uns und bogen in den dichten Wald ein. Jetzt war es nicht mehr weit. Die Straße wurde schmaler, holpriger und ging schließlich in Waldboden über. Das Auto rumpelte heftig, als mein Vater es auf einen matschigen Parkplatz lenkte. Der gepflasterte Hof war schon voll besetzt mit verschiedenen Wagen. Hier, auf einem uralten Bauernhof mitten im Wald, wohnten meine Großeltern.
Der halb verfallene Stall diente ihnen als überdimensionale Hundehütte und die umgebaute Scheune war für unsere Familienfeiern wie geschaffen. Das dreietagige Haupthaus mit ausgebautem Dachboden war eigentlich viel zu groß für zwei Personen. Doch meine Großeltern weigerten sich, umzuziehen oder wenigstens die ungenutzten Zimmer zu vermieten. Bei einer großen Familie brauche es eben ein paar Räume mehr, behaupteten sie immer.
Ich stieg aus dem Auto aus und atmete die frische Waldluft ein. Herrlich! Nachdem ich zwei Stunden im stickigen Wagen gesessen hatte, war mir sogar die Kälte willkommen. Auch wenn hier nicht mehr so viel Schnee lag wie bei uns zu Hause, so war vom Frühling auch noch nichts zu sehen. Der Himmel über dem Wald war grau und hinter den Bäumen konnte ich schwarze Gewitterwolken aufragen sehen. Eine lauernde Brise schlich über den Hof und die Luft schmeckte nach Regen.
Meine Eltern stiegen ebenfalls aus dem Auto. Mit unserem Gepäck und dem Geschenk machten wir uns auf den Weg ins Haus, begleitet von dem aufgeregten Gebell von zwei Schäferhunden, während der dritte nur träge auf dem Hof liegen blieb. Ich kraulte die beiden etwas und tätschelte ihre Köpfe, dann schickte ich sie fort.
Die alte Haustür quietschte beim Öffnen laut wie das Tor einer Burg. Im Flur stapelten sich haufenweise Schuhe, von den quirligen Kinderschuhen meiner Cousins über robuste Alltagsschuhe bis hin zu den Pantoffeln meiner Großeltern. Wir stellten unsere Schuhe dazu und betraten den Wohnbereich.
Eine meiner Tanten, Inge, stand in der Küche. Sie begrüßte uns fröhlich und rührte in verschiedenen Schüsseln. Es roch nach Braten, aber sie schubste mich vom Topf weg, als ich hineinsehen wollte. »Das ist für heute Abend. Du kannst dir den Kuchen anschauen«, sagte sie mit gespielter Strenge und deutete auf eine hinreißend duftende Erdbeertorte.
»Hast du die gebacken?«, fragte ich begeistert.
»Natürlich. Und ich bin noch nicht fertig.« Lächelnd holte sie ein Blech frischer Muffins aus dem Ofen.
»Wo sind die anderen?«, fragte mein Vater, ohne den Blick vom Gebäck zu nehmen.
»Irgendwo im Haus verteilt. Die Knirpse sind im Garten und Nora ist einkaufen gefahren.«
»Wie? Mit einem Auto?«
»Ja«, Inge verzog gequält das Gesicht, »und zwar mit meinem Auto.«
Ich lachte laut.
Nora war meine Cousine – meine einzige Cousine unter vielen Cousins. Sie war zwei Jahre älter als ich und hatte gerade ihren Führerschein gemacht. Allerdings fragten wir uns alle, wie das möglich gewesen war, denn ihr Fahrstil war katastrophal.
»Es wird schon heil zu dir zurückkommen«, sagte ich grinsend zu Inge.
Ich blieb in der Küche, während meine Eltern das Gepäck in unsere Zimmer brachten und den Rest der Familie begrüßten. Es war immer schrecklich für mich, allen Guten Tag zu sagen und mit jedem denselben langweiligen Small Talk machen zu müssen. So lief es bei jedem Treffen. Es fühlte sich fast wie ein weiterer Alltag an, dem es zu entfliehen galt. Also schob ich es noch ein wenig auf. Kurz vor dem Essen würde ich in der Scheune ohnehin auf die geballte Verwandtschaft treffen. Wie üblich würde es laut und sehr lebhaft zugehen. Irgendwer stritt grundsätzlich, mindestens eins der Kinder schrie und die Luft wurde schnell dick. Ich dagegen zog es vor, während der Familientreffen ein ruhigeres Gespräch mit einzelnen Familienmitgliedern zu suchen. Das war interessanter und wesentlich angenehmer. Und so hatte ich mir das jetzt auch mit Tante Inge vorgestellt. Doch diesmal ging mein Plan nicht auf.
Schon nach wenigen Minuten schimpfte sie: »Oh, Mist! Jetzt ist Schokoladenglasur auf meinem Kleid!«. Sie trug ein weißes Sommerkleid mit schwarzen Punkten, eigentlich viel zu dünn für diese Jahreszeit. »Alice, du machst mich ganz nervös.« Angesichts ihrer grellgelben Strickjacke, die bereits mit etlichen Backzutaten bekleckert war, wollte ich ihr widersprechen, doch sie ließ mich nicht. »Das ist nicht böse gemeint, aber bitte verschwinde aus der Küche, sonst werden die Muffins nie fertig.« Sie schob mich zur Tür hinaus und ich stand allein im dunklen Flur.
Am Abend war meine Laune noch mieser.
Wir saßen in der ausgebauten Scheune an der langen Tafel und aßen Inges Braten. Er schmeckte köstlich, wie immer.
Aber ich hockte eingeengt zwischen zwei meiner Cousins, zwei von denen, die Inge am Nachmittag als Knirpse bezeichnet hatte. Beide waren vier Jahre alt und hatten wohl beschlossen, die ganze Familie lautstark zu unterhalten. Einer von ihnen sang lauthals, der andere, Johnny, bettelte um irgendein Spielzeug, das er zu Hause vergessen hatte. Anfangs hatten seine Eltern noch versucht, ihn zu beruhigen. Doch inzwischen waren sie in ein Gespräch vertieft und schenkten ihm keine Beachtung mehr, obwohl sie direkt neben ihm saßen. Johnny kreischte - hoch, schrill und viel zu nahe an meinem Ohr. Wie konnten sie bei dem Gezeter so ruhig bleiben?
Angespannt rückte ich ein Stück von ihm ab. Doch das nutzte nicht viel, denn jetzt saß ich zu nah an dem kleinen Sänger. Meine Nerven protestierten.
Nora warf mir einen mitfühlenden Blick zu. Lange war der Stuhl zwischen den beiden Jüngsten ihr Platz gewesen, aber ihr achtzehnter Geburtstag hatte sie auf magische Weise davon erlöst. Jetzt saß sie entspannt neben ihrem dreizehnjährigen Bruder Mark. Die Glückliche!
Nun begann Johnny auch noch, ohrenbetäubend zu heulen und zu schreien, aber auch das ignorierten seine Eltern genauso wie der Rest der Familie. Wo blieb da die Erziehung?
Draußen grollte ein Donner über das Haus hinweg, der sogar die Kinderstimmen übertönte. Für einen herrlichen Augenblick war es still. Doch kaum ein paar Sekunden später weinten die Kleinen. Angst vor dem Gewitter. Natürlich.
Ich gab mir Mühe, dem Beispiel meiner Familie zu folgen und das Geschrei zu ignorieren, doch es war schwer. Mit zusammengepressten Lippen schnitt ich an meinem Braten herum, während ich versuchte, ruhig ein- und auszuatmen. Bissen für Bissen schob ich dann langsam zwischen meine Zähne und konzentrierte mich auf das Kauen.
Die beiden Knirpse bekamen nun doch Ärger. Aber Johnny verschränkte nur kreischend seine kleinen Ärmchen und rückte demonstrativ von seinen Eltern ab. Er stieß mich an, worauf eine Kartoffel auf halbem Weg zu meinem Mund wieder von der Gabel rollte.
Ein neuer Schwung Gereiztheit durchbrach meine erzwungene Ruhe. Von Sekunde zu Sekunde nahm ich die aufdringlichen Geräusche stärker wahr und meine Nerven spannten sich. Jeder Ton schien sich zu vervielfachen, bis der Lärm unerträglich wurde. Johnnys Geschrei, das Klappern von Geschirr und die Gespräche der Erwachsenen, es war einfach zu laut. Plötzlich war ich nicht mehr in der Lage, weiterzuessen. Ich wollte nur noch weg. Nach draußen, in den Regen, nach Hause oder nach Australien, wohin auch immer. Mein Kopf drehte sich, mein Herz schlug unregelmäßig und plötzlich war es wieder da, das Gefühl von heute Morgen. Dieser Rausch, diese endlose Wut, sogar der Anflug von Macht pulsierte durch meine Adern. Es fühlte sich schrecklich und großartig zugleich an. Mein ganzer Körper stand unter Strom, bis sich in meinem Inneren ein Ventil öffnete. Es war, als zerreiße etwas in meinem Geist, dessen Überreste blitzartig davonstoben. Die Anspannung hatte sich ganz plötzlich aufgelöst und ein ungeheurer Druck wich damit von meiner Brust. Ich atmete immer noch heftig, aber meine Nerven entspannten sich, die Gereiztheit verflog und ich wurde wieder ruhiger. Die Verbindung war verschwunden.
Und dann wurde es still im Raum.
Erst dachte ich, jemand hätte bemerkt, was mir passiert war, aber schnell begriff ich, dass ich mich irrte. Johnny war auf dem Stuhl zusammengesunken und zuckte wie ein Fisch auf dem Trockenen. Seine Augen rollten unkontrolliert in den Höhlen und er rutschte langsam vom Stuhl. Dem Schock folgten hastiges Stühlerücken und sorgenvolles Gemurmel.
Ich bekam gerade noch mit, wie jemand einen Krankenwagen rief, bevor ich nach draußen stürmte. Ich lief am Haus vorbei, über den Hof, den schlammigen Parkplatz, hinein in den Wald. Donner brüllte über mir und der Regen prasselte hart auf meinen Körper und mein Gesicht, doch es fühlte sich richtig an. Als würde das Gewitter meinen Geist reinigen.
Zitternd lehnte ich mich gegen einen Baum. Es war unmöglich, absolut absurd und abwegig. Trotzdem hatte ich das Gefühl, verantwortlich für Johnnys Anfall zu sein. Aber wie sollte ich das verursacht haben? Ich hatte ihn nicht einmal berührt! Nein, es war unmöglich. Das konnte einfach nichts mit mir zu tun haben! Nur was hatte er dann?
Sobald ich die Sirenen des Krankenwagens hörte, wich ich in den Wald zurück wie ein scheues Tier. Was war nur los mit mir? Durch die kahlen Zweige sah ich, wie Inge die Sanitäter zu ihrem Sohn führte.
Dann wurde es für lange Zeit still auf dem alten Bauernhof. Nur der Regen trommelte weiter auf alles, was er fand. Klare Tropfen stoben von Blättern, durchnässten meine Kleider und zerplatzten auf dem Waldboden. Inzwischen zitterte ich nicht mehr vor Schock, sondern vor Kälte. Ich hockte mich hin und schlang die Arme um meinen Körper. Mein Haar klebte nass an meinem Gesicht. Es wirkte im Regen mehr schwarz als rot. Auch wenn ich nichts dafürkonnte, auch wenn meine Einbildungen unrealistisch waren, so hatte ich dennoch schreckliche Schuldgefühle. Was hatte ich getan? Da war dieser Hass gewesen, eine Art von Wahnsinn, und dann war Johnny schon vom Stuhl gefallen. Als hätte ich irgendetwas auf ihn übertragen …
Das tiefe Bellen eines Hundes riss mich aus meinen Gedanken. Ich hob den Kopf, um besser durch die Zweige spähen zu können. Das Scheunentor stand nun offen und die Sanitäter transportierten Johnny heraus. Er lag auf einer Trage und regte sich nicht. Es gab einen dumpfen Knall, als die Türen des Krankenwagens geschlossen wurden, dann rumpelte er mit Blaulicht und schriller Sirene davon. Ein Geräusch, das einfach nicht in diesen friedlichen Wald passen wollte. Meine ganze Familie stand dort im Regen. Sie blickten auf die Spuren, die der Krankenwagen im Waldboden hinterlassen hatte. Niemand bemerkte mich.
Ich vergrub das Gesicht in den Händen und versuchte, an gar nichts zu denken. Es gelang mir nicht. Wenn man einen kleinen Jungen auf dem Boden liegen und krankhaft zucken gesehen hatte, vergaß man das nicht in einer halben Stunde. Man vergaß es wahrscheinlich nie. Und erst recht nicht, wenn man kurz vorher eine unheimliche Macht in den eigenen Gedanken gespürt hat. Verdammt, was war nur passiert?
Ich erschrak furchtbar, als eine sanfte Stimme meinen Namen aussprach. Es war meine Oma. Meine kleine, zerbrechliche Oma, die am Stock ging, fast blind war und mich trotzdem irgendwie gefunden hatte.
»Wie geht es Johnny?«, fragte ich, ohne aufzusehen.
»Ich weiß es nicht. Sie haben ihn ruhiggestellt und mitgenommen. Inge und Bastian wollen gleich hinterherfahren. Mädchen, was passiert ist, war nicht deine Schuld.«
Jetzt sah ich doch auf. Woher wusste sie, was ich dachte?
»Komm mit, Alice.«
Ungelenk rappelte ich mich auf und folgte ihr. Sie humpelte über den matschigen Laubteppich, langsam, aber zielstrebig. Es regnete immer noch in Strömen und ich sah, wie sie ihre schwachen Augen zusammenkniff. Genau wie ich trug sie weder Jacke noch Mantel und es war eiskalt.
Ich wickelte meinen Schal ab und hielt ihn ihr über den Kopf. Aus irgendeinem Grund wollte ich die alte Frau unbedingt vor dem Regen schützen.
Dankbar lächelte sie mich an. Das Lächeln meiner Oma war etwas ganz Besonderes. Die Zeit hatte ihr tiefe Furchen ins Gesicht gegraben und ihre Mundwinkel nach unten gezogen, was ihr einen mürrischen Gesichtsausdruck verlieh. Doch wenn sie lächelte, sah sie aus wie ein junges Mädchen im Körper einer alten Frau. Offen, herzlich und dennoch weise.
Zu meiner Überraschung führte sie mich nicht zurück in die Scheune, sondern ins Haus. Genauer gesagt in den Keller. Meine Oma zitterte und schnaufte, während sie die unförmigen Stufen unter enormer Anstrengung hinunterkletterte.
»Ähm … Soll ich dir etwas von unten holen?«, fragte ich.
»Nein, Mädchen«, keuchte sie. »Komm einfach hinter mir her.«
Zweimal wäre sie fast gestürzt, aber irgendwann hatten wir beide es nach unten geschafft und sie humpelte weiter.
Der Keller des Hauses war größer als das Haus selbst. Er hatte drei halbwegs ausgebaute Räume, die als Abstellkammern dienten, und sieben Gewölbe, in denen Kartoffeln, Äpfel und Möhren gelagert wurden. In jedem Raum hing eine einzelne Glühbirne, sonst gab es hier unten keine Elektrizität. Sobald wir die drei Abstellkammern hinter uns gelassen hatten, war es wie ein Labyrinth aus Erde und Stein. Als Kind hatte ich das furchtbar gruselig gefunden und war nie gern in die Gewölbe gegangen. Ich duckte mich unter weißen Spinnenweben hinweg und sah an der Wand dunkle Schatten hin und her huschen. Vermutlich waren es Mäuse. Meine Oma führte mich bis in das letzte der Gewölbe. Alles, was hier lagerte, waren zwei schmutzige, kaputte Traktorreifen.
»Alice, hör mir jetzt gut zu.«
Ich sah überrascht auf. Es war selten, dass sie mich mit meinem Namen ansprach.
»Dein Haar hat die Farbe von Blut, so wie das deiner Cousine und meins, bevor es grau wurde. Hast du dich je gefragt, wieso?«
Ich wusste nicht genau, ob sie eine Antwort auf diese Frage hören wollte oder nicht. Mir wurde flau im Magen. »Ich habe keine Ahnung, warum überhaupt jemand eine bestimmte Haarfarbe hat«, krächzte ich unsicher und versuchte, ihrem durchdringenden Blick standzuhalten.
Sie schwieg kurz, als würde sie mit sich selbst ringen. »Was ich dich jetzt frage«, fuhr sie schließlich stockend fort, »ist sehr wichtig und ich möchte eine ehrliche Antwort.«
Ich nickte, immer noch verwirrt.
»Als Johnny heute zusammengebrochen ist, hast du da etwas gespürt? Etwas Machtvolles wie Hass oder Freude?«
Ich war nicht überrascht, dass sie diese Frage gestellt hatte. Ich hatte das aus irgendeinem Grund wohl schon erwartet, als sie mich im Wald abgeholt hatte. Aber was sollte ich sagen? Würde sie mich für verrückt erklären? Es sollte die Wahrheit sein, hatte sie gesagt. Mein Herz klopfte wie verrückt, und ich hatte Angst, dass es wieder passieren könnte. Dass diesmal meine Oma am Boden liegen würde. »Ja«, brachte ich schließlich heraus.
Sie nickte bedächtig. »Hast du das schon öfter gespürt? Vielleicht in anderen Situationen?«
Diesmal war es leichter, zu antworten. »Ja.«
»Was ist, wenn du einen Raum betrittst? Erschrecken sich die Leute, weil sie dich nicht bemerkt haben?«
»Ja, andauernd.«
»Hast du schon Dinge getan, die dir unmöglich erschienen sind?«
»Ähm … ja, heute Morgen erst.«
»Und hast du auch schon einmal etwas vorausgesehen?«
Gerade wollte ich Nein sagen, da fiel mir die Sache mit den Plätzchen ein. Zählte das als Voraussagung oder war es purer Zufall gewesen?
»Einmal. Glaube ich zumindest«, presste ich schließlich hervor und wartete auf die Reaktion meiner Oma.
Sie schloss die Augen und stützte sich fester auf ihren Stock. »Ich stelle dir jetzt die Frage, die ich ganz am Anfang hätte stellen sollen. Glaubst du an Magie?«
Unter anderen Umständen wäre meine Antwort auf jeden Fall Nein gewesen. Aber so …
Meine Oma schien jedoch nicht wirklich eine Antwort zu erwarten, denn sie sprach bereits weiter. »Mädchen, könntest du diesen Reifen zur Seite schieben?«
Überrascht über den Themawechsel sah ich zu dem Reifen, auf den sie zeigte. Er war groß und sicherlich schwer. »Ich kann es probieren …«, murmelte ich und kniete mich auf den schmutzigen Boden. Dreckig war ich sowieso. Es kostete mich enorme Anstrengung, bis ich es endlich schaffte, das Ding zu bewegen. Es gab ein kratzendes Geräusch und der trockene Gummi ritzte meine Haut ein. »Wie weit zur Seite?«, ächzte ich.
»Noch ein Stück … Stopp!«





























