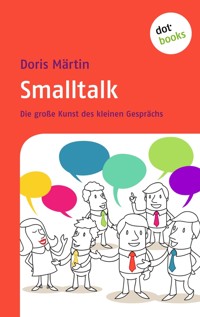Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Michelle Obama, Ugur Sahin, Frank-Walter Steinmeier: Sie erbten keine Privilegien oder Firmen in dritter Generation. Aus bescheidenen sozialen Bedingungen arbeiteten sie sich bis zum Vorbild hoch. Ihre Wege belegen: Das Leben ist nach oben offen. Allen steht frei, größer zu denken und aus Wenigem viel zu machen. In ihrem neuen Buch geht Doris Märtin den Chancen, aber auch den Mühen und Fallen des sozialen Aufstiegs nach. Realistisch und konkret zeigt sie, wie sich das Beste aus den Karten herausholen lässt, die einem das Schicksal zugeteilt hat. Mit 21 strategischen Empfehlungen, erhellenden Studienergebnissen und Erfahrungen prominenter Aufsteiger:innen, die die Brücke zwischen Herkunft und Zukunft sichtbar machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DORIS MÄRTIN
HIER
GEHT’S
HOCH
21 Strategien für den Aufstieg, egal wo Sie stehen
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Michelle Obama, Ugur Sahin, Frank-Walter Steinmeier: Sie erbten keine Privilegien oder Firmen in dritter Generation. Aus bescheidenen sozialen Bedingungen arbeiteten sie sich bis zum Vorbild hoch. Ihre Wege belegen: Das Leben ist nach oben offen. Allen steht frei, größer zu denken und aus Wenigem viel zu machen. In ihrem neuen Buch geht Doris Märtin den Chancen, aber auch den Mühen und Fallen des sozialen Aufstiegs nach. Realistisch und konkret zeigt sie, wie sich das Beste aus den Karten herausholen lässt, die einem das Schicksal zugeteilt hat. Mit 21 strategischen Empfehlungen, erhellenden Studienergebnissen und Erfahrungen prominenter Aufsteiger:innen, die die Brücke zwischen Herkunft und Zukunft sichtbar machen.
Vita
Dr. phil. Doris Märtin begleitet seit über 20 Jahren Menschen und Unternehmen beim wirkungsvollen Auftritt. Als Expertin für Persönlichkeit und Kommunikation gibt sie innovative Impulse für emotionale und soziale Intelligenz, Sichtbarkeit und Exzellenz auf Augenhöhe. In 19 Büchern verknüpft sie psychologische, philosophische und Management-Perspektiven und fasst sie in eine klare Sprache und einprägsame Stories. Wenn es um das Thema Habitus geht, zählt sie zu den bekanntesten Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Bücher erscheinen unter anderem auch in China, Japan, Südkorea, den Niederlanden, Spanien und Italien.
»Leben allein genügt nicht. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu.«
Hans Christian Andersen, Der Schmetterling
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
INHALT
Impressum
INHALT
WIE DER SOZIALE STATUS DAS LEBEN BESTIMMT
Warum Dabeisein nicht alles ist
Schöne Bescherung
Geht da noch was?
Und selbst so?
Gute Aussichten
Kapitel 1
Stellen Sie sich den Tatsachen — Aufsteigen ist nichts für Feiglinge
Hürde 1: Der eingeschriebene Habitus
Hürde 2: Der unterschätzte Klassismus
Hürde 3: Der hinderliche Statusfatalismus
Kapitel 2
Helfen Sie Ihrem Glück auf die Sprünge — Wie Sie sich am eigenen Schopf nach oben ziehen
Aus dem wenigen das meiste herausholen
Bootstrap 1: Was die Familie zu bieten hat
Bootstrap 2: Sag mir, wer deine Freunde sind
Bootstrap 3: Wie die Schule das Leben bestimmt
Bootstrap 4: Wunder gibt es immer wieder
Bootstrap 5: Liebe lieber ungewöhnlich
Kapitel 3
Treten Sie aus Ihrem Schatten heraus — Wenn Cinderella nicht zum Ball geht, begegnet sie auch keinem Prinzen
Aufstieg wie im Märchen
Küss dich wach!
Wie Promikult den Aufstieg behindert
Wunscherfüllung für Selbstabholer
Jenseits von Konsum und Status
Kapitel 4
Legen Sie die bestmöglichen Grundlagen — Warum viele Wege nach oben führen und trotzdem nichts über das Gymnasium geht
Bildung: Nie war sie so wertvoll wie heute
Das engste Nadelöhr im Lebenslauf
Alles Abi, oder was?
Geht doch!
Warum Akademikereltern das Beste gerade gut genug finden
Kapitel 5
Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben — Spielen Sie die Stärken Ihrer Herkunft aus
#1 Improvisationskunst: Aus Nichts etwas machen können
#2 Zielstrebigkeit: Weil von nichts auch nichts kommt
#3 Resilienz: Robust im Nehmen
#4 Nahbarkeit: Dicht dran am Leben
Kapitel 6
Fragen Sie nicht ständig nach dem Nutzen — Denn wer weiter will, muss größer denken
Es war schon immer etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben
Warum der Notwendigkeitsgeschmack den Aufstieg gefährdet
Der Traum, der Luxus des Denkens
Kapitel 7
Nehmen Sie Äußerlichkeiten ernst — Warum Aussehen, Geschmack und Manieren kein Luxus sind
Wohin solls denn gehen?
Wie Sie Anfängerfehler vermeiden
Capsule Habitus #1: Aussehen
Capsule Habitus #2: Umgangsformen
Capsule Habitus #3: Sprechweise
Capsule Habitus #4: Kultiviertheit
Wie ein Fisch im Wasser
Kapitel 8
Ziehen Sie Ihre Familie mit — Weil verwurzelte Bäume am höchsten in den Himmel wachsen
Generationenprojekt Aufstieg
Parallele Universen
Immer schön auf dem Teppich bleiben
Aufsteiger können nicht bleiben, wie sie sind
»Nichts wie weg« ist keine Alternative
Warum es so hilfreich ist, wenn man weiß, wo man herkommt
Gegangen, um zu bleiben: Eine(r) von uns
Der Königsweg: Die Familie mitziehen
Kapitel 9
Lassen Sie sich von Verbündeten nach oben tragen — Denn wir sind nur so stark, wie wir vereint sind
Warum die engsten Kontakte nicht immer die hilfreichsten sind
Mehr als Vitamin B: Was Verbindungen und Verbundenheit auslösen
Warum lose Beziehungen so überraschend wertvoll sind
Wie Sie netzwerken, auch wenn Sie nicht dafür geboren sind
Kapitel 10
Verwirklichen Sie, was für Sie das Höchste ist — Denn Orangen wachsen nicht im Blaubeerfeld
Unbezahlbar: Das Gefühl, gut dazustehen
Was wollen Sie vom Leben haben?
Erfolg hat viele Gesichter
Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun
Kapitel 11
Stärken Sie Ihr Erfolgs-Mindset — Von jetzt an gilt: Persönlichkeit kommt vor Performance
Es ist nicht der Maßanzug, sondern die Mentalität
Vom Leistungsstreben zur Leistungsexzellenz
Vom Irgendwann-später zum Besser-sofort
Vom Erfolgstraum zur Erfolgsgewissheit
Von der Vollkommenheit zur Vervollkommnung
Kapitel 12
Passen Sie sich langsam an die Höhe an — Damit die Psyche mit dem Erfolg Schritt halten kann
Schwachstellen schließen
Angekommen heißt nicht unantastbar
In die neue Rolle hineinwachsen
Auf schwankendem Boden
Im Taumel des Erfolgs
Kapitel 13
Veredeln Sie Ihren Geschmack — Weil Stil fast alles ist und Statussymbole fast nichts
Der Geschmack wandelt sich
Ganz oben sind nicht alle gleich
Das Gleiche, aber auf immer höherem Niveau
Aufgeklärten Wohlstand ahnt man nur
Kapitel 14
Bieten Sie Ihrem inneren Hochstapler die Stirn — Wie Sie aufhören, sich am falschen Platz zu fühlen
In bester Gesellschaft
Das lähmende Fast-Gefühl
Wie Sie den Blick für das eigene Können schärfen
Gegen Selbstüberschätzung immun
Kapitel 15
Versöhnen Sie Herkunft und Zukunft — Wie aus zwei Hälften ein Ganzes wird
Fremde im Paradies
Gutes aus der alten Welt
Dankbar, trotz allem
Die Brüche vergolden
Zwischen Anpassen und Anschmeicheln
Innovation statt Konvention
Kapitel 16
Aktualisieren Sie Ihr Verhältnis zu Geld — Damit nicht immer nur die anderen reich sind
Nur wer Geld hat, kann es ignorieren
Alles in Maßen
Normalmenschen arbeiten für Geld, Privilegierte lassen Geld für sich arbeiten
Kassensturz: Vielleicht sind Sie schon weiter, als Sie denken
Kapitel 17
Gehen Sie in Führung — Als Spitze gilt, wer an ihr steht
Mehr Sichtbarkeit gewinnen
Früh übt sich, wer in Führung geht
Von Anfang an die Weichen stellen
Als Leader (m/w/d) wahrgenommen werden
Wer Führung will, bekommt sie auch
Alle Achtung
Kapitel 18
Knacken Sie die Insider-Codes — Wie sich zeigt, dass Sie dazugehören
Familienstolz und -ehre
Verdienst und Vorurteil
Verantwortung und Unternehmergeist
Diskretion und Understatement
Kapitel 19
Lassen Sie es entspannt angehen — Total normal: Wer oben ankommt, gehört nicht automatisch gleich dazu
Vom Steilaufstieg zum Spitzentanz
Auch Götter sind nicht frei von Neid
Zugehörigkeitssignale aussenden
Find dich gut, sonst tut es keiner
Wenn Ihnen höchstens noch Ihre Emotionen im Weg stehen
Kapitel 20
When they go low, we go high — Weil Haltung und Anstand der Goldstandard sind
Heilige sind wir alle nicht
Gutes tun: Warum es oben dazugehört
Moral ist meistens ein Dilemma
Die Maßstäbe der Statushöheren
Luxury beliefs: Moral ist das neue Statussymbol
Kapitel 21
Holen Sie den Aufstieg aus der Tabuzone raus — Denn wer den Weg gegangen ist, kann ihn am besten weisen
Ich bin dann mal weg
Warum soll es anderen besser ergehen als mir?
Zeige deine Klasse
Starke Worte
LITERATUREMPFEHLUNGEN
Aufstiegsgeschichten in Literatur und Film
Beim Aufstieg helfen auch
ANMERKUNGEN
Wie der soziale Status das Leben bestimmt
1 Stellen Sie sich den Tatsachen
2 Helfen Sie Ihrem Glück auf die Sprünge
3 Treten Sie aus Ihrem Schatten heraus
4 Legen Sie die bestmöglichen Grundlagen
5 Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben
6 Fragen Sie nicht ständig nach dem Nutzen
7 Nehmen Sie Äußerlichkeiten ernst
8 Ziehen Sie Ihre Familie mit
9 Lassen Sie sich von Verbündeten nach oben tragen
10 Verwirklichen Sie, was für Sie das Höchste ist
11 Stärken Sie Ihr Erfolgs-Mindset
12 Passen Sie sich langsam an die Höhe an
13 Veredeln Sie Ihren Geschmack
14 Bieten Sie Ihrem inneren Hochstapler die Stirn
15 Versöhnen Sie Herkunft und Zukunft
16 Aktualisieren Sie Ihr Verhältnis zu Geld
17 Gehen Sie in Führung
18 Knacken Sie die Insider-Codes
19 Lassen Sie es entspannt angehen
20 When they go low, we go high
21 Holen Sie den Aufstieg aus der Tabuzone raus
WIE DER SOZIALE STATUS DAS LEBEN BESTIMMT
14. April 1912, kurz vor Mitternacht, südöstlich von Neufundland. Hundertfach erleuchtet gleitet die Titanic durch die eiskalte Nacht. In drei Tagen sollen die 1 300 Passagiere in New York an Land gehen. Dann geschieht, was ausgeschlossen schien. Ein 300 000 Tonnen schwerer Eisberg schlägt ein 90 Meter langes Leck auf der Steuerbordseite. Zweieinhalb Stunden später nimmt das vermeintlich sicherste Schiff seiner Zeit 809 Passagiere und drei Viertel der Besatzung mit sich in die Tiefe.
Zu den Toten gehören einige der reichsten Menschen der Welt: der Millionär John Jacob Astor, der Tycoon Benjamin Guggenheim, die Miteigentümer der Kaufhauslegende Macy’s Ida und Isidor Straus. Ihre berühmten Namen machen vergessen: Die Überlebenschancen auf der Titanic waren von Rang und Reichtum bestimmt. 63 Prozent der Reisenden der ersten Klasse konnten sich retten. Bei den Passagieren der zweiten Klasse waren es 45 Prozent. Am schlechtesten erging es den Auswanderern in der dritten Klasse. Von ihnen überlebten nur 24 Prozent die Katastrophe.
Ein Blick auf den Längsschnitt der Titanic liefert die Erklärung. Das Leben an Bord bildete wie in einem Brennglas die viktorianische Klassengesellschaft ab: Unten im Schiffsbauch waren die Passagiere der dritten Klasse untergebracht. Ihre Kajüten befanden sich auf den Decks, die als erste geflutet wurden. Darüber lagen die Kabinen der zweiten Klasse. Ganz oben thronten die Suiten der Superreichen, in unmittelbarer Nähe des A-Decks, wo auch die Rettungsboote installiert waren. Die Reisenden der dritten Klasse gelangten dorthin nur, wenn sie sich durch das Gewirr der Gänge und Treppen hocharbeiteten. Aus dem Titanic-Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio wissen Sie: Wenn die ärmeren Passagiere das oberste Deck überhaupt erreichten, waren die wenigen Boote oft schon besetzt und ins Wasser gesenkt.
Warum Dabeisein nicht alles ist
Die Schichtung der sozialen Klassen auf der Titanic mag Ihnen wie ein fernes Relikt erscheinen. Doch sie besteht fort. Bis heute bildet jedes Flugzeug, jedes Theater und so manche Wohnimmobilie gleichsam einen Mikrokosmos der Gesellschaft ab. Wer mehr hat, sitzt weiter vorn, weiter oben und meist auch am längeren Hebel. Das ist ein gutes Gefühl für Habende. Denn ob Eigenleistung oder Zufallsglück, es macht Lust, sich positiv abzuheben. Jedes kleine Like, jede positive Empfehlung, jedes Upgrade in eine bessere Sitzkategorie steigt uns zu Kopf. Dopamin und Adrenalin werden ausgeschüttet und heben das Selbstbewusstsein.
Umgekehrt verhält es sich genauso: Ein winziger Misserfolg nur, und wir fühlen uns schlecht. Wer jemals beim Ballspiel als eine der Letzten ins Team gewählt wurde, spürt physisch: Selbst eine vorübergehende Ausgrenzung beschämt. Man möchte in den Boden versinken und verliert die Motivation. Ein ähnliches Gefühl stellt sich ein, wenn man nach einem ermüdenden Überseeflug in den hintersten Reihen der Economy-Class mit den Füßen scharrt. Einstweilen eilen die Reisenden der First Class schon zur Einreisekontrolle und sind auch dort wieder die Ersten.
Wenn aber schon flüchtige soziale Privilegien und Frustrationen Spuren hinterlassen, um wie viel mehr berührt uns dann die relativ stabile Statusposition, die wir in der gesellschaftlichen Rangordnung einnehmen? Wie prägt und formt uns unser soziales Milieu? Was löst der Vergleich mit anderen in uns aus? Was macht es mit Menschen, wenn sie das Gefühl haben, sozial oder ökonomisch nicht mithalten zu können?
Teilnehmen ist wichtiger als Siegen, unter dieses Motto stellte Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele der Neuzeit. Der Gedanke klingt nobel. Er passt allerdings nicht zu unserer menschlichen Physiologie. Studien der amerikanischen Hirnforscherin Caroline Zink verraten: Wir alle überprüfen ständig, wo wir in der gesellschaftlichen Rangordnung stehen. Sogar ein eigenes Gehirnzentrum besitzen wir dafür. Es ist im ventralen Striatum lokalisiert, und Untersuchungen durch funktionelle Magnetresonanztomographie (MRT) zeigen: Wir hassen es, unterlegen zu sein. Ein Statusabstieg beziehungsweise die Panik davor löst im Gehirn ähnlich starke Erregungszustände aus wie die Angst vor einem Finanzverlust. Kaum sehen wir unseren Rang bedroht, schon sinkt der Serotoninlevel und mit ihm das Wohlbefinden. Wir geraten aus der Balance und wenn wir uns nicht im Griff haben, zeigen wir uns betroffen oder angegriffen und gefährden umso mehr die soziale Anerkennung, an der uns zurecht so viel liegt. Schließlich hängt von unserem Status einiges ab. Sieht man genau hin, gibt es kaum einen Lebenswinkel, wo er keine Rolle spielt.
Schöne Bescherung
Bereits auf neuronaler Ebene lässt sich also erkennen: Wir alle wünschen uns eine gute Position im Leben. Allerdings kommen wir nicht alle gleichermaßen reich beschenkt auf die Welt. Arbeitsmarktforscher vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und der Universität Madrid fassen den Unterschied in Zahlen. Mit Hilfe mathematischer Modellierungen ermitteln sie: Rund 60 Prozent von dem, was bei uns die gesellschaftliche Stellung eines Menschen ausmacht, haben wir von unseren Vorfahren mitbekommen. Neben Begabungen und Talenten erben wir von ihnen auch Geld und Besitz, Manieren, Erfolgsgewissheit und Vitamin B und zwar bis in die Urgroßelterngeneration zurück.
Aus dem Geburtslotto resultieren Ungleichheiten, die sich gewaschen haben. In ihrer Dimension erinnern sie an die Gewinnquoten im Lotto 6 aus 49. Vergleichen Sie einmal: Drei Richtige plus Superzahl bringen Gewinnern gut 20 Euro ein, vier Richtige rund 200 Euro, fünf Richtige circa 20 000 Euro. Damit lässt sich einiges anfangen. Trotzdem wirken selbst fünf Richtige wie Peanuts, wenn man sie mit dem millionenhohen Jackpot vergleicht. Auf der anderen Seite steht natürlich: Die meisten im Spiel gehen komplett leer aus …
Beim Lotto bestimmen die Gewinnklassen die Gewinnhöhe. Im wahren Leben beeinflusst das Milieu, in das Sie hineingeboren wurden, wie Sie in den einzelnen Lebensbereichen abschneiden: beim Einkommen und Vermögen, bei Gesundheit und Bildung, bei der Ausdrucksfähigkeit und den sozialen Beziehungen und darin, welche Möglichkeiten Sie für sich erkennen können. Aus all diesen Aspekten gemeinsam errechnet sich die soziale Position. Besitz und Geld spielen dabei eine Rolle, aber nicht die einzige.
Das Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik malt aus, wie der soziale Rang den Alltag prägt: Kaum jemand im untersten Fünftel der Gesellschaft besitzt Wohneigentum. Nur ein Drittel der Ärmeren nimmt am politischen Geschehen Anteil. Weniger als ein Viertel besucht Ausstellungen oder Konzerte, und überhaupt und vor allem: Von den Kindern aus schlecht gestellten Familien nimmt nur eines von vier ein Studium auf.1 Im obersten Fünftel gestaltet sich das Leben anders: Die Top-20-Prozent verdienen um ein Vielfaches mehr. Fast alle wohnen im eigenen Haus, mischen kulturell und politisch mit, halten sich fit und dass ihre Kinder studieren, ist fast schon gesetzt: drei von vier gehen an die Uni. Der Platz im Leben beeinflusst aber nicht nur die Lebensqualität. Wie auf der Titanic verlängert er die Lebensdauer: Das gut aufgestellte obere Drittel genießt im Schnitt neun gute, gesunde Jahre mehr als das untere.2 Das ist so lang, wie das G9-Gymnasium dauert.
Natürlich sagen Statistiken wenig über den Einzelfall aus. Es gibt Menschen, die mit Wenigem glücklich sind, und andere, die sich rastlos fühlen, egal, wie viel sie erreicht haben. Es hängt also keinesfalls allein vom sozialen Status ab, ob Sie sich innerlich erfüllt und äußerlich anerkannt fühlen. Eine gute Position in der gesellschaftlichen Hierarchie hebt aber die Chancen dafür: Im obersten Fünftel bezeichnen sich 69 Prozent als zufrieden mit sich und der Welt, in der breiten Mitte sind es 50 Prozent, im untersten Fünftel dagegen nur 39 Prozent. Die subjektive Einschätzung gibt zu denken. Fern jeder Neiddebatte, frei von Ressentiments lese ich daraus ab: Der soziale Status ist die halbe Miete, und das nicht mal, weil Reiche schöner wohnen, ferner reisen oder Autos fahren, die ihre Besitzer wie ein Bollwerk vor den Zumutungen der Welt bewahren. Tatsächlich geht es um viel mehr:
Merksatz
Ob ein Neugeborenes in der Sozialwohnung, im Reihenhaus oder im Villenviertel groß wird, zeichnet vor, welches Leben ihm einmal offensteht.
Erinnert sich noch jemand an den Roman Schöne neue Welt aus dem Jahr 1932? Der britische Autor Aldous Huxley schildert darin eine Gesellschaft, in der fünf unterschiedlich intelligente Klassen von Menschen im Labor produziert werden. Je nach Sauerstoffzufuhr kommen sie als Alphas oder Epsilons auf die Welt, als künftige Entscheider oder künftige Kanalreiniger.3 Die von Huxley entworfene Gesellschaftsordnung entbehrt nicht der Realität. Auch Ihre und meine Zukunft ist ganz schön vorgezeichnet. Vom Zufall der Herkunft hängt ab, was wir vom Leben erwarten dürfen, wie viel Freiheit und Unabhängigkeit wir genießen, wie viel wir bewegen und welche Vorhaben und Ideen wir verwirklichen können. Immerhin: Unsere soziale Position ist nicht in Stein gemeißelt. Anders als auf der Titanic können Sie die Klasse unterwegs wechseln.
Geht da noch was?
Im 21. Jahrhundert setzt eine glänzende Zukunft keine glänzende Herkunft mehr voraus. Menschen wie Biontech-Chef Uğur Şahin oder Bundestagspräsidentin Bärbel Bas beweisen: Auch bei suboptimalen Startbedingungen können wir auf eine hohe Flughöhe aufsteigen. Jeder kann mit Bildung, Biss und Talent die Grenzen seiner Ausgangslage überschreiten. Jeder. Aber bei weitem nicht alle. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Zahlen. Im internationalen Vergleich stand Deutschland 2020 in Sachen soziale Durchlässigkeit auf Platz 11 von 82 Ländern.4 Zwischen den sozialen Lagen aufzusteigen, gestaltet sich bei uns schwieriger als beispielsweise in Dänemark, Norwegen, Schweden oder Finnland. Und auch wenn der Aufstieg gelingt, führt er selten auf höchste Höhen hinauf:
Merksatz
Die wenigsten Aufsteigerinnen und Aufsteiger wandeln sich vom Aschenbrödel zur Prinzessin oder vom Tellerwäscher zum Millionär.
Extremaufstiege kommen zwar vor. Doch der Normalfall sind sanfte Milieuwechsel. Also zum Beispiel: Die Eltern leben von Hartz IV, die Tochter qualifiziert sich zur Meisterin im Garten- und Landschaftsbau. Oder: Die Oma arbeitete als Altenpflegerin, der Sohn baut eine Praxis für Physiotherapie auf, die Enkelin befindet sich auf dem besten Weg, Chefärztin zu werden. Oder: Die Eltern haben als Lehrer ein gutes Auskommen, die Tochter verdient als Associate in einer internationalen Kanzlei so viel wie Mama und Papa zusammen. Und schließlich auch: Die Eltern führen eine Apotheke, der Sohn prägt als Bundeswirtschaftsminister das Land.
Die Beispiele verdeutlichen: Sozialer Aufstieg kann sich in allen gesellschaftlichen Lagen vollziehen. Die einen arbeiten sich aus prekären Verhältnissen in die Mitte vor, sozusagen von der Badstraße des Monopoly-Spielbretts zur Münchner Straße. Andere schaffen es aus der unteren Mitte in die obere. Wieder andere sind schon in der Schlossallee geboren und schwingen sich von dort aus zur internationalen Spitze auf. Und manchmal, ganz selten, katapultieren Können und Schicksal einen Menschen von der Holzklasse in die Stratosphäre der hundert reichsten Deutschen oder den hyperelitären Club der amerikanischen Präsidentenfamilien hinein. So war es bei Uğur Şahin und Michelle Obama.
Egal, ob jemand im kleinen Stil aufsteigt oder im ganz großen, ganz gleich, welches Teilstück des Anstiegs Sie bewältigen, als Spaziergang erweist sich keines davon. Denn ob Sie sich von ganz unten zur Mittelstation hoch mühen oder aus großer Höhe das letzte Steilstück zum Gipfel erklimmen, jeder Aufstieg verlangt Ausdauer, Mut, Glück und Kraft, und auf dem nächsten Level gelten andere Spielregeln als auf der Ebene, die Sie hinter sich lassen.
Und selbst so?
Statistische Erhebungen zeigen: Über 23 Millionen Menschen der deutschsprachigen Bevölkerung hegen den Wunsch, sozial aufzusteigen und mehr zu erreichen als ihre Eltern.5 Allerdings – das geht aus den Forschungsarbeiten der Organisationspsychologen Hee Young Kim und Nathan C. Pettit hervor – offenbaren Menschen das Verlangen danach so selten wie die Lust auf Erdbeeren im Januar. Auch Politik und Wissenschaft halten sich in Fragen der sozialen Mobilität auffällig bedeckt. Die eigene Biografie zu entwerfen, bleibt weitgehend Privatsache: »Wir reden viel zu wenig über Begriffe wie Klasse, Milieu und Habitus in Deutschland – das gilt übrigens auch für die Psychologie«, bemängelt der Aufstiegsforscher und Bestsellerautor Aladin El-Mafaalani.6
Es scheint, über Status und soziales Fortkommen spricht man nicht, und Aufsteiger genießen einen ähnlichen Ruf wie Streber in der Klasse. Meine eigene Sozialisierung ist in diesem Punkt anders verlaufen. Das Wort vom Aufstieg kannte ich schon mit fünf. Es bedeutete für mich, dass mein Vater wochenweise in der nächstgrößeren Stadt wohnte, freitags mit einem Mitbringsel für mich zurückkam und samstags zu Hause lernte. Ich wusste auch genau den Grund dafür: Bei meinen Großeltern war in den Nachkriegsjahren das Geld knapp geworden. Zwei Jahre vor dem Abitur war deshalb für meinen Vater Schluss mit Griechisch und Chemie. Statt im humanistischen Gymnasium fand er sich in einer Ausbildung zum mittleren Beamten wieder. Um etwas von den versäumten Möglichkeiten nachzuholen, qualifizierte er sich als junger Familienvater für den gehobenen Verwaltungsdienst. Im öffentlichen Dienst heißt dieser Weg bis heute: den Aufstieg machen.
Als ich in die zweite Klasse kam, hatte mein Vater die nächsthöhere Laufbahn erreicht, erklomm die sich nun öffnenden Karrierestufen, und ich wuchs mit Eltern auf, die schulische Leistungen wichtig nahmen, mir in Mathe und beim Aufsatz halfen und für die der Ablativus absolutus kein vollkommenes Fremdwort war. Dass ich ins Gymnasium ging, stand außer Frage. Ich segelte ziemlich mühelos durchs Abitur. Der Übergang ins Studium fiel mir weniger leicht. An der Uni musste ich mich allein zurechtfinden. Dafür gab es keine Vorbilder mehr. In meiner Familie hat vor mir niemand (und nach mir jeder) studiert. Ich schwankte zwischen Psychologie, Jura und Journalismus und wählte am Schluss das, was ich am besten kannte und meine Eltern für das Vernünftigste hielten: das Lehramt an Gymnasien mit Englisch und Französisch als Fächerkombination. Es sprach ja alles dafür. Ich half seit Jahren jüngeren Schülern beim Lernen, war in Sprachen gut, und als Studienrätin würde ich in die Gehaltsstufe einsteigen, die mein Vater erst kurz vor dem Ruhestand erreichen konnte.
Was folgte, illustriert Brechts Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens. Der scheinbar so solide, sichere Weg erwies sich als Sackgasse: Als ich mich dem Staatsexamen näherte, gab es mit meiner Fächerverbindung auf absehbare Zeit keine Lehrerinnenstellen mehr. Mein Lebensplan löste sich in Luft auf. Wie alle in meinem Jahrgang und vielen nachfolgenden verfolgte ich Pfade, für die es keine Landkarte gab. Sie waren unübersichtlich und unwegsam und die Ziele, zu denen sie mich führen würden, lagen im Nebel. Lange wusste ich nicht, ob ich überhaupt die Ausrüstung und Kondition dafür besaß.
Gute Aussichten
Heute gehöre ich zu den über 12 Millionen Menschen in Deutschland, die nach eigener Einschätzung eine höhere soziale Stufe erreicht haben als ihre Eltern.7 Die gemeinsame Erfahrung des Anstiegs verbindet, macht aber nicht gleich. Aufsteigerinnen und Aufsteiger unterscheiden sich in ihren Voraussetzungen, kulturellen Hintergründen, ihren finanziellen Möglichkeiten, ihren Lebenszielen und den Stufen des Erreichten. Die Volljuristin und Managerin Stefanie Mattes, die die gemeinnützige Mentoring-Plattform Aufsteiger GmbH gegründet hat, fächert die Bandbreite der Aufstiegserfahrungen auf: »Es gibt Aufsteiger, die soweit möglich von zu Hause gefordert und gefördert wurden und solche, deren Umfeld den Wunsch nach mehr nicht versteht oder sogar ablehnt. Manche wachsen in absolut prekären Verhältnissen auf, bei anderen fehlt es nicht an Geld. Ich kenne Aufsteiger, die stolz sind auf ihren Weg, und solche, die ihren Hintergrund gern vergessen würden.«8
So wenig sich die Menschen ähneln, so wenig gleichen sich ihre Aufstiegswege. Die Aufstiegsrouten verlaufen unterschiedlich lang und steil, führen unterschiedlich weit und fordern psychologisch anders heraus. Während die einen alles und mehr wahrmachen, wonach sie sich je gesehnt haben, kommen andere nur schwer über die Brüche hinweg, die der Aufstieg ihnen abverlangt. Eines aber erleben alle Aufsteigerinnen und Aufsteiger: Weiter oben, wo immer das im Einzelfall ist, weitet sich der Blick. Man hat Zugang zu Chancen und Optionen, Erfahrungen und Verbindungen, die es vorher nicht gab. Der höhere Status trägt häufig, aber nicht notwendigerweise, mehr Geld und Wohlstand ein. Er bietet Perspektiven, die nur Menschen selbstverständlich finden, die schon immer da waren, wo Aufgestiegene erst hinzukommen. Je nach Ausgangslage bedeutet Aufstieg, nicht jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen, kreativ zu arbeiten, selbstbestimmt zu entscheiden, sich abgesichert zu fühlen, sich einen Namen zu machen, Ideen zu verwirklichen, Gehör zu finden, Achtung zu genießen, große Träume zu haben und in vieler Hinsicht das Leben so führen zu können, wie es (zu) einem passt. Jeder einzelne dieser materiellen und immateriellen Wohlstandszuwächse ist dazu angetan, das Leben schöner und leichter zu machen. Deshalb bin ich fest überzeugt:
Merksatz
Keines dieser Vorrechte darf vom Lebenszuschnitt, der geistigen Offenheit und dem Bildungsstand der Eltern abhängen.
Allen gebührt das Recht, sich ein vielversprechenderes und ja, auch privilegierteres Leben zu erschaffen als das, das ihnen in die Wiege gelegt wurde. Wie Sie dieses Anliegen verwirklichen, wie Sie den Aufstieg planen und bei allen Mühen als anregende und aufregende Erfahrung erleben, dabei möchte ich Ihnen Orientierung geben. Nicht als Bergführerin und schon gar nicht als Sherpa. Denn hochfinden und hochkommen können Sie nur aus eigener Kraft. Nur Sie wissen, wo es Sie hinzieht, wie weit Sie dafür gehen wollen und worin sich das Gipfelglück für Sie ausdrückt: in mehr Können, Einfluss, Luxus, Kultiviertheit, Prestige, darin, eine Autorität auf dem eigenen Gebiet zu sein? Nichts davon ist einfach zu erreichen, für nichts von alledem gibt es eine Gipfelgarantie. Dieses Buch kann Sie aber als eine Art Expeditionsmanager begleiten. Es rüstet Sie dafür aus, dass Ihr Aufbruch in unbekannte Höhen so gut und sicher wie möglich gelingt. Dazu verbindet es wissenschaftliche Erkenntnisse und philosophische Überlegungen mit Erfahrungen prominenter Aufsteigerinnen und Aufsteiger und fiktionalen Beispielen aus Film und Literatur. Hier geht’s hoch unterstützt Sie,
einzuschätzen, wo Sie sozial stehen,
Ihren Habitus weiterzuentwickeln,
Ihre herkunftsspezifischen Stärken auszuspielen,
ohne Berührungsängste Kontakte zu knüpfen,
Hochstapler-Gefühle abzulegen,
mit der Familie und den alten Freunden verbunden zu bleiben,
Topliga-Codes zu verstehen,
eine neue Haltung zu Geld und Besitz zu entwickeln,
Ihre Souveränität zu steigern
und bei vielem mehr.
Denn keine Frage, das Geburtsglück ist ungerecht verteilt. Wir starten von höchst unterschiedlichen Linien aus. Natürlich müsste und könnte unser Land bessere Rahmenbedingungen für soziale Mobilität und mehr Bildungsgerechtigkeit bieten, beginnend bei den Allerkleinsten. Das alles ist unbestritten. Bis allerdings der strukturelle Wandel greift, sind Sie in erster Linie auf sich gestellt: mit Ihrer Kraft und Kompetenz, Ihren Begabungen, Ihrem Wollen und Ihrem Sinn für das Mögliche. Denn wie immer sich Ihre äußeren Umstände gestalten: In jeder Situation wohnt auch die Freiheit, größer zu denken und aus wenigem mehr zu machen. Dabei geht es nicht darum, andere zu überbieten, auszustechen, rauszukicken.
Merksatz
Es geht um Sie und Ihr Glück, sich an der richtigen Stelle zu erleben.
Oder wie Coco Chanel es formulierte: »Ma vie ne me plaisait pas, alors j›ai créé ma vie.« Mein Leben hat mir nicht gefallen, also habe ich mein Leben selbst entworfen. Gehen Sie es an! Erschaffen Sie sich den besten, schönsten Platz im Leben, den Sie finden und verwirklichen können.
Kapitel 1 Stellen Sie sich den Tatsachen
Aufsteigen ist nichts für Feiglinge
Sie gehört zu den meistfotografierten Frauen der Welt. Sie ist mit dem Ersten in der englischen Thronfolge verheiratet. Böse Zungen behaupten, sie habe ihn sich gekrallt. Mit ihrem Aufstieg aus dem Mittelstand in den höchsten Kreis der britischen Monarchie machte Kate Middleton Märchenträume wahr. Doch ganz so einfach ist es nicht. Während die heutige Prinzessin von Wales sich langsam, dafür aber pannenfrei in ihre royale Rolle vortastete, erlebte sie die gleichen Vorbehalte wie alle, die höher hinauswollen: Ihr wurde die Klasse abgesprochen. Als »Glyzinie« verhöhnte sie die Presse: »sehr dekorativ, wahnsinnig duftend und ausgestattet mit einem heimtückischen Klettertalent«.1
Wer aufsteigt, muss einstecken können. Der Aufbruch in unbekannte Gefilde birgt Fallstricke und wird nicht immer freundlich begleitet. Das erschwert das Fortkommen, egal von welcher Situation aus man sich erhebt. Mit diesen drei Hürden müssen Sie rechnen.
Hürde 1: Der eingeschriebene Habitus
Es vollzieht sich ohne unser Wissen. Wir werden in eine Familie hineingeboren, eine Wohnumgebung, einen Lebensstil, und wenn wir mit sechs in die Schule kommen, sind die einen mit Büchern bis unter die Stuckdecke großgeworden und die anderen vor einem Flachbildfernseher mit über hundert Kanälen. Ich weiß, das klingt pauschalisiert. Aber so sind die Gegensätze. Es prägt ein Kind, ob es mit den Eltern auf Fernreise geht oder kaum aus dem eigenen Stadtviertel herauskommt, ob eine Familie zusammen kocht oder jeder etwas aus dem Kühlschrank nimmt, ob man die Welt abonniert, das Lokalblatt oder überhaupt keine Zeitung, ob die Eltern eine Spitzenposition innehaben oder einen sicheren Arbeitsplatz, ob sie mit Pannen und Rückschlägen gestresst umgehen oder entspannt. Kinder registrieren, welche Werte in ihrer Umgebung als wichtig gelten und welches Verhalten als richtig. Unbewusst übernehmen sie die Denk- und Handlungsweisen, die ihnen vorgelebt werden. Je statushöher das Elternhaus, desto sicherer erben sie das Denken, Auftreten und Selbstverständnis, das alle Türen öffnet. Wem das Leben so viel Glück vorenthält, der kann später immer noch viel aus sich machen. Eines bekommen allerdings die wenigsten spurenlos weg: den inneren Druck, die latente Anspannung, die gern dann dazwischenfunkt, wenn es am wenigsten passt.
»Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß intuitiv, welches Verhalten dieser Person verwehrt ist«, schrieb der französische Sozialphilosoph Pierre Bourdieu, der den Begriff des Habitus grundlegend definierte. »Der Habitus ist ein System von Grenzen.«2 Die Prägung erfolgt über das soziale Umfeld: Je nachdem, in welcher Familie Sie aufgewachsen sind, haben Sie sich bestimmte Einstellungen und Vorlieben angeeignet. Sie drücken sich in Ihrem Kleidungsstil aus, der Ernährung, der Freizeitgestaltung, Ihrer Sprache und Ihrem Geschmack, den Menschen, unter denen Sie sich wohl fühlen, und in den Verhaltensweisen und Interessen, die Sie als normal empfinden. In den unterschiedlichen sozialen Lagen tragen die unbewussten Gewohnheiten des Denkens und Handelns unterschiedliche Züge, je nachdem, ob man irgendwie durchkommen muss, das Fortkommen gekonnt befördert oder sich seit Generationen an der Spitze der Gesellschaft angekommen weiß.
Merksatz
Entgegen verbreiteter Ansicht ist der Habitus also kein Oberschichtending.
Jeder von uns ist damit ausgestattet, egal, woher wir kommen und was aus uns geworden ist. Er ist ein Teil Ihrer und meiner Persönlichkeit, nur dass er nicht in unseren Genen schlummert, sondern von unseren klassenspezifischen Lebensumständen hervorgebracht wurde. Wie eine perfekt auf Wetter und Sportart abgestimmte Funktionsjacke hilft er uns, in unserem angestammten Umfeld bestmöglich zurechtzukommen. Angenommen Sie finden es gut, wenn sich in Ihrem Wohnviertel alle duzen und man einander unkompliziert aushilft. Dann ist Ihr Habitus wie gemacht für das Klima im dicht bebauten Vorort, einer typischen Wohnform der Mittelschicht. Natürlich würden Sie sich auch im Villenviertel zu benehmen wissen. Doch ob Sie sich dort auch vollkommen wohl und zu Hause fühlen? Möglicherweise nicht so ganz. Unser Habitus funktioniert nämlich immer dort am besten, wo er geprägt wurde. Wechseln wir die Klasse, passt er prompt weniger gut. Damit wir uns in einer neuen Umgebung so ungezwungen bewegen wie in der alten, muss unser verinnerlichtes Denken und Handeln erst Anschluss finden.
Das dauert, aber es geht. Je mehr Stationen im Leben Sie durchlaufen, je mehr Sie von der Welt sehen, desto weiter treten die Muster der Kindheit in den Hintergrund. Schule, Beruf, Medien, Auslandsaufenthalte, Begegnungen mit Menschen, veränderte Lebensverhältnisse und eine veränderte Finanzsituation wirken auf Ihren Habitus ein und überlagern ihn durch neue, auf die veränderte Umgebung zugeschnittene Verhaltensweisen und Vorlieben. Weil keine zwei Menschen in ihrem Habitus identisch sind, tun sich auch Soziologen schwer, trennscharfe Grenzen zwischen den großen sozialen Schichten zu ziehen. Zudem gibt es auch innerhalb der Klassen signifikante Abstufungen: Zwischen einem Langzeitarbeitslosen und einem angestellten Lieferfahrer liegen Welten im Selbstverständnis, und eine superreiche Unternehmenserbin ist finanziell um ein Vielfaches besser gestellt als der auch schon sehr wohlhabende Partner einer Wirtschaftskanzlei.3 Das alles ändert nichts an der Tatsache: Die gesellschaftlichen Klassen unterscheiden sich voneinander und zwar ziemlich klar erkennbar. Arbeiten wir uns der Reihe nach vor.
Der Notwendigkeitshabitus der Unterschicht regiert in den gut 30 Prozent der Haushalte, wo das Geld knapp ist, die Qualifikationen niedriger ausfallen und an Besitz kaum zu denken ist.4 Hier leben die Menschen, die unseren Alltag am Laufen halten: verkaufen, pflegen, liefern, kochen, kassieren. Prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne, körperliche Arbeit, anstrengende Arbeitszeiten und Erwerbslosigkeit machen es zur Herausforderung, Kinder in das Bullerbü-Idyll einzuhüllen, das sich in besser gestellten Familien eingebürgert hat. Der Habitus ist darauf ausgelegt, dass man über die Runden kommt. Man krempelt die Ärmel hoch, schaut auf die Preise und stellt keine verstiegenen Ansprüche ans Leben. Auch für den Nachwuchs nicht.
Der Leistungshabitus der traditionellen Mittelschicht bestimmt das Leben und Denken der durchschnittlichen Bevölkerung. Hier ist die Welt der stabilen Familien, der Eigenheime, Sparverträge, Elektrogrills, der mittleren und immer öfter auch Hochschulabschlüsse. Vom unteren Drittel der Gesellschaft aus gesehen wirkt der gesicherte Lebensstandard der traditionellen Mitte wie ein ferner Traum. Zwar wachsen auch in der Mitte der Gesellschaft die Bäume nicht in den Himmel. Doch wer ihr wie jeder Zweite in Deutschland angehört, verdient in der Regel zwischen 80 und 150 Prozent des Medianeinkommens, also des Einkommens, von dem aus gesehen es genauso viele Haushalte mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen gibt. Man fühlt sich als Teil der großen Mehrheit und hat verinnerlicht: Anstrengung lohnt sich. Das schlägt sich im Habitus nieder: Man denkt zukunftsorientiert, setzt auf Ausbildung und Bildung und glaubt an das meritokratische Versprechen, dass die Leistung den Erfolg bestimmt. Der Ehrgeiz für die eigenen Kinder ist groß, die Sorge, es könnte ihnen einmal schlechter gehen als den Eltern allerdings auch. Denn die traditionelle Mitte hat ein Problem: Ihre Abschlüsse verlieren angesichts der Akademisierung der Berufswelt an Wert.
Der Wachstumshabitus der akademischen Mittelschicht. Natürlich gab es schon immer eine Art Oberschicht der Mittelschicht. Dort fuhr man anstelle des gebrauchten Kombis die Mercedes E-Klasse und ließ den Konzertabend gepflegt im Edelrestaurant ausklingen. Inzwischen verkomplizieren sich die Dinge: Die obere Mitte verdient zwar, diese Grenze zieht das Institut der deutschen Wirtschaft Köln, bis zum Zweieinhalbfachen des Medianeinkommens.5 Der eigentliche Unterschied liegt aber im Selbstverständnis: Die akademisch geprägte Mittelschicht, der auch ich mich zuordne, begreift sich und die Welt als grundsätzlich entwicklungsfähig. Breit informiert gefällt sie sich darin, die Dinge neu und besser zu denken: moralisch, technologisch, politisch, im Umgang mit dem Körper, mental. Ihre Erkennungszeichen sind daher mehr kultureller als materieller Art: der Einkauf im Hofladen, der Ausflug in den so klimafreundlichen wie angesagten Präriegarten, das Fahrrad als sportlichere, ökologischere Alternative, die Gewissensfrage, ob man Sohn oder Tochter die Pippi-Langstrumpf-Ausgabe aus der eigenen Kindheit in die Hand geben darf, in der der Südseekönig noch anders heißt. Die Sensibilitäten der akademischen Mittelschicht stellen die Gepflogenheiten der traditionellen Mittelschicht infrage, vom Billigflug bis zum Eigenheim. Aber auch die viel wohlhabendere Oberschicht kommt an den stilbildenden Mustern der akademischen Mitte nicht vorbei: Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Diversität.
Der Distinktionshabitus der Oberschicht. Der Oberschicht gehören je nach Berechnungsweise höchstens 5 Prozent der Deutschen an. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln definiert Menschen als einkommensreich, die mehr als das Zweieinhalbfache des mittleren Einkommens verdienen. Jenseits dieser Schwelle sind nach oben alle Grenzen offen. Die Reichsten der Reichen beziehen Einkommen und halten Vermögen jenseits der üblichen Vorstellungskraft. Allein die Quandts und die anderen 44 reichsten Familien in Deutschland besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bundesbürger zusammen.6 Doch auch für den einkommensreichen, aber nicht superreichen Teil der obersten Schicht sind finanzielle Nöte weit weg. Die Preissprünge beim Essen, Wohnen, Heizen mögen die anderen drei Statusgruppen empfindlich treffen, in der Jackpot-Klasse fallen sie kaum auf. Man ist jemand, denkt nach vorn und lebt der Masse enthoben. Unternehmerisches Denken, anspruchsvolle kulturelle und sportliche Aktivitäten und Vertrauen in die eigene Leistungskraft bestimmen das Auftreten. Eltern verstehen sich als Sachverwalter und Weichensteller für die nächste Generation. Die Kinder sollen den Erfolg der Familie fortführen, sei es als Nachfolger oder an verantwortungsvoller Stelle innerhalb der wirtschaftlichen oder kreativen Elite.
Hürde 2: Der unterschätzte Klassismus
Aufsteigen, Unterschicht, Mittelschicht, Topliga. Wenn wir über Klasse sprechen, verwenden wir »Vertikalismen«, also Vokabeln, in denen mitschwingt: Menschen haben, sind und gelten unterschiedlich viel. Der Soziologe Andreas Kemper rückte das Thema vor einigen Jahren ins Bewusstsein: »Eine klassengerechte Sprache müsste komplett auf Vertikalismen verzichten, da in den europäischen Kulturen Oben als das Gute und Unten als das Schlechte eingeschrieben ist. Vertikalismen verhindern die gleiche Augenhöhe.«7 Der Hinweis gibt zu denken. Trotzdem hat es bisher niemand geschafft, eine neue Sprache für soziale Unterschiede zu entwickeln, und ich gebe zu: Auch ich habe absolut keine Idee, wie es gehen könnte. Zu exakt benennen Vertikalismen die gesellschaftliche Wirklichkeit, an der wir alle zusammen mitwirken: dass Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft und Position in Güteklassen kategorisiert werden wie Spargelstangen.
Bestimmt haben Sie irgendwann einmal Pretty Woman gesehen. Nach heutigen Maßstäben strotzt die Romantikkomödie mit Julia Roberts und Richard Gere vor Sozialklischees. Nicht an Gültigkeit verloren hat dagegen die Szene, wie Julia Roberts in einem ziemlich trashigen Outfit eine Luxusboutique in Los Angeles betritt. Ihr Blick fällt auf ein sehr edles, sehr zurückhaltendes Kleid, doch eine Verkäuferin bügelt sie ab: »Ich glaube nicht, dass wir etwas für Sie haben. Bitte gehen Sie.« Merke: Man muss gut gekleidet sein, um in einem Geschäft willkommen zu sein, das die Art von Kleidung führt, die in gehobenen Kreisen Anklang findet.
Wie das Geschlecht und die Hautfarbe prägt die Klasse, die jemand ausstrahlt, die Lebens- und Zukunftsperspektiven: die Lebenserwartung, die Bildungsabschlüsse, das Selbstbewusstsein, die beruflichen Chancen. Der amerikanische Wirtschaftsprofessor Paul Ingram von der Columbia Business School in New York liefert Zahlen. In seinen Studien hat er den Zusammenhang von sozialer Herkunft und beruflichem Erfolg gemessen. Es zeigte sich: In den USA erreichen Frauen und Männer aus einer niedrigen Statusklasse um 32 Prozent seltener eine Managementposition als Konkurrenten aus einer hohen Statusklasse. Die ungleichen Erfolgsaussichten haben nichts mit individueller Intelligenz oder persönlicher Anstrengung zu tun. Sie sind einzig und allein den sozialen Ausgangsbedingungen geschuldet. Ingram zufolge tritt das gleiche Phänomen in allen großen Volkswirtschaften auf.8
Nur dass darüber keiner spricht. Über Sexismus und Rassismus schreibt die Bild-Zeitung. Klassismus, die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder Position, ist dagegen vielen nicht einmal als Wort bekannt. Wie sollte es auch. Selbst das Grundgesetz blendet Klassismus und soziale Ungerechtigkeit aus. Zwar verpflichtet Artikel 3 Absatz 1 GG den Staat, dass niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache oder seiner Heimat und Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Das Wort »Herkunft« bezieht sich aber vornehmlich darauf, ob jemand seine Wurzeln in Aachen oder Antalya hat. Ob man als Metzgerinnensohn oder Ministertochter groß wurde, bleibt dagegen außen vor. Darauf weisen die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags ausdrücklich hin: »Das Diskriminierungsmerkmal ›soziale Herkunft‹ gehört nicht zu den durch das AGG geschützten Diskriminierungsmerkmalen.«9 Vor diesem Hintergrund leuchtet ein, wenn Unternehmen und Parteien ihre Anstrengungen um mehr Vielfalt auf das Geschlecht und das Herkunftsland konzentrieren. Dagegen wird Diversität nur selten sozial gedacht.
Hinzu kommt: Aufsteigerinnen und Aufsteiger hängen ihre Biografie ungern an die große Glocke. »Vielen Menschen fällt es schwer, über ihre sozialen Ausgangsbedingungen zu sprechen«, sagt die deutsche Autorin und Unternehmerin Tijen Onaran.10 Das deckt sich mit meinen Erfahrungen: Selbst Menschen, die sich gut kennen, schweigen sich über Unterschiede aus, die der sozialen Herkunft oder Position geschuldet sind.
Merksatz
Ob wir lieber Star Trek und Star Wars gucken, ist ein Thema. Ob wir im Wohnblock oder der Walmdachvilla groß wurden, eher nicht.
In Wohlstand und Reichtum Aufgewachsene realisieren oft nicht einmal, um wie viel besser es ihnen geht, Aufsteigende überspielen, dass sie an manchen Erfahrungen nicht teilhaben können: dass sie nie ein Musikinstrument gelernt haben, dass sie das Geld für den Aperitif vor dem Essen lieber sparen würden oder dass sie sich für die Kleinstadtuni entschieden haben, weil anderswo die Mieten unbezahlbar erschienen. Wenige Aufsteigerinnen und Aufsteiger offenbaren die Irrungen und Wirrungen ihres Werdegangs so ungeschminkt wie Michelle Obama, deren Geschichte aus diesem Grund in diesem Buch eine Hauptrolle spielt. Der Schleier lüftet sich allenfalls, wenn alle am Tisch sich als Aufgestiegene verstehen und eine ähnliche Höhe erreicht haben. Gelegentlich kommt dann zur Sprache, was sonst nur Romane und literarische Erinnerungen enthüllen: die Entfremdung von der eigenen Familie, die Angst, trotz aller Anstrengung nicht gut genug zu sein, die Frage, was es über einen sagt, dass man den vom Schicksal zugewiesenen Platz verbessern will, wie ein Gast, der heimlich die Tischkarten vertauscht. Die Scham der Aufgestiegenen führt dazu, dass Klassismus, sofern er sich oberhalb von Armut und Chancenlosigkeit abspielt, kaum ins Bewusstsein rückt.
So gesehen bleibt Pretty Women übrigens doch relevant. Wenn Julia Roberts alias Vivian den Start in ein besseres Leben schafft, dann weil sie ihre soziale Zurücksetzung eben nicht verschleiert. Sie fackelt nicht lang, holt sich Hilfe und bekommt sie auch. Natürlich sorgen Tischmanieren und ein Kleid mit braun-weißen Polkatupfen nur im Märchen für ein Happy End. Aber niemand wird bestreiten: Wenn es schon an den banalsten Äußerlichkeiten fehlt, bleibt der Einstieg in den Aufstieg von vornherein verwehrt.
Hürde 3: Der hinderliche Statusfatalismus
Das Geburtslotto kann ungerecht sein. Es steht aber in unserer Macht, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Was viele allerdings nicht wissen: Auch der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit ist unten, in der Mitte und oben unterschiedlich ausgeprägt: In den einkommensschwachen Schichten denkt nur jeder Vierte, jeder könne durch eigene Leistung mehr erreichen. In der breiten Mitte hält dies jeder Dritte für möglich, ganz oben ist es jeder Zweite.11 Die Zahlen verraten: Knappe Ressourcen verpassen hochfliegenden Zielen schnell mal einen Dämpfer.
Mir ist es an einer entscheidenden Abzweigstelle meiner Karriere so ergangen. Ich hatte meine Doktorarbeit abgeschlossen, zwei Großkonzerne und ein Start-up von innen kennen gelernt, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, der Laden lief, der erste Buchvertrag war unter Dach und Fach, und ich war mir sicher, nach Jahren des Suchens und Findens auf dem richtigen Weg zu sein. Ungefähr zu dieser Zeit lud mich eine Hochschule ein, mich um eine neu zu schaffende Professur für Technikkommunikation zu bewerben. Obwohl ich die Berufungsvoraussetzungen erfüllte, winkte ich ab. Erstens war ich von meinen Plänen absorbiert, und zweitens sah ich sofort den Haken: Ich kannte mich mit Unternehmenssprache, Werbetexten und wissenschaftlichem Publizieren aus. Aber Technikkommunikation? Ohne technologisches Wissen wäre es mir vermessen erschienen, auf diesem Gebiet lehren und forschen zu wollen. Mein Mann, der damals schon Professor war, redete mit Engelszungen gegen meine Bedenken an. Doch selbst er konnte mich nicht überzeugen, über meinen Schatten zu springen.
»Statusfatalismus« nennen Soziologen die Selbstbescheidung, die uns davon abhält, anstrengende und anspruchsvolle Ziele ins Auge zu fassen, nicht einmal dann, wenn sie auf dem Silbertablett an uns herangetragen werden. Psychologen sprechen von »unbewusster Selbstselektivität«. Beide Termini bedeuten: Menschen verharren auf dem Boden der Tatsachen. Sie wählen die kleinere Lösung, weil sie die größere für verstiegen oder unerreichbar halten. Die Zurückhaltung hat viel mit dem eigenen Background zu tun, und ihre Folgen wiegen schwer:
Merksatz
Statusfatalistinnen und -fatalisten erheben sich nicht über ihren Stand.
Sie übersehen Optionen und lassen Chancen entwischen. In der Konsequenz bedeutet das: Sie gründen keine Firmen, heiraten keinen Prinzen, werden nicht Professorin, kaufen keine Neuemissionen, bringen sich nicht ins Gespräch und wenn überhaupt, steigen sie höchstens in unspektakulären Schritten auf.