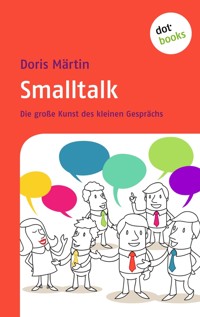Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Lassen Sie sich nie in Jogginghosen sehen … … wenn Sie in Ihrem Leben etwas erreichen wollen. Das weiß nicht nur Karl Lagerfeld. Die Dos and Don'ts des sozialen Aufstiegs erläutert die Stil-, Sprach- und Benimmexpertin Doris Märtin für erfolgsorientierte Leserinnen und Leser. Ihr Buch bietet einen kurzweiligen Mix aus Stories, Interviews und soziologischer Forschung, in dem sie entschlüsselt: - wie die Elite tickt, - welche Codes Zugehörigkeit signalisieren - wie jeder von uns die Lebenskunst der Leitmilieus erlernen kann. Ob große Karriere oder optimale Startbedingungen für die Familie: Der Habitus ist entscheidend! Und das Beste: Einmal gewonnen, bleibt er für immer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Doris Märtin
Habitus
Sind Sie bereit für den Sprung nach ganz oben?
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Lassen Sie sich nie in Jogginghosen sehen …
… wenn Sie in Ihrem Leben etwas erreichen wollen. Das weiß nicht nur Karl Lagerfeld. Die Dos and Don'ts des sozialen Aufstiegs erläutert die Stil-, Sprach- und Benimmexpertin Doris Märtin für erfolgsorientierte Leserinnen und Leser.
Ihr Buch bietet einen kurzweiligen Mix aus Stories, Interviews und soziologischer Forschung, in dem sie entschlüsselt:
– wie die Elite tickt,
– welche Codes Zugehörigkeit signalisieren
– wie jeder von uns die Lebenskunst der Leitmilieus erlernen kann.
Ob große Karriere oder optimale Startbedingungen für die Familie: Der Habitus ist entscheidend! Und das Beste: Einmal gewonnen, bleibt er für immer.
Vita
Dr. phil. Doris Märtin unterstützt Unternehmen, überzeugend am Markt aufzutreten und mit charakterstarken Texten erfolgreich zu verkaufen. Sie ist Autorin von 18 Büchern über Kommunikation, emotionale Intelligenz und Lebenskunst, Alumna des Deutschen Knigge-Rats und als Sprach- und Stilexpertin in den Medien präsent. Das Thema Habitus fasziniert sie, seit sie beim deutsch-französischen Schüleraustausch das Leben diesseits und jenseits der Mitte erlebt hat – in zwei Gastfamilien, die unterschiedlicher nicht hätten sein können.
Inhalt
Kapitel 1Nur wer abhebt, kann auch fliegen: Wie der Habitus das Leben, die Chancen, den Status bestimmt
Zu Höherem geboren
Die feinen Unterschiede
Das Kapital, das sich ausbauen lässt
Oben. Mitte. Unten: Wie die Herkunft den Habitus prägt
Und wir können doch aus unserer Haut
Was heißt eigentlich ganz oben?
Auf ein neues Niveau kommen. Mit den Codes der Eliten.
Kapitel 2Wissenskapital: Was man kann
Alles andere als ohne: Abschlüsse und Zertifikate
Wenn das Studium Pflicht ist, was ist dann die Kür?
Ohne fachliche Exzellenz ist alles nichts
Das Feld identifizieren: Wissen, wo man hinwill
Breit gefächerte Interessen weiten den Blick
Kreativität heißt: sein Ding durchziehen
Karrierewissen: Systeme durchschauen, Abkürzungen kennen
So setzen Sie zum Sprung nach oben an: Bauen Sie auf allen Ebenen Ihr Wissen aus
»Es darf nicht ausschlaggebend sein, wen man kennt, sondern was man kann« — Als Top-Headhunter hat Matthias Kestler einige Hundert Positionen der ersten und zweiten Führungsebene von Konzernen und mittelständischen Unternehmen besetzt. Seine Erfahrung: Das Rennen um den Top-Job macht nicht automatisch derjenige, der am meisten kann. Fachliche Exzellenz hält er dennoch für unverzichtbar.
Kapitel 3Materielles Kapital: Was man hat
Die Unterschicht der Oberschicht
Und es liegt doch am Kontostand
Plötzlich reich ist auch nicht leicht
Was Geld mit Menschen macht
Die Einstellung zum Geld optimieren
Der Millionär von nebenan fährt keinen Luxus-SUV
Der Wert des privaten Sicherheitspolster
Annehmen: ja. Am Tropf hängen: nein.
So setzen Sie zum Sprung nach oben an: Investieren Sie in Ihre Unabhängigkeit
»Selbständigkeit ist die Voraussetzung, um reich zu werden« — Wie bauen Menschen aus eigener Kraft ein zwei- oder dreistelliges Millionenvermögen auf? Das analysiert Rainer Zitelmann in seinem Buch Die Psychologie der Superreichen. Seine These: Die Herkunft ist es nicht. Viel wichtiger ist der Mut, gegen den Strom zu schwimmen.
Kapitel 4Soziales Kapital: Wen man kennt
Die liebe Familie: Der größte Unterschied von allen
Erfolg kommt nicht allein von innen: Wie Ihr Umfeld auf Sie abfärbt
Die Kunst, dazu zu gehören
Cliquen und Klüngel? Oder Freundschaft und Community?
Verbindungen sind wertvoll, machen aber viel Arbeit
Mentoren, Clubs und Topadressen
Online-Reputation: Wer Einfluss will, muss sichtbar sein
Macht, Status und Sichtbarkeit: Wie weit der Einfluss reicht
So setzen Sie zum Sprung nach oben an: Schaffen Sie Verbundenheit
»Absichtslos. Unkompliziert. Das sind die Zugehörigkeits-Zauberworte in der Topliga.« — Wie verbindet man sich mit Menschen, die im Großen wirken? Dorothea Assig und Dorothee Echter kennen die Wege. Im Interview sprechen die Autorinnen von Ambition darüber, wie der Zugang zur Topliga gelingt.
Kapitel 5Kulturelles Kapital: Wie man sich abhebt
Warum das kulturelle Kapital die wichtigste Währung von allen ist
Hummer oder Hummus: Die Soziologie des Geschmacks
Bio, Fahrrad, Glücksfall Kind: Status, neu definiert
Französisch, Flöte, Fußball? Oder: Griechisch, Geige, Golf? Die winzigen Unterschiede
Warum gute Manieren gelebt sein wollen
In der Welt zu Hause, in der Region daheim
Luxus undercover: Von der Finesse, unterschätzt zu werden
So setzen Sie zum Sprung nach oben an: Flügel spreizen, Wurzeln akzeptieren
»Alles ist heute viel differenzierter« — Was ist guter Geschmack? Die Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen und sein wirklich eigenes Ding zu machen – sagt der Trendforscher und Soziologe Matthias Horx.
Kapitel 6Physisches Kapital: Wie man Status verkörpert
Das Aussehen bestimmt das Ansehen: Wie sich physische Attraktivität lohnt
Schön locker oder zugeknöpft steif: Modisch Zeichen setzen
Gesund und fit: Der verkörperte Erfolg
Operation Schönheit? Oder Leben mit allen Sinnen? Eine Frage der sozialen Identität
Der Trend zur individuellen Bestzeit: Darum wurde Marathon zum Lieblingssport der Chefs
So setzen Sie zum Sprung nach oben an: Behandeln Sie Ihren Körper als Ihr wichtigstes Kapital
»Einem Menschen, der sich elegant bewegt, traut man auch geistige Eleganz zu« — In ihren Büchern, Coachings und Seminaren verrät die Imageberaterin und Modedesignerin Katharina Starlay, was Menschen gut aussehen lässt. Ihre Botschaft: Wichtiger als Jugend und Model-Gene sind Haltung, Persönlichkeit und Qualität.
Kapitel 7Sprachlich-kommunikatives Kapital: Wie man spricht
Ausdruck macht Eindruck
Sich sprachlich Raum nehmen
Sachlich, wohlwollend, lösungsorientiert: Was die Königsklasse der Kommunikation bringt
Mitdenken, was akzeptabel ist
Wahre Klasse: Klar in der Sache, verbindlich im Ton
Smalltalk mit Alphatieren
Show, don’t tell: Die Sprache der Symbole
So setzen Sie zum Sprung nach oben an: Werten Sie sich und andere auf
»Jemand, der ganz oben ist, kommuniziert ohne Neid und Bitterkeit« — Jan Schaumann coacht Top-Führungskräfte, Politiker, Schauspieler und Popstars. Im Interview sagt er, wie Status klingt, was Entscheider hören möchten, und warum Ambitionierte nicht nur die Grammatik beherrschen sollten, sondern auch ihre Gefühle.
Kapitel 8 Psychologisches Kapital: Wie man die Dinge anpackt
Hohe Ziele, hohe Sicherheit: So kann das Selbst sich optimal entfalten
Erfolgsgewissheit: Der verinnerlichte Glaube an sich selbst
Noblesse oblige: Sich großzügig zeigen
Irgendwas ist immer möglich: Die Wirkkraft eines dynamischen Selbstbilds
Das Ego kontrollieren: Warum Anstand nicht von gestern ist
Produktiv mit Druck umgehen: Scheitern lernen, Krone richten
Jenseits des Ego: Der Lebenswerk-Gedanke
So setzen Sie zum Sprung nach oben an: Vervollkommnen Sie Ihre Persönlichkeit
»Wer tut, was er liebt, hat den größten Erfolg« — Die einen fangen ganz unten an. Die anderen starten von Haus aus auf der Erfolgsspur. Wie geht man mit so ungleichen Ausgangsbedingungen um? Und zeigt mit Selbstvertrauen die eigenen Stärken? Ein Gespräch mit der Diplom-Psychologin und Bestseller-Autorin Eva Wlodarek.
Kapitel 9Sind Sie bereit für den Sprung nach ganz oben?
Danke!
In der Reihenfolge des Erscheinens …
Literatur
Anmerkungen
Nur wer abhebt, kann auch fliegen: Wie der Habitus das Leben, die Chancen, den Status bestimmt
Wissenskapital: Was man kann
Materielles Kapital: Was man hat
Soziales Kapital: Wen man kennt
Kulturelles Kapital: Wie man sich abhebt
Physisches Kapital: Wie man Status verkörpert
Sprachlich-kommunikatives Kapital: Wie man spricht
Psychologisches Kapital: Wie man die Dinge anpackt
Sind Sie bereit für den Sprung nach ganz oben?
Kapitel 1Nur wer abhebt, kann auch fliegen: Wie der Habitus das Leben, die Chancen, den Status bestimmt
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Hermann Hesse
Er umgibt Menschen wie eine Aura. Er ist bei Verhandlungen und beim Date dabei, beim Geschäftsessen und in der Wahlkabine, bei der Wohnungsbesichtigung, bei der Kita-Auswahl und im Supermarkt. Er bestimmt, wie Menschen ihr Leben entwerfen, welches Ansehen sie genießen, wie sie denken, wohnen, essen, reden, wie wohl sie sich fühlen, was sie sich zutrauen, welchen Rang sie in der Gesellschaft einnehmen und wie gut sie dem Leben gewachsen sind.
Die Rede ist vom Habitus: der Art, wie wir uns in der Welt bewegen. Jeder hat ihn. Aber nur bei manchen ist der Habitus so ausgebildet, dass er alle Wege ebnet. Bei anderen hemmt er große Sprünge eher, als dass er sie beflügelt. Das lässt sich ändern. Wie? Das erfahren Sie in diesem Buch.
Zu Höherem geboren
Tüpfelhyänen leben in Gruppen mit einer komplexen Sozialstruktur. Angeführt von dominanten Weibchen bilden bis zu hundert Tiere eine hierarchisch gegliederte Gemeinschaft. Für neugeborene Tüpfelhyänen bedeutet das: Was aus ihnen wird, entscheidet sich schon in der Geburtshöhle. Gehört ihre Mutter zur High-Society des Rudels, starten auch die Jungtiere mit besten Aussichten ins Leben. Das haben die Biologen Oliver Häner und Bettina Wachter vom Berliner Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Tansania erforscht. Nach jahrelangen Forschungsarbeiten im Ngorongoro-Krater wissen sie: »Von Geburt an hat der Nachwuchs einer hochrangigen Mutter einen Riesenvorteil.« 1
Während rangniedrige Hyänenweibchen kurz nach der Geburt ihrer Jungen wieder auf die Jagd gehen, wachsen die Prinzen und Prinzessinnen unter den Jungtieren in der wachsamen Obhut ihrer Mutter auf. Oberklasse-Weibchen erlegen ihre Beute nämlich nicht selbst. Sie lassen jagen und nehmen, was sie brauchen, den weniger privilegierten Weibchen der Gruppe ab. Die Vorteile kommen direkt ihren Sprösslingen zugute: Hochwohlgeborene Junge sind sicherer gegen Gefahren geschützt, werden besser genährt und wachsen schneller. Von klein auf lernen sie das typische Verhalten der Hyänen-Oberklasse kennen. Quasi mit der Muttermilch erwerben sie einen Erfolgshabitus, der ihnen ein Leben lang einen Spitzenplatz im Rudel garantiert. Töchter aus hochrangigen Hyänenfamilien werden ihrerseits Anführerinnen im Hyänen-Matriarchat. Söhne schließen sich neuen Rudeln an, wissen, wie man die dominantesten Weibchen umgarnt, und zeugen früher und öfter als Rivalen Nachwuchs.
Der Status der Jung-Hyänen ist sozial vererbt. Das lässt sich daran ablesen, dass adoptierte Hyänenkinder einen ähnlichen Rang einnehmen wie ihre Adoptivmutter. Zwischen dem Status adoptierter Nachkommen und der genetischen Mutter zeigt sich dagegen kein Zusammenhang.2
Wie kleine Tüpfelhyänen starten auch Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Leben.
Je nachdem, ob wir oben, unten oder irgendwo dazwischen geboren sind, bilden wir einen mehr oder weniger erfolgsförderlichen Habitus aus. Damit verbunden sind Anschub- und Ausbremskräfte im Verhalten und im Lebensstil, im Status und in der Sprache, in den Ressourcen, Erfolgschancen und in den Erwartungen ans Leben.
Die feinen Unterschiede
Zum ersten Mal in aller Deutlichkeit erlebt habe ich die Unterschiede, die aus dem Habitus erwachsen, mit 16 beim deutsch-französischen Schüleraustausch. Eine Schülergruppe aus meiner ostbayerischen Heimatstadt war zu Gast in einem Pariser Vorort, keine zehn Kilometer vom Eiffelturm entfernt. Die begleitenden Lehrer teilten mich behütetes BRD-Mittelschichtskind einer Gastfamilie zu, von der sich herausstellte: Sie lebte in einer trostlosen Hochhaussiedlung, die Eltern arbeiteten auf Schicht, zum Abendessen gab es Dosen-Ravioli zum Selber-Aufwärmen und in der Messerschublade krochen Küchenschaben. Ich hielt es keine zwei Tage dort aus. Die begleitenden Lehrer zuckten die Schultern, meine Eltern konnten mir in der Zeit vor Handy und WhatsApp nicht helfen. Dann überzeugte meine Freundin ihre Gastmutter, auch mich bei sich einzuquartieren. Fast wie im Märchen fand ich mich im Haushalt einer Fabrikantenfamilie wieder. Stuckdecken, Antiquitäten, Eltern, die einander siezten, gehobene Tischkonversation, Hauskonzerte, Krustentiere, in den Regalen Pléiade-Ausgaben der französischen Klassiker mit Bibelpapier und Goldschnitt. Französisches Großbürgertum oder jedenfalls fast. Auch hier hatte der Lebenszuschnitt wenig mit dem zu tun, was ich von zu Hause her kannte. Ich war beeindruckt, fügte mich ein und fühlte mich so amicalement aufgenommen wie es nur geht. Trotzdem blieb das Gefühl: Egal, wie sehr ich mich anstrengte, völlig einerlei, wie gut meine Noten in Mathe und Französisch waren – das war nicht meine Welt.
Die Wochen in Paris prägten meine Vorstellungen vom guten Leben. Sie ließen Ambitionen wachsen, die es so vorher nicht gab. Doch es dauerte bis zum vierten oder fünften Semester meines Studiums, ehe ich das Eintauchen in zwei grundverschiedene Milieus einordnen konnte, die mir fremd waren, jedes auf seine Art. Auf meiner Leseliste für ein Seminar stand ein damals neu erschienenes und heute zum Klassiker avanciertes Werk des französischen Sozialphilosophen Pierre Bourdieu (1930–2002): Die feinen Unterschiede.3 Bourdieu untersuchte darin die charakteristischen Lebensstile und Lebensvorstellungen von oben, Mitte und unten. Ich erinnere mich: Das Buch war spannend, wenn auch mit seinen tausend Seiten schwere Kost. Aber es machte mich mit einem Begriff bekannt, der den Erfahrungen beim Schüleraustausch einen Namen gab: Habitus, abgeleitet von dem lateinischen Verb habere: ›haben, halten, an sich tragen‹.
Vom Habitus, lernte ich bei Bourdieu, leitet sich ab, mit welchen Einstellungen und Vorlieben, Geschmacksurteilen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten wir der Welt begegnen. Die Erfahrungen, die wir aufgrund von Herkunft und Erziehung gemacht haben, haben uns diese Haltung eingeimpft: ob das Geld knapp war oder im Überfluss da, ob wir im Kinderzimmer fünfzig Bücher oder eine Playstation hatten, wohin wir in den Urlaub fuhren und ob überhaupt, ob die Eltern Fleiß oder Fantasie besser förderten, ob Papa zum Joggen ging oder zur Jagd – alles zusammen bestimmt, was wir später im Leben als normal, erstrebenswert und sinnvoll empfinden. Vieles von dem, was wir für uns ins Auge fassen, hat damit zu tun, in welchen sozialen Verhältnissen wir aufgewachsen sind und entspringt nur vordergründig unserer persönlichen Entscheidung. Das bedeutet:
Unser Habitus ist zugleich Ergebnis und Ausdruck unserer sozialen Position. Ohne unser Zutun offenbart er unseren Rang in der Gesellschaft.
Am besten passt der Habitus dort, wo auch die anderen so ähnlich denken, leben oder sich benehmen wie wir. In dieser Welt fühlen wir uns in unserem Element. In anderen Umfeldern fehlt diese Vertrautheit. In diesem Punkt sind wir uns alle ähnlich, egal, wo wir uns auf der sozialen Leiter einordnen. Der Unterschied liegt anderswo: Zwar bringt jeder Mensch von Haus aus einen Habitus mit. Aber nicht jeder Habitus ist in den Augen der Welt gleich viel wert. Obwohl die Grenzen zwischen den sozialen Klassen verschwimmen, obwohl immer mehr Menschen in vielen Welten zu Hause sind – es macht nach wie vor mehr Eindruck, sich sicher im Sterne-Restaurant zu bewegen als mit kleinem Budget ein gesundes Abendessen auf den Tisch zu bringen. Hinter der unterschiedlichen Bewertung steht eine kalte Logik:
Im Spiel um Status und Distinktion ist ein (groß-)bürgerlicher Habitus das Maß aller Dinge. Er trägt mehr Ansehen ein und eröffnet mehr Möglichkeiten.
Wer den gehobenen Habitus der oberen 10 Prozent, noch besser der obersten 3 Prozent besitzt, hebt sich ab. Wer nicht, der nicht. Das ist ungerecht. Aber wahr.
Das Kapital, das sich ausbauen lässt
Wer sind eigentlich die Besten? Oder sogar die Besten der Besten? Wer am meisten Geld verdient oder das größte Vermögen aufweist? Der Unternehmenserbe? Die Lottogewinnerin? Wer die richtigen Eltern hat? Wer als Topmanager Verantwortung trägt? Wer die Gesellschaft politisch oder künstlerisch prägt? Menschen, die die Welt um innovative Problemlösungen bereichern, in der Medizin, der Computertechnologie, beim Verkehr? Machthaber wie Politiker oder Richter? Wer es zur Nummer eins auf seinem Gebiet schafft: zum Spitzenkoch, zur Olympiamedaille oder zu Germanys Next Top Model? Oder sogar, wer Millionen von Follower auf YouTube von sich überzeugt?
Das Geld allein gibt jedenfalls nicht den Ausschlag. Mindestens genauso entscheidend für ein bedeutsames Leben, Größe, Einfluss und Erfüllung sind andere Ressourcen. Bourdieu bezeichnet die Voraussetzungen, die Exzellenz erleichtern, als Kapitalsorten und meint damit eine ganze Menge mehr außer Wohlstand und Können. Herkunft und Verbindungen gehören dazu. Allgemeinbildung, Formen des Umgangs und ästhetisches Empfinden. Eloquenz und ein Gespür für den angemessenen Ton. Ein souveränes Erscheinungsbild. Und nicht zuletzt: Optimismus und eine stabile Psyche.
Es gibt also eine Reihe von Möglichkeiten, sich vorteilhaft zu unterscheiden. Was es Menschen erlaubt, ihr volles Potenzial zu entfalten (oder eben nicht), sind verschiedene Kategorien von Kapital: ökonomisches Kapital, Wissenskapital, soziales Kapital, kulturelles Kapital, sprachliches Kapital, physisches Kapital, psychologisches Kapital. Alle diese Kapitalarten zahlen auf den Habitus ein.4 Je mehr von allen sich auf eine Person kristallisiert, desto weiter oben bewegt er oder sie sich in der Gesellschaft.
Finanzielles Kapital: alle materiellen Besitztümer, von der Höhe des Einkommens über Geldvermögen, Immobilien und Unternehmenswerte bis hin zu Renten- und Versicherungsansprüchen und zu erwartende Erbschaften.
Wissenskapital: Abschlüsse, Titel und Weiterbildungen, Fachwissen, Karrierewissen, akademische und Funktionstitel, aber auch die Fähigkeit, das meiste aus den eigenen Kenntnissen und Kompetenzen zu machen.
Soziales Kapital: Wen man kennt und wie gut man mit Menschen und Gruppen umgeht. Eine Familie, die Kraft gibt. Vorbilder, die eine Vorstellung vermitteln, was möglich ist. Kontakte, die weiterhelfen. Mentoren, die sich ins Zeug legen. Zugang zu Entscheidern. Gleichgesinnte, die bestärken. Einfluss, Macht und Sichtbarkeit.
Kulturelles Kapital: Das Vertrautsein mit den Codes und Geschmacksvorlieben, die Ansehen und Distinktion eintragen. Klassisch gehören die Vertrautheit mit Hochkultur und herausragende Umgangsformen dazu. Neuere Trends sind ein achtsamer, nachhaltiger Lebensstil oder der Mut zu Exzentrik und Individualität.
Sprachliches Kapital, zum Beispiel eloquent zu formulieren, auf Menschen zuzugehen, Themen konstruktiv, differenziert und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Besonders bedeutsam: das Wissen, was man wo auf welche Weise sagen kann.
Physisches Kapital: Wie attraktiv, gesund und energiegeladen sich jemand fühlt. Außenstehende schließen aus der äußeren Erscheinung auf den sozialen Status, die Belastbarkeit und die inneren Werte.
Psychologisches Kapital: Optimismus, Leidenschaft, Vorstellungskraft, Biss. Von der psychischen Stabilität hängt ab, ob man sein Leistungspotenzial verwirklichen kann oder im Mittelmaß stecken bleibt.
Mit den sieben Kapitalarten verhält es sich wie mit einem Anlageportfolio: Bei jedem von uns ist das Kapital anders strukturiert und in den einzelnen Kategorien unterschiedlich hoch. Manche Menschen sind reich an Geld und Beziehungen. Andere brillieren durch Kompetenz und Kultiviertheit. Wieder andere sprühen selbst dann noch vor Leistungskraft, wenn andere im gleichen Alter schon die Rente planen. Ganz oben sind typischerweise alle Kapitalsorten im Überfluss vorhanden, und der hochgeborene Nachwuchs wirft schon beim Start ins Leben mehr und Gefragteres in die Waagschale als Kinder aus weniger begüterten Verhältnissen. Eine vergleichbar gute Ausbildung bringt also nicht notwendigerweise auch den gleichen Habitus hervor.
Beispiel
Max. Jennifer. Marie. Alle drei haben Wirtschaftswissenschaften studiert, weisen brillante Abschlüsse vor und absolvieren das Traineeprogramm eines begehrten Arbeitgebers. Man könnte sie für soziodemografische Drillinge halten. Doch es gibt Unterschiede: Max, 26, Sohn eines Chefarztes und einer Orchestermusikerin, Studium in Stockholm und Yale, von den Großeltern hat er eine Villa am Walchensee geerbt. Jennifer, 24, hat sich mit Bafög, Studentinnenjobs und eisernem Willen durchs Studium gehangelt. Marie, 25, kennt das Unternehmen, hat schon ihre Bachelorarbeit dort geschrieben, die Marketingchefin ist ihre Schwägerin.
Kinder aus den etablierten Schichten der Gesellschaft übernehmen einen Großteil ihrer Kapitalausstattung von ihren Eltern und Großeltern. Vieles fliegt ihnen zu, ohne dass sie sich groß darum bemühen müssten. Große Pläne sind ihnen selbstverständlich. Die Bevorzugtesten unter ihnen werden fast schon im Ziel geboren. Wie den Hyänenjungen im Ngorongoro-Krater macht ihnen das nicht nur die Kindheit schöner. Es bietet auch die fast sichere Gewähr, dass sie von Haus aus und ein Leben lang ganz oder jedenfalls weit oben dazugehören. Wie groß der Vorteil der hohen Herkunft ist, hat der Elite-Forscher Michael Hartmann nachgewiesen. Im Rahmen seiner Forschungsarbeiten wertete er die Lebensläufe von Geschäftsführern und Vorstandschefs der größten Unternehmen in verschiedenen Ländern aus. Seine Studien belegen:
In Deutschland entstammen die meisten Top-Manager den oberen vier Prozent, also den sehr wohlhabenden, bürgerlichen oder sogar großbürgerlichen Familien.
Begüterte Eltern und Großeltern vererben ihren privilegierten Status an die nächste Generation. Zwar bleibt auch dem hochwohlgeborenen Nachwuchs nicht erspart, die Top-Positionen in Wirtschaft, Politik und Kultur selbst zu erringen. Doch ihnen kommt zugute: Bei der Eliterekrutierung regiert das Prinzip der Ähnlichkeit. Wer zu den Weichenstellern im Land gehören will, muss am besten sein wie sie.5 Die fachliche Qualifikation zählt zwar auch. Sonst hätten die immerhin 14 Prozent der Top-Führungskräfte, die laut einer Studie der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar aus Elternhäusern der Arbeiterklasse stammen, es nie in den Vorstand schaffen können. Aber Können ist nur die halbe Miete. Leichter und im Schnitt doppelt so schnell gelingt die Karriere, wenn der gehobene Habitus von Haus aus vorhanden ist.6
Oben. Mitte. Unten: Wie die Herkunft den Habitus prägt
Während Mittelschichtseltern mit ihrem Kind um den Unterschied zwischen simple past und present perfect ringen, während Kinder aus der Unterschicht dabei überhaupt niemand unterstützt, wächst der gleichaltrige Verlegersohn zweisprachig auf, zieht die Teenie-Tochter der Unternehmensberaterin mit den Eltern für ein Jahr nach Toronto. Im Kielwasser der Eltern bewegt sich der Nachwuchs aus gesellschaftlichen Spitzenmilieus von klein auf in den Umfeldern, die für etwas Besseres stehen. Die Neunjährige darf nach dem Liederabend Diana Damrau die Blumen überreichen, weil ihr Vater dem Kuratorium der Philharmonie angehört. Noch wirkt sie ein bisschen schüchtern dabei, doch das wird sich bald legen. Der Elfjährige verfolgt das Endspiel auf Einladung eines elterlichen Geschäftsfreundes von der VIP-Lounge aus, in der Pause erläutert er der städtischen Wirtschaftsreferentin in pointierten Sätzen das Leitbild seines Gymnasiums. Die Sechzehnjährige diskutiert beim Familienrat Unternehmensentscheidungen mit. Überzogen? Vielleicht. Oberklasse-Eltern sehen es anders:
Der Nachwuchs trainiert beizeiten Verantwortung und Parkettsicherheit und erlernt von klein auf einen Habitus der Distinktion und Exzellenz.
In der Mittelschicht werden einstweilen andere Qualitäten eingeübt: Ehrgeiz, Selbstdisziplin, Impulskontrolle. Studien über die Lebenswelt deutscher Jugendlicher zeigen: In den höheren Milieus des Mittelstands geben Eltern dem Nachwuchs Kritikfähigkeit, ökologisches Bewusstsein und kulturelle Bildung mit auf den Weg: Sprachen, Musik, gesellschaftliches Engagement. Untere Mittelschichtsfamilien vermitteln Anstrengungsbereitschaft, Bodenständigkeit und die Einhaltung von Regeln als zentrale Haltung. Hier wie dort stehen Erfolgsorientierung und solide Werte im Fokus.7 Hier wie dort werden Höflichkeit und Anstrengung gefördert, gesellschaftlicher Schliff und allzu ausgefallene Interessen aber eher misstrauisch beäugt.
Typisch für alle Mittelschichtmilieus ist ein Habitus des Leistungs- und Statusstrebens.
Auch wenn die Grenzen zwischen oben, oberer Mitte und Mitte verschwimmen, sind die Sprösslinge aus Ober- und Mittelschicht also deutlich unterschiedlich geprägt. In einem Punkt besteht jedoch Einigkeit: Wenn irgend möglich, machen die Kinder Abitur.8
Bei den schwächeren sozialen Schichten hegt diesen Anspruch nur ein Drittel der Eltern. Bourdieu nennt diese Selbstbescheidung amor fati: Hingabe an das Schicksal. Er meint damit: Die Ambitionen sind davon geprägt, was andere im eigenen Umfeld erreichen. Aus diesem Grund fassen Ärmere für ihre Tochter eher eine Ausbildung zur Bürokauffrau ins Auge als das BWL-Studium mit internationaler Ausrichtung an einer Top-Uni.
Stärker als weiter oben bildet sich in der Welt der Niedriglöhne und prekären Arbeit ein Habitus der Überlebenskunst heraus.
Man strebt an, was man für sich für realistisch hält. Fehlen die Vorbilder für einen prestigeträchtigen Lebensentwurf, fasst man einen solchen Weg auch für sich oder seine Kinder nicht ins Auge. You Can’t Be What You Can’t See, heißt ein neues Buch über armutsgefährdete Kinder. Genau das ist das Problem. Dennoch bringt auch der Blick auf die Notwendigkeiten Kompetenzen hervor: Pragmatismus, Frustrationstoleranz, Zusammenhalt und Härte gegen sich und andere.
Bourdieus Einteilung in drei klassenspezifische Habitusformen stellt wie jede Kategorisierung eine Vereinfachung dar. Ihr Sinn liegt darin, gesellschaftliche Unterschiede zu erfassen und zu beschreiben. Im wahren Leben präsentiert sich die Welt um einiges vielschichtiger: Weil jeder Habitus von einer individuellen Mischung der sieben Kapitalformen geprägt ist, bilden sich Hybridformen heraus. Das ist vor allem dann der Fall, wenn in einzelnen Kapitalarten sehr hohe Volumen erreicht werden, in anderen aber nicht. Sind nur einzelne Kapitalformen überdurchschnittlich gut gefüllt, erwächst daraus Selbstbewusstsein und Prestige. Reichtum, Distinktion und Macht hat dagegen in der Regel nur, wer in allen sieben Kategorien herausragend aufgestellt ist.
Beispiel
Tobias, 30, lehrt und forscht als Nachwuchs-Wissenschaftler an einer Exzellenzhochschule. Seine Eckdaten: fachlich Spitze, international vernetzt, rhetorisch gewandt, Vertrag befristet, Einkommen prekär, Selbstbild verunsichert. Beim fachlichen, kulturellen, kommunikativen und sozialen Kapital liegt er weit vorn. Beim materiellen und psychologischen Kapital gibt es noch einige Luft nach oben.
Und wir können doch aus unserer Haut
Zwischen Unten, Mitte, Oben und ganz Oben gibt es Unterschiede, und häufig sind sie mehr als nur fein. Lange Zeit galt daher als gesetzt: Wer aus dem richtigen Stall kommt, ist auf der Überholspur unterwegs. Wer nicht, wird durch seinen Herkunftshabitus gebremst. Eines der bekanntesten Zitate von Bourdieu wird gern herangezogen, um diese Ansicht zu stützen: »Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt und weiß intuitiv, welches Verhalten dieser Person verwehrt ist.«9 Ist ein gehobener Habitus also ein Privileg einer enthobenen Schicht? Ein geheimer Code, der sich Normalmenschen allenfalls teilweise erschließt?
Nein.
Die Vorstellung von einem starren Habitus greift zu kurz. Natürlich entwickeln sich unsere Neigungen und Vorlieben mit der Lebenserfahrung mit. Selbstverständlich passen Menschen ihr Verhalten den Umständen an. In allen Schichten, allen Geschäftsfeldern machen Menschen das Beste aus ihren Möglichkeiten, stellen sich auf neue Umgebungen ein, legen an Statur und Status zu, bringen in die Welt, was in ihnen steckt. Und heben dabei nachhaltig das eigene Niveau. »In Abhängigkeit von neuen Erfahrungen ändern die Habitus sich unaufhörlich«, stellte Bourdieu klar.10 Er selbst war dafür der beste Beweis.
Beispiel
Bourdieu wuchs in den 1930er Jahren in den Pyrenäen auf. Sein Vater stammte aus einer bäuerlichen Familie, wurde Briefträger und später Vorsteher eines kleinen Dorfpostamts. Im Ort nahmen die Bourdieus von da an eine Außenseiterstellung ein, gehörten weder dem Bauernstand noch dem Bürgertum an. Pierre Bourdieu litt unter der fehlenden Zugehörigkeit, ging in die Stadt aufs Gymnasium, nach Paris zum Studium und legte eine wissenschaftliche Spitzenkarriere als Anthropologe und Sozialphilosoph hin. Als Professor am Pariser Collège de France wirkte er an einer wissenschaftlichen Einrichtung, die in der ganzen Welt als einmalig gilt.
Der Habitus ist also wandelbar. Wir können aus unserer Haut. Am leichtesten gelingt dies Menschen, die sich bewusst sind, wie der Habitus das Weltbild, den Geschmack und die Ambitionen bestimmt. Dies belegt eindrucksvoll ein Experiment, das die Psychologin Nicole M. Stephens und ihr Team durchgeführt haben.11 Die Wissenschaftler schickten Studienanfänger aus bildungsferneren Milieus in eine von zwei Einführungsveranstaltungen. In der einen ging es um die Hürden, die den Studienerfolg behindern können und wie man sie überwindet. In der anderen wurden speziell die Herausforderungen angesprochen, mit denen Kinder aus einem nicht-akademischen Elternhaus zu kämpfen haben. Am Ende des ersten Studienjahrs zeigte sich: Die Studierenden, die sich explizit mit den Nachteilen ihrer Herkunft beschäftigt hatten, beendeten das Jahr mit signifikant besseren Noten als die Vergleichsgruppe. Mehr noch: Sie erzielten ähnlich gute Ergebnisse wie Studierende aus einem gehobeneren Elternhaus. Das heißt:
Der Herkunftshabitus ist zwar ein Teil von uns. Doch nichts hält uns davon ab, darüber hinauszuwachsen.
Die Chancen dafür standen noch nie so gut: Noch vor fünfzig Jahren bestimmten Eltern, Lehrer und Kirche das Leben, zeigten sich als Autoritäten, gegen die man kaum aufzubegehren wagte. Heute sind breite Teile der Bevölkerung hoch gebildet und ausgebildet, entscheiden selbst, was sie glauben, wofür sie brennen, mit wem, wie und wo sie leben wollen. Digitalisierung und Globalisierung machen unseren Alltag lebendig. Der Zugang zu Informationen ist grenzenlos und oft umsonst. Engt ein Lebensentwurf ein, steht es uns frei, ihn zu ändern. Viel öfter als frühere Generationen wechseln wir den Job, die Partner, die Branche, die Stadt, lernen spannende Lebensstile kennen, lassen uns von Menschen inspirieren, fuchsen uns in unbekannte Unternehmenskulturen ein. Der Horizont weitet sich, wir entwickeln Sehnsüchte und sehen Möglichkeiten, an die wir früher nicht im Traum gedacht hätten.
Zugleich bleibt es nicht aus, dass wir an unsere Grenzen stoßen und uns in Umgebungen wiederfinden, wo der aktuelle Habitus zumindest anfangs zu kurz greift. Manchmal fühlt er sich sogar grundfalsch an. Das verunsichert und kratzt am Selbstbewusstsein. Die mangelnde Vertrautheit mit neuen sozialen Codes erfordert Lernprozesse, für die es kein Webinar gibt. Aber: Jedes neue Umfeld, jede daraus resultierende Irritation ist auch eine Ermutigung, über den eigenen Schatten zu springen und auf den nächsthöheren Level zu kommen.
Dabei hilft das Wissen um die sieben Kapitalformen. Als materielle und immaterielle Ressourcen lassen sich systematisch mehren und wirken direkt auf unseren Habitus ein. Im Grunde ist es wie bei einem Computerspiel, wo man virtuelle Gegenstände wie Schwerter oder Heilpflanzen erwirbt und mit ihrer Hilfe die Handlungsspielräume und Ambitionen vergrößert.
Eine Einschränkung sollten Sie allerdings kennen: Der Habitus, den wir aus der Kindheit mitbringen, sitzt tief. Er verändert sich mit neuen Erfahrungen – allerdings nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Sie haben es vielleicht selbst schon erlebt: Sie sind beruflich aufgestiegen, haben den Sprung in ein neues, anspruchsvolleres Umfeld geschafft: Eine herausfordernde Stadt. Eine Elite-Uni, wo man mit den Besten der Besten konkurriert. Ein renommierter Gesellschaftsclub. Eine Schwiegerfamilie, in der es feiner zugeht als in der eigenen Herkunftsfamilie. Doch so sehr man sich anstrengt, man fasst auf dem neuen Spielfeld schwer Fuß. Vor allem am Anfang fischt man im Trüben, bewegt sich auf dünnem Eis, fühlt sich als Aufsteiger oder sogar Aufschneider.
Diese Erfahrung ist keine persönliche Schwäche. Sie ist in einem neuen Umfeld ganz normal.
Denn ganz gleich, wohin uns das Leben trägt, der Habitus hinkt hinterher. Es dauert, bis er sich auf veränderte Gegebenheiten einstellt. Bourdieu nennt diese Trägheit des Habitus Hysterese. Beim Sprung nach ganz oben bedeutet das: Bücher, Kniggeseminare oder Managementtrainings treiben zwar die Persönlichkeitsentwicklung voran. Sie können aber nicht verhindern, dass neu erlernte Verhaltensweisen zunächst angelernt wirken.
Erst wenn wir uns schon eine Weile in einem Feld bewegen, fangen wir an, die dort geltenden Spielregeln auch zu verinnerlichen. Solange dauert es, bis sich echte Zugehörigkeit einstellt und unser Verhalten nicht mehr bemüht, sondern natürlich wirkt. Dafür ist der sich allmählich herausbildende Habitus am Ende aber auch nichts Aufgesetztes, sondern echt. »Wir kommen mit unserem Geschmack, unseren Einstellungen und Neigungen nicht einfach zur Welt«, erklärt der Eliteforscher Shamus Rahman Khan, »sondern wir leben sie wieder und wieder aus, sodass ihre Inszenierung immer weniger wie eine gespielte Rolle wirkt – eine Rolle, die uns möglicherweise zum Vorteil gereicht –, und mehr und mehr wie unsere ureigene Natur.«12
Auch wenn wir in neuen Situationen gern von Anfang an voll dabei wären, empfiehlt es sich daher, es langsam angehen zu lassen. Zu beobachten. Das Feld von hinten aufzurollen. Und darauf zu vertrauen: Der passende Habitus stellt sich ein. Wir müssen ihn nur lange genug kultivieren.
Ist das gelungen, verwandelt sich die Trägheit des Habitus sogar in einen Vorteil. Der Hysterese-Effekt funktioniert nämlich in beide Richtungen. Rutscht man von einem schon erklommenen Level wieder ab, bleibt der dort entwickelte Habitus lange Zeit erhalten. Verarmter Adel ist das typische Beispiel. Die Liegenschaften sind weg. Die Souveränität bleibt. Besser noch: Ein einmal erworbenes Habitus-Repertoire ist so fest verankert, dass es sich an die nächste Generation vererbt.
Was heißt eigentlich ganz oben?
Was haben Jeff Bezos, Helene Fischer, Donald Trump, die englische Königin, Anna Netrebko, die Quandts und der Sultan von Brunei gemeinsam? Sie haben die Spitze der sozialen Leiter erreicht. Höher hinauf geht es nicht mehr. Die Frage, was eigentlich ganz oben heißt, lässt sich deshalb, so scheint es, recht einfach beantworten: Ganz oben ist, wenn man reicher, mächtiger, bekannter und leistungsstärker ist als die meisten. Das klingt plausibel. Es beantwortet aber nicht die entscheidende Frage:
Wo ist der Cut?
Wo verläuft der Schnitt zwischen Masse und Klasse? Was muss man leisten und darstellen, um sich abzuheben? Zählt man oben dazu, wenn man dem oberen Drittel der Gesellschaft angehört und damit jener Gruppe, die gemeinsam für 79 Prozent des Einkommensteueraufkommens in Deutschland sorgt?13 Ist es zutreffender, die deutlich schmalere Schicht der obersten zehn Prozent als ganz oben zu definieren? Oder trennt man noch kleinere Gruppen ab, beispielsweise die obersten eins oder gar null komma eins Prozent? Legt man die Latte so hoch, bewegen wir uns in der enthobenen Welt jener reichen und superreichen Familien, die eine Million bis viele Millionen US-Dollar im Jahr verdienen.14
Wo immer man die Grenze zieht, egal, ob eng oder weit, sie ist willkürlich.
Das ist aber noch nicht alles. Es gibt einen weiteren Haken, der die Definition von ganz oben erschwert: Was sich für den Einzelnen als ganz oder jedenfalls sehr weit oben anfühlt, ist durchaus subjektiv. Es hat mit dem eigenen Platz in der Gesellschaft zu tun und dem, wohin der eigene Blick sich richtet. Welche Erwartungen fasst man für sich ins Auge? Wie definiert man höchste Leistung? Welchen Errungenschaften misst man den höchsten Wert bei? Was findet man bei anderen herausragend?
Es kommt auf die Perspektive an. Gehört eine Person zur Elite der obersten drei Prozent, erscheint ihr bereits der Lebenszuschnitt eines IT-Chefs oder einer niedergelassenen Apothekerin als vergleichweise niedrig. Jemand aus dem unteren Drittel hingegen empfindet möglicherweise ein Leben, wie es der IT-Manager führt, als unermesslich gehoben und wäre schon über die Zugehörigkeit zur Mitte mehr als glücklich. Die Definition von ganz oben wird also immer stellarer, je höher man selbst steigt.
Beispiel
Sie ist leitende Oberärztin für Viszeralchirurgie. Den meisten ihrer Patienten erscheint sie wie eine Göttin in Weiß. Ihr Bruder kritisiert, sie habe keine Ahnung, was es bedeute, mit dem auszukommen, was er ein normales Gehalt nennt. Genau entgegengesetzt sieht es ein Kollege, dessen Praxis nur so brummt: »Ihr Klinikärzte in eurer erbärmlichen Existenz.« Selbst arbeitet sie an der Berufung zur Chefärztin. Der Aufstieg in die Spitzenposition ihres Fachgebiets wäre für sie der Karriereolymp.
Ganz oben ist nicht nur eine Frage statistischer Rangfolgen und Grenzwerte. Es ist auch eine Frage der persönlichen Wahrnehmung. So gesehen bedeutet ganz oben: die Position, die Lebensleistung, die Fülle, die für Sie persönlich das Höchste wäre.
Auf ein neues Niveau kommen. Mit den Codes der Eliten.
Ich schreibe dieses Buch nicht für die obersten drei Prozent. Ich schreibe es für Menschen wie Sie und mich. Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Die Bildung wichtig finden, für die Gesellschaft einen hohen Beitrag leisten und von ihrem Einkommen ordentlich oder sogar bestens leben können. Unter ihnen sind Steuerberaterinnen, Wissenschaftler, Medizinisch-Technische Assistentinnen, Manager, Lehrerinnen, Unternehmer, Politikerinnen, Handwerksmeister, Projektleiterinnen, Studierende, Psychologinnen, Oberärzte, Webdesigner, Geschäftsinhaber, Consultants. Die meisten von ihnen zeichnet ein Habitus der Leistungsorientiertheit aus. Viele würden gern Träume verwirklichen, die das eigene Umfeld vielleicht abgehoben findet. Hemmungen abschütteln, die sie vor noch Größerem zurückhalten. Zugang zu interessanten Kreisen finden. Sich im Wettbewerb positiv abheben. Noch mehr gestalten und bewirken, als im Moment möglich scheint. Sich auf hohem Niveau verändern. Kurzum: einen Habitus ausbauen, der ihnen mehr ermöglicht als Geld oder Können allein.
Was Sie dazu brauchen, ist kein Geheimwissen. Denn die Kapitalarten, die den Habitus bereichern, sind ein exakt beschreibbares System. Ein gehobener Habitus ist deshalb auch für Menschen erreichbar, die nicht in die High Society hineingeboren sind. Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie verstehen …
>was Menschen aus sehr wohlhabenden, erfolgreichen Familien anderen voraus – aber nicht für sich gepachtet haben; >welche Faktoren den Habitus von innen stärken und welche Bedeutung er für den Erfolg, die Chancen und die Außenwirkung hat; >wie Sie die verborgenen Codes der Oberschicht nutzen, um selbst einen Habitus der Distinktion und Exzellenz zu entwickeln; >wie Sie den Zugang in neue gesellschaftliche Welten finden – oben, unten, quer, dazwischen – und warum es normal ist, in ungewohnten Umgebungen nicht auf Anhieb dazu zu gehören; >wie Sie Ihren Kindern optimale Startbedingungen schaffen – auch wenn Sie Harvard nicht finanzieren können; >wie Sie anspruchsvolle Gesprächspartner und Zielgruppen erreichen und ihnen auf Augenhöhe begegnen.Ob Sie die große Karriere anstreben, ein besonderes Talent verwirklichen oder mehr Anerkennung für Ihre Leistungen möchten – ein gehobener Habitus bringt Sie nicht nur Ihren Zielen näher. Er weitet den Blick, hebt die Möglichkeiten und ist eine Chance, sich neu in der Welt zu verorten.
Kapitel 2Wissenskapital: Was man kann
Wissenskapital. 1. Bildungstitel, Abschlüsse und Zertifikate. Den Wert des Wissenskapitals bestimmt die Gefragtheit des Gelernten am Markt. 2. Das Wissen und Können, das jemand besitzt und gewinnbringend einsetzen kann.
Das Narrativ ist allgegenwärtig: Bildung und Fachkundigkeit sind gut und schön. Doch für den großen Durchbruch zählt anderes: Persönlichkeit, Stallgeruch, Selbstgewissheit, eine Spur Dreistigkeit, das Übliche. Am besten kennt man dazu die richtigen Leute und besetzt ein Thema, das gerade en vogue ist oder aktuell ein Comeback erlebt.
Ganz von der Hand zu weisen ist diese Einschätzung nicht. Natürlich kann man mit einem YouTube-Kanal namens BibisBeautyPalace als Influencerin richtig gut Geld verdienen. Klar legen smarte Überflieger ohne erkennbare theoretische Exzellenz den kometenhaften Aufstieg hin. Selbstredend gibt es Gründer ohne formale Qualifikation, aber mit dem Riecher, ausgefallene Technik aus einem früheren Ostblockland zu beziehen, zu veredeln und für ein Vielfaches zu vermarkten. Tag für Tag sahnen mittelbegabte Absolventinnen den Job ab, von dem alle träumen, nur weil ihre Eltern die richtigen Kontakte haben. Nach dem gleichen Prinzip führen Menschen Unternehmen, weil der Aufsichtsratschef einen Narren an ihnen frisst.
Und ja, manchmal drängt sich der Eindruck auf, dass die Wunderwuzzis in Wirtschaft und Politik ihre Materie nicht in aller Tiefe durchdringen. Vielleicht kratzen sie fachlich wirklich nur an der Oberfläche. Möglicherweise kommt über dem Tun das abstrakte oder konzeptionelle Denken zu kurz. Trotzdem wäre es verfehlt, den ego-starken Siegertypen Ahnungslosigkeit zu unterstellen. Natürlich bringen sie Kompetenz in ihre Unternehmungen ein: Markt- und Branchenkenntnisse. Das Verständnis für Publikumserwartungen und Kundenbedürfnisse. Das Technologie-Know-how, das nächste große Ding auf den Markt zu werfen. Die fast hellseherische Fähigkeit, eine wachtstumsträchtige Idee zu identifizieren. Und vor allem und von vielen unterschätzt: das Wissen, wo man hinwill und was man anstrebt.
Man kann die verklärten Hoffnungsträger als Lichtspektakel abtun. Man kann ihren Erfolg aber auch zum Anlass nehmen, den eigenen Wissensbegriff mal etwas differenzierter zu betrachten. Spätestens dann fällt nämlich auf: Kein Mensch kann mit den Datenmengen von Google mithalten. Zwar reicht Recherchieren allein auch künftig nicht aus, und niemand kommt um den Aufbau eines Wissenskerns herum. Trotzdem verliert die Datenbank im Kopf in ähnlicher Weise an Bedeutung wie der Brockhaus im Regal. Stattdessen wird unser Kopf immer mehr zur Denkfabrik: Mehr als die Daten zählt das, was man daraus macht.
Im 21. Jahrhundert entscheidet sich Erfolg daran, Wert aus Wissen zu schöpfen: es praxisorientiert anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreativ zu verknüpfen, offen zu teilen, kompakt aufzubereiten oder in höchstes Können zu verwandeln.
Wissen in all seinen Formen ist und bleibt also ein wertvolles Kapital. Für unsere Gesellschaft, die nicht umsonst Wissensgesellschaft heißt. Und für uns selbst. Denn Wissen ist zwar nicht immer mit Funktionstiteln und und der daraus resultierenden Gestaltungsmacht verbunden. Und auch nicht mit Geld. Aber aus Wissen erwächst Selbstbewusstsein, Kreativität und Leistungskraft. Je mehr davon Sie haben, desto mehr Leichtigkeit strahlt auch Ihr Habitus aus.
Alles andere als ohne: Abschlüsse und Zertifikate
Er gilt als der beste Zahnarzt der Stadt. Seine Praxis residiert in einem repräsentativen Altbau. Sogar in der Patiententoilette liegt die Deckenhöhe bei geschätzt vier Metern. An der Längswand gegenüber Waschbecken und Spiegel hängen die gerahmten Weiterbildungszertifikate in Viererreihen übereinander: Anerkennung als Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Sachkundelehrgang für die Aufbereitung von Medizinprodukten in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis. Praxiskurs Guided Implantology. Intensivseminar Hygiene und QM in der Zahnarztpraxis. Und so weiter, und so fort.
Die ironische Zurschaustellung von Kompetenz im Gästeklo ist nicht jedermanns Sache. Trotzdem machen die meisten Menschen mehr oder weniger subtil auf Abschlüsse, Bildungs- und Funktionstitel und Preise aufmerksam. Mit gutem Grund. Die Abkürzungen vor und hinter dem Familiennamen (Dr., Prof., LL.M., MBA, M.Sc., M.A., RA), der Job Title in der E-Mail-Signatur, die Liste der gewonnenen Awards auf der Website oder das Yale-Hoodie beim Teambuilding im Klettergarten tragen ihren Besitzern Anerkennung ein. Sie sind ein symbolisches Kapital, das für sich spricht, ohne dass man die Werbetrommel rühren muss. Ihr Wert ist so groß, dass die Handwerkskammer Wiesbaden vor einigen Jahren für Meister im Handwerk den Titel me. ersonnen hat. Nun können auch Handwerksmeister eine Abkürzung vor den Namen stellen (me. Marie Muster) und wie Anwälte, Ärzte, Ingenieure oder Professoren dezent ihre Qualifikation vermitteln.
Bildungsabschlüsse und Titel werten aber nicht nur die Visitenkarte oder das Namensschild auf. So wie sich bei Computerspielen durch In-App-Käufe die Konkurrenzfähigkeit steigern lässt, erhöhen Bildungsabschlüsse im Real Life die Wahrscheinlichkeit, sich schneller und weiter nach oben zu spielen.
Für Menschen ohne privilegierte Herkunft ist eine gute Ausbildung sogar die einzige oder jedenfalls wichtigste Chance für den sozialen Aufstieg. Je niedriger der soziale Status der Vorfahren, desto mehr zählen Bildungsgrad und Bildungswissen für das Fortkommen und die Einkommensperspektiven der Nachkommen.
Beispiel
Der Chefdesigner der britischen Luxusmarke Burberrry, Riccardo Tisci, wurde als jüngstes von neun Kindern in Süditalien geboren. Nach dem Tod seines Vaters wuchs er in einer Sozialwohnung auf. Schon als Teenager trug er durch Nebenjobs zum Lebensunterhalt der Familie bei. Halt gab ihm damals die Welt des Goth: schwarze Kleidung, weißes Gesicht, Plateaustiefel: »Aber ich machte keinen Blödsinn, hatte gute Noten und arbeitete.« Mit 17 ging er nach London und studierte Modedesign am renommierten Central Saint Martins College of Art und Design.1 2014 heiratete Kim Kardashian in einem von ihm entworfenen Givenchy-Brautkleid.
Der einzige Weg nach ganz oben ist eine gute Ausbildung allerdings nicht. Erstaunlich viele sehr reiche, sehr bekannte Menschen haben das Studium geschmissen. Statt für den Abschluss zu pauken, verfolgten sie schon in jungen Jahren einmalige Ideen und Lebenspläne. Ganz ohne ein paar Semester Uni lief es also auch bei ihnen selten. Sie hatten in den entscheidenden Jahren nur Besseres zu tun, als die noch fehlenden Semester für den Abschluss durchzuziehen.
Beispiel
Ausgerechnet Bill Gates hat sein Studium mit 19 hingeworfen. Genau wie Oprah Winfrey, Lady Gaga und Marc Zuckerberg, die ebenfalls Spitzenplätze auf der Forbes-Liste der einflussreichsten und finanzstärksten Menschen der Welt einnehmen. Als Vorbild in punkto Karriereplanung sieht Bill Gates sich dennoch nicht: »Ich denke, der Wert, eine großartige Ausbildung zu bekommen – das bedeutet, zu studieren – wird allzu leicht unterschätzt. Die interessantesten Jobs erfordern einen Uniabschluss.«2
Eine groß angelegte Bildungsstudie, die das Ifo-Institut 2017 im Auftrag der Investmentgesellschaft Union Investment durchgeführt hat, gibt Gates Recht. Statistisch gesehen bereichert jedes zusätzlich in Bildung investierte Jahr nicht nur die Persönlichkeit. Es ist auch ein gutes Geschäft. In der Regel verzinst sich Bildung nämlich im Verhältnis zum eingesetzten Aufwand über das gesamte Erwerbsleben hinweg mit durchschnittlich zehn Prozent im Jahr.3 Finanziell betrachtet bringt die richtige Ausbildung somit höhere Erträge ein als fast alle anderen Anlageformen.
Vergleicht man das Lebenseinkommen von Menschen mit und ohne Abschluss, ergeben sich messbare Unterschiede.
So liegt das Lebenseinkommen mit einer abgeschlossenen Lehre durchschnittlich 143.000 Euro netto über dem von Menschen ohne Berufsausbildung. Gegenüber einer Ausbildung erzielt ein Meister oder Techniker durchschnittlich 129.000 Euro netto mehr, ein Fachhochschulabsolvent 267.000 Euro und ein Universitätsabsolvent 387.000 Euro. Deutlich größer ist der Abstand bei Human- und Zahnmedizinern: Mit einem Medizinstudium verdient man aufs Berufsleben gerechnet fast eine Million mehr als mit einer Lehre.4 Ob man die Unterschiede im Lebenseinkommen hoch oder niedrig findet, hängt von der eigenen Lebenssituation ab: Für eine ganz normale Mittelschichtsfamilie sind eine Viertel Million Euro hin oder her viel Geld. Der Erbe von zwei Mehrfamilienhäusern in München dürfte von den Unterschieden im Lebenseinkommen weniger beeindruckt sein.
Das war die Statistik. Die Wirklichkeit sieht natürlich differenzierter aus. Je nach Branche und Studienrichtung klaffen die Verdienstmöglichkeiten unter Akademikern weit auseinander. Auch bei den Meistern gibt es nach oben hin keine Grenzen: Führt jemand ein gut gehendes KMU, toppt das Lebenseinkommen um Längen das von angestellten Akademikern. Auch ohne wissenschaftlich-theoretisches Genie, dafür aber ausgestattet mit handwerklichen und technischen Fähigkeiten kann man also ein Vermögen verdienen. Allerdings vornehmlich dann, wenn man sein eigener Chef ist und ein Unternehmen gründet oder erbt.
Wenn das Studium Pflicht ist, was ist dann die Kür?
Eines ist sicher: Ein finanzstarkes Unternehmen wird den meisten von uns nicht zufliegen. Deshalb macht es Sinn, wenn akademische Abschlüsse so begehrt sind wie nie zuvor. Die Zahlen sprechen für sich: In den 1970er Jahren, als Waterloo und Dancing Queen die Musikcharts anführten, waren in Deutschland gerade einmal sechs Prozent der Bevölkerung Akademiker, genauso viele verfügten über den Abschluss als Meister. Vierzig Jahre später weisen dreißig Prozent der Deutschen einen akademischen oder Meisterabschluss auf, also fast genau die Zahl von Menschen, die die SINUS Markt- und Sozialforschung heute den gesellschaftlichen Leitmilieus zurechnet.5 Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der Menschen ohne Berufsausbildung von 38 Prozent auf 16 Prozent halbiert. Und der Trend geht weiter: 2018 besitzt mehr als die Häfte der Schulabgänger eine Studienberechtigung, die Studierendenzahl war im Wintersemester 2017/18 mit 2,8 Millionen so hoch wie nie zuvor.6
Beispiel
Die Akademisierungswelle versetzt selbst junge Uniabsolventen in Staunen. In einem Kniggekurs erzählt ein junger Masterabsolvent, er stamme aus einem Allgäuer Dorf. Als er das Studium begonnen hat, war er der einzige im Ort, der studiert hat. Zehn Jahre später hat sich das Verhältnis gedreht: »In diesem Jahr geht der ganze Jahrgang zum Studium weg. Das hat es bei uns noch nie gegeben.« Die Generation Abschluss-Sammler rollt an.
Betriebswirt im Handwerk, Bachelor, Master, Doktor, MBA. Die Abschlüsse klingen immer beeindruckender. Vom Hocker reißen sie trotzdem keinen mehr. Allerhöchstens fällt auf, wenn jemand beim Poker um die tollste Qualifizierung nicht mitgehen kann. Der Grund liegt auf der Hand: Die Bildungstitel verlieren aufgrund ihrer schieren Zahl an Wert. Wenn alle abheben, wird es für die einzelnen immer schwieriger, sich abzuheben.
Die Reichsten reagieren darauf bereits. In den USA investieren die One-Percenter, also die obersten ein Prozent, doppelt so viel Geld in die Universitätsausbildung ihrer Kinder wie die übrigen, ebenfalls extrem bildungsbewussten Top-10-Prozent der Gesellschaft. Sie erkaufen damit das Privileg, dass ihre Kinder von der Pole-Position weg ins Leben starten – mit den angesehensten Abschlüssen und idealerweise dort, wo die höchsten Gehälter und aussichtsreichsten Positonen locken: Hedgefonds, Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen, Investmentbanken, Consultingfirmen.
Auch in Deutschland entmischt sich das Bildungssystem. Neben den normalen staatlichen Gymnasien schießen exklusivere und kostenpflichtige Angebote aus dem Boden: bilinguale, internationale, Kunst- und Musikgymnasien. Wie die Schulen versuchen sich auch die Hochschulen und Universitäten im Spagat zwischen Masse und Klasse, ringen um Exzellenz und gute Rankings, denn, logisch, wenn demnächst jeder zweite Bachelor oder Master ist, bietet der Studienabschluss an sich nicht mehr viel Statusgewinn. Umso wichtiger wird es, dass der Name der Alma Mater Prestige ausstrahlt.
Es ist schwer geworden, im Wettrüsten um Bildung einen signifikanten Vorsprung zu erringen. Trotzdem gibt es zum Run auf Abschlüsse und Titel keine Alternative. Denn sogar für den Nachwuchs der Oberschicht ist der Studienabschluss das Nadelöhr. Ohne das universitäre Gütesiegel nützen auch beste Herkunft und glänzende Verbindungen nur halb so viel. Allzu hoch ist die Pflichthürde freilich nicht angesetzt: Nach Angaben des Deutschen Studentenwerks ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Akademikerkind das Studium schafft, viermal so hoch wie bei einem anderen Kind. Das ist logisch. Wie alle Eltern wünschen sich hochausgebildete Mütter und Väter, dass ihr Kind es einmal mindestens so gut hat wie sie selbst. Ohne Bachelor und Master geht das nicht. Denn bei begehrten Arbeitgebern wie Audi, adidas und Co. hat die jüngere Generation ohne abgeschlossenes Studium kaum eine Chance auf eine Spitzenposition.
Zumindest der Bachelor-Abschluss ist Pflicht, damit sich die Türen in die Chefetage öffnen.
Mehr her macht natürlich die Kür, oder wie es in Juristenkreisen heißt, die »vollständige Kriegsbemalung«: das perfekte Gap Year, die Eliteuni, eindrucksvolle Praktika, Prädikats- und/oder Doppelabschluss, ein im Ausland erworbener Master, erste Adressen sind beispielsweise Stanford, Oxford, die ETH Zürich oder das Imperial College of London, gerne auch der Doktortitel. Der Soziologieprofessor Michael Hartmann sagt es glasklar: »Wer in die Elite will, muss an die Universität. Über 90 Prozent der deutschen Eliten haben heute einen Hochschulabschluss.«7 Im deutschen Bundestag herrschen ähnliche Verhältnisse: Von den 709 Abgeordneten des 19. Bundestags haben vier von fünf studiert, jeder fünfte ist promoviert.8
Aus den Zahlen lässt sich ablesen: Akademische Abschlüsse garantieren mit ziemlicher Sicherheit eine solide berufliche Entwicklung. Zudem mehren sie, der klassische Bildungskanon lässt grüßen, das kulturelle und soziale Kapital. Das heißt: Ein hoher Abschluss zahlt sich nicht nur in Einkommenschancen aus, er resultiert auch in einem verfeinerteren Habitus, einem gehobeneren Lebensstil und interessanteren Sozialkontakten. Zwar ziehen Akademiker mit einer bodenständigen Herkunft nur selten vollkommen gleich mit Kommilitonen aus besser betuchten Elternhäusern. Trotzdem nivelliert das Studium die Unterschiede, die Weltsicht weitet sich, die Geschmäcker und Ambitionen gleichen sich einander an. Ausbildungsabschlüsse zielen im Vergleich dazu stärker auf unmittelbar verwertbare Fachkompetenzen ab, weniger auf Entfaltung der Persönlichkeit.
Eines allerdings kann auch die perfekteste Bildungsvita nicht gewährleisten: Dass man tatsächlich bis in die Elite aufsteigt, nur weil man viel kann. Dafür sind zu viele ähnlich qualifizierte Mitbewerber im Rennen. Fakt ist aber auch: Fehlen die formalen Qualifikationen, ist der Sprung in die Manager-Elite eines Großunternehmens utopisch. Es sei denn: Man gründet und macht sein eigenes Ding.
Beispiel
Christina Reuter und Fränzi Kühne. Beide Anfang 30, beide erstmals Mutter, beide wurden zu den jüngsten Aufsichtsrätinnen berufen, die Deutschland je hatte: Christina Reuter bei der Kion Group, dem weltweit zweitgrößten Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten, Fränzi Kühne bei dem Telekommunikationsunternehmen freenet. Dorthin gekommen sind sie auf höchst unterschiedlichen Wegen. Bei Christina Reuter war es der klassische: Studium des Wirtschaftsingenieurwesens in Aachen und Peking, Promotion zur Dr. Ing., Oberingenieurin, Gruppenleiterin, Projektleiterin im Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen. Völlig anders ging es Fränzi Kühne an: Aufgewachsen in Berlin-Pankow, Jurastudium geschmissen, mit zwei Freunden die Digitalagentur »Torben, Lucie und die gelbe Gefahr« (TLGG) gegründet. Heute berät TLGG das Bundeswirtschaftsministerium, Spotify und BMW, hat einen Standort in New York und schickt sich an, die weltweit führende Agentur für Digital Business zu werden.9
Ohne fachliche Exzellenz ist alles nichts
Werden Leistungsträger aus Politik, Wirtschaft und Kultur nach den Gründen für ihren beruflichen Erfolg gefragt, antworten sie fast unisono: Ausschlaggebend waren Können und harte Arbeit. Typisches Beispiel: Kurt Biedenkopf, der erste Ministerpräsident von Sachsen. Er gilt als Redetalent, wenige andere Politiker können ihm in Sachen Eloquenz das Wasser reichen. »Können es wenige – oder sind viele zu bequem es zu lernen?« sagt Biedenkopf dazu. »Das ist ein großer Unterschied. Natürlich muss man das trainieren. Was glauben Sie, wie viel Zeit ich verwende, um eine dreiviertelstündige Rede zu halten, ohne ein Stück Papier?«10
Biedenkopf gehört mit seinen 88 Jahren einer vergangenen Generation an. Doch nicht nur ältere Menschen, auch junge Höchstleister reden viel von Antrieb und mehr Anstrengung, als unbedingt nötig ist. »Ich habe mir immer Ziele gesetzt und dann teilweise auch hart dafür gearbeitet, diese zu erreichen«, erklärt Christina Reuter, die junge Aufsichtsrätin, ihren Erfolg. Auch die Geigerin Julia Fischer, 35, betont die Notwendigkeit, nie nachzulassen: »Wenn man Musiker ist, bestimmt das das ganze Leben, auch das alltägliche Leben. Das ist kein Beruf, den man von Montag bis Freitag hat, man hat ihn auch Samstag und Sonntag, an Weihnachten und am Geburtstag.«11
Arbeit am Ich, erarbeiteter Sachverstand, Disziplin, vielleicht sogar unter persönlichen Opfern – die meisten sehr erfolgreichen Menschen nennen persönliche Zielstrebigkeit und Leistung als wichtigste Voraussetzung einer Spitzenkarriere.12