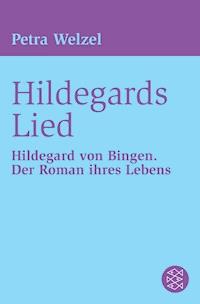
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Vater will die junge Hildegard an einen Adligen verheiraten. Doch sie liebt Erik, einen armen Troubadour. Nur ein Ausweg bleibt: sie flüchtet ins Kloster. Aber auch als Nonne ordnet Hildegard sich nur schwer unter. Wieder flüchtet sie: ihre Heilkunst wird am Hof des deutschen Kaisers verlangt. Endlich wird sie auch in der Kirche anerkannt und erhält ihren großen Auftrag. Sie soll ein Kloster gründen – in Bingen am Rhein. Und dann trifft sie wieder auf Erik, die Liebe ihres Lebens...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Petra Welzel
Hildegards Lied
Hildegard von Bingen. Der Roman ihres Lebens
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Christos, der verrückt genug ist,
auch heute noch Visionen zu haben.
1. Buch
Kapitel 1
Die alte Frau war vor ihre Hütte am Waldrand getreten und lauschte in die Nacht. Irgendetwas lag in der Luft. Und plötzlich wusste sie, was sie vom Lager hatte hochfahren lassen: Es war die Stille, das Fehlen der vertrauten Nachtgeräusche. Da raschelte nichts im Unterholz, kein Nachtvogel schrie, die Wipfel der Bäume standen regungslos, hoben sich starr wie ein Scherenschnitt gegen den Nachthimmel ab. Es war, als hielte die Schöpfung gespannt den Atem an.
Die Alte legte den Kopf in den Nacken, wandte ihr runzliges Gesicht den Sternen zu. Sie bemerkte es sofort: Mars war in das Haus der Venus getreten. Sie verstand es, die Zeichen zu lesen. Etwas ganz Außergewöhnliches stand bevor. Als sich plötzlich eine Schleiereule lautlos aus dem Geäst einer uralten Eiche abstieß und ihren Gesichtskreis von rechts nach links passierte, wusste sie, dass man sie noch heute Nacht brauchen würde.
Entschlossen trat sie zurück in ihre Hütte und atmete den betörenden Duft, den die zahllosen, kopfüber an der Decke baumelnden Kräutersträuße verströmten. Sie entzündete ein Wachslicht und wandte sich den rohen Regalbrettern zu, die die Wand gegenüber Herd und Lager vom Boden bis zum niedrigen Strohdach bedeckten. Dicht an dicht reihten sich dort Krüge, Töpfe, Tiegel und Körbe merkwürdigsten Inhalts. Umsichtig wählte sie dies und jenes aus und verstaute es in einem wollenen Tragsack. Dann schürte sie das Feuer im Herd, erhitzte Wasser in einem Kessel und warf, als es sprudelnd kochte, einige metallische Instrumente hinein. Sorgfältig breitete sie ein reines Leinentuch über den Tisch, fischte mit einem Holzlöffel die abgekochten Instrumente wieder aus dem Topf und wickelte sie in das Tuch.
Die Alte hielt jedes Mal die genaue Reihenfolge dieser Prozedur ein, fast, als ob sie ein magisches Ritual ausübe. Sie wusste nicht genau, wie es wirkte, sie wusste nur, dass es half. Von ihr entbundene Frauen hatten eine weit höhere Überlebenschance, als bei vielen anderen, teils selbst ernannten Heilern, teils ausgebildeten Ärzten. Die Alte konnte weder lesen noch schreiben, aber vielleicht hielt sie gerade deshalb Wissen in Ehren, das ihr von Generationen heilkundiger Frauen mündlich überliefert worden war.
Außerdem, da Satan, der listige Versucher, als von Staub und Schmutz besudelte Schlange zu Eva gekrochen war, um das Böse in die Welt zu bringen, erschien es der Alten nur selbstverständlich, dass bei ihrer Tätigkeit derlei Anhaftungen peinlich vermieden werden mussten. Sie war davon überzeugt, dass es die ungesunde Luft stickiger Zimmer, das faule Stroh der Lager, der Schmutz an Leibern und Gerät war, was das teuflische Fieber ins Wochenbett kriechen ließ und es für so viele Frauen und ihre Neugeborenen zur Totenbahre machte. Das Böse war in der Welt, gehörte dazu. Aber man konnte sich dagegen wappnen, wenn man die Zeichen zu deuten wusste. Darauf verstand sie sich.
So gerüstet trat sie erneut in die Nacht, stand einfach da, sammelte sich. Doch die Spannung wollte nicht von ihr abfallen. Der volle, unverschleierte Mond schien sie bedeutungsvoll, wie das magische Auge der großen Allmutter, anzuschauen. Sie fühlte sich dem Göttlichen nah, ganz hingegeben, ganz Werkzeug. Da klang unterhalb, vom Dorf her kommend, eiliger Hufschlag auf.
Sie rührte sich nicht. Doch noch bevor der Reiter den finsteren Hohlweg verlassen hatte, wusste sie, wer da zu ihr heraufkam. Ein so schnelles Pferd hatte in der Gegend nur einer: Hiltebert von Bermersheim, Edelfreier und Herr über die paar hundert Seelen des gleichnamigen Dorfes. Dass er selbst kam und nicht einen der Hörigen geschickt hatte, erstaunte sie nicht. Längst war ihr klar, dass in dieser Nacht Besonderes eintreten würde.
Der Reiter kam über die Lichtung zügig auf sie zu. An einem Seil führte er eine ungesattelte Eselin mit sich. Seine Kleidung unterschied sich deutlich von den schlicht gewirkten Kitteln der Bauern. Sie war schmucklos, aber für die Verhältnisse kostbar. Die Füße steckten in ledernen Stiefeln und auch das Wams, das die breite Brust überspannte, war aus allerfeinstem, weichem Hirschleder gefertigt. Als einzige Waffe steckte ein langes Jagdmesser mit kunstvoll geschnitztem Horngriff im Gürtel.
Hiltebert hatte die vierzig bereits überschritten. Noch nie war das der Alten so ins Auge gefallen wie heute. Vielleicht lag es an seinen von Nervosität zeugenden fahrigen Bewegungen, mit denen er sein Pferd zur Hütte hin lenkte, vielleicht auch an dem Schweiß, der sein ganzes Gesicht bedeckte. Die Anstrengung eines schnellen Ritts hatte seine sonst so stolzen Züge verzerrt. Tief gruben sich die Falten in sein Antlitz.
Erst dicht vor der Alten zügelte er sein Pferd. Mit gerunzelten Brauen sah Hiltebert auf das Kräuterweib hinab.
»Du wusstest bereits, dass ich kommen würde, Rike?«, richtete er, mehr feststellend als fragend das Wort an sie.
Die Alte hatte das leise Grauen in seinen Augen wohl bemerkt und wich dem Blick aus, indem sie sich demütig verneigte. Sie wusste, dass sie in dem Ruf stand, über allerlei übernatürliche Gaben zu verfügen. Manch einer munkelte sogar, dass sie mit dem Fürsten der Finsternis und seinen Dämonen Umgang pflege. Ein gefährlicher Ruf. Ihresgleichen war bereits aus weit geringerem Anlass der Garaus gemacht worden. Aber noch brauchten die Menschen der Gegend sie, wenn Priester und Gebet nicht helfen konnten. Das Kommen des edlen Herren zeugte davon. Doch das Eis, auf dem sie sich bewegte, war dünn. Schon eine unerklärliche Seuche oder Missernte konnte genügen, und Schuldige mussten her. Dass sie, die außerhalb der Gemeinschaft lebte, einen hervorragenden Sündenbock abgab, war ihr nur zu bewusst. So sagte sie nichts von den Zeichen und beeilte sich, eine harmlose Erklärung für ihr Wachen zu geben.
»Es ist das Alter, gnädiger Herr. Der Schlaf meidet immer öfter mein Bett. Das ist es, was mich vom Nachtlager getrieben hat«, sagte sie demütig.
Hilteberts Brauen zogen sich noch ein wenig mehr zusammen. »Weißt du denn kein Kraut, um Abhilfe zu schaffen? Dein Ruf scheint größer als deine Kunst.« Ungeduldig zerrte er die Eselin am Seil heran. »Kannst du dir auch nicht selber helfen, so höre, Rike: Wenn du bei meinem Weib versagst, wird Gevatter Tod dich schlafen lehren. Und nun komm. Die Herrin liegt auf Tod und Leben.«
Rike konnte die Drohung nicht schrecken. Sie wusste, dass der Herr ein gottesfürchtiger Mann war. So verneigte sie sich nur erneut stumm und trat zu der Eselin.
Behutsam strich sie dem scheuenden Tier über die samtigen Nüstern, hob sanft eins der langen Ohren und flüsterte hinein. Augenblicklich legte sich das Tier, und sie stellte sich breitbeinig über dessen Rücken. Mühelos hob die Eselin die federleichte Alte an.
Rike hätte die erneute Demonstration ihrer Fähigkeiten gern vermieden, aber es ging nicht anders: Niemals hätte sie es sonst mit ihren im Lauf der Jahre immer ungelenkiger werdenden Beinen auf das Tier geschafft. Doch Bermersheim hatte sein Pferd bereits gewendet und schien nichts bemerkt zu haben. In Gedanken war er längst wieder bei seinem sich in Wehen windendem Weib. Tiefe Sorge zeichnete sein Gesicht. Ungeduldig stieß er seinem Tier die Fersen in die Weichen und schon jagten sie in fliegendem Galopp über die Lichtung. Rike schloss ergeben die Augen.
Die wilde Jagd dauerte gottlob nicht allzu lange. Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatten sie den Stammsitz derer von Bermersheim im Nahegau, nicht weit von Alzey, erreicht, der auf der Rikes Hütte gegenüberliegenden Erhebung lag. In das sanfte, fruchtbare Tal dazwischen duckte sich das noch im Schlaf liegende Dorf.
Die Bermersheimer gehörten zwar dem Adel an, aber der Herrensitz glich eher einem großen Gutshof als einer Burg. Keine wehrhafte Mauer umschloss die Ställe, Scheuern und Wohnstätten. Im Unterschied zum Dorf waren die Gebäude aber aus solidem Stein errichtet und mit Ziegeln statt mit Stroh gedeckt. Und auf die eigene kleine Kapelle waren die Bermersheimer so stolz wie die Mainzer auf ihren Dom.
Erst als die Reittiere in Schritt verfielen, öffnete Rike wieder die Augen. Hinter dem geölten Pergament, das die holzgerahmten Fenster des zweistöckigen Haupthauses verschloss, flackerte Licht. Rike konnte immer wieder die Silhouetten geschäftig vorbeieilender Gestalten erkennen. Bermersheim zügelte sein Pferd aber nicht an der breiten Eingangspforte des Hauses, sondern hielt auf die hinten angebauten Stallungen zu. Rike wusste sofort warum und konnte sich ein leises Schmunzeln nicht verkneifen. Nicht allzu viele sollten mitbekommen, dass auch der edle, christliche Herr auf die Hilfe eines anrüchigen Kräuterweibleins zurückgriff.
An der Stalltür ließ sie sich erleichtert vom Rücken des Tieres gleiten. Bermersheim hatte kein Auge für sie und eilte durch den dunklen Stall voran, vorbei an dem friedlich vor den Raufen schlafenden Milchvieh. Erst als er die Tür zum Haupthaus aufriss, fiel wieder Licht auf sein angespanntes Gesicht. Aus Richtung der Küche erklang plötzlich unpassend grelles Lachen. Wenn sie auch nie zur Kirche ging, erkannte Rike doch deutlich darin die Stimme des Priesters, der offensichtlich bereits kräftig dem guten Wein der Gegend zugesprochen hatte.
Bermersheims Gesicht verfinsterte sich. Er verabscheute den Suff und verachtete die Säufer, insgeheim also auch den Pfaffen, was er allerdings laut nie gesagt hätte. Rike wunderte es nicht, dass er sich nicht allein auf dessen Gebet verlassen wollte.
Sie eilten die Treppe zu den Wohngemächern hinauf. Erst vor der Tür des herrschaftlichen Schlafraums schien sich Bermersheim wieder an seine Begleiterin zu erinnern. Fast flehend sah er sie an. Aus seinem Gesicht war jeder Anflug von Misstrauen und Verachtung gewichen, da war nur noch liebende Sorge um die Seinen.
»Höre, Rike«, entrang es sich ihm gepresst, »vergiss, was ich vorhin gesagt habe. Rette mein treues Weib und verhilf dem Kind zum Leben. Es soll dein Schade nicht sein.«
»Es steht alles in Gottes Hand«, erwiderte die Alte schlicht und meinte es auch so.
Wie zum Hohn erklang von unten erneut das Gegacker des fröhlichen Theologen. Bermersheim sackte in sich zusammen.
»Du sagst es«, nickte er resigniert und wandte sich ab, um gemeinsam mit dem Priester auf den unerforschlichen Lauf der Dinge zu harren.
Rike rührte die tiefe Bewegtheit des sonst so stolzen Mannes an, und so setzte sie tröstend hinzu: »Was ich dazu tun kann, werde ich tun. Es wird alles gut.«
Bermersheim drehte sich noch einmal um, und das Unglaubliche geschah: Er lächelte sie freundlich an. »Dank dir, Rike. Wie es auch kommt, wir müssen es demütig annehmen. Dir aber werd ich es nicht vergessen.«
Rike wusste, dass das ein leeres Versprechen war. Wenn sie ihre Arbeit getan hatte, wollte man sie stets schnell wieder loswerden. Sie war den Menschen unheimlich. Niemand hatte sie gern länger unter seinem Dach. So war es immer gewesen. Trotzdem freute sie sich über das freundliche Wort des edlen Herren.
Als sie den Raum betrat, setzte bei dessen kurz vor der Niederkunft stehenden Frau gerade wieder eine der Wehen ein. Das Wimmern der sich auf der zerwühlten Bettstatt Windenden steigerte sich langsam zum Schreien. Rike sah sofort, dass es höchste Zeit war. Der feuchte Fleck auf den Laken verriet, dass das Fruchtwasser bereits abgegangen war. Sie schickte die Mägde, die händeringend um ihre Herrin standen, ihr aber nicht zu helfen wussten, hinaus.
Mechtild von Bermersheim war bereits Ende zwanzig und hatte neun Kindern das Leben geschenkt. Sie war eine starke Frau, aber diesmal spürte sie, das alles anders war. Die nackte Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben. Sie klammerte sich an Rikes Hand und sah die Alte flehentlich an
»Das Kind«, stöhnte sie, »es liegt mir quer zum Leben. Nur du kannst noch helfen.«
Rike brummte ein paar beruhigende Laute, kramte aus ihrem Tragsack eine Phiole, die eine milchige Essenz enthielt, und träufelte einige Tropfen davon in einen bereitstehenden Becher mit Wein.
»Trinkt«, sagte sie lächelnd. »Es wird Euch die Schmerzen nehmen und den Sinn heben. Glaubt mir, alles wird gut.«
Die Bermersheimerin griff dankbar zu. Während sie trank, reinigte sich Rike die Hände sorgfältig an einem Wasserbecken mit Salz und Sand, bevor sie die Untersuchung begann. Schnell stellte sie fest, dass sich das Kind in Steißlage befand. Der Muttermund hatte sich bereits weit geöffnet. Sie durfte keine Zeit mehr verlieren. Es würde ohnehin schwer werden.
Die Gebärende hatte sich sichtlich entspannt. Rike drückte ihr noch einen grün schimmernden Jaspis in die Hand. Der magische Stein würde Mutter und Kind in der Geburtsstunde vor dem Weltverderber schützen. Dann setzten erneut Wehen ein. Rike begann zu beten, griff dabei aber beherzt zu.
Der Priester wäre höchst erstaunt und mit Sicherheit empört gewesen, hätte er Rikes leise gemurmelte Gebete und Beschwörungen vernommen, denn es handelte sich um eine recht freie Interpretation der christlichen Lehre. In Rike lebte noch eine Ahnung von den alten Göttern.
Nach einer Stunde hatte das Kind dank Rikes Umsicht und Erfahrung mit den Füßen voran heil seinen Weg durch den engen Geburtskanal genommen. Es war blau angelaufen und mit Blut und Schleim behaftet, aber Rike konnte seine kommende Schönheit sehen. Auch entging ihr nicht das kleine mandelförmige Mal unter dem linken Auge, ein so genannter Storchenbiss. Für das magische Denken der Alten ein sicheres Zeichen, dass dieser neue Mensch über ganz besondere Gaben verfügte und einmal heraustreten würde aus der Schar der Gewöhnlichen.
Geschickt nabelte sie den schreienden Säugling ab und legte ihn an die milchschwere Brust der geschwächt in den Kissen liegenden Mutter. Dann kümmerte sie sich intensiv um die Nachgeburt, las darin wie andere in einer Offenbarungsschrift und fand auch hier Zeichenhaftes, was ihre Annahmen über die besondere Rolle des Kindes bestätigte.
Die Bermersheimerin war, nachdem sie gesehen hatte, dass ihr zehntes Kind wohlauf war, glücklich in tiefen Schlaf gesunken. Rike löste den Säugling von der Mutterbrust, rieb ihn mit einem reinen Tuch ab und trat mit ihm ans Fenster. Als sie dessen Flügel mit dem Ellenbogen aufgestoßen hatte, wurden die Alte und das Baby vom gleißenden Licht der Morgensonne überstrahlt. Feierlich hob Rike das Kind hoch über ihren Kopf der Sonne entgegen und sprach ergriffen: »Mit den Füßen zuerst bist du auf diese Welt gekommen, um fest darin zu gründen, dein Haupt aber wirst du zu den Sternen heben.«
Augenblicklich setzte das Konzert der Morgenvögel ein und der Säugling fiel krähend ein. Rike klang es wie aller Jubel dieser Welt. Eine Hymne an das Sein. Und wenn sie auch noch nicht wusste, was genau dieses Kind auszeichnete – dass es mit den Musen innigste Freundschaft pflegen würde, darüber war sie sich sicher.
Der Alten traten Tränen in die Augen. Sie spürte tiefe Seelenverwandtschaft zu dem neuen Geschöpf, gleichzeitig aber auch einen schmerzlichen Stich des Verlustes. Sie, die nie geboren, nie einem Mann beigewohnt hatte, würde all ihre Erfahrung, all ihr Können mit ins Grab nehmen. Die Kette würde reißen und mit ihr wieder ein Teil uralten Wissens im Dunkel des Vergessens versinken. Dieses Kind, das sie da in den Armen hielt, wäre genau das richtige gewesen, die Fackel aufzunehmen und weiterzutragen. Zum ersten Mal verspürte sie tiefe Reue über ihre verpasste Mutterschaft.
Für einen Moment flammte Neid, ja Hass auf die Bermersheimerin auf. Warum nahm sie sich nicht einfach das Kind und verschwand mit ihm in den Wäldern? Hatte sie nicht ein Recht darauf? Sie hatte ihm schließlich ins Leben geholfen. Aber der Moment ging schnell vorüber. Liebevoll bettete sie den Säugling in die Armbeuge der noch schlafenden Mutter. Es musste zusammenbleiben, was zusammengehört. Alles andere wäre grausam gewesen und hätte nur die kosmische Ordnung gestört. Sie schwor sich aber, den Werdegang dieses Kindes zu beobachten und, wenn möglich, zu begleiten.
Es gab nichts mehr für sie zu tun. Rasch packte sie ihre Utensilien zusammen und trat vor die Tür, vor der schon die Mägde ungeduldig warteten. Sie hatten das Schreien des Säuglings bereits gehört, es aber nicht gewagt, ungefragt einzutreten.
»Geht hinein, eure Herrin braucht euch jetzt.«
Die Mägde stürzten voll Neugier an ihr vorbei. Rike ging still auf demselben Weg, den sie gekommen war. Im Untergeschoss hörte sie in einem der Räume jemanden Gebete murmeln, das war Hiltebert. Das sägende Schnarchen kam zweifellos vom Priester. Rike betrat den Raum nicht. Bei dem Säugling handelte es sich um ein Mädchen. Sie wollte sich das eigene Hochgefühl nicht durch Hilteberts Enttäuschung, der sich sicherlich einen Sohn gewünscht hatte, trüben lassen.
Fast hatte sie die Stalltür erreicht, da hörte sie eilige Schritte hinter sich. Die rundliche Köchin, die sie wohl an der offenen Küchentür hatte vorbeihuschen sehen, kam ihr nachgelaufen. Sie hielt darreichend einen großen Schinken in den Händen. Rike war einigermaßen überrascht. Hiltebert hatte also Wort gehalten und ihre Bezahlung vor dem ungewissen Ausgang der schwierigen Geburt veranlasst. Doch sie lehnte das üppige Geschenk ab.
»Behalt es für dich und die deinen, gute Frau. Eine Familie hat dafür bessere Verwendung als ein altersschwaches Weib.«
Der Köchin fehlten vor Überraschung die Worte. Dass jemand ein für einfache Leute wie sie recht kostbares Geschenk ausschlug, wollte ihr so schnell nicht in den Kopf. Sie konnte ja nicht wissen, dass die Alte kein Fleisch aß. In Rikes Vorstellung waren auch die Tiere beseelte Wesen, und sie hasste das Töten. Sie war der Überzeugung, dass beim Fleischverzehr die Angst der Kreatur beim Schlachten aufgenommen wurde. Und Angst gebar Gewalt. Von beidem gab es schon genug in der Welt.
Rike huschte durch den Stall nach draußen in den jungen Tag. Nie schien ihr ein Morgen verheißungsvoller. Sie war sich sicher, heute Zeugin eines Ereignisses geworden zu sein, das ihr Leben noch einer einschneidenden Veränderung unterwerfen würde. Tief in Gedanken wanderte sie heimwärts.
Der Säugling wurde zwei Tage später auf den Namen Hildegard getauft. Es war ein Sonntag im Jahre des Herrn 1098. Das heraufziehende zwölfte Jahrhundert würde von Hildegard noch hören.
Kapitel 2
Hildegard saß reglos im hohen Gras. Ein flüchtiger Beobachter hätte die zierliche Gestalt, welche die Bienen betrachtete, die in ihre Körbe ein- und ausflogen, wohl gar nicht wahrgenommen, so sehr verschmolz sie mit ihrer Umgebung. Hildegard konnte für eine Achtjährige erstaunlich lange auf einem Fleck verharren. Andererseits liebte sie auch das Umhertollen, was ihr zerzauster Blondschopf ahnen ließ. Aber jetzt blickten ihre Augen staunend auf das Imkerhäuschen, das sich in der Nähe des Bachlaufs befand, dem Hildegard gefolgt war. Eigentlich war es mehr ein Schuppen, in dem der Müller, dem auch die Pflege der Bienenvölker anvertraut war, die zur Honiggewinnung notwendigen Gerätschaften verwahrte. Daneben standen, aufgereiht auf einem hüfthohen, roh gezimmerten Gestell, die geflochtenen Bienenkörbe.
Hildegard hatte durch aufmerksames Beobachten schon längst herausgefunden, dass die scheinbar planlos hin und her fliegenden Bienen einer genau festgelegten Choreographie folgten.
Doch heute hatte sie etwas Neues entdeckt. Hartnäckig hinderte ein Teil der Bienen die anderen daran, in den Korb zurückzukehren. Merkwürdigerweise waren die Verteidiger deutlich kleiner als die Einlass Begehrenden. Trotzdem mussten Letztere nach unzähligen gescheiterten Versuchen entkräftet aufgeben.
Hildegard wunderte sich, da sie das Zusammenleben der Bienen bis jetzt immer als harmonisch empfunden hatte. Warum waren die Kleinen so erbarmungslos? Wie konnten sie es überhaupt schaffen, sich gegen die Größeren durchzusetzen?
Hildegard ging es wie schon so oft in ihrem kurzen Leben. Ihr brannten ungezählte Fragen auf der Seele und es war schwer, jemanden zu finden, der ihren Wissensdurst stillen konnte. Ihre Geschwister beschäftigten sich bereits mit in deren Augen viel wichtigeren Dingen. Die älteren Schwestern übten tagein, tagaus, was man zur Führung eines Haushaltes benötigte. Schließlich war es üblich, mit dreizehn oder vierzehn eine eigene Familie zu gründen. Und Hildegards Brüder, die ihr vom Alter her näher standen, interessierten sich zwar für Kampf, aber weniger für den unter Bienen als den unter Rittern.
Hildegard hatte im Laufe der Zeit gelernt, dass sie auch von ihrer Mutter nicht allzu viel Aufmerksamkeit erwarten durfte. Sie erklärte es sich damit, dass für sie als Jüngste keine Zeit übrig blieb. Trotzdem merkte sie oft, wie sich Enttäuschung in ihr breit machte, wenn sie mit ansah, wie viel Ehrgeiz ihre Mutter etwa darein setzte, der ältesten, Framhild, das Harfenspiel beizubringen.
Aber Hildegard klagte nicht, sondern tröstete sich damit, dass ihr Vater ihr mehr Zeit widmete, als es für eine Tochter üblich war. Das kleine, eigensinnige Mädchen hatte sein Herz im Sturm erobert. Aber die Sorge um Hof und Dorf nahm ihn sehr in Anspruch, sodass Hildegard ein einsames Mädchen geworden wäre, hätte nicht ein Mensch sich ihrer angenommen, wann immer es möglich war. Und auch jetzt teilten sich die Büsche, und Rike stand, wie aus dem Nichts emporgewachsen, plötzlich vor Hildegard. »Sei gegrüßt, mein Kind.«
Hildegard fiel der Alten in die weit ausgebreiteten Arme, die dem jugendlichen Ansturm kaum standhalten konnten, denn an Rike waren die Jahre seit Hildegards Geburt nicht spurlos vorübergegangen. Das harte und entbehrungsreiche Leben, das die meisten Menschen führten, war für sie noch schwerer, da sie immer allein und auf sich gestellt war. Aber Rike war zäh, trotzte dem Hunger und den Krankheiten. Die Leute munkelten, ihre seltsamen Verbindungen mit Magie und anderen dunklen Mächten seien ihr dabei behilflich.
In Wirklichkeit hatte Rikes Durchhaltevermögen einen ganz einfachen Grund. Es war Hildegard.
Rike hatte sich nie damit abgefunden, dass sie Hildegard lediglich auf die Welt geholt hatte. Sie wollte ihr die Welt erklären, mit ihr Natur und Leben neu entdecken. Sie empfand schlicht mütterliche Gefühle gegenüber dem Kind. Und sie schaffte es nicht, sie zu unterdrücken, obwohl sie wusste, dass es besser für Hildegard wäre. Denn normalerweise mieden die Leute Rike, wo immer es ging, und sie würden auch jedem, der sich länger mit ihr abgab, Misstrauen entgegenbringen.
Für Hildegard war es unausgesprochen klar, dass sie ihre Treffen geheim hielt, denn auch sie wusste, was die Leute dachten. Doch genauso klar war es für sie, dass die Leute sich irren mussten, kannte sie Rike doch als sanftmütige, ehrbare Frau, von der sicher keinerlei Gefahren ausgingen.
Rike revanchierte sich für das Glück, das das Zusammensein mit dem kleinen Mädchen ihr schenkte. Sie lehrte Hildegard Stück für Stück alles, was sie selbst wusste. Der Alten war es eine Freude, denn Hildegard war eine dankbare Schülerin, voll unstillbarer Wissbegier, voll klugen Verstehens. Rike wunderte es nicht. Sie hatte die Zeichen bei der Geburt des Kindes gesehen.
»Rike, komm schnell, sieh dir das an! Wie gemein sie zueinander sind«, rief Hildegard erregt aus, Rike mit sich noch näher zu den Körben ziehend.
Rike wuchtete die Weidenkiepe vom Rücken, die randvoll mit frisch geschnittenem Wildkraut gefüllt war, setzte sich und betrachtete ruhig die emsig umherfliegenden Bienen. »Tiere sind nie grausam, das musst du dir merken«, antwortete Rike freundlich, aber bestimmt. »Grausam ist nur der Mensch.«
»Aber es kann doch nicht recht sein, die eigenen Genossen auszustoßen. Schau, wie sie entkräftet wegfliegen müssen«, empörte sich Hildegard.
»Das sind die Bienenmännchen, die mit der Befruchtung ihre Aufgabe erfüllt haben. Jetzt müssen sie Platz für die kommende Generation machen«, erklärte Rike.
»Wie undankbar! Warum gibt man ihnen keinen Platz zum Ausruhen?«
»Weil sie dem Nachwuchs die Nahrung rauben würden, wenn die Kriegerinnen sie hereinließen. So aber werden sie selbst zur Nahrung für andere, für die Vögel zum Beispiel.«
Hildegard erkannte die Ordnung im Ganzen und war fasziniert, wenn auch immer noch etwas befremdet von der Unerbittlichkeit der Natur. Rike erzählte alles, was sie von den Bienen wusste, dass dort, anders als bei den Menschen, die Weibchen herrschten und die Männchen dienten und dass sie sogar eine Königin hatten.
»Aber das kann doch nicht sein«, begehrte Hildegard auf. »Steht nicht geschrieben, dass der Mann das Haupt des Weibes sei?«
Rike zuckte nur mit den Achseln. Sie war nicht bibelfest und außerdem wollte sie den Glauben des Mädchens nicht erschüttern.
»Bei den Menschen ist das heute zweifellos so«, bemerkte sie deshalb zustimmend, um dann sybillinisch hinzuzufügen: »Aber gestern war es vielleicht nicht so, und wer weiß, wie es morgen sein wird.«
Rike sah die nachdenklich gekrauste Stirn der kleinen Hildegard und wünschte, sie könnte ihr das Erkennen der Welt einfacher machen.
»Nimm dir das Mühlrad als Beispiel«, sagte Rike und deutete mit dem Kopf in Richtung des stetigen Rumpelns, das vom Mühlenhaus herüberklang. »Was eben noch unten war, steigt auf, steht einen Moment im Zenit, um gleich wieder hinabzufallen, und immer so fort. Das ist das Prinzip der Welt. Alles ist in stetiger, kreisförmiger Veränderung. Nur die Mitte des Rads steht still und bleibt sich immer gleich. Und diese Mitte, das ist Gott.«
Hildegards nachdenklich gekrauste Stirn glättete sich plötzlich. Um ihren Mund zuckte es spitzbübisch. Sie war sich sicher, diesmal Rike bei einem Irrtum ertappt zu haben.
»Die Mitte vom Rad ist ein Loch, und ein Loch besteht bekanntlich aus Nichts«, wandte sie eifrig ein. »Demnach dürfte es Gott gar nicht geben.«
Rike schüttelte energisch den Kopf, freute sich aber über ihre kluge Schülerin.
»Natürlich gibt es Gott«, erklärte sie kategorisch. »Genau wie es das Nichts nicht ohne das Etwas gibt. Ein Loch ist schließlich erst da, wenn es einen Rand hat.«
Rike betrachtete fast ein wenig mitleidig das tiefe Ratlosigkeit widerspiegelnde Gesicht des Mädchens. Sie strich Hildegard liebevoll über das Haar und sagte tröstend: »Den Menschen ist es nicht gegeben, die letzten Dinge zu wissen. Wir können uns immer nur Vorstellungen machen, in Bildern denken. Du musst glauben, um zu erkennen. Trotzdem solltest du dich nicht vorschnell zufrieden geben und mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Also lerne, was immer es nur zu lernen gibt. Und achte auf den Sonnenstand, mit dem du dich schließlich schon auskennst.«
Hildegard sah Rike fragend an, die dann fortfuhr. »Die Sonne steht tief, wahrscheinlich vermisst man dich schon.«
Hildegard fiel plötzlich ein, dass das Nachtmahl kurz bevorstehen musste. Eilig verabschiedete sie sich heimwärts, um nicht zu spät zu kommen. Doch in Wahrheit trieb sie noch etwas anderes an. In ihrem Taubenhaus würden heute wahrscheinlich ein paar Küken schlüpfen und sie wollte unbedingt dabei sein, wenn es so weit war. Hildegard begann, noch schneller zu laufen.
Hildegard hatte Glück. Noch hatte sie niemand vermisst, da das Nachtmahl zugunsten eines üppigen Festessens auf die späten Abendstunden verschoben worden war.
Nahe der Küche brannten mehrere offene Feuer, über denen dreibeinige Kessel, bis oben mit Fleischsuppe gefüllt, hingen. Der Küchenmeister inspizierte die Vorbereitungen und befehligte die schwitzend arbeitenden Mägde.
Hiltebert von Bermersheim hatte Besuch bekommen, sehr wichtigen Besuch. Sein Nachbar, der im nicht weit entfernt liegenden Rara bei Worms residierende Gunter von Hoheneck, hatte auf dem Rückweg vom Fürstentag zu Ingelheim bei ihm Halt gemacht. Und obwohl sein Begleiter, Ruthard, Erzbischof von Mainz, der bei weitem Mächtigere von beiden war, galt Hilteberts Aufmerksamkeit hauptsächlich Gunter. Dem Erzbischof, der eine kleine und hagere Erscheinung war, fiel das unangenehm auf. Musste er es als Kind und Heranwachsender oft genug ertragen, übersehen zu werden, so hatte er durch eifriges Streben und geschicktes Intrigieren verstanden, schon früh eine einflussreiche Stellung einzunehmen. Jetzt konnte er den nötigen Respekt einfordern, wovon er oft genug Gebrauch machte.
Er konnte nicht wissen, dass Hilteberts mangelnde Ehrerbietung nichts mit ihm zu tun hatte, sondern einfach darin begründet lag, dass Hiltebert sich ganz darauf konzentrierte, die von Hohenecks und die Bermersheimer miteinander zu verbinden. Er hoffte, seine Jüngste, Hildegard, mit Gunters Sohn Anno verheiraten zu können.
Der Zwölfjährige war eine überaus gute Partie. Die Ländereien Gunters übertrafen Hilteberts bei weitem und Gunter genoss auch bei den Mächtigen hohes Ansehen, was sein Begleiter, der Erzbischof von Mainz, bewies.
Mechtild näherte sich den dreien, da sie solch eine wichtige Sache nicht ihrem Mann alleine überlassen wollte. Hiltebert sah mit Stolz auf seine festlich gekleidete Frau, deren dichtes, langes Haar mit einem golddurchwirkten Netz hochgehalten wurde, sodass ihr langer, schlanker Hals zur Geltung kam. »Schließe dich uns an, Mechtild.«
Mechtild verneigte sich vor Gunter, während sie vor dem Erzbischof auf die Knie fiel. Sie wusste sehr wohl der Macht ihren Tribut zu zollen. Als sie sich Gunter zuwandte, wunderte sie sich, wie jedes Mal wenn sie ihn sah, wie es ihm gelang, sein bis zum Zerreißen gespanntes Wams über seinem mächtigen Bauch zu schließen. Auch sein rotes Gesicht, auf dessen fliehender Stirn unter einem spärlich werdenden Haaransatz Schweißtropfen standen, stieß sie eher ab. Trotzdem hoffte auch sie, Hildegard in vier Jahren, mit ihrem zwölften Geburtstag, in seine Familie geben zu können.
Mechtild hatte seit Hildegards Geburt kein Kind mehr zur Welt bringen können. Anstatt noch einmal einen Knaben zu gebären, wie es ihr Wunsch war, endete jede ihrer Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt. Obwohl sie als gottesfürchtige Frau wusste, dass sie ihr Schicksal annehmen musste, hegte sie doch insgeheim einen leisen Groll gegen Hildegard. Was war bei ihrer Geburt geschehen, das sie jetzt unfähig machte, ihre Bestimmung als Frau zu erfüllen? Und wenn es schon das letzte Kind sein sollte, warum war es dann nicht wenigstens ein Knabe geworden? Und so hoffte sie auf den Zeitpunkt, wo sie Hildegard als ständige Erinnerung an ihr Unvermögen nicht mehr täglich vor Augen haben musste.
Gunter, nichts ahnend, welche Erwartungen seine Gastgeber an ihn hatten, konnte es kaum abwarten, das Neueste vom Fürstentag zu berichten. »Stellt Euch vor, der Kaiser hat abgedankt.«
Hilteberts Erstaunen hielt sich in Grenzen. Sicher, Heinrich hatte einiges in Kauf genommen, um an der Macht zu bleiben, schließlich sogar den Gang nach Canossa. Aber warum sollte er jetzt nicht den Platz zugunsten seines Sohnes räumen? Auch er würde seinen Hof schließlich beizeiten seinem Ältesten überlassen. Aber an Gunters Miene erkannte er, dass das bei einem Kaiser wohl etwas ganz Besonderes war, also heuchelte er Erstaunen. »Nein, so früh? Wir verlieren wahrlich einen großen Herrscher.«
Der Bischof schien das nicht gerne zu hören. »Vielleicht von seiner Statur. Aber nicht von seinen Taten. Er hat sich von den Juden aushalten lassen.«
»Aber dafür hat er ihnen Schutz gewährt«, erwiderte Hiltebert sofort. Ihm selber war so einiges über die Ausschreitungen gegen die Juden zu Ohren gekommen und es hatte ihm nicht gefallen. Hiltebert war ein friedliebender Mann, wenn auch hauptsächlich aus dem Grund, weil er selber in Ruhe gelassen werden wollte. »Das hat er anderen überlassen. Er selber hat nur kassiert«, entgegnete Ruthard schroff.
Jetzt hielt es Mechtild für höchste Zeit, einzugreifen. Sie wandte sich an den Erzbischof: »Nur Leute wie Ihr kennen die ganze Wahrheit. Unsereins ist auf die spärlichen Nachrichten angewiesen, die bis hierhin dringen.«
Mechtild stand die Rolle der sanften und unterwürfigen Ehefrau gut. In Wahrheit besaß sie einen scharfen Verstand, mit dem sie alles, was an Gerüchten zu ihr drang, filterte, sodass sie meistens über die Ereignisse im Reich gut informiert war. So wusste Mechtild, dass auch der Erzbischof Geld von den Juden angenommen hatte, um sie gegen die Kreuzfahrer zu schützen. Doch im Gegensatz zum Kaiser hatte er sein Versprechen nicht wahr gemacht, sondern die Juden einfach im Stich gelassen. Heinrich hatte ihn daraufhin getadelt, während Ruthard die Sache natürlich lieber vertuscht hätte. Kein Wunder, dass der Erzbischof nicht gut auf den Kaiser zu sprechen war.
Mechtild sah Hiltebert eindringlich an. Es war höchste Zeit, das Gespräch endlich auf Hildegard zu bringen, bevor ihr Gatte den ebenso mächtigen wie schmächtigen Ruthard noch vollends verärgerte.
Hildegard kam außer Atem beim väterlichen Hof an. Auch wenn es sie noch so sehr eilte, zu den Tauben zu kommen, so erschien es ihr doch klüger, ungesehen von hinten durch den großen Gemüsegarten das Anwesen zu betreten. Doch kaum war sie durch einen Spalt in der dichten Weißdornhecke geklettert, der nur ihr bekannt war, blickte sie stumm vor Erstaunen auf das bunte Treiben, das sich vor ihr auf dem Hof darbot. Mindestens ein Dutzend fremde, mit Kettenhemden bekleidete Reiter waren damit beschäftigt, ihre Pferde zu versorgen. Die Stallburschen ihres Vaters gingen ihnen dabei zur Hand.
Neugierig näherte sich Hildegard der Truppe, von der einige bereits dabei waren, Zelte für die Nacht aufzuschlagen. Besuch war angekommen! Hildegard freute sich, denn sie wusste, das bedeutete nicht nur ein Festmahl, sondern auch Neuigkeiten aus der Welt draußen.
Hildegard wollte gerade einen der Reiter fragen, woher sie kämen, als ein lautes Geräusch sie herumfahren ließ. Es klang, als wenn Metall auf Metall träfe. Und tatsächlich, ein junger Bursche hieb sein Schwert auf die Metallbänder, die den Holzstamm ihres Taubenhauses ummantelten. Hildegard zuckte erschrocken zusammen, als sie das Schwert erneut niedersausen sah. Bei jedem Schlag stoben Scharen von Tauben verschreckt in die Luft. Hildegard rannte zu dem Burschen hinüber und fiel ihm in den Arm, bevor er erneut zuschlagen konnte.
»Lass das!«
Hildegard drückte seinen Arm mit aller Kraft hinunter, was nicht einfach war, da der Junge bald zwei Köpfe größer war als sie. Mit breiten Schultern und wehenden blonden Haaren war er eine stolze Erscheinung. Verblüfft blickte er auf das junge Mädchen hinab. Hildegard trat zurück und senkte scheu den Blick, als ihr bewusst wurde, was sie getan hatte, doch dann siegte die Neugier und sie blickte dem Recken ins Gesicht. Es war ebenmäßig geschnitten, seine Nase gerade, das Kinn hervorgestreckt. Ein schönes Anlitz, doch etwas störte Hildegard. Vielleicht waren es seine schmalen Lippen, vielleicht seine eng zusammenstehenden blauen Augen. Es ging etwas Kaltes von ihm aus.
»He, junges Fräulein, ist das deine besondere Art, dich vorzustellen?«
Der Junge sah belustigt auf das ihn mit wilder Miene anstarrende Mädchen herab. Doch Hildegard dachte nicht daran, auf seinen scherzhaften Ton einzugehen. »Lass meine Tauben in Ruhe. Sie haben dir nichts getan.«
»Was interessieren mich deine Tauben? Ich muss mein Schwert schärfen.«
Er fuhr prüfend über die Klinge, die im Licht der untergehenden Sonne aufblitzte. Die Waffe, die sein Vater ihm erst seit kurzem erlaubt hatte bei sich zu tragen, war sein ganzer Stolz. In ihrem Glanz spiegelte sich für ihn seine Zukunft als kampferprobter, wagemutiger Ritter. Es gab genügend Vorbilder, denen er nacheifern konnte. Seinen Gedanken nachhängend hatte er das Mädchen, das ihn starr anblickte, schon vollkommen vergessen, während er erneut Metall auf Metall hieb, sodass Funken aufstoben. Hildegard schrie auf und stellte sich entschlossen schützend vor den Stamm. »Hast du mich nicht verstanden? Das ist mein Taubenhaus!«
Hildegard versuchte mit klarer, bestimmter Stimme zu sprechen, auch wenn sie innerlich sehr aufgewühlt war. Der Taubenschlag war ein Geschenk ihres Vaters ganz für sie alleine gewesen und sie hatte mit seiner Hilfe eine Taubenzucht begonnen. Mit zwei Tauben, einer schneeweißen und einer grau gefiederten, hatte sie angefangen und mittlerweile wurde der Schlag schon von gut drei Dutzend prächtigen und gesunden Tieren bevölkert. Hildegard hatte sie gehegt und gepflegt und Rike immer wieder um Rat bei Krankheiten befragt. Sie konnte es nicht glauben, dass jemand sich so gleichgültig ihren Schützlingen gegenüber verhielt.
Der Junge sah erstaunt, dass das Mädchen sich ihm in den Weg gestellt hatte. Langsam wurde sie lästig, auch wenn ihr Beharrungsvermögen ihm imponierte. So was hatte er bei einem Mädchen bis jetzt noch nicht erlebt.
»Schsch, schsch, ganz ruhig«, versuchte Hildegard die umherflatternden Tiere zu beruhigen. »Ich bin bei euch, keine Angst.«
»Vielleicht sollte ich dir sagen, mit wem du dich gerade anlegst, mein Täubchen. Ich bin Anno.«
Hildegard sah ihn unbeeindruckt an. »Das ist mir egal. Und wenn du der Kaiser persönlich wärst.«
Jetzt war Anno wirklich belustigt. »Damit kann ich leider nicht dienen. Noch nicht. Doch wenn ich mich weiter in der Kampfkunst übe, so wird vielleicht ein berühmter Mann aus mir.«
»Dazu gehört mehr als wildes Drauflosschlagen.«
Hildegard wandte sich von dem Jungen ab, denn in dem Moment kam Lise, die weiße Taube, mit der sie ihre Zucht begonnen hatte, zutraulich auf sie zugeflattert. Anno hob erneut sein Schwert. »Natürlich, zur Kraft gehört auch Schnelligkeit.«
Lise wollte sich gerade auf Hildegards Schulter niederlassen, doch die Waffe traf das Tier noch im Flug. Sie trennte den Kopf vom Körper. Entsetzt sah Hildegard, wie die leblose Taube schwer vor ihre Füße fiel. Sie sah hoch, in das triumphierende Gesicht Annos, dann wieder auf den Vogel, und konnte doch nicht fassen, was geschehen war. Hildegard bückte sich, nahm das tote Tier sanft auf und schmiegte ihre Wange daran. Sie hatte nicht aufgepasst, hatte das schutzlose Tier diesem seelenlosen Haudegen ausgeliefert! Hildegard schossen heiße Tränen in die Augen. Sie fuhr Anno wütend an: »Wie kannst du es wagen, dich auf meiner Eltern Hof so aufzuführen! Warte, bis mein Vater davon erfährt.«
»Hildegard, da bist du ja, mein Kind.«
Es war die Stimme ihres Vaters, die Hildegard herumfahren ließ. »Vater!«
Hildegard lief auf ihren Vater zu, der ihr wie der Erlöser aus einem Albtraum erschien. Gleich würde sie in seine Arme sinken, gleich wäre alles wieder gut.
»Wir haben Besuch. Es ist unser lieber Nachbar Gunter von Hoheneck.«
Hildegard musterte den dicken, atemlos wirkenden Mann flüchtig. Sie hatte ihn schon früher gesehen und wusste, dass Vater ihn sehr schätzte.
»Meinen Sohn hast du anscheinend schon kennen gelernt. Ich hoffe, ihr habt euch gut amüsiert.«
Gunter warf Hiltebert einen bedeutungsvollen Seitenblick zu, der Hildegard allerdings entging. Sie war zu erstaunt darüber, dass ausgerechnet dieser gewissenlose Rüpel Gunters Sohn war. Aber sei es drum, sie konnte und wollte zu seinen Taten nicht schweigen. »Wir haben uns überhaupt nicht amüsiert.«
Sie hielt Hiltebert und Gunter die tote Taube hin. »Er hat meine Lise ermordet.«
Hiltebert sah den Kadaver in ihren Händen. Sofort riss er ihn ihr weg und schmiss das tote Tier in hohem Bogen fort. Er wollte nicht, dass seine Gäste mit irgendwelchen Albernheiten belästigt wurden, zumal jetzt auch noch Ruthard dazukam, der sich Hilteberts Hof anschauen wollte. »Es ist nur eine Taube, mein Kind, und obendrein tot.«
Hildegard starrte ihren Vater erstaunt an, bevor sie ohne nachzudenken loslief, um die Taube wieder aufzulesen. Aber Hiltebert hielt sie fest. »Wir haben Gäste, vergiss das nicht.«
Hildegard warf Anno einen feindseligen Blick zu. »Wie könnte ich das.«
Anno war sich offenbar keiner Schuld bewusst. Er zuckte mit den Achseln. »Ich habe nur das Führen des Schwertes geübt.«
Gunter nickte bestätigend. »Mein Sohn macht große Fortschritte. Er ist sehr eifrig und lässt keine Gelegenheit aus, sein Können zu vervollkommnen. Schließlich will er ein großer Ritter werden.«
Der Bischof, der näher kam, blickte Anno beifällig an. »Du wirst deine Bestimmung erfüllen, mein Sohn.«
Er musterte Annos bereits gestählten Körper und es war nicht zu übersehen, dass er ihm gefiel. Hildegard konnte nicht länger an sich halten. »Wie kann es Bestimmung sein, ein wehrloses Tier zu töten?«
Mit erstaunt gerunzelten Brauen wandte der Bischof sich Hildegard zu. Hiltebert beeilte sich, seine Tochter vorzustellen. »Das ist Hildegard, meine Jüngste.«
Ruthard versuchte das Mädchen gütig anzulächeln, was ihm aber nicht ganz gelang, da ihm ihr aufmüpfiger Ton überhaupt nicht gefiel. »Das Tier soll dem Menschen dienen, ebenso wie die Frau dem Mann. Das sind die Gesetze, in denen Gott seinen Willen kundtut.«
Hildegard war etwas verlegen, weil sie wohl wusste, dass sie eigentlich in Anwesenheit all der hohen Herren gar nicht sprechen dürfte. Andererseits war sie so empört und aufgewühlt, dass es einfach aus ihr herausplatzte. »Aber morgen kann schon alles anders sein.«
Ruthard blickte erst Hildegard, dann ihren Vater streng an. »Ich muss mich wohl verhört haben.«
Hildegard, die die leise Drohung nicht heraushörte, wurde nun deutlicher. »Es ist wie beim Mühlrad. Das, was gerade noch oben war, fällt hinab, während das, was tief unten ist, im nächsten Augenblick hoch oben am Zenit erstrahlt.«
Hildegard spürte eine tiefe Freude in sich, dass ihr das eben erst von Rike Gelernte schon so klar und einsichtig erschien. Doch des Bischofs Stimme erschallte nun eindeutig verärgert, sodass das Mädchen zusammenzuckte. »Natürlich ist sie nur ein Mädchen, Hiltebert. Aber Ihr müsst ihr trotzdem die Heilige Schrift verkünden.«
Hiltebert nickte beflissen. »Alle meine Kinder, auch Hildegard, kennen die Offenbarung. Ihr müsst verzeihen, sie ist noch ein Kind, aus dem manches unbedacht heraussprudelt.«
Er wandte sich an Gunter. »Aber, keine Angst, bis sie ein Mitglied Eurer Familie wird, ist sie reif und vernünftig.«
Hildegard wusste nicht, wie ihr Vater das meinte und sah ihn fragend an, während Gunter schon lachend einfiel: »Hauptsache, Anno bekommt sie nicht erst als Greisin zur Frau.«
»Zur Frau?«
Hildegard blickte fragend von einem zum anderen. An Annos überraschter Miene las sie ab, dass er genauso wenig wusste wie sie. Doch schon sollte ihr Vater ihr Klarheit verschaffen. »Warum die frohe Botschaft länger geheim halten? Wir werden ohnehin noch vor dem Essen verkünden, dass unsere Familien sich verbinden. Du, meine liebe Hildegard, wirst Anno heiraten. Die Feier wird im Jahre des Herrn 1112 stattfinden.«
Hildegard stand wie vom Donner gerührt, während Anno sie etwas scheu ansah. Doch Hildegard nahm seinen Blick gar nicht wahr, in ihrem Inneren begann ein Sturm zu toben. Nicht, dass die Hochzeit an sich der Grund dafür war. Einen Mann, Kinder, Haus und Hof, all das erträumte sie sich. Sicher, standesgemäß war dieser Anno. Sie wusste, dass die von Hohenecks viel mehr Land besaßen als ihre Familie. Aber das konnte doch nicht wettmachen, dass der Junge ein grausamer Mensch war. Wieso schien sie die Einzige zu sein, die das merkte? Hildegard blickte zu ihrem Vater, der schon wieder mit Gunter und dem Bischof sprach. Er warf noch einen kurzen Blick zurück. »Kommt, Kinder, das Essen wartet!«
Damit ging er weiter. Doch Hildegard zögerte. Ihr Blick fiel auf Anno, der sich bei dem Wort »Essen« bereitmachte, den Männern zu folgen. Er griff ein Büschel Stroh, das unter dem Taubenschlag lag, um damit sein Schwert zu reinigen. Hildegard schnitt es ins Herz, als sie sah, wie er die Spuren des Taubenblutes abwischte, bevor er sein Schwert wieder in die Scheide führte. Sie wich erschrocken zurück, als er auf sie zukam. Er reichte ihr den Arm. »Darf ich dich hineingeleiten?«
Sie merkte, dass er es ernst meinte. Dieser kaltherzige Junge, den nicht mehr viel vom Mann trennte, hatte gar nicht begriffen, was er bei ihr angerichtet hatte. Hildegards Zorn machte einer kalten Verachtung Platz. Jemand, der weder genug Gefühl noch ausreichend Verstand besaß, für so jemanden konnte sie nur Abscheu empfinden. Hildegard machte wortlos kehrt und ließ den verblüfften Anno stehen. Sie musste zu Rike, und zwar sofort.
Kapitel 3
Hildegard lief über den Hof in Richtung des Eingangstores. Immer noch herrschte rege Betriebsamkeit im Hof, wo schon der Nachschub für die Festgesellschaft vorbereitet wurde. Hildegard wich zwei Knechten aus, die ein an einem Stock hängendes Spanferkel zur Feuerstelle transportierten. Das Mädchen mied den hellen Feuerschein und schlich sich im Schutz der Dämmerung an dem geschäftig hin- und hereilenden Gesinde vorbei nach draußen. Kaum aus dem Tor hinaus, rannte Hildegard so schnell sie konnte.
Außer Atem erreichte sie schließlich die ersten Stämme der alten Eichen, sich eilig umblickend, ob irgendjemand ihre Flucht bemerkt haben könnte. Aber niemand schien sie zu suchen, zu sehr waren wohl alle von den großen Feierlichkeiten abgelenkt.
Sie fühlte sich plötzlich ausgeschlossen. Das unbeschwerte Umhertollen in den Wiesen, das staunende Beobachten der Bienen, all das schien eine Ewigkeit her zu sein. Ob es auch anderen Mädchen so ging? Wer weiß, vielleicht hatte sich auch eine ihrer älteren Schwestern schon einmal in einer solchen Lage befunden. Jetzt rächte es sich, dass Hildegard so wenig an deren Alltag teilgenommen hatte. Framhild beherrschte meisterlich die Kunst, einen Haushalt zu führen. Aber ob sie glücklich war über die Wahl ihres künftigen Gatten? Hildegard wusste es nicht. Johanna befehligte das Gesinde mit Herz und Verstand, fast wie die Mutter. Aber hatte sie gegenüber ihrem Zukünftigen etwas zu sagen? Hildegard seufzte. Wie gern hätte sie jetzt mit den Älteren gesprochen. Aber sie wagte es nicht, zurückzukehren. Zu sehr hatte sie die Gleichgültigkeit ihres Vaters, von dem sie sich sonst immer verstanden fühlte, verschreckt. Wenn er nicht merkte, dass sie einen gefühllosen und grausamen Mann wie Anno unmöglich heiraten konnte, würden es wohl auch ihre Schwestern nicht tun.
Aber Rike würde sie verstehen. Trotz der mittlerweile vollkommenen Dunkelheit wandte sich Hildegard dem Wald zu, der undurchdringlicher denn je wirkte. Sie wagte es nicht, den Weg zu nehmen, aus Furcht, entdeckt zu werden. Sie, die die Zeichen der Natur gut zu lesen verstand, wusste, wie sie sich orientieren konnte, auch wenn jeglicher Pfad fehlte. Doch diese Nacht machte es Hildegard schwer. Die Sterne, sonst gute Richtungsweiser, waren hinter dichten Wolken verborgen.
Hildegard bahnte sich ihren Weg und versuchte, die vielen Kratzer und Schrammen nicht zu beachten, die mittlerweile auf ihrer Haut brannten. Rike würde eine heilende Salbe anrühren und auf all ihre wunden Stellen auftragen. Würde sie Arnika nehmen, oder vielleicht den die Heilung beschleunigenden Löwenzahn bevorzugen? Ach, wäre Hildegard nur erst da.
Ungeduldig suchte sie nach vertrauten Wegzeichen. Wann erreichte sie endlich die große Lichtung, die die Hälfte der Strecke zu Rikes Hütte markierte? Doch seltsam, der Weg dorthin zog sich arg in die Länge. Nicht auszudenken, wenn sie einen Irrweg beschritten hätte. Tagelang konnte sie durch den Wald irren, ohne auch nur einen Menschen zu sehen. Hildegard drängte den Gedanken energisch beiseite, da sie merkte, wie Angst sich in ihr breit machte.
Plötzlich erschien ihr der Wald, in dem sie schon so viele Stunden im Spiel umhergestreift war, nicht als Freund, sondern als Feind. Die nur undeutlich zu erkennenden Äste schienen sich bedrohlich zu ihr zu neigen. Das Mädchen eilte so schnell es konnte, doch je schneller sie lief, umso schneller holte die Panik sie ein. Wieder und wieder drehte sich Hildegard um, fast sicher, einem schrecklichen Verfolger ins Gesicht zu sehen. Da! Hatte sie nicht ein Geräusch gehört? Hildegard ließ sich keine Zeit, um zu lauschen, sondern stürzte vorwärts, immer nur weiter, weg von diesem namenlosen Grauen.
Doch dann zwang etwas Hildegard, ihre wilde Flucht zu unterbrechen. Sie wollte es erst nicht wahrhaben, doch schließlich konnte sie es nicht mehr leugnen. Der Boden war nass. Nicht vom Regen durchweicht oder von einem Bachlauf durchdrungen, nein, es war die stinkende, faulige Kälte, die von den Sümpfen herüberdrang.
Jetzt hatte Hildegard die Gewissheit. Sie war vollkommen in die Irre gegangen. Rikes Hütte lag weit entfernt vom Moor. Hildegards erste Reaktion war, abrupt kehrtzumachen. Doch dabei vergaß das Mädchen, auf festen Tritt zu achten. Und plötzlich merkte Hildegard, dass sie schon viel tiefer in die Sümpfe hineingeraten sein musste, als sie gedacht hatte, denn schon steckte sie mit dem Fuß im Schlamm, kam ins Straucheln und verlor den Halt. Sie versuchte, sich wieder aufzurichten, was ihr tatsächlich gelang. Hildegard atmete auf, sicher, der Gefahr noch einmal entronnen zu sein, doch schon mit dem nächsten Schritt war sie bis zu den Hüften eingesunken. Der kalte Schlamm drang durch ihr Kleid. Jetzt erst wurde sie gewahr, wie sehr sie schon die ganze Zeit gefroren hatte. Die kalte Masse kam ihr wie die Hand des Todes vor, die sie fest umschließen wollte. In Panik wand sie sich, was zur Folge hatte, dass sie immer tiefer einsank. Sie begann um Hilfe zu rufen, sich gleichzeitig der Aussichtslosigkeit ihres Tuns bewusst. So wurde aus den Schreien bald ein Wehklagen, ein verzweifeltes Rufen nach ihrem ach so geliebten Vater. Vielleicht hatte sie ihm mit ihrer Flucht Unrecht getan, vielleicht hatte sie voreilig gehandelt. In ihrer Not hatte sie fast schon das Gefühl, die gerechte Strafe ereile sie in diesem Augenblick.
Als der Modder jedoch begann, fest ihren Brustkorb zu umschließen und ihr den Atem nahm, durchfuhr es sie, dass es vielleicht einfach ihr Schicksal sei. Vielleicht sollte sie sich fügen, aufhören, sich zur Wehr zu setzen gegen etwas, das ohnehin stärker war als sie. Hildegard fand eine Art Trost darin, sich nicht mehr aufbäumen zu müssen, sich dem heimtückischen Schlick einfach hinzugeben. Sie wollte ihre letzten Atemzüge nicht im Kampf verbringen, sondern sich der gewaltigen Kraft, die an ihr zerrte, anvertrauen. Und als sie aufhörte wild zu rudern und ganz still hielt, spürte sie plötzlich, dass der Sog nachließ. Jede Bewegung hatte sie nur noch schneller einsinken lassen, aber das entdeckte sie zu spät.
Wieder hörte Hildegard ein Geräusch, doch noch bevor sie die Richtung wahrnehmen konnte, verstopfte der Morast ihre Ohren, verschloss ihre Nase. Ihr kam die schreckliche Gewissheit, dass sie ersticken musste. Doch als sie schon die Augen schließen wollte, um zu verhindern, dass der Schlamm schließlich auch hinter ihre Lider drang, sah sie plötzlich die Umrisse einer Gestalt vor sich. Sie konnte kaum noch wahrnehmen, ob es sich um einen Menschen handelte, oder ob sie in ihren letzten Minuten auch noch ein Dämon oder ein Kobold heimsuchen wollte. Aber dann spürte sie, dass etwas an ihr zog. Zuerst dachte sie, es sei wieder der Sog des Moores, doch dann spürte sie, dass sie Luft bekam. Nach und nach kehrten ihre Sinne zurück. Die gewaltige, erdrückende Last des sumpfigen Erdreiches fiel von ihr ab und sie fühlte sich von zwei kräftigen Armen nach oben gezogen. Sie blickte in ein Antlitz, das ihr dunkel, aber keineswegs Furcht erregend, fremd, aber trotzdem Vertrauen erweckend erschien. Falls es wirklich ein Dämon war, so war es Hildegard egal, ja, sie hieß ihn sogar willkommen. Weiter konnte Hildegard nicht denken, denn erneut versank sie in völlige Dunkelheit, aber diesmal in die tröstliche Umarmung einer Ohnmacht.
Als Hildegard erwachte, hatte sie das Gefühl, als ob sie sich aus tiefen Schichten mühsam Elle um Elle nach oben kämpfen musste. Da kam die Erinnerung an das Moor zurück. Aber diesmal war kein Sumpf um sie, nein, ihre Umgebung fühlte sich wohlig und warm an und sie tauchte nicht aus der Erde, sondern nur aus einem tiefen und traumlosen Schlaf auf. Alles war wieder gut. Sie öffnete die Augen und wollte sich schon genüsslich recken, als sie plötzlich zwei Unbekannte wahrnahm. Auch ihre Umgebung war ihr völlig fremd. Schnell schloss sie die Augen wieder und stellte sich schlafend, vorsichtig durch die halb geschlossenen Lider blinzelnd. Sie sah, dass sie in einem geräumigen Zelt lag. Aber es war keineswegs zugig und kalt, sondern ein Feuer schuf eine mollige Wärme. Der Rauch biss nicht, wie sie es von zu Hause gewöhnt war, in ihren Augen, sondern zog sauber ab. Wohlige Gerüche lagen in der Luft. Sie schnupperte begierig, wandte dann ihre Aufmerksamkeit wieder den beiden Fremden zu.
Es waren eine Frau und ein Junge. Sie stutzte, denn Letzterer kam ihr seltsam vertraut vor. Sie sah seine leicht gebräunte Haut, sein dunkles Antlitz und plötzlich kam die Erinnerung an die Stunde ihrer größten Not hoch. Und dann wusste sie, dass er es war, dessen Arme sie aus dem Moor gezogen hatten. Hildegard betrachtete ihn aufgeregt. Die Frau war ihm sehr ähnlich, woraus Hildegard schloss, seine Mutter vor sich zu haben.
Die beiden unterhielten sich, doch so sehr sich Hildegard auch anstrengte, sie verstand kein Wort. Sie sprachen in ihr unverständlichen, kehligen Lauten, die sich auch nicht wie Latein, das sie von den Kirchenliedern her kannte, anhörten. Hildegard vergaß ihre Vorsicht und setzte sich auf, um besser hören zu können.
Die beiden bemerkten, dass sie wach war. Die Frau beugte sich sofort zu ihr hinunter. Hildegard schrak zurück, doch die Frau strich ihr sanft über die Wange. »Hab keine Angst, du bist in Sicherheit.«
Hildegard wollte es nur zu gerne glauben und ließ die Liebkosung geschehen. Die Frau lächelte den Jungen an und sprach wieder mit diesen seltsamen Lauten zu ihm. Als sie Hildegards erstaunten Blick sah, wandte sie sich wieder ihr zu. »Entschuldige, ich vergesse immer, dass man mich hier nicht versteht. Ich habe meinem Sohn gesagt, dass deine Temperatur wieder normal ist. Die Kälte ist aus dir gewichen. Das Moor hat dich endgültig losgelassen.«
»Was sprecht Ihr für eine Sprache? Und woher kommt Ihr? Und woher wusste Euer Sohn, dass ich im Moor war?«
Die Frau lachte. »Eine Menge Fragen für ein kleines Mädchen. Du scheinst dich tatsächlich schneller zu erholen, als ich gedacht hätte. Das ist Erik.«
Sie deutete auf ihren Sohn. »Und mein Name ist Deria. Erik hat dich ins Moor laufen sehen, als wärst du von tausend Hunden gehetzt.«
»Nicht von tausend Hunden. Nur von einem Jungen, wenig älter als Euer Sohn.« Hildegard wusste nicht, warum sie es tat, vielleicht um ihr Herz zu erleichtern, vielleicht, weil sie so großes Zutrauen zu den beiden Fremden gefasst hatte. Auf jeden Fall erzählte sie ihnen, ohne auch nur eine Pause zu machen, ihr ganzes Elend. Beim Sprechen geriet Hildegard ganz außer Atem, woraufhin Deria ihr beruhigend die Hand auf die Schulter legte. »Nun ist es gut, mein Kind. Trink das hier, das wird deine Sorgen vertreiben.«
Hildegard nippte an dem süß schmeckenden Tee, den Deria ihr reichte. Sie lehnte sich zurück und tatsächlich, nach einigen Minuten fühlte sie eine ungewohnte Leichtigkeit.
Hildegard wusste nicht, dass diese Wirkung dem Hanf zuzuschreiben war, den Deria dem Getränk beigemischt hatte. Ihr Blick glitt über die Wände des Zeltes, an denen sich bizarre Schatten abzeichneten und fand schließlich die wachen und freundlichen Augen Eriks, bevor ihr die Lider zufielen. Mit leichtem Gemüt schlief Hildegard ein.
Deria wandte sich an Erik. »Sobald das Mädchen wach ist, muss dein Vater sie zurückbringen. Ihre Eltern werden schon außer sich vor Sorge sein.«
Erik nickte.
Er ging, um seinen Vater zu suchen. Auf dem Weg durch das kleine Lager, das den Reisenden, einer Gruppe von ungefähr einem Dutzend Reiter, Schutz bot, beschloss er, seinen Vater und das Mädchen zu begleiten. Erik fühlte sich in gewisser Weise für Hildegard verantwortlich. Außerdem verband ihn mit ihr die Neugier auf alles Unbekannte. Und für Erik war jeder Schritt im Land seines Vaters, das er bisher nur aus dessen Erzählungen kannte, neu. Denn Erik war in Jerusalem geboren und seine Wurzeln reichten bis nach Ägypten, der Heimat seiner Mutter, der Fatimidenprinzessin.
Nachdem Hildegard beim Festmahl nicht erschienen war, hatte man sie überall suchen lassen. Erst dachte Hiltebert noch ärgerlich, dass sie mal wieder irgendwo auf dem Anwesen die Zeit vergessen hatte. Als die Knechte und Mägde schließlich jeden Winkel des Hofes auf den Kopf gestellt hatten, begannen die Eltern, sich ernsthaft zu sorgen. Aber darauf, dass Hildegard weggelaufen war, kam keiner.
Gunter brachte hingegen die Möglichkeit einer Entführung ins Spiel, da seiner Meinung nach das Gesindel auf den Straßen überhand nahm.
Hiltebert, den die Warterei ohnehin mürbe machte, zog einige Männer zusammen. Auch Gunter bestand darauf, mit seinen Männern und Anno mitzureiten, schließlich ging es um die zukünftige Frau seines Sohnes. In der Morgendämmerung hatte man schon ein gutes Stück des Weges hinter sich gebracht.
Es ging einige Zeit leicht bergauf, sodass Hiltebert und seine Männer, oben angekommen, nun einen weiten Blick in das sich vor ihnen ausbreitende Tal hatten. Gunter deutete nach vorne. »Da seht, Reiter! Bald haben wir das Pack!«
Jetzt sah auch Hiltebert die kleine Gruppe. Und wenn er die Augen fest zusammenkniff, glaubte er sogar ein kleines, blondes Mädchen bei einem der Reiter auf dem Pferd zu erkennen. »Ihr habt Recht, Gunter. Sie haben Hildegard!«
Gunter griff zu seinem Schwert und brachte sein Pferd in Position. Sein Sohn tat es ihm nach, als Hiltebert Gunter die Hand auf den Arm legte. »Wartet! Die Reiter kommen auf uns zu!«
Gunter sah ihn ungeduldig an. »Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Je schneller wir angreifen, desto weniger sind sie darauf gefasst.«
Aber Hiltebert schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass sie Böses im Schilde führen. Dann würden sie vor uns fliehen.«
Gunter runzelte die Stirn. Das Argument konnte er nicht einfach in den Wind schlagen, obgleich ihm die Gelegenheit, sich durch einen schnellen und erfolgreichen Kampf gegen die sich in der Minderheit befindenden Gegner hervorzutun, allzu verlockend erschien. »Gut, lasst uns hören, was es mit den Reitern auf sich hat. Aber sobald ich merke, dass es Diebesgesindel ist, das seine Beute nur gegen Geld und Gold eintauschen will, werde ich uns zu verteidigen wissen.«
Hiltebert schauderte es, als er Gunter seine Tochter als Beute bezeichnen hörte. Er konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass es Gunter mehr um die verletzte Ehre als um Hildegard ging. Gunter ritt entschlossen weiter, die Hand am Schwert. Hiltebert folgte ihm besorgt, denn er wollte Hildegard nicht durch unnötige Provokationen in Gefahr bringen.
Sie waren bald nahe bei den Reitern angelangt, als diese stehen blieben. Hiltebert konnte jetzt ganz deutlich seine Tochter hinter einem Jungen auf einem Pferd sitzen sehen. Als der Junge das Tier zum Stehen gebracht hatte, sprang Hildegard behände hinunter und kam auf ihn zugerannt. Hiltebert glitt ebenfalls vom Pferd und nahm seine Tochter, die sich in seine Arme warf, lachend in Empfang. Eine große Sorge fiel von ihm ab. »Hildegard, mein Mädchen! Wo hast du bloß gesteckt?«
Hildegard barg ihren Blondschopf an des Vaters Schulter. »Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich werde nie, nie mehr weggehen. Bitte sei nur nicht böse.«
Auch die fremden Reiter stiegen nun ab und näherten sich, worauf Hiltebert seinen Männern Zeichen gab, es ihnen gleichzutun. Nur Gunter blieb oben, die Herankommenden misstrauisch musternd.
Eriks Vater trat an Hiltebert heran. Er war von hünenhafter Gestalt, mit von der Sonne dunkel gebrannter Haut und hellem Haar. Seine Kleidung war verschlissen, und als er seinen Umhang nach hinten warf, konnte Hiltebert das rote Kreuz, das Zeichen der Kreuzritter, erkennen. Der Mann musste eine lange Reise hinter sich haben.
»Ich bin Rupert von Maasfelden. Es ist mir eine Ehre, Euch Eure Tochter zurückzubringen.«
Hiltebert reichte dem Fremden die Hand. »Und es wird mir eine Ehre sein, Euch als Dank auf meinem Hof willkommen zu heißen.«
»Nicht so vorschnell«, ließ sich plötzlich Gunters Stimme vernehmen.
Alle Augen wandten sich ihm zu.
»Wie konnte das Mädchen in Eure Obhut, oder sollte ich eher sagen, in Eure Gewalt gelangen?«
Hiltebert war wenig glücklich über Gunters harte Wortwahl, aber Rupert ließ sich nicht verschrecken. Er sah Gunter gerade in die Augen. »Mein Sohn Erik hat das Mädchen aus den Sümpfen gerettet.«
Er deutete auf Erik. Hiltebert sah Hildegard erschrocken an. »Du warst in den Sümpfen? Wie um alles in der Welt bist du dahin gekommen?«
»Ich habe mich verlaufen.«
Hildegard sah zu Boden, denn sie wusste nur zu gut, wie die nächste Frage lautete. Sie würde sagen müssen, dass sie weggelaufen war. Und dann würde man wissen wollen, warum. Nicht, dass sie ihre Meinung über Anno und die Hochzeit geändert hätte. Wenn sie ihn ansah, war ihr sofort klar, dass sie nie, nie wieder etwas mit ihm zu tun haben wollte. Aber sie wusste auch, was es bedeuten würde, wenn sie das hier vor allen Leuten kundtäte. Hilteberts Stimme riss sie aus ihren Gedanken. »Aber was hast du überhaupt mitten in der Nacht draußen zu suchen?«
Hildegard hörte deutlich, dass eine gewisse Ungeduld die Sorge des Vaters verdrängte.
Sie sah zur Seite, wobei ihr Blick Erik streifte. Der blickte sie aufmunternd an. Sie war froh, nicht ganz allein zu sein, froh, dass jemand ihre Not kannte, auch, wenn dieser ihr letztendlich diesmal nicht heraushelfen konnte.
Hiltebert blickte jetzt streng auf seine Jüngste. »Du wusstest genau, dass du im Festsaal erwartet wurdest. Sag mir jetzt, warum du trotzdem den Hof verlassen hast.«
Hildegard traten Tränen in die Augen. Sie konnte unmöglich sagen, dass sie wegen Anno weggerannt war. Das würde ihren Vater vor all den Leuten noch mehr blamieren, als wenn sie einfach weiterhin auswich. »Ich weiß es wirklich nicht …«
»Lasst sie in Ruhe. Sie ist vollkommen durcheinander.«
Hildegard nahm erstaunt zur Kenntnis, dass ausgerechnet Gunter Partei für sie zu ergreifen schien. Doch dann fuhr er fort. »Und es gibt nur einen Grund, warum sie so verschüchtert ist. Jemand muss ihr gedroht haben, nichts zu sagen.«
Gunters Blick traf Rupert, womit klar war, was er andeutete. Aber diesmal blieb Rupert nicht mehr so ruhig. Drohend ging er auf Gunter zu. »Wir haben das Mädchen nicht bedroht, und ihm auch sonst nichts zuleide getan. Muss ich noch einmal sagen, dass mein Sohn ihr das Leben gerettet hat, bis es auch der Dümmste endlich versteht?«
Voller Hohn blickte Rupert zu Gunter hoch, der immer noch auf seinem Pferd thronte. Aber der dachte gar nicht daran, seine Zunge zu zähmen. »Wirklich, sehr ehrenvoll … wenn es sich tatsächlich so zugetragen hat. Vielleicht habt Ihr sie auch schlicht und einfach verschleppt und Euch erst eines Besseren besonnen, als Ihr unsere eindeutige Übermacht gesehen habt.«
Statt einer Antwort machte Rupert einen großen Schritt auf Gunter zu, der daraufhin sein Schwert zog. Erik stürzte zu seinem Vater, um ihm beizustehen, doch jemand anderer war schneller.
Hildegard machte sich vom Arm ihres Vaters frei und stellte sich zwischen Rupert und Gunter, der sie ärgerlich anblickte.
»Aus dem Weg!«
Gunter fuchtelte mit seinem Schwert in der Luft herum. Er wollte freie Bahn haben. »Geh sofort da weg!«





























