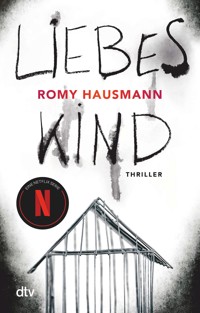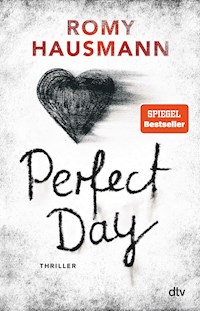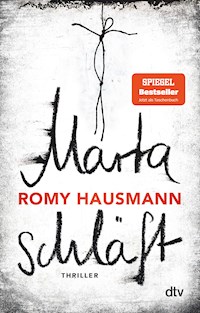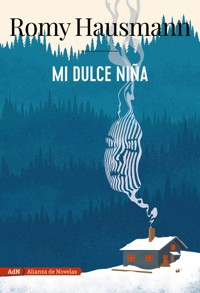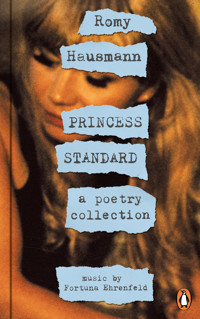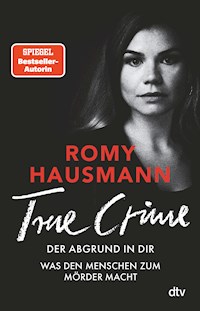14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Endlich: Der neue Thriller von Romy Hausmann!
Ein Thriller, der unter die Haut geht: Über das Verschwinden des eigenen Kindes. Die Angst vor dem Erinnern. Über zerstörte Leben und die Abgründe von „True Crime“.
»Der Teufel hatte gewonnen. Seine Macht war grenzenlos. Meinen Körper würde er am Leben halten, gerade so. Wie eine Trophäe. Doch als ich zu mir kam, fand ich mich plötzlich wieder am Ufer des Sees …«
Seit dem 7. September 2003 ist Julie Novak verschwunden. Die Familie ist daran zerbrochen. Nur ihr Vater Theo hört nicht auf, nach ihr zu suchen. Als sich Julies Verschwinden zum zwanzigsten Mal jährt, nimmt die Podcasterin Liv Kontakt zu Theo auf. Sie sei auf eine neue Spur gestoßen. Doch wenn er die Wahrheit erfahren will, muss er sich beeilen, bevor seine fortschreitende Demenz alles mit Dunkelheit überzieht. Wer zum Teufel hat ihm seine Tochter genommen? Warum hat Julies Ex-Freund Daniel das Schlafzimmer seiner verstorbenen Mutter so sorgfältig verschlossen? Und gibt es etwas Grausameres als die Ungewissheit über das Schicksal des eigenen Kindes?
»Es ist ein fesselnder Demenz-Thriller geworden.« bild.de
»›Himmelerdenblau‹ lässt einen bis zum Ende rätseln […] Es gelingt Romy Hausmann, dass man zu den Charakteren Sympathie aufbaut - und doch für ihre Unschuld keine Hand ins Feuer legen würde.« Süddeutsche Zeitung
»Du liebst Thriller? Dann kommst du an Romy Hausmann nicht vorbei.« Glamour
»›Himmelerdenblau‹ ist so spannend, dass man es schon vor der Verfilmung gelesen haben sollte.« MDR-FS, Romy Gehrke
»Spannung, lebensechte Charaktere und eine emotionale Achterbahnfahrt.« Westdeutsche Zeitung
International Emmy 2024 für die Netflix-Verfilmung von »Liebes Kind«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ROMYHAUSMANN wurde 1981 in Thüringen geboren und floh mit den Eltern nach Westdeutschland. Ihr Debütroman »Liebes Kind« landete sofort auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Die gleichnamige Netflix-Verfilmung erhielt 2024 den INTERNATIONALEMMY. Mit den Thrillern »Marta schläft«, »Perfect Day« und ihrem außergewöhnlichen Sachbuch »True Crime. Der Abgrund in dir« setzte sie ihren Erfolg fort. Romy Hausmanns erster Poetry-Band »Princess-Standard. A poetry collection. Music by Fortuna Ehrenfeld« wird von der Presse und den Fans gleichermaßen gefeiert. »Himmelerdenblau« ist ihr vierter Thriller.
»Er war der Teufel. Er wollte mir mein Wissen nehmen, meine Identität und alle meine Farben. Ich sollte nichts mehr sein als eine leere weiße Fläche, die er nach seinem Belieben neu gestalten konnte. Für immer sein Eigentum.«
Seit 2003 ist Julie Novak verschwunden. Ihre Familie ist daran zerbrochen. Nur ihr Vater Theo hört nicht auf, nach ihr zu suchen. Als Julies Verschwinden sich zum zwanzigsten Mal jährt und die True-Crime-Podcasterin Liv den Fall wieder aufrollen will, stürzt Theo sich deshalb gemeinsam mit Liv in die Nachforschungen. Wer zum Teufel hat ihm seine Tochter genommen? Warum hält Julies Ex-Freund Daniel das Schlafzimmer seiner verstorbenen Mutter so sorgfältig verschlossen? Und was, wenn Julie gar nicht gefunden werden will? Theo muss die Wahrheit herausfinden, bevor seine fortschreitende Demenz alles mit Dunkelheit überzieht. Denn es gibt nichts Grausameres als die Ungewissheit über das Schicksal des eigenen Kindes.
»Himmelerdenblau« ist ein atemberaubender Thriller über die todbringende Macht des Vergessens.
»Das ist Romy Hausmanns definitiv bester Thriller. Er knüpft genau da an, wo die Autorin mit ›Liebes Kind‹ aufgehört hat.«
UK-Verlegerin Stefanie Bierwirth
über »Himmelerdenblau«
Romy Hausmann in der Presse:
»›Liebes Kind‹ hat längst die Welt erobert. Und jetzt einen Emmy für die Serie.«
Tagesschau
»Romy Hausmann ist eine der besten Thrillerautorinnen Deutschlands.«
The Sunday Times über »Marta schläft«
»Die Meisterin des Domestic Noir.«
Stern über Perfect Day
»Ein Sachbuch, spannender als jeder Thriller.«
Meins über »True Crime. Der Abgrund in dir«
Außerdem ist von Romy Hausmann lieferbar:
Princess Standard. A poetry collection. Music by Fortuna Ehrenfeld
www.penguin-verlag.de
ROMY HAUSMANN
HIMMEL
ERDEN
BLAU
Thriller
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung und Illustration:
www.buerosued.de und wildesblut
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-33356-0V004
www.penguin-verlag.de
»Kein Mensch wählt das Böse, weil es das Böse ist;
er verwechselt es mit dem Glück, dem Guten, das er sucht.«
Mary Shelley
Irgendwann, im Lauf der Geschichte, haben sich ein paar Fische in die tiefen, lichtlosen Grotten entlang der mexikanischen Küste verirrt. Es hätte ihr Todesurteil bedeuten müssen, doch anstatt zu sterben, haben sie sich an die Gegebenheiten angepasst, an die Kälte und die Dunkelheit. Zur Orientierung verlegten sie sich von ihrer Sehfähigkeit mehr und mehr auf ihren Gleichgewichtssinn, was bedeutsame Folgen für ihre weitere Entwicklung hatte. Zuerst verloren sie ihre Farbe, ihre Pigmentierung. Dann verkümmerten ihre Netzhäute, bis sie schließlich gar keine Augen mehr ausbildeten.
Sie sind hässlich und blind.
Aber sie haben überlebt, trotz allem.
Sie sind, was ihre Umgebung aus ihnen gemacht hat, wozu die Natur sie gezwungen hat. Ich frage mich, was geschehen würde, wenn es einem von ihnen gelänge, sich aus dem tiefen schwarzen Labyrinth freizuschwimmen. Wenn er die Oberfläche erreichte, auf der sich die Sonne spiegelt. Würde er das Licht spüren, die Wärme? Sich mit der Zeit wieder daran gewöhnen? Seine Augen zurückbekommen und wieder sehen können? Oder würde er –
Ich stocke. Der feste Griff der Hand, die sich von hinten auf meine Schulter gelegt hat, holt mich zurück in die Realität. Ich atme noch einmal tief, in der Hoffnung, meine zitternden Finger zu beruhigen.
Gib ihm seinen Frieden, lautet die Anweisung.
Ich ahne, dass ich es jetzt nicht übertreiben darf. Trotzdem will ich es wenigstens versuchen. Ich muss.
»Meinst du … Also, vielleicht könntest du dich ja am Wochenende um das Licht kümmern?« Ich blicke zur Zimmerdecke, aus deren Mitte zwei nackte Kabel ragen, die aussehen wie abgestorbene Pflanzentriebe.
»Ja, vielleicht«, bekomme ich zur Antwort, und der Griff um meine Schulter verfestigt sich ein weiteres Mal, wie zur Erinnerung daran, was für mich auf dem Spiel steht. Ich lasse meine Finger auf die Tasten sinken und tippe.
Du musst aufhören, nach mir zu suchen.
Du wirst mich sowieso nicht finden, hier unten, in meiner tiefen, dunklen Grotte, füge ich in Gedanken hinzu.
1.
Transkript
Zehn Tage zuvor
Theo
Klick, macht es in meinem Kopf. Klick, wie bei einem altmodischen Kippschalter.
Licht an, Orientierung: Ich sitze auf einem Stuhl. Ich habe mich nicht auf einen Stuhl gesetzt. Um mich herum weiße Wände, vor mir ein Dings, Schreibtisch, aus Kirschholz, vielleicht sogar Mahagoni. Linksseitig ein Fenster, Sonne, tanzender Staub. Nicht in Details verlieren, Theo. Die Details lenken dich bloß ab.
Von ihm, dem Mann. Hager, fahle Haut, die Nase spitz, eine Gockelnase. Er trägt einen weißen Krittel. Ich betaste meine Brust, blicke an mir hinab. Ich trage nur ein Hemd und darüber eine Strickjacke. Es ist mein Krittel, den der Mann anhat.
»Theo.«
Woher kennt er meinen Namen? Was geht hier vor? Ich springe auf, der Stuhl kippelt. Ich weiß ganz sicher, dass ich mich nicht auf einen Stuhl gesetzt habe! Der Hagere macht einen Satz, fasst dem schwankenden Stuhl nach, bevor er auf dem Boden aufschlägt. »Es ist alles in Ordnung.« Seine Stimme klingt ruhig und monoton, ein Frequenz gewordenes Anästhetikum. Ich reiße die Hände nach oben, umfasse meinen dröhnenden Schädel. Narkosemittel mit zehn Buchstaben: Sufentanil. C22H30N2O2S. Synthetisches Opioid, das stärkste in der Humanmedizin zugelassene. Listennummer: 641 – 081 – 8. Jetzt begreife ich. Er hat mich sediert. Er hat mich sediert und auf einen Stuhl gesetzt.
Ich muss weg, sofort raus hier. Der Hagere, er jagt mir humpelnd nach, holt mich ein an der Tür. »Siehst du«, sagt er wie zum Beweis. Nur wüsste ich nicht, was er mir beweisen wollte. Ich kenne ihn nicht, der Mann ist ein Fremder. Nein, nicht ganz ein Fremder. Der Mann ist ein verschwommenes Gefühl. Er ist Schmerz.
»Bitte.« Vorsichtig greife ich nach der Türklinke. »Ich habe eine Frau. Sie heißt Vera. Und sie wartet bestimmt schon mit dem Abendessen auf mich.«
Der Hagere berührt meinen Oberarm, schüttelt langsam den Kopf. Seine monotone Stimme wieder: »Vera wartet nicht, Theo. Sie ist seit vier Jahren tot.«
»Tot«, wiederhole ich brüchig. Und noch bevor ich für mein Gegenüber eine adäquate Beleidigung parat habe, laufen mir auch schon die Tränen.
Arschloch.
Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und ich ärgere mich, dass es mir nicht rechtzeitig eingefallen ist. Der Hagere mit der Gockelnase: Das ist Claus, Claus Dellard. Eine Koryglyphe will er sein auf dem Gebiet der Neurologie und der Psychiatrie. Ein Arschloch ist er. Eine wichtighaberische alte Petze. Anstatt mich einfach in Ruhe zu lassen, hat er Sophia angerufen, und jetzt haben wir den Salat. Entwürdigt hat sie sich, als sie mich bei Dellard abgeholt hat wie eine Mutter ihren missratenen Sohn aus dem Büro des Schuldirektors. Tut mir leid, Claus. Er hat offenbar keinen guten Tag heute, Claus. Ja, Claus. Ich kümmere mich um ihn, Claus.
Claus – pah!
»Vielleicht besteht ja doch die Möglichkeit, dass du dich freiwillig auf den Stuhl im Behandlungszimmer gesetzt hast«, sagt sie jetzt. »Immerhin hattest du einen Untersuchungstermin. Da setzt man sich eben, das ist doch ganz normal.«
Ich knurze. Es wäre mir lieber gewesen, sie wäre weggeblieben. Ich bin 74 Jahre alt und kann Bus fahren. Jeder Trottel kann Bus fahren. Oder wie sollte ich sonst überhaupt zur Klinik hingekommen sein?
»Papa?«
»Was hat der Idiot noch über mich gesagt?«
»Du meinst Claus? Nichts! Niemand hat irgendetwas über dich gesagt.«
»Lüg nicht, Sophia.« Bestimmt hat er ihr auch das mit Vera erzählt. Als wüsste ich nicht, dass sie gestorben ist. Als wäre ich nicht selbst dabei gewesen und hätte ihre Hand gehalten. Und dass ich ein Abendessen als Ausrede benutzt habe, um Dellard loszuwerden, war bei der ganzen Aufregung auch nur ein kleiner Versprecher. Es ist mitten am Tag, 12.43 Uhr, als ich in diesem Moment auf die Uhr in Sophias Auto schaue. Ich meinte »Mittagessen«, »Mittagessen« war das, was ich meinte.
»Jemand vom Empfang hat mich angerufen und gefragt, ob es möglich wäre, dich abzuholen. Das ist alles, Papa. Wirklich.« Ein kurzer Seitenblick und die Art von Lächeln, die sie für aufmunternd hält. Ich hasse es, wenn sie das tut.
»Wahrscheinlich hat er dir wieder irgendwas …«
»Papa, bitte. Du warst doch die ganze Zeit dabei. Wann hätte er mir denn irgendwas über dich sagen sollen?«
Ich schiele zu ihr hinüber. Sie sieht aus wie Vera, als sie noch jung war, nur in einer verhärteten Version, mit schmaleren Zügen und einer V-förmigen Einkerbung zwischen den Augenbrauen. Und die Haarfarbe, die Haarfarbe ist auch anders. Und außerdem schrecklich. Ich rechne. Sophia, sie müsste jetzt 34 sein. So alt war Vera, als Sophia zur Welt kam. 2876 Gramm, 47 Zentimeter klein. Ein Würmchen. Ha! Von wegen vergesslich.
Ich muss es wissen. Ich muss wissen, ob Sophia mir die Wahrheit sagt. Und ich bin mir sicher, dass sie es nicht für sich behalten kann, wenn Dellard ihr weisgemacht hat, ich würde mich nicht an den Tod ihrer geliebten Mutter erinnern. Ein Test, ja. Ich werde Sophia testen.
»Deine Mutter«, mehr sage ich zunächst nicht, stattdessen warte ich auf ihre Reaktion.
»Was ist mit ihr?«
»Mit wem?«
»Mit Mama. Du wolltest gerade etwas von ihr erzählen.«
Meine Vera, ich lächle. »Sie war so schön.« Ich sehe aus dem Seitenfenster, hinauf zum Himmel. »Weißt du noch, wie schön sie war, Sophia? Weißt du das noch?«
»Natürlich, Papa. Sie war wunderschön.«
»Nicht nur äußerlich, stimmt’s? Sie war auch innerlich die Schönste. Sie glaubte, die wahre Natur eines Menschen säße direkt in seinem Herzen.«
»Ja, sie war jemand sehr Besonderes.«
»Ich habe täglich nichts anderes getan, als Brustkörbe aufzuschneiden – und warum? Weil das Herz ein unzuverlässiger Klumpen ist, mehr nicht. Aber deine Mutter, sie war eine hoffnungslose Romantikerin, die sich zeit ihres Lebens auf diesen Klumpen verlassen hat.« Ich seufze, als mir wieder einfällt, warum ich überhaupt angefangen habe, über Vera zu sprechen. Wahrscheinlich ist es gut, dass sie nichts von alldem hier mehr mitbekommt. Die wahre Natur eines Menschen sitzt nämlich woanders. Nicht im Herzen, sondern direkt hinter der Stirn. Im Frontallappen, Lobus frontalis.
»Ja, das hat sie. Und trotzdem würde sie dir jetzt ganz vernünftig raten, Claus eine Chance zu geben. Er ist sehr kompetent und noch dazu empathisch.«
Ich sehe hinüber zu Sophia hinter dem Lenkrad. Ihre langen schwarzgefärbten Haare sind feucht und haben einen Abdruck auf ihrem blauen T-Shirt hinterlassen. Vielleicht hat der Anruf der Klinik sie erreicht, als sie gerade unter der Dusche stand.
»Woher nimmst du das mit der Kompetenz? Nur weil er einen weißen Krittel trägt?«
»Kittel, Papa.«
Ich habe schon den Mund geöffnet, als sie »Entschuldige« hinzufügt. »Ich dachte nur, du fühlst dich bei ihm wohler als bei irgendeinem Fremden, für den du nur eine Patientenakte bist. Immerhin wart ihr lange Kollegen. Und er ist dein Freund.« Es klingt wie eine Frage. Die mir keiner Antwort wert ist. Claus Dellard war noch nie mein Freund. Höchstens ein aufgeblasener Gockel. Ich konnte ihn früher nicht leiden, und heute schon dreimal nicht.
Eine ganze Weile fahren wir schweigend. Bis sie sagt: »Wegen deines Autos habe ich vorhin mit Richard telefoniert. Er holt es nach der Arbeit ab.«
»Oh.« Dann bin ich wohl doch nicht mit dem Bus zur Klinik gefahren. Nein, bin ich nicht. Der dunkelgrüne Saab, Baujahr 2011, steht in der Dings, Parkgiraffe der Klinik.
»Richard ist …«
»Dein Mann. Ich bin nicht blöd, Sophia.«
»Das wollte ich damit auch gar nicht …«
»Sei still jetzt.«
Sophia gehorcht, Schweigen ist besser. Zwei Ampeln später tut es mir leid. Sie war so klein bei ihrer Geburt, ein Würmchen. Wieder schiele ich nach links.
»Du bist auch schön.«
»Danke, Papa.«
»Nur deine Haare gefallen mir nicht.«
»Ich weiß, Papa.«
Abermalig sehe ich aus dem Fenster nach oben, in den Himmel, ins Blau. Bist du da irgendwo, Vera? Kannst du mich sehen? Dann sieh lieber weg. Dellard sagt, ich werde mich verändern; Sophia sagt, das habe ich schon. Ich reibe mir über die Augen und im gleichen Zug auch noch über die Stirn. Sophia soll denken, dass ich schwitze, mehr nicht, ich schwitze nur, das ist doch ganz normal im Hochsommer. Wer nicht schwitzt, ist tot. Oder leidet an Anhidrose, fehlender Schweißsekretion, oft genetisch bedingt. Ausgeprägte Anhidrosen können zu Thermoregulationsstörungen führen, im schlimmsten Fall zu einem Hitzschlag. Und der wiederum zum Tod. Wusste ich es doch. Also wische ich mir lieber gleich noch mal über das Gesicht. Nicht, weil ich weine – Oh nein, ich weine nicht! Ich weine nie! Ich weine nur ganz selten! –, sondern schlichtweg, weil ich gesund bin, ein ganz gesunder, quicklebendiger, schwitzender Mensch. Ha! Tirilierend blicke ich erneut zu Sophia hinüber, doch sie beachtet mich gar nicht; sie konzentriert sich auf den Verkehr. Besser so, denn ihre Fahrkünste sind genauso schrecklich wie ihre Haare.
»Wenn du möchtest, komme ich noch mit hoch«, sagt sie, als sie vor einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus in Spandau hält. »Wir könnten einen Kaffee zusammen trinken.«
Ich schüttele den Kopf und öffne die Beifahrertür.
»Etage 2, Parkplatz 68, zwischen einem silbernen Audi A6 und einem roten Mini Cooper, falls die da heute Abend noch stehen.«
Irritiert sieht sie mich an.
»Richard«, erinnere ich sie. »Er soll mir doch nach Feierabend mein Auto bringen.« Ich fummsele die Taschen meiner Hose und meiner Strickjacke durch, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Gerade als ich ihn in die Mittelkonsole legen will, sagt Sophia: »Vielleicht sollten wir den Wagen erst mal bei uns in Weißensee abstellen.«
Ich glotze, während meine Hand noch immer über der Mittelkonsole schwebt.
»Du solltest nicht mehr fahren, Papa.« Ihr Blick flirrt; sie tut sich sichtlich schwer, den meinen zu halten.
»Rein rechtshaft ist es so, dass man im Frühstadium …«
»Papa, bitte.«
Ich lasse den Autoschlüssel in die Konsole fallen, steige aus, gehe in Richtung Haustür. In meinem Rücken höre ich, wie Sophia den Motor abstellt, dann das Zuschlagen ihrer Autotür.
»Papa!«
Ich drehe mich um. Sie sieht traurig aus. Ihre feuchten Haare hängen schlaff herab, genau wie ihre schmalen Schultern und ihre Mundwinkel. Sie setzt sich in Bewegung und drängt sich im nächsten Moment so fest an mich, dass ich das Gefühl habe, ihr Herz schlüge in meiner Brust. Ich versuche, es auszuhalten, ohne wütend zu werden. Auf Sophia, die wohl denkt, mit einer Umarmung wäre es getan. Auf Claus Dellard, den dummen Gockel. Auf die Welt, die sich gegen mich verschworen hat. Und sogar auf Gott, an den ich eigentlich nicht glaube, den es aber vielleicht doch gibt und der mir seine Existenz beweisen will, indem er mir auch noch das Letzte nimmt. Bis heute war ich mir nämlich sicher, dass es zwei Dinge gäbe, die mir bleiben würden, ganz gleich, wie irgendein Idiot meinen Zustand einstuft. Zwei Dinge, die nicht in der wabernden grauen Masse hinter meiner Stirn sitzen. Die vielleicht nicht mal in dem unzuverlässigen Klumpen sitzen, in dem Vera sie verortet hätte. Zwei Dinge, die sich tiefer geschabt haben, in meine Knochen und mein ganzes Sein. Die ich ein- und ausatme, an jedem Tag, zu jeder Stunde, jeder Sekunde.
Zum einen Veras Tod.
Ich denke mich zurück in Dellards Arztzimmer und muss mir eingestehen, dass er mich eben doch kalt erwischt hat. Zumindest für einen klitzewinzigen Moment.
Doch wenn mir das passieren konnte, was bedeutet das für die zweite Sache? Was bedeutet das für dich, Julie? Was, wenn ich eines Morgens aufwache und vergessen habe, dass du jemals existiert hast? Wahrscheinlich wäre das der Tag, an dem ich mich umbringen würde, wie ferngesteuert, ohne die geringste Ahnung, warum. Ich schiebe Sophia von mir und sage: »Geh jetzt.«
Liv
Liv:Julie Eileen Novak wird am 6. Juni 1987 in Berlin-Mitte als älteste Tochter von Vera und Theo Novak geboren. Theo ist ein weltweit anerkannter Chirurg und noch dazu der Direktor der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Charité in Berlin. Damit sorgt er für ein ordentliches Familieneinkommen, um nicht zu sagen: Die Novaks leben in ihrem riesigen Haus in Berlin-Grunewald im blanken Luxus. Vera hat als Lehrerin gearbeitet, ihren Job nach der Heirat mit Theo aber aufgegeben, um sich ganz der Familie zu widmen. Das könnte man jetzt als veraltet bewerten, aber wir befinden uns in den 1980ern, und da herrscht großenteils noch Einigkeit über diese Art von Rollenmodell. Sprich: Vati schafft die Kohle ran, Mutti kocht ihm dafür was Schönes und kümmert sich um den Nachwuchs. So ganz genügt Vera das auf Dauer dann aber doch nicht; sie möchte sich noch in einem weiteren Sinne gebraucht fühlen. Daher engagiert sie sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Und das ist etwas, das wiederum sehr modern gedacht ist, denn – noch mal – wir sprechen hier von den späten 80ern, wo der Umgang mit zum Beispiel Depressionen oder biopolaren Störungen noch ein ganz anderer ist als heutzutage. Die kleine Julie ist das große Glück der Novaks, und dieses Glück wird sogar noch größer, als zwei Jahre später ihre Schwester Sophia geboren wird. Zur Familie gehören außerdem eine Katze und ein Au-pair-Mädchen, das auf Julie und Sophia aufpasst, wenn Vera Termine wegen ihres Ehrenamts hat. Und eine von beiden, entweder die Katze oder das Au-pair, heißt Feline … Hahaha, dein Blick, Phil! Der ist Gold wert! Aber aus den Quellen ist das tatsächlich nicht so ganz ersichtlich. Mal wird die Katze Feline genannt, mal das Au-pair.
Phil: Oh Mann, stell dir mal vor, du bist das Au-pair und heißt vielleicht – ich weiß nicht – Nicole oder Jacqueline. Und dann findest du dich plötzlich in der Presse wieder, und sie haben dir einfach den Namen der Katze gegeben.
Liv:Andererseits bist du vielleicht auch ganz froh, wenn niemand deinen richtigen Namen kennt, denn immerhin bezieht sich die Berichterstattung auf ein Verbrechen. Da möchte man möglicherweise gar nicht so sehr in den Fokus rücken. Jedenfalls sind die Novaks, wie wir es hier im Podcast oft haben, eine absolute – na?
Phil: Bilderbuchfamilie. Natürlich, Klassiker halt.
Liv:Exakt. Und damit du dir das mal ein bisschen besser vorstellen kannst, habe ich dir hier ein Foto mitgebracht, das geschätzt so um 1997 aufgenommen wurde. Da müsste Julie zehn Jahre alt gewesen sein, und ihre Schwester, Sophia, acht.
Phil: Wow, wo hast du das denn aufgetrieben?
Liv:Tja, mon cher. Ich habe meine Quellen.
Phil: Offensichtlich … Ja, ich sehe auf den ersten Blick, was du meinst. Das kommt einem eher vor wie eine Waschmittelreklame als wie ein Familienfoto. Wir haben hier Mutti, Vati und zwei kleine rothaarige Mädchen, wie sie gemeinsam auf einer Picknickdecke auf einem Bootssteg sitzen und in die Kamera schauen. Und das alles wirkt irgendwie total – na ja, wie soll ich sagen? – unecht, fast schon kitschig. Die Mädchen tragen Zöpfe mit kleinen Schleifchen darin und die gleichen rosafarbenen Kleider. Der Vater sieht aus wie ein typischer Arzt. Charismatisch, aber auch irgendwie glatt, so ein gut gekämmter Teflon-Typ. Er trägt ein hellblaues Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und Stehkragen über beigefarbenen Shorts und dunkelblaue Segelschuhe. Ja, und die Mutter – ausnehmend hübsch, würde ich sagen. Sie könnte auch eine berühmte Schauspielerin sein. Sie hat lange rote Haare und trägt ein hellgelbes Kleid.
Liv:Sonst noch was?
Phil: Hm, ich gehe davon aus, dass das Foto auf dem Grundstück der Novaks aufgenommen wurde, denn das lag ja direkt an einem See, samt eigenem Bootssteg. Vor ihnen, auf der Picknickdecke, stehen Frischhaltedosen mit Sandwiches, Obst und Gemüsesticks. Und alle lachen. Na ja, alle bis auf eine.
Liv:Genau darauf will ich hinaus. So richtig glücklich sieht Julie nicht aus, oder?
Phil: Stimmt. Das Foto ist altersbedingt nicht mehr besonders scharf. Trotzdem erkennt man deutlich, dass ihr Gesicht irgendwie verzerrt ist. So, als hätte sie gerade geweint.
Liv:Und wenn du jetzt noch ein bisschen genauer hinsiehst, dann fällt dir vielleicht noch etwas auf.
Phil: Wow, krass. Du hast recht. Da sind mehrere rote Flecke auf dem Stoff ihres Kleides. Ist das … Blut?
Theo
Es ist mir nicht recht, dass Sophia mit nach oben kommt. Aber sie ist starrnäckig, genau wie ihre Mutter es war, und lässt sich einfach nicht abschütteln. Ich habe alles versucht, sogar Richard beleidigt, dem ich nicht zutraue, mein Auto ohne Schrammen aus der Parkgiraffe zu steuern. Ich habe auch Sophia selbst beleidigt, mit ihren schrecklichen Haaren und ihrer Strichmännchen-Figur. Ich habe ihr gesagt, dass es ja kein Wunder ist, dass sie selbst im Sommer lange Hosen tragen muss. So dünn wie sie ist, friert sie ständig und zittert dabei wie ein scheißender Hund. Trotzdem hängt sie mir an den Fersen, als wir die Treppe zum dritten Stock nach oben gehen. Der entwürdigende Klebezettel an der Toilettentür fällt mir ein, nicht aber, ob ich den Dings, Abwasch heute Morgen erledigt habe. Oder gestern. Ich schäme mich. Dafür, dass mir das mit dem Abwasch nicht einfällt, und für den Gulaschsuppengeruch im Treppenhaus, für den ich ja eigentlich gar nichts kann. Ich schäme mich für die kleine Pfütze neben Sophias linkem Schuh, die Wasser sein könnte, aber auch Bier oder Hundeurin. Vor allem aber schäme ich mich für die Wohnung, in der ich meiner Tochter gleich einen Kaffee servieren soll. Die Wohnung ist klein und trostlos. Kein Vergleich zu dem Haus, in dem Sophia aufgewachsen ist, sondern das gnadenlose Zeugnis eines Versagens. Unvermittelt drehe ich mich um und schlage mit den Armen aus wie ein in Panik geratener Riesenvogel seine Schwingen. Sophia kann gerade noch rechtzeitig in Deckung gehen.
»Sch, Papa«, sagt sie nach dem ersten Schreck. »Dein Name ist Theo Novak. Du bist zu Hause, im Treppenhaus deiner Wohnung in Berlin-Spandau. Ich bin Sophia, deine Tochter. Ich liebe dich, du musst keine Angst haben.« Mit jedem ihrer Worte hat sich ihre Hand vorsichtig meiner Wange genähert, bis Sophia, die eine Stufe unter mir steht, auf gleiche Höhe aufgeschlossen hat und mein Gesicht berührt.
»Bitte geh.« Es klingt fast flehend.
Sophia schüttelt den Kopf.
»Geh.« Diesmal zische ich.
Sie zögert.
»Soll ich wenigstens deine Wäsche mitnehmen?« In ihren Augen schwimmt etwas, das ich nicht sofort einordnen kann. Ich weiß nur, dass kein Kind seinen Vater so ansehen sollte.
»Nicht nötig.« Damit wende ich ihr den Rücken zu und stapfe die restlichen Stufen hinauf zum dritten Stock.
Meine Welt, sie besteht aus Unordnung, Wut und kleinen gelben Klebezetteln mit Sophias Handschrift darauf. »Küche«, steht auf einem, und er hängt folgerichtig an der Tür, die nach dem schmalen Flur in meine Küche führt. Am Kühlschrank klebt ein weiterer Zettel, auf dem steht: »Kühlschrank – hier nur Essen!«, nachdem irgendjemand mal aus Versehen eine Zeitung hineingelegt hat. Ich weiß nicht, wie oft ich diese dummen gelben Zettelchen schon abgerissen, zerknüllt und in den Müll geworfen habe. Nicht, weil ich es auf eine pathologische Art und Weise vergessen hätte, sondern weil nicht einmal ein Kopf ohne Diagnose das hätte zählen können. Ich tue es immer dann, wenn ich befürchte, Sophia käme zur Visite – von »Besuch« kann ja schon lange keine Rede mehr sein. Sie soll nicht denken, sie hätte recht mit ihren dämlichen Klebezetteln; sie soll nicht denken, ich fände mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr zurecht. Ich bin schließlich kein Trottel, höchstens ein wenig zerstreut. Aber das ist nichts Neues; schon Vera hat mich immer damit aufgezogen, wenn ich mal wieder meine Aktentasche zu Hause vergessen hatte. Ach, meine Vera. Sie hat das weltbeste Boeuf Dings gekocht. Name einer berühmten russischen Adelsfamilie mit neun Buchstaben: Stroganow. Ja, genau. Im Vorbeigehen reiße ich den Klebezettel von der Küchentür und schiebe mich am Esstisch vorbei zum Fenster. Wenn ich mich ein wenig anstrenge, dann verklärt sich meine Sicht auf die gegenübrige Häuserfront mit der glitzernden Weite eines Sees, auf dem eine leichte Brise die Sonnenstrahlen wiegt. Dann sind da keine Graffiti verschandelten Wände mehr, dann sind da sattgrüne Bäume, die sich ausladend in Richtung des koboldblauen Himmels strecken. Dann ist da nicht mehr Sophia im Vordergrund, die in diesem Moment in ihr Auto steigen will und nur noch kurz zögert für einen letzten Blick hinauf zu meinem Küchenfenster. Dann sehe ich an ihrer Stelle Julie, die sich gerade auf ihr Fahrrad schwingt und ihrerseits zögert, als sie mich hier stehen sieht, am Fenster meines Arbeitszimmers. Ich sehe, wie sie lächelt, in einer verschwörerhaften Geste den Zeigefinger an die gespitzten Lippen legt und mir zuzwinkert. Ich schüttele gespielt resignant den Kopf und lächle auch. »Pass auf dich auf, mein Engel«, formen meine Lippen stumm. Julie, sie versteht mich, über Meter hinweg und durch Wände hindurch, so wie es immer war, und antwortet mir auf dieselbe stumme und doch durchdringliche Weise zurück. »Ich hab dich lieb, Papa.« Anschließend steigt sie, bekleidet mit ihren Lieblingsjeans, einer Schlaghose mit Löchern an den Knien, und einer von Veras alten Blusen aus den 70ern, auf ihr Rad und fährt davon. Erneut schüttele ich den Kopf und wende mich vom Fenster ab. Vera, sie würde Julie gewaltig die Devisen lesen, wenn sie wüsste, dass unsere Tochter – anstatt in ihrem Zimmer für die morgige Bioklausur zu lernen – sich lieber mit ihren Freundinnen trifft. Oder doch mit irgendeinem Jungen? Nein, denke ich. Davon hätte sie mir erzählt.
Schmunzelnd setze ich mich an meinen Schreibtisch, nehme einen Stift zur Hand und klappe eine Patientenakte auf. Karpfenfisch mit vier Buchstaben: Orfe. Fluss des Vergessens in der griechischen Mythologie, fünf Buchstaben: Lethe. Blume des (spirituellen) Erwachens, fünf Buchstaben: Lotos, Ende des Lebens, mit drei –
Ich gebe einen Laut von mir, der selbst für meine eigenen Ohren fremd klingt. Ich sitze nicht an meinem Schreibtisch in meinem Haus in Grunewald. Ich sitze in der Küche dieses Zweizimmerlochs in Spandau. Und die Patientenakte ist in Wahrheit die Morgenausgabe der Berliner Rundschau; aufgeschlagen ist die Seite mit dem Kreuzworträtsel. Mit einer harschen Bewegung fege ich die Zeitung vom Tisch. Und dann heule ich, zum dritten Mal an diesem Tag, wie ein Baby.
Es tut mir so leid, Julie.
Es tut mir so leid.
Daniel
»… da sind mehrere rote Flecke auf dem Stoff ihres Kleides. Ist das … Blut?«
Ich kann gar nicht anders, als die Augen zu verdrehen. Wie sie allein schon so getan haben, als hätten sie das Foto der Novaks exklusiv. Tja, mon cher. Ich habe meine Quellen. Gar nichts hast du, Liv Keller. Keinen Respekt, kein Ethos, keine Ahnung – höchstens Google. Dort findet man das Bild in hundertfacher Ausführung, weil es damals kaum eine Zeitung gab, die es nicht abgedruckt hat. Ich glaube sogar, Theo Novak selbst hatte es den Redaktionen zur Verfügung gestellt; zumindest hat er genau dieses Foto einmal in einem Fernsehinterview gezeigt. Abgesehen davon ist es letzte Woche auch schon Thema bei einem anderen True-Crime-Podcast gewesen. Und auch da hat sich das infantile Moderatorengespann ewig an der weinenden Julie mit den roten Flecken auf dem Kleid aufgehalten, nur um gleich daraufhin festzustellen, dass es sich dabei wohl um den heruntergetropften Saft der Kirschen handelt, die in einer der Tupperdosen auf der Picknickdecke zu sehen sind. Ich wette, jetzt kommt gleich auch noch das mit dem Omen.
»… dennoch irgendwie unheimlich, findest du nicht? Wie ein Blick in die Zukunft –«
Ich drücke auf Pause und rupfe mir die Kopfhörer aus den Ohren. Ich wusste es: das Omen. Es würde nicht gut enden mit Julie. Einmal schlechte Laune als Kind, und dann auch noch das Sonntagskleid bekleckert – schon bist du dem Tod geweiht. Ihr seid widerlich, ihr Podcast-Gesocks, wisst ihr das? Ihr seid widerlich und so durchschaubar! Erst als meine Fingerknöchel zu schmerzen beginnen, merke ich, wie fest ich das Handy umklammere. Ich schüttele den Kopf und lockere meinen Griff. Man kann die Menschen nicht bekehren. Sie lassen es nicht zu. Aus einer Meinung stricken sie sich eine Wahrheit, aus der angeblichen Wahrheit knüpfen sie einen Strick. Wie im Reflex fasse ich mir an den Kragen und öffne den obersten Knopf meines Poloshirts. Es ist warm heute, drückend schwül. Für den Abend wird ein Gewitter vorausgesagt, was bedeutet, dass ich pünktlich Feierabend machen muss, damit ich es noch rechtzeitig nach Hause schaffe. Ich blicke zum Himmel, dann zurück zu dem Handy in meinem Schoß. Was würde ich dafür geben, die Geschichte nur ein einziges Mal so zu hören, wie sie sich wirklich zugetragen hat. Dass Leute wie diese Liv Dingsbums und ihr Kollege das nicht leisten werden, ist mir klar – aber die Hoffnung, jedes Mal die Hure Hoffnung mit ihren säuselnden Versprechen. Nein, entscheide ich. Diesmal falle nicht darauf herein, so wie ich schon einmal darauf reingefallen bin. Nie wieder passiert mir das. Ich hebe den Blick von meinem Schoß in Richtung Garten. Eine meiner Kolleginnen, Anna, ist mit Frau Lessing aus Zimmer 316 unterwegs. Im Schneckentempo schieben sie sich vorwärts, Frau Lessing dabei auf ihren Rollator gestützt. Ab und zu sieht Anna auf die Uhr, während ihr 82-jähriges Mündel damit beschäftigt ist, einerseits seine vorsichtigen Schritte zu koordinieren und andererseits die Umgebung in sich aufzunehmen. Ich beobachte, wie sie lächelnd auf einen der großen Bäume deutet, eine Strauchkastanie mit langen weißen Blütenrispen, während Annas Augen nur wieder auf ihr Handgelenk gerichtet sind. So ist die Welt. Keine Geduld, keine Manieren, kein Mitgefühl. Als Frau Lessing mich hier sitzen sieht, winkt sie mir fröhlich zu. Ich schiebe mir das Handy samt Kopfhörern in die Hosentasche, streiche mir den Scheitel glatt und erhebe mich von der Bank, auf der ich eigentlich meine Mittagspause verbringen wollte. Mit wenigen Schritten bin ich über den Kiesweg gesprintet, um mich der alten Dame für den Spaziergang anzudienen, den sie offenbar so gerne machen möchte.
»Ich löse dich ab, Anna.«
Das muss man ihr nicht zweimal sagen; ohne Abschied, ohne »Danke«, nur mit einem Nicken macht Anna sich davon. Erneut schüttele ich den Kopf, dann strecke ich Frau Lessing meinen angewinkelten Arm hin, als wollte ich sie auf die Tanzfläche führen. »Darf ich bitten?«
»Ich weiß nicht.« Sie wirft einen zögerlichen Blick auf ihren Rollator.
»Den brauchen Sie nicht. Sie haben doch mich.«
Frau Lessing sieht mich an, noch immer etwas verunsichert. In ihr drin steckt eine Generation, die keine Umstände machen will. Oder der man das Recht auf Umstände spätestens nach ein paar Monaten hier im Altersheim ausgetrieben hat. Dann, wenn das Versprechen der Familie, mindestens zweimal in der Woche zu Besuch zu kommen, erloschen ist und die Realität einsetzt, zum Sterben zurückgelassen worden zu sein, in der Obhut der Annas dieser Welt, die ihrerseits tagtäglich von der eigenen Realität überrollt werden. Womöglich hatten sie einmal die gute Intention, etwas Sinnvolles zu tun – bis sie gemerkt haben, wie sehr sich Theorie und Praxis oftmals voneinander unterscheiden. Das Gehalt als Pflegekraft genügt gerade, um die Miete zu bezahlen; die Arbeit ist fordernd an allen Fronten. Nicht nur körperlich, auch psychisch. Man muss es schon aushalten können, jeden Tag mit Verfall und Tod konfrontiert zu sein. Und vielleicht muss man es nicht nur aushalten, sondern auch das Geschenk darin erkennen.
»Sie werden mir doch keinen Korb geben, Frau Lessing. Damit brechen Sie mir das Herz.«
»Ach, mein lieber Herr Daniel.« Lächelnd hakt sie sich nun doch noch ein, und wir setzen uns in Bewegung, langsam, behutsam, Schritt für Schritt. »Wenn ich Sie nicht hätte.«
»Dann hätten Sie einen anderen Verehrer.«
Frau Lessing kichert. Mir fällt auf, dass ihr heute Morgen anscheinend niemand die Haare gekämmt und ihr mit der Kleidung geholfen hat. Nicht nur, dass sie viel zu warm angezogen ist, sind auf ihrem langärmeligen, dunkelgrauen Oberteil auch bereits einige Flecken erkennbar; Reste von Eigelb und noch etwas Helles, vielleicht die Sahne vom gestrigen Kaffeekränzchen. Flecken – damit ende ich erneut bei der Podcastfolge. Bei Julie und dem Kirschsaft auf ihrem Kleid.
»Trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich Sie von Ihrer Mittagspause abhalte.«
»Das müssen Sie nicht.« Ich tätschele die blasse Hand, die sich haltsuchend unterhalb meiner Ellenbeuge festgeschraubt hat. »Ich hatte sowieso nichts zu tun.«
»Nein? Sie sahen so in sich gekehrt aus, als Sie da auf der Bank saßen. Haben Sie etwa Sorgen wegen der Arbeit?«
»Nein, nein, gar nicht. Sie wissen doch, wie gerne ich diesen Job mache.«
»Und daheim ist auch alles in Ordnung, ja? Ihrem Hündchen geht es auch wieder besser?«
Ich muss schmunzeln wegen der Art, wie Frau Lessing meine Queen immer ein »Hündchen« nennt. Das kann sie auch nur, weil sie noch nie ein Foto von ihr gesehen hat.
»Viel besser, danke.«
»Und die Anfälle?«
Augenblicklich werde ich wieder ernst. Ich hätte Frau Lessing nichts davon erzählen sollen, denn seitdem fragt sie bei jeder Gelegenheit nach, und dann schießt mir sofort wieder das Bild in den Kopf, wie Queen spuckt und schreit, als wäre der Teufel in sie hineingefahren. Ein schmerzhafter Anblick, kaum zu ertragen.
»Haben nachgelassen.«
»Gott sei Dank. Wir hatten auch ein Hündchen, mein Mann und ich, nachdem die Kinder ausgezogen waren. Einen kleinen Bologneser.«
»Ja, davon haben Sie mir mal erzählt. Jimmy hieß er, richtig?«
»Ja, unser lieber, kleiner Jimmy. Er hat uns viel Freude bereitet, bis er so schlimm krank wurde.« Sie sieht mich an. »Sie müssen regelmäßig mit Ihrer Queen zum Arzt gehen, mein lieber Herr Daniel. Wirklich, das müssen Sie tun.«
»Queen geht es blendend«, sage ich mit Nachdruck. »Ich darf nur heute keine Überstunden machen. Der Wetterdienst hat ein Gewitter angekündigt, und da hat sie immer etwas Angst, wenn sie allein zu Hause ist.«
»Oh, das verstehe ich. Mir ist auch nicht wohl, wenn es da draußen scheppert und blitzt. Mein Mann hat sich immer darüber lustig gemacht. Stellen Sie sich vor, er für seinen Teil ist ja sogar bei Unwetter spazieren gegangen!« Auf ein kurzes Lachen folgt ein erwartungsvoller Blick. »Also? Was hat Sie beschäftigt?«
Ich zucke mit den Achseln. »Ich hab mir nur einen Podcast angehört. Also nichts, was ich nicht gerne für einen Spaziergang mit Ihnen eintauschen würde.«
»Ah ja.« Frau Lessing nickt verständig. »Das ist so eine Art Radiosendung im Internet, richtig? Meine Enkelin hört auch immer Podcasts. Sie will am Wochenende zu Besuch kommen.«
»Das freut mich sehr. Sie war schon lange nicht mehr da.«
»Na ja, sie ist jetzt dreißig und hat eine eigene Familie. Da gibt es immer viel zu tun.« Ihre Lippen simulieren ein Lächeln. »Worum ging es denn in Ihrem Podcast?«
»True Crime, das bedeutet ›wahre Verbrechen‹. Jede Woche besprechen die Moderatoren einen echten Kriminalfall. Dabei ist es meist so, dass einer der beiden den erzählenden Part übernimmt und der andere scheinbar spontan darauf reagiert.« Ich schüttele den Kopf. »Ich glaube, in Wahrheit ist da gar nichts spontan, sondern läuft ganz strikt nach einem Skript ab.«
»Das hat mein Mann auch immer gesagt, wenn wir zusammen ferngesehen haben. Elly, hat er dann gesagt, glaub nicht alles, was du da siehst. Die haben für alles ein Drehbuch, sogar für die Nachrichten.«
Wir gehen ein Stück weiter. Der Garten ist der schönste Teil des Altenstifts St. Elisabeth; hier unterwirft die Natur den Menschen und nicht andersherum. Die Bäume strecken sich und treiben aus, ungeachtet ihres Alters und der Witterungsverhältnisse. Selbst die, die zwischendurch mal ein Jahr lang aussetzen, sodass der Hausmeister sie bereits mit Sprühfarbe zum Fällen markiert hat. Wie zum Trotz erwachen sie ausgerechnet dann wieder zu neuem Leben, und dem Hausmeister bleibt nichts anderes übrig, als abzurücken mit seiner Motorsäge. Tja, wie heißt es so schön? Totgesagte leben länger.
»Na, und?«, fragt Frau Lessing nach einem Moment. »Um welchen Kriminalfall ging es heute? Wissen Sie, mein Mann und ich haben uns oft diese eine Sendung da angesehen, freitags mit Eduard Zimmermann auf dem Zweiten. Elly, hat er dann immer gesagt, die Welt ist voller Spinner.«
»Da sagen Sie was.«
»Also?«
Ich verkneife mir ein Seufzen und steuere sie auf der Kiesweggabelung in Richtung des Hauptgebäudes. Meine Mittagspause ist fast vorbei, und meine Begleiterin könnte sicherlich ein Nickerchen vertragen, damit sie später angemessen ausgeruht für das Seniorinnenturnen ist.
»Es ging um ein junges Mädchen«, antworte ich. »Sie heißt Julie.«
Wie auf Kommando bleibt Frau Lessing stehen und sieht mich durchdringend an. Kurz frage ich mich, ob sie etwas gemerkt hat. Habe ich gezögert? Vielleicht doch unabsichtlich geseufzt oder seltsam geklungen, als ich Julies Namen ausgesprochen habe?
Ich räuspere mich, bereit zu einem Themenwechsel. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, in einem Alter, in dem man Haare verliert und an Körpermasse zulegt. Ein Alter, in dem die Jugend und ihre Möglichkeiten zu einem Flirren in der Ferne geraten sind. Das ist manchmal traurig und manchmal auch nicht, denn es ist gleichermaßen ein Alter, in dem man die Menschen und ihre Mechanismen verstanden hat. Bei Menschen wie Frau Lessing beispielsweise dreht sich alles bloß um eines: Sie sind einsam. Sie stellen nur Fragen, weil sie insgeheim auf Gegenfragen hoffen. Sie möchten nicht wirklich zuhören, sondern warten nur auf die Gelegenheit, von sich selbst zu erzählen, weil sie wissen, dass ihnen dafür nicht mehr viel Zeit bleiben wird. Ihre Geschichten haben ein Verfallsdatum; sie müssen sie unter die Leute bringen, solange sie noch die Chance dazu haben, damit am Ende wenigstens ein bisschen was von ihnen bleibt. Wenigstens eine kleine Erinnerung, eine winzige Anekdote, die dem, der zugehört hat, ein Lächeln ins Gesicht treibt, wenn das Zimmer des Erzählers oder der Erzählerin längst einen neuen Bewohner gefunden hat.
»Mich würde interessieren, wie Sie als junges Mädchen waren«, sage ich also, um Frau Lessing ihre Chance aufzuzeigen. »Bestimmt waren Sie ein ganz schön heißer Feger.«
Sie kneift die wachen Augen zusammen – scheinbar mühelos seziert sie mich – und stellt fest: »Sie lenken ab, mein lieber Herr Daniel. Ich möchte jetzt schon wissen, was mit dieser Julie passiert ist.«
Liv
Liv:Machen wir einen kleinen Zeitsprung in den Sommer des Jahres 2003. Julie ist mittlerweile sechzehn Jahre alt und wird nach den Sommerferien in die elfte Klasse des Walther-Rathenau-Gymnasiums in Berlin-Grunewald gehen. Bisher ist sie eine sehr gute Schülerin gewesen, die über eine bemerkenswert schnelle Auffassungsgabe verfügt. Sie kommt ganz nach ihrem Vater Theo: Ihr Ding ist die Naturwissenschaft. Sie träumt davon, nach dem Abi Geophysik und Ozeanografie, also Meereskunde, zu studieren, am liebsten irgendwo im Ausland. Ihrem späteren Berufswunsch entsprechend ist sie auch in ihrer Freizeit sehr wasseraffin: Schon mit zehn hat sie ihren ersten Tauchschein gemacht und mit vierzehn den Bootsführerschein. Mittlerweile gehört Tauchen zu ihren liebsten Hobbys, genau wie Motorboot fahren, segeln oder eben schwimmen ganz allgemein. Zusätzlich besucht sie zusammen mit ihrer Schwester Sophia Kampfsportkurse und nimmt Tanzunterricht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Wie zum Teufel kriegt sie das alles hin? Das kann doch kein Mensch sein, das ist eine Maschine! Denn nicht nur, dass sie wahnsinnig viele Hobbys hat, hat Julie noch dazu jede Menge Freunde und Freundinnen, mit denen sie ständig unterwegs ist. Sie gehen shoppen oder ins Kino, oder die Gruppe trifft sich bei Julie zu Hause, genauer: in der alten Bootshütte auf dem Grundstück der Novaks. Hier hören sie Musik und trinken bestimmt auch heimlich das ein oder andere Bier.
Phil: Und kiffen und knutschen.
Liv:Ist nicht belegt, aber ja, könnte sein.
Phil: Klar, in dem Alter.
Liv:Du meinst, mit sechzehn? Wobei einige von Julies Bekannten tatsächlich schon älter sind. Eine Person sticht da besonders hervor: Daniel W. Er ist bereits 22, als Julie ihn Anfang Juni 2003 kennenlernt. Und rat mal, wie!
Phil: Na?
Liv:Totales Klischee. Julie hat unterwegs einen platten Fahrradreifen, Daniel W. kommt zufällig mit seinem Auto vorbei und bietet sich sofort als Retter in der Not an.
Phil: Ürgh.
Liv:Ja, das trifft es wohl bei dem Altersunterschied. Jedenfalls werden die beiden schnell ein Paar, was jedoch bald zu Streitigkeiten im Hause Novak führt, denn Julies Eltern sind davon ganz und gar nicht begeistert.
Phil: Völlig verständlich. Er ist nun mal ein erwachsener Mann, während sie noch mitten in der Pubertät steckt. Bei wem würden da nicht sofort sämtliche Alarmglocken angehen?
Liv:Richtig. Aber es ist nicht nur der Altersunterschied, der den Eltern Sorgen bereitet. Denn Daniel W. – wenn du dir hier mal ein weiteres Foto anschauen willst, das ich dir mitgebracht habe – sieht nicht nur aus wie James Dean, er ist auch genauso ein Typ, wie James Dean ihn gerne gespielt hat, ein Außenseiter. Er kommt aus sozial eher schwachen Verhältnissen und hat bereits eine Ausbildung abgebrochen. Das passt natürlich so gar nicht zu den feinen Novaks. Zudem wird sein Einfluss auf Julie schnell spürbar. Sie beginnt, die Schule zu vernachlässigen, was bei den Plänen, die sie für ihre Zukunft hat, durchaus problematisch werden könnte. Und sie vernachlässigt plötzlich ihre Familie und ihre Clique, weil sie fast nur noch mit Daniel W. zusammen ist. Er habe sie ganz gezielt immer mehr von ihrem Umfeld isoliert, würde später einer von Julies besten Freunden in einem Zeitungsinterview sagen.
Phil: Eine toxische Beziehung.
Liv:Der Julies Eltern bald einen Riegel vorschieben: Sie verbieten ihr den Umgang mit Daniel W. Und zur allseitigen Überraschung scheint Julie sich tatsächlich an das Verbot zu halten. Voller Enthusiasmus startet sie Mitte August 2003 in das neue Schuljahr. Außerdem unternimmt sie auch wieder viel mehr mit ihrer Clique und geht ihren zahlreichen Hobbys nach. Kurz: Sie scheint wieder ganz die Alte zu sein. Doch dann –
Phil: Bammbammbamm, unheilvolle Musik.
Liv:Ja, so in etwa. Es ist jetzt Sonntag, der 7. September 2003, sehr früh am Morgen und dementsprechend noch dämmerig. Julies Mutter, Vera, ist gerade aufgestanden und will nun das Frühstück für die Familie vorbereiten. Als sie auf dem Weg in Richtung der Treppe zum Untergeschoss am Arbeitszimmer ihres Mannes vorbeikommt, erregt ein bläulich weißes Licht ihre Aufmerksamkeit, das ihr aus der spaltbreit geöffneten Tür vor die Füße fällt. Vera Novak betritt den Raum und stellt fest, dass der angeschaltete Computerbildschirm die Lichtquelle ist. Ein Word-Dokument ist geöffnet, und darauf verfasst: die längste Lösegeldforderung in der deutschen Kriminalgeschichte. Bevor wir uns dieser in aller Ausführlichkeit widmen, fasse ich sie dir und unserer Hörerschaft zum Verständnis vorweg schon mal kurz zusammen. In dem Dokument heißt es, man habe ihre Tochter entführt, und fordere nun 30 000 Euro zum Tausch für ihr Leben. Vera sieht sofort in Julies Zimmer nach – und tatsächlich: keine Spur von der Sechzehnjährigen. Voller Panik stürmt Vera nun in das elterliche Schlafzimmer und weckt ihren Mann …
Theo
Der Traum, er geht so: Vera steht am Fußende unseres Bettes. Ihre Arme rudern durch die Luft, Worte fliegen aus ihrem Mund wie Geschosse. Sie erreichen mein Verständnis nicht, sie prallen gegen meine Stirn und bleiben da stecken.
Julie, irgendwas mit Julie.
Vera hat einen Satz um das Bett herum gemacht und zerrt jetzt an meinem Arm. Ich bin Arzt, stets auf den Notfall programmiert, auf promptige Reaktion. Alles andere könnte ein Leben kosten.
Ich sage: »Ganz ruhig, Vera.« Ich sage immer: »Ganz ruhig«, zu jedem, denn auch das ist essenziell im Notfall: Ruhe bewahren.
»Julie!«, schreit Vera, und ich: »Ganz ruhig«, woraufhin sie mir eine Ohrpfeife verpasst. »Verstehst du es nicht, Theo?«
In diesem Moment tritt Julie ins Zimmer. Ihr Gesicht blutverschmiert, ihre Haare dunkelrot verklebt. In der Hand flattert geräuschhaft ein Stück Papier.
»Hast du das Geld, Papa?«, fragt sie, während Tränen helle Bahnen über ihr verschmiertes Gesicht ziehen. Zur Antwort nicke ich mehrmals schnell hintereinander. »Dann ist es ja gut, Papa. Dann kann ich mir jetzt das Gesicht waschen gehen.« Damit verlässt sie unser Schlafzimmer. Ich schüttele Vera ab und stürze unserer Tochter ins Bad hinterher.
Doch da ist Julie nicht.
Ich wirbele herum, immer wieder um die eigene Achse, als bestünde ernstlich die Möglichkeit, dass ich sie übersehen haben könnte. Erst als Vera im Türrahmen auftaucht, bringt ihr Schrei mich abrupt zum Stoppstand. Ich sehe sie an, ihre aufgerissenen Augen, ihre rechte Hand, die zitternd vor ihrem Mund liegt, das Geschrei gestillt. Dann folge ich ihrem Blick zum Wasserhahn. Aus dem Blut tropft. Und wache auf.
Ich hatte diesen Traum nicht zum ersten Mal. Nicht dass ich das mit Sicherheit wüsste, doch ich kann es spüren; es ist ein lauerndes Gefühl. Ich setze mich auf. Sofort macht mein unterer Rücken sich bemerkbar, Vertebrae lumbales, eine anfällige Körperregion. Ibuprofen wäre zu überlegen. C13H18O2. Nichtsteroidales Antirheumatikum, neben Paracetamol und Acetylsalicylsäure das am häufigsten verwendete Analgetikum gegen Schmerzen, Fieber und Entzündungen. Oder eine neue Couch. Diese hier ist lange durchgelegen, ihr Lederbezug von Kratzern und matten, rauen Stellen übersät. In unserem früheren Haus stand sie in meinem Arbeitszimmer und wurde für Gespräche genutzt, für vertrauliche Momente, in denen man sich in die Augen sah und einander die Hand hielt, bei Beichten, Plänen, Entschlüssen. Nur einmal in all den Jahren habe ich darauf geschlafen – nach einem Streit mit Vera, nachdem sie mich wütend aus dem Schlafzimmer ausquartiert hatte. Sie fand es unmöglich, dass ich Julies Abschlussball früher verlassen hatte, aber ein Notfall war nun mal ein Notfall. Heute steht die Couch in meiner Küche, die dafür eigentlich zu klein ist. Doch abgesehen davon, dass ich ohnehin nicht die finanziellen Möglichkeiten hätte, mich den Gegebenheiten entsprechend neu einzuräumen, ist dieses Mobil eines der wenigen Stücke, die ich überhaupt aus dem Haus mitnehmen konnte. Dann lieber doch Paracetamol. Ich reibe mir über die Stirn. Der Traum wabert noch nach, ansonsten scheint das Mittagsschläfchen seinen Dienst getan zu haben. Bis auf die leichten Rückenschmerzen fühle ich mich gut. Ich weiß genau, wo ich bin, und kann sämtliche Gegenstände in meinem Sichtfeld benennen. Stuhl. Tisch. Küchenzeile. Kaffeemaschine. Ein Stapel dreckiges … Dings – konzentriert kneife ich die Augen zusammen – Geschirr. Ich nicke zufrieden; Entenmus durchströmt meine Glieder. Ich stehe auf. Ich möchte etwas tun. Ich möchte mich bewegen. Ich möchte Vera besuchen und ihr ein paar frische Blumen bringen. Meine Vera. Sie hat Blumen geliebt. Nicht die angeberischen Schnittblumen in dicken Bouquets, sondern die, die einfach wachsen, wo die Natur ihnen dafür einen Raum bietet. Wiesenschwertlilien, Sumpfgladiolen, Wiesenschaumkraut. Vera hat nie Blumen gekauft, sie hat sie immer selbst gepflückt, in unserem Garten, unten am See. Ich werde ihr trotzdem welche aus dem Laden beim Friedhof holen; sie soll nicht denken, ich wäre kneuserig geworden. Außerdem wüsste ich nicht, wo ich hier in der Gegend Blumen pflücken könnte. Auf dem schmalen Grünstreifen vor dem Haus, in dem ich wohne, findet man höchstens mal ein verirrtes Gänseblümchen zwischen weggeworfenem Einwickelpapier, leeren Getränkedosen und Hundehaufen. Dann fällt mir ein, dass Sophia meinen Autoschlüssel einkassiert hat. Oder? Vorsichtshalber betaste ich meine Hosentaschen und sehe auch noch mal am Schlüsselbrett im Flur nach. Ha! Ich hatte recht, ich habe mich erinnert – was mich weiterhin freudig stimmt, mein Problem aber nicht löst. Ich überlege und komme auf den Bus. Jeder Trottel kann Bus fahren. Ich gehe ins Schlafzimmer. Dort, unter dem Fenster, steht mein Schreibtisch eingezwängt, ein weiteres aus der Vergangenheit herübergerettetes Relikt, und darauf: der Computer. Er ist schon etwas älter, in Ausmaß und Leistung nicht zu vergleichen mit dem, was man heutzutage benutzt, doch er erfüllt seinen Zweck. Ich schalte ihn ein, und sofort ist ein Brummen zu vernehmen, die Belüftung. Ich will mir eine Busverbindung zum Friedhof Grunewald heraussuchen, als ich auf die Idee komme, zuerst auf mein E-Mail-Postfach zu klicken. Früher habe ich immer Dutzende von Anfragen bekommen, Einladungen zu Symposien, Interviews für Fachzeitschriften oder Bewerbungen von jungen Leuten, die gerade ihr Studium abgeschlossen hatten und davon träumten, in meinem Team zu arbeiten. Ich halte inne, als mir einfällt, wie diese Art von Anfragen stetig weniger wurde, abgelöst von anderen, die sich jedes Mal anfühlten wie zu Zeilen verfasste Dolchhiebe – Interviewanfragen zum Verschwinden meiner Tochter. Als auch diese schließlich nachließen, war ich zunächst froh darum. Bis mir klar wurde, was das bedeutete. Niemand glaubte mehr daran, dass Julie noch leben könnte. Man hatte sie abgeschrieben.
So wie man mittlerweile auch mich abgeschrieben hat.
Ich weiß, dass ich eine Krankheit habe. Ich weiß, wie diese Krankheit im Regelfall endet. Ich kann ein gottverdammichtes MRT lesen, und ich kenne sämtliche Studien. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sich nicht um meinMRT handelt, wenn Dellard es mir zeigt, und dass die Dinge, die er sagt, nicht auf mich zutreffen. Vielleicht irrt er sich ja doch, oder er macht das alles nur, um sich an mir zu rächen, weil, weil, Dings, Dellard war schon immer ein Idiot.
Der Mauszeiger fährt über Werbeangebote und Warnungen, mich endlich um den abgelaufenen Virenschutz für meinen Computer zu kümmern. Bis ich auf einen Betreff stoße, der unter allen anderen heraussticht. Er lautet: »Interviewanfrage zum Fall Ihrer Tochter Julie«. Mit zittriger Hand und angestopptem Atem navigiere ich den Mauszeiger darauf.
Sehr geehrter Herr Novak,
mein Name ist Liv Keller, und zusammen mit meinem Partner Philipp Hendricks betreibe ich seit 2020 den Podcast Two Crime – Der True Crime Podcast. Mit monatlichen Abrufzahlen von über 800000 Hörern und Hörerinnen gehören wir zu den erfolgreichsten Podcasts über wahre Verbrechen im deutschsprachigen Raum. Aktuell planen wir eine Folge über den Fall Ihrer Tochter Julie – ein Fall, der sich in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal jährt und der uns sehr ergriffen hat. Wir können nicht fassen, dass es auch nach all der Zeit nicht möglich sein soll, zu klären, was mit Julie passiert ist, und würden gerne unseren Teil dazu beitragen, dass der Fall noch einmal in das Interesse der Öffentlichkeit sowie der Ermittelnden rückt. Da es unserem Ethos der journalistischen Sorgfaltspflicht widerspricht, uns mit halbgaren, aus dem Internet zusammenkopierten Informationen zu begnügen, hätten wir Sie gerne als Interviewpartner bei der Episode dabei. Nur so können wir sicher sein, verlässliche Aussagen aus erster Hand zu bekommen.
Die Aufzeichnung müsste Mitte August in unserem Studio in der Knesebeckstraße hier in Berlin stattfinden; für die Ausstrahlung ist die dritte Augustwoche geplant. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich anrufen würden (meine Nummer finden Sie unten in der Signatur).
Es grüßt Sie herzlich:
Ihre Liv Keller
»Die Anfrage ist doch schon zwei Wochen alt und damit auch gar nicht mehr aktuell«, lautet Sophias erste Reaktion, die mich aber nicht sonderlich interessiert. Als sie das merkt, stellt sie sich breitbeinig vor mir auf und stemmt dabei die Hände in die Hüften. »Nein!«, poltert sie nun. »Vergiss es! Unter gar keinen Umständen wirst du ein Interview geben!« Jetzt bereue ich, dass ich sie angerufen und zu mir gebeten habe. Allein ihr Ton und wie sie in diesem Moment vor mir steht, während ich eingesunken auf der durchgelegenen Ledercouch sitze, und Richard, den sie ohne vorherige Abmache einfach so mitgebracht hat, hinter ihr mit meinem dreckigen Geschirr klappert – das macht mich auf den Schlag wütend. Also erhebe ich mich. Sophia – ganz gleich, wie sehr sie versucht, sich aufzuplustern – ist zwei Köpfe kleiner als ich und dünn wie ein Grashalm.
»Es ist nicht deine Entscheidung, ob ich mich mit dieser Journalistin treffe oder nicht«, knurze ich ihr entgegen.
»Oh, doch!«, feuert sie zurück. »Denn diese Entscheidung betrifft nun mal nicht nur dich, sondern auch mich, und im weiteren Sinne auch Richard.«
Irritiert sehe ich an Sophia vorbei zu ihrem Mann, der den Abwasch kurz unterbricht für einen Blick und ein Seufzen über seine Schulter hinweg. Richards Familie stammt aus Brasilien. Mit seinem schlanken, muskulösen Körper und seinem nahezu perfekten Gesicht sieht er aus wie eine Skulptur aus einer teuren Kunstsammlung, so als hätte sein Schöpfer sich beim Schnitzen hemmungslos verkünstelt. Vera hätte Richard gemocht, aber sie war ja selbst so ein Kunstwerk. Ich persönlich finde ihn zu schön für einen Mann, dem etwas zuzutrauen wäre.
»Ich wüsste nicht, was er damit …«, beginne ich, doch Sophia lässt mich nicht ausreden.
»Falls du es vergessen hast – und ziehen wir diese Möglichkeit bitte ernsthaft in Betracht –, aber Richard und ich stecken mitten im Vermittlungsverfahren für eine Adoption. Und wir sind nicht – ich wiederhole – nicht bereit, unsere Chance auf ein Kind aufzugeben, nur weil du meinst, die ganze Sache nach all den Jahren wieder hochkochen zu müssen!«
»Die ganze Sache, Sophia?« Ich trete einen Schritt auf sie zu, um ihr das Größenverhältnis zwischen uns noch etwas deutlicher zu machen. »Julie ist keine Sache, sondern deine Schwester! Das Mädchen, das stundenlang mit dir im Garten saß und Dings, Teepartys, veranstaltet hat, wenn du keine Freundin zum Spielen hattest! Die dich mit zu ihren Turnkursen genommen und dir ihr Abschlussballkleid umgenäht hat, weil du es so schön fandst! Die dir …«
»Ach. Das alles weißt du also noch. Aber dass Richard und ich seit fast einem Jahr versuchen, ein Baby zu adoptieren, ist natürlich nicht wichtig genug, um es irgendwo dort abzuspeichern, wo du auch wieder drauf zugreifen kannst.«
»Sophia.« Richard, einen tropfenden Teller in der Hand, dreht sich von der Spüle in ihre Richtung und schüttelt den Kopf. »Er macht das doch nicht mit Absicht.«
»Stimmt, da war ja was«, gibt sie in ironischem Ton zurück und schlägt sich die flache Hand vor die Stirn. »Er ist krank! Er kommt manchmal tagelang nicht aus dem Bett!« Sie wirbelt zu Richard herum, nimmt ihm den Teller ab und fuchtelt damit vor meiner Nase herum. »Er kann kaum mehr seinen eigenen Haushalt führen, geschweige denn –« Mit ihrer freien Hand schnappt sie nach der Knopfleiste meiner Strickjacke und zerrt daran. Der zweite Knopf von oben steckt im dritten Knopfloch. »Guck ihn dir doch mal an! Wie von der Straße sieht er aus! Die Haare! Der Bart! Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut, Papa?« Sie lässt von meiner Jacke ab, fuchtelt aber weiterhin mit dem Teller herum. »Er hat Aussetzer, bei denen er glaubt, ein Fremder hätte ihn entführt, dabei sitzt er in einem Behandlungszimmer, und der angebliche Fremde ist nicht nur sein behandelnder Arzt, sondern noch dazu ein langjähriger Freund und Kollege! Genau das ist heute erst passiert. Erinnerst du dich, Papa?«
Ich sehe zu Boden, doch Sophia, sie ist noch nicht fertig mit mir. »Stimmungsschwankungen! Wortfindungsstörungen!« Sie reißt die Arme in die Luft, in der rechten Hand hält sie noch immer den frisch abgewaschenen Teller. »Aber klar, was soll’s? Lassen wir ihn ruhig ein Interview geben, bei dem er sich vor aller Öffentlichkeit vollends zum Idioten macht!«
Klick –––
Liv
Liv:Es ist immer noch nicht ganz hell an diesem Sonntag, dem 7. September 2003, als vor dem Haus der Novaks bereits eine Fahrzeugkolonne der Polizei hält. Innerhalb von nur einer halben Stunde, nachdem Vera das Verschwinden ihrer Tochter beim Notruf gemeldet hat, sind bereits zahlreiche Beamte eingetroffen – und das ist höchst erstaunlich, wenn man bedenkt, was in der Lösegeldforderung steht, die Vera auf dem Rechner ihres Mannes gefunden hat. Hier heißt es nämlich wie folgt: Sehr geehrte Frau Novak, sehr geehrter Herr Novak – lesen Sie sich dieses Schreiben bitte aufmerksam durch und halten Sie sich akribisch an unsere Anweisungen. Wir haben Ihre Tochter. Für den Moment ist sie in unserer Obhut sicher und gesund – dies kann sich aber sehr schnell ändern, wenn Sie unseren Forderungen nicht nachkommen. Sie werden 30 000 Euro in die schwarze Sporttasche packen, die Ihre Tochter für gewöhnlich zum Karateunterricht mitnimmt. Wir werden Sie im Laufe des Tages anrufen, um Sie mit weiteren Instruktionen für die Übergabe des Geldes zu versorgen. Denken Sie nicht mal daran, die Polizei miteinzubeziehen. Wir beobachten Ihr Haus und haben auch sonst jedmögliche technische Vorkehrung getroffen, Ihre Kommunikationswege zu überwachen. Sollten Sie dennoch entscheiden, die Polizei zu involvieren, werden Sie mit sofortigen Konsequenzen rechnen müssen. Wir werden Ihre Tochter in den Tod schicken. Und sie wird in dem Wissen aus der Welt scheiden, dass Sie sie im Stich gelassen haben. Wir werden ihre Leiche verschwinden lassen und Ihnen die Möglichkeit nehmen, sie zu beerdigen. Wir werden Sie für den Rest Ihres Lebens daran erinnern, welche fatalen Auswirkungen Ihre Entscheidung hatte. Unterschätzen Sie uns nicht. Im Gegensatz zu Ihnen ist uns diese Situation nicht fremd. Wir arbeiten schon lange im Bereich der »Tauschgeschäfte«. Manche sind gut ausgegangen, andere nicht – das hängt ganz davon ab, ob sich unsere »Geschäftspartner« an unsere Regeln halten. Keine Tricks, Herr und Frau Novak! Wir sitzen am längeren Hebel. Und wir wissen, was wir tun. Halten Sie sich bereit.
Phil: Wow, okay. Das muss ich erst mal sacken lassen.
Liv:Im Gegensatz zu den Novaks anscheinend, denn – wie gesagt – entgegen der ausdrücklichen Warnung der Entführer involvieren sie sofort die Polizei.
Phil: Das ist definitiv eine Entscheidung.
Liv:Von der sie annehmen müssen, dass sie ihre Tochter das Leben kosten könnte. Klar, wahrscheinlich fühlen sich die Eltern in diesem Moment völlig überfordert – aber würde man dieses Risiko wirklich eingehen? Zumal in dem Schreiben steht, dass man ihre Kommunikationskanäle überwacht. Also, würde man es nicht – wenn man sich schon an die Behörden wendet – wenigstens so handhaben, dass es keiner mitbekommt?
Phil: Du spielst auf die Polizeikolonne vor dem Haus an.
Liv:Auffälliger geht’s ja wohl kaum.
Phil: Stimmt. Aber ganz abgesehen davon, dass die Eltern in dieser Hinsicht schon mal klar gegen die Anweisung der Entführer handeln: Was ist das überhaupt für eine seltsame Lösegeldforderung? Wer macht sich die Mühe, ein Schreiben solcher Länge zu formulieren, wenn man die Quintessenz auf vier kurze Sätze runterbrechen könnte: Wir haben Ihre Tochter entführt. Wir wollen 30 000 Euro. Keine Polizei, sonst stirbt sie. Wir melden uns im Laufe des Tages – fertig.
Liv:Ich hab das übrigens gestern mal ausprobiert und den Text auf Zeit abgetippt. Wir sprechen hier von 246 Wörtern. Natürlich bin ich keine professionelle Schreibkraft, aber ich tippe mit zehn Fingern und bilde mir schon ein, das einigermaßen flott hinzukriegen. Dabei bin ich auf rund fünfeinhalb Minuten gekommen, wobei ich mich aber auch viermal vertippt habe. Und vor allem habe ich den Brief nur abgeschrieben, heißt: Ich musste nicht groß nachdenken, wie ich etwas formuliere. Gehen wir also davon aus, dass derjenige, der das Dokument ursprünglich verfasst hat, weitaus länger damit beschäftigt war als nur fünfeinhalb Minuten. Und jetzt mal ernsthaft: Wer tut so was? Ich meine, stell dir vor, du bist einer der Entführer …
Phil: Ich würde mich sicherlich nicht in aller Ruhe zum Tippen ins Arbeitszimmer des Vaters setzen und damit ja auch Gefahr laufen, entdeckt zu werden. Ich hätte die Lösegeldforderung bereits daheim geschrieben und einfach mitgebracht. Dann wäre ich ins Haus der Novaks eingestiegen, hätte mir das Mädchen geholt und wäre so schnell wie möglich wieder abgehauen.
Liv:Du und vermutlich jeder andere vernünftig denkende Mensch auf dieser Welt. Noch dazu, wenn du angeblich Profi bist für diese seltsame Art von »Tauschgeschäften«.
Phil: Und dann finde ich auch die Höhe der Lösegeldforderung seltsam. So eine reiche Familie zahlt 30 000 Euro doch aus der Portokasse, oder?
Liv:Na ja – jein. Vielleicht sind die Entführer davon ausgegangen, dass die Novaks so einen Betrag zu Hause haben, quasi unterm Kopfkissen. Die Abhebung eines sechs- oder sogar siebenstelligen Betrags hingegen hätte Theo Novak bei seiner Bank anmelden müssen, was wahrscheinlich nicht nur mit Nachfragen verbunden gewesen wäre, sondern auch mit einer gewissen Wartezeit.
Phil: Ja, okay. Aber wenn ich schon so felsenfest davon ausgehe, dass Novak in seinem Haus Bargeld aufbewahrt: Warum suche ich dann nicht einfach nach dem Geld? Im Haus bin ich doch sowieso schon, und große Eile oder Angst, entdeckt zu werden, scheine ich ja auch nicht zu haben. Warum also mache ich mir die Umstände, das Mädchen mitzunehmen?
Liv:Du willst darauf hinaus, dass es dir in Wahrheit gar nicht um das Geld, sondern von Anfang an nur um das Mädchen gegangen ist? Aber das ergibt doch genauso wenig Sinn, oder nicht? Denn wenn du dir nur das Mädchen holen wolltest, warum würdest du dann deine Zeit mit der Lösegeldforderung verschwenden?
Phil: Du denkst also, Julies Entführung hat auf jeden Fall etwas mit Geld zu tun?
Liv:Irgendeine Rolle muss es spielen, ja. Sonst würdest du dich nicht unnötig der Gefahr aussetzen, erwischt zu werden.
Phil: Pass auf, Liv: Ich glaube, ich bin ein Lügner. Ich bin keine Gruppe, so wie ich in meiner Lösegeldforderung behaupte. Für mich ist das kein Job. Vielmehr bin ich ein Insider, jemand, der die Familie gut genug kennt, um von dem Geld zu wissen. Ich bin ein einzelner Mensch mit einem sehr persönlichen Motiv.
Liv: