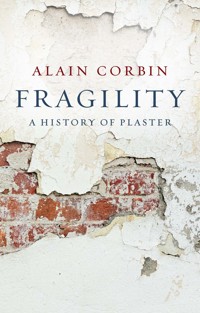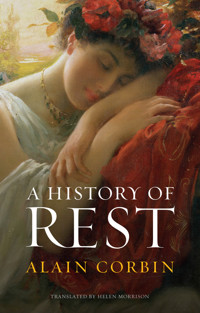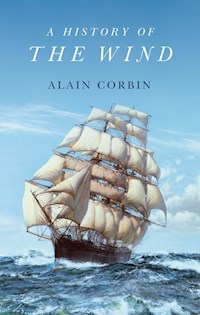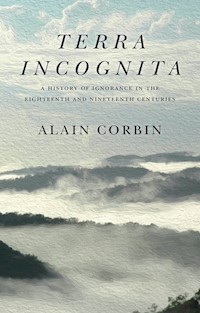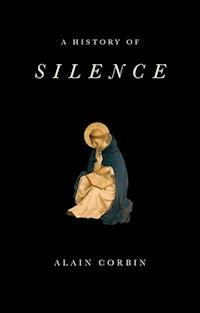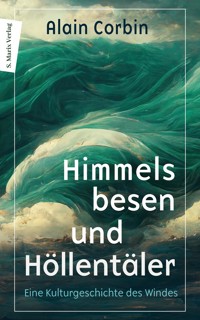
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alain Corbin, der große Historiker der Sinneswahrnehmungen, schreibt mit dieser Kulturgeschichte des Windes seine Gedanken zur Herausbildung moderner Wetterfühligkeit fort. In einem elegant geschriebenen Text verarbeitet er zahlreiche Zeugnisse von der Antike bis in die Gegenwart, wobei es ihm um die Erfahrung des erlebten Wetters geht: In einer Verschmelzung mit erhabenen Naturereignissen gerät das Subjekt zu einem meteorologischen Ich, das die Unbeständigkeit der Winde als Spiegel seines wechselhaften Daseins deutet. Dabei erweist sich der Wind als äußerst ambivalent: Als laue Brise, die leise singt, murmelt und streichelt, wird der Frühlingswind zur Chiffre für erotisches Begehren, wogegen der raue Nordwind heult, peitscht und zerstört, sodass ihn auch die Moderne noch oft metaphysisch interpretiert als ein göttliches Instrument der Strafe. Zudem versinnbildlicht der Wind den Atemhauch des Universums und die Beziehung zwischen atmosphärischer Luftzirkulation und menschlicher Atmung. So gilt ein beständiger Luftzug als reinigendes Mittel gegen aus der Erde aufsteigende giftige Dünste und soll ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung guter und der Bezwingung schlechter Wetterphänomene herstellen, welche als Widersacher des Menschen erscheinen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Corbin
Himmelsbesen und Höllentäler
Alain Corbin
Himmelsbesen und Höllentäler
Eine Kulturgeschichte des Windes
Aus dem Französischen von Karin Becker
Vorspiel
1
Der Wind – ein komplexes wissenschaftliches Problem
2
Das Alltagswissen über den Wind
3
Die Äolsharfe. Der Wind als Stimme der Natur
4
Neuartige Erfahrungen mit dem Wind
- Der Ballon, ein »Spielball der Lüfte«
- Der Sandsturm in der Wüste
- Der Wind im Giant Forest
5
Der Einfluss biblischer Vorstellungen vom Wind
6
Die epische Macht des Windes
7
Ossian und Thomson: Vorstellungen vom Wind im Jahrhundert der Aufklärung
8
Sanfte Brise und zärtlicher Lufthauch
9
Das Rätsel des Windes im 19. Jahrhundert
10
Kurzer Spaziergang im Wind des 20. Jahrhunderts
11
Der Wind, das Theater und das Kino
Nachspiel
Anmerkungen
Vorspiel
Die Gesetzmäßigkeiten des Windes erschließen sich den Gelehrten erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Zuvor erfolgte jedwede Erfahrung und Beschreibung dieses geräuschvollen Nichts allein anhand verschiedener Sinneseindrücke. Der Luftstrom – unsichtbar, anhaltend und unvorhersehbar – schien bestimmt durch eben diese substanzlose, unbeständige und vergängliche Beschaffenheit. Die Flüchtigkeit des Windes, der scheinbar die unendliche Weite beförderte, galt als Erklärung dafür, dass man nicht genau wusste, welchen Ursprung und welches Ziel er hatte.
Ein jeder konnte ihn spüren in seiner Präsenz, seiner Stärke und seiner Macht. Bisweilen bläst der Wind nur, manchmal aber schreit er, brüllt oder heult: Er steht vor allem für Lärm und Getöse. Mitunter scheint er zu wimmern und zu klagen wie eine gequälte Seele, die zur ewigen Verdammnis verurteilt ist. Seine Wucht ruft Entsetzen hervor: Der Wind ist ein brutaler Angreifer, er peitscht, stürzt um und entwurzelt und wurde daher mit dem Zorn gleichgesetzt. Zudem reißt er fort, verschleppt und zerstreut alles auf seiner Flucht. Er kann austrocknen und Feuer anfachen. Doch gibt es auch Winde, die seufzen, die streicheln und zuweilen wie das Ebenbild eines Liebhabers anmuten.
Dabei kann der Wind in ganz unterschiedlicher Weise auf den menschlichen Körper einwirken: Hier lässt er frösteln, dort meint man zu ersticken. Seit der Antike glaubte man, dass er eine reinigende, gesundheitsfördernde Kraft hatte, aber auch, dass er – im eigentlichen Wortsinn – verpesten und vergiften konnte. Kurzum, der Wind, den Victor Hugo »den Schluchzer der unermesslichen Weite, diesen Hauch des Weltenraums, diesen Odem des Abgrunds« nannte, rief über die Zeiten hinweg Angst, Schrecken und Abscheu hervor.
Die obigen Ausführungen legen die Vermutung nahe, der Wind in seinen immer gleichen Erscheinungsformen könne kein Gegenstand der Geschichtsschreibung sein. Doch ist dies keineswegs der Fall. Denn die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse seit Beginn des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Überzeugung von den weit entfernten Entstehungsorten der Winde sowie die Erfassung ihrer Gesetzmäßigkeiten und ihres Verlaufs sind durchaus historische Fakten – ebenso wie die neuartigen Erfahrungen, die man seitdem mit dem Wind auf Berggipfeln, in der Wüste, mitten in riesigen Waldgebieten oder erst recht im Luftraum gemacht hat.
Darüber hinaus hat sich in derselben Epoche durch das Aufkommen des sogenannten »meteorologischen Ich« die Palette der Wahrnehmungsweisen des Windes sowie der entsprechenden Sinnesempfindungen stark erweitert. Von diesem Zeitpunkt an war der Wind als literarischer Gegenstand den Schriftstellern eine stete Quelle der Inspiration. Dabei haben sich die Vorstellungen, die Reden und Träume vom Wind in all ihren Facetten kontinuierlich weiterentwickelt; zudem werden sie durch die Theorie des »Erhabenen« bereichert, durch die Verherrlichung der Natur in der deutschen Dichtung und generell der Romantik, sowie – nicht zu vergessen – durch die neuen Deutungen, die die epische Literatur nach und nach beigetragen hat, welche dem Wind im Laufe der Jahrhunderte gleichfalls eine grundlegende Bedeutung zuwies.
Demnach ist es erforderlich, von Beginn dieser Studie an genauestens den jeweiligen Wissensstand bzw. den Grad an Unwissenheit herauszustellen, will man die verschiedenen Wahrnehmungsweisen des Windes wirklich begreifen. Aus diesem Grund soll hier mit einer Darstellung des wissenschaftlichen Wendepunktes ganz am Ende des 18. Jahrhunderts begonnen werden, insbesondere mit der Entdeckung der Zusammensetzung der Luft. Erst im Anschluss daran sollen die Fortschritte im Verständnis der atmosphärischen Luftzirkulation beschrieben werden und auch die zunehmenden Erfolge in der experimentellen Auseinandersetzung mit konkreten Winden. All dies soll freilich unter ausdrücklicher Berücksichtigung jener ästhetischen Theorien erfolgen, die damals die durch die Kraft des Naturelements ausgelösten Gefühle beherrschten.
Nach diesem Ausflug mitten in die reale Erfahrungswelt soll in den folgenden Kapiteln in groben Zügen dargelegt werden, in welchen Deutungen und vor allem Träumen Künstler, Schriftsteller und Reisende seit der Antike dieser unvergleichlichen Macht, diesem unlösbaren Rätsel, das der Wind darstellte, Ausdruck verliehen haben. Denn diese Quellen haben sich im 18. und 19. Jahrhundert mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den jüngsten Naturerfahrungen vermischt und zu einer Erneuerung der Vorstellungswelt geführt.
Mit einem Wort: Vor den Augen des Historikers zeichnet sich ein gewaltiges Forschungsfeld ab, zumal der Wind selbst ebenfalls – oder vielleicht vor allem – ein Symbol der Zeit und des Vergessens ist. Daher sollten wir in uns gehen und über folgende Formulierung Joseph Jouberts nachsinnen: »Notre vie est du vent tissé« – »Unser Leben ist aus Wind gewoben«.
1
Der Wind – ein komplexes wissenschaftliches Problem
In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1788 erlebt Horace Bénédict de Saussure, der ein Jahr zuvor den Montblanc bestiegen hat, während einer Exkursion zum Col du Géant einen Wind von bislang unbekannter Heftigkeit. Diese Erfahrung erscheint ihm so neuartig, dass er sich dazu entschließt, sie in seinem Buch Voyages dans les Alpes (»Reisen durch die Alpen«) detailliert zu beschreiben.
Nachdem er sich mit seinen Gefährten in eine kleine Hütte geflüchtet hat, schreibt er:
»Eine Stunde nach Mitternacht erhob sich ein Südwestwind von einer solchen Gewalt, dass ich jeden Moment glaubte, er würde die Steinhütte, in der mein Sohn und ich uns schlafen gelegt hatten, mit sich fortreißen. Dieser Wind wies die Besonderheit auf, dass er regelmäßig von Phasen einer vollkommenen Windstille unterbrochen wurde. In diesen Zwischenzeiten hörten wir, wie der Wind unter uns, in der Tiefe der Allée-Blanche, wehte, während um unsere Hütte herum absolute Lautlosigkeit herrschte. Aber auf diese Momente der Stille folgten Windböen von einer unbeschreiblichen Wucht; sie waren wie eine anschwellende Abfolge von Schüssen und ähnelten Geschützsalven. Wir fühlten, wie der ganze Berg unter unseren Matratzen erschüttert wurde; der Wind drang durch die Steinfugen der Hütte ein; er hob sogar zweimal meine Laken und Decken an und ließ mich von Kopf bis Fuß erstarren; ein wenig beruhigte er sich bei Tagesanbruch, doch bald erhob er sich von Neuem und kam in Begleitung von Schnee zurück, der von allen Seiten in unsere Hütte eindrang. Da flohen wir in eines der Zelte […]. Dort stießen wir auf die Bergführer, welche fortwährend die Zeltstangen festhalten mussten aus Angst, die Wucht des Windes könne sie umreißen und samt dem Zelt wegfegen.«
Sodann beschreibt Saussure den »Hagel« und den »Donner«, die über sie hereinbrechen:
»Damit man sich von der Heftigkeit des Windes eine Vorstellung machen kann, sei noch gesagt, dass unsere Bergführer bei dem Versuch, Lebensmittel aus dem anderen Zelt zu holen, zweimal eine der Pausen abwarteten, in denen der Wind sich zu legen schien, und dass sie auf halbem Wege – auch wenn es von einem Zelt zum anderen nur sechzehn oder siebzehn Schritte waren – von einem Windstoß so plötzlich angefallen wurden, dass sie sich, um nicht in den Abgrund gerissen zu werden, an einen Felsen klammern mussten, der glücklicherweise auf halber Strecke lag, und dass sie zwei oder drei Minuten mit vom Wind über den Kopf gestülpten Kleidern dort verharrten, mit vom Hagelschlag gepeinigtem Leib, bis sie es wagten, sich erneut in Bewegung zu setzen.«1
In diesem Sommer 1788 erschien Saussure ein solches Winderlebnis völlig neuartig, während es dem heutigen Leser wohl eher unspektakulär vorkommen muss. Genau diese Einschätzung stellt nun aber ein historisches Faktum dar, und wie wir noch sehen werden, sollte es im Laufe der folgenden Jahrzehnte noch mehr dieser scheinbar immer neuen Erfahrungen mit dem Wind geben. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als Luft gerade in Mode war, wurde der Wind noch mehrheitlich als eines der Elemente wahrgenommen, bevor einige Jahrzehnte später Erkenntnisse über die Beschaffenheit, den Ursprung und die Zirkulation der Winde vertieft werden konnten.
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts besaß man nur sehr wenige wissenschaftliche Daten zur Bestimmung der Winde. Nennenswerte Erfahrungen beschränkten sich auf – oft schreckliche – Prüfungen, die in der Seefahrt oder zeitweise auch auf dem Boden verschiedener Landstriche zu bestehen waren. Die Winde wurden anhand ihres örtlichen Erscheinungsbildes beschrieben, worauf wir noch zurückkommen werden. Seeleute maßen ihnen äußerst große Bedeutung bei und benutzten eine Vielzahl von Begriffen und Ausdrücken zu ihrer Beschreibung. Doch die kümmerlichen Versuche einer wissenschaftlichen Bestimmung der Winde hingen noch von den Verfahren jener Erfassung ab, die von einigen Amateuren geleistet wurde, die über Messinstrumente verfügten. In den kleinen Laboratorien dieser Wetterbegeisterten fand sich bisweilen ein Anemometer zur Messung der Windgeschwindigkeit neben dem Thermometer und dem Barometer, nicht zu vergessen die Windfahnen zur Anzeige der Windrichtung, die auf Kirchtürmen und Schlossfassaden angebracht wurden, denn dies war ein herrschaftliches Privileg.
Damals nahmen selbst die Gebildetsten den Wind nach wie vor vermittels jener Darstellungen wahr, die ihnen die umfangreiche kirchliche und weltliche Literatur vorgab, die bis in graue Vorzeit zurückreichte. Abgesehen davon blieb der Wind – trotz seiner Deutung als entscheidende Größe des menschlichen Lebens – ein Naturphänomen, für das es keinerlei genauere Erklärung gab. Zwar hatten Seeleute seit der Renaissance durchaus das regelmäßige Auftreten der Passatwinde in der Gegend zwischen den Wendekreisen ausgemacht, und es gab seitdem Seekarten, die diese Beobachtungen sehr wohl berücksichtigten. Darüber hinaus waren bestimmte lokale Winde wie der Mistral, die Tramontane und der Noroît (um uns auf Frankreich zu beschränken) bereits mit großer Genauigkeit beschrieben worden; nicht zu vergessen die Tatsache, dass man sich Ende des 18. Jahrhunderts in der Salonkultur kleinen Vorführungen widmete, in deren Verlauf Gelehrte oder Personen, die als solche galten, das Wehen des Windes im Kleinen nachstellten. Aber ein gründlicheres Verständnis setzte in erster Linie Kenntnisse über die Luft und ihre Zusammensetzung voraus. Handelte es sich um ein Fluidum im Sinne eines Elements, wie man seit Aristoteles glaubte, neben dem Wasser, der Erde und dem Feuer, oder gar um einen mysteriösen Stoff namens Phlogiston?
Wie auch immer, die Spezialisten waren nunmehr der Ansicht, dass Luft in vielfältiger Weise auf den Körper einwirkte: durch einfachen Kontakt mit der Haut oder der Lungenmembran, durch einen Austausch über die Poren oder durch direkte oder indirekte Aufnahme über die Nahrung, da Lebensmittel ja Luft enthielten. Die Gelehrten wurden nicht müde zu betonen, dass Luft je nach Jahreszeit und Region die Spannung der Körperfasern steuerte – eine Größeneinheit, die damals als maßgeblich galt. Beobachtungen ergaben, dass sich im Körper ein prekäres Gleichgewicht zwischen äußerer und innerer Luft einstellte, welches ohne Unterlass durch Vorgänge wie Ausatmen, Schleimauswurf, Aufstoßen und Abgang von »Winden« aufrechterhalten wurde. Bereits zwei Jahrhunderte zuvor hatte Rabelais ausführlich von der Insel Ruach gesprochen, deren Einwohner sich ausschließlich von Winden ernährten.
All dies trug zum Aufkommen der Überzeugung bei, die Luft würde von einer Art biegsamer Sprungfeder angetrieben, gerade groß genug, die Schwerkraft auszugleichen. Aus dieser Sichtweise ergab sich, dass es bei einem Elastizitätsverlust der Luft allein Bewegung und Regsamkeit (auf die zurückzukommen ist) vermochten, diese Elastizität wiederherzustellen und damit das Überleben der Organe zu gewährleisten. Für die damalige Medizin stellte das Gleichgewicht zwischen dem Körper, also dem inneren Milieu, und der Atmosphäre eine entscheidende Gegebenheit dar: Da warme Luft eine Verlängerung und Erschlaffung der Körperfasern verursachte, kalte Luft hingegen ihre Straffung, erwies sich frische Luft als besonders wohltuend und galt darum als erstrebenswert. So erklärt sich, dass wissenschaftliche Vorstellungen der Luft die Grundlage für das allgemeine Interesse darstellten, das man dem Wind entgegenbrachte.
Diese »aeristische« Denkweise führte dazu, dass man die Luft als eine entsetzliche Brühe ansah, in der sich Rauch, Schwefeldämpfe und wässrige, flüchtige, ölige und salzige Dünste vermengten, ja sogar entzündliche, aus dem Erdreich aufsteigende Stoffe, Ausdünstungen der Sümpfe sowie von verwesenden Körpern ausgehende »Miasmen«. All dies gefährdete die Elastizität der Luft, die bisweilen außerdem durch seltsame Gärungs- und Umwandlungsprozesse bedroht wurde, wie sie scheinbar durch Blitz, Donner und Unwetter in Gang gesetzt wurden.
Die Atmosphäre eines Ortes stellte ein gefährliches Reservoir dar, in dessen Innerem sich Seuchen zusammenzubrauen drohten. Diese Gemengelage führte zu einem überschwänglichen Lobpreis des Windes und der Luftbewegung, die in der Lage schienen, die Luft von ihrer schädlichen Fracht zu befreien. Der Neohippokratismus – die Lehre des Hippocrates von Kos (5. – 6. Jahrhundert) in der Überarbeitung des 18. Jahrhunderts – empfahl dementsprechend die sorgsame Überwachung der Atmosphäre und ein erhöhtes Misstrauen gegenüber einer besonders ruhigen Wetterlage. Diese Verherrlichung der Luftzirkulation hat über eine sehr lange Zeit Bestand, die letztlich sogar länger ist als jene Phase, in der sich später die Definition der Luft als chemische Verbindung durchsetzte, die ihre Auffassung als Element oder Phlogiston schließlich ablöste. Genau diese Übergangsphase soll uns im Folgenden beschäftigen.
Das Phlogiston galt damals als eine der zentralen Mächte der Natur. Es handelte sich, wie man glaubte, um ein spezielles Fluidum, das jedem Lebewesen innewohnte und das, sobald es aus diesem austrat, eine Verbrennung auslöste. Diese Theorie, die bereits im 17. Jahrhundert entworfen worden war, wurde von Georg Stahl, einem der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, aufgegriffen und weiterentwickelt. Ihm zufolge kam das Phlogiston in allen brennbaren Körpern vor, und der Verbrennungsvorgang selbst stellte lediglich den Übergang des Phlogistons vom gebundenen zum freien Zustand dar.
Bekanntlich hat Antoine Lavoisier diese Missdeutung des Verbrennungsprozesses ausgemerzt. Er konnte beweisen, was bereits der Pfarrer Priestley, auf den wir zurückkommen werden, auf seine Weise festgestellt hatte, während dieser allerdings unverändert in der Phlogistontheorie verfangen blieb: dass nämlich Luft eine Verbindung darstellte aus Stickstoff (wie seit 1772 durch Daniel Rutherford erwiesen), aus Sauerstoff und Wasserstoff (der bereits von Henry Cavendish bestimmt worden war).
Die Entdeckungen des gelehrten Theologen Priestley aus den Jahren 1772 und 1778 waren folglich durchaus von Bedeutung, allerdings blieben sie unvollständig. Ihm zufolge waren hinsichtlich der Atmung eine »gewöhnliche Luft«, eine »phlogistische Luft« (Stickstoff) und eine »lebenserhaltende Luft« (Sauerstoff) zu unterscheiden, wobei letztere vom Phlogiston befreit und damit die Atmungsluft schlechthin war. Kurzum, die Tatsache, dass Priestley zum Teil immer noch der Phlogistonlehre anhing, hinderte ihn an der Verwirklichung einer fehlerfreien Beschreibung der Zusammensetzung der Luft. Gleichwohl stellt die Luft in seinem Werk nicht mehr ein Element dar, sondern wird als Kombination beziehungsweise Gemisch aus Gasen erkannt. Dessen ungeachtet besteht seiner Meinung nach – und andere Gelehrte der Epoche teilen diese Auffassung – eine enge Verbindung zwischen der Chemie der Gase und organischen Prozessen. Die Beschaffenheit der Luft zu untersuchen bedeutete damals, die Mechanismen des Lebens zu studieren; und für Belüftung zu sorgen hieß, den öffentlichen Raum zu entgiften. Damit ist klar, dass der Wind einen zentralen Platz im öffentlichen Gesundheitswesen einnimmt, das zu jener Zeit gerade im Entstehen begriffen war. Das Lüften avanciert zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen Gesundheitspolitik, die ja von der Furcht vor Stillstand und Unveränderlichkeit geleitet war.
Noch vor der Entdeckung der genauen chemischen Zusammensetzung der Luft hatte also die neohippokratische Luftlehre zu einer Befürwortung des Lüftens geführt, welches ja die Elastizität und die keimtötende Eigenschaft der Luft wiederherstellen sollte. Der Wind fegt die unteren Schichten der Atmosphäre durch, er reinigt verdorbenes Wasser und beseitigt schlechte Gerüche. Mit einem Wort: Die Überwachung und Beherrschung des Windes und des Luftzugs gelten zu jener Zeit als zweckdienliche Verfahren.
Im Rahmen dieser Sichtweise zeigt sich die Nützlichkeit des Blasebalgs beziehungsweise eines jeden Geräts, das eine Luftzufuhr ermöglicht. Es gab zahlreiche Gegenstände, die im Ruf standen, die gesundheitsfördernde Wirkung des Windes, und das heißt die Luftzirkulation, anzuregen: im privaten Raum den Fächer; in der Nachbarschaft von Sümpfen die Bäume; in der Stadt auf Schlitten angebrachte Windmühlen mit sich waagerecht drehenden Flügeln und diverse andere Gefährte; weiter die Erschütterung der Atmosphäre durch Glockengeläut und Kanonendonner; auf Schiffen den Effekt der Segel … Und in Quarantänestationen wurden jene Waren, die im Verdacht standen, die Pest zu übertragen, ausgelüftet.
Während der Aufklärung sind die Architekten geradezu besessen von dem Bedürfnis, in Gebäuden eine stete Luftzirkulation zu erzeugen, und von dem Bestreben, für einen aufsteigenden Luftzug zu sorgen. Auch darf eine gesunde Stadt nicht von Mauern umgeben sein, denn diese würden jedes bauliche Instrument der Luftreinigung behindern. Zur Förderung der Luftbewegung müssen die Straßen breit und die Plätze großzügig angelegt sein. Diese Überzeugung verpflichtet gleichfalls zu einem Abstand zwischen den Gebäuden und zum Bau von Hospitälern, die als »Inseln in der Luft« konzipiert sind. Entsprechend lautete eine Erklärung des Königs Ludwig des XVI., der damit jede Behinderung der Luftzirkulation innerhalb der Stadt unterbinden und die Luftzufuhr im städtischen Raum gewährleisten wollte.2
In England wie in Frankreich empfahlen die königlichen medizinischen Gesellschaften die Erstellung von »medizinischen Verfassungen« für ein jedes Gebiet, vor allem um die gesundheitliche Situation, das heißt die Seuchengefahr, besser erkennen zu können. Diese Praxis bestimmt auch jene große statistische Untersuchung, die Jean-Antoine Chaptal während des Konsulats und des Kaiserreichs auf der Ebene der Départements durchführte, und sie setzt sich im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts als Gegenstand unzähliger Druckschriften fort. Sie stellt eine wertvolle Quelle für die Geschichte lokaler Windphänomene dar – doch ist all dies hinlänglich bekannt.
Kehren wir zu unserem eigentlichen Thema zurück. Zwischen 1800 und 1830 macht die Erforschung des Windes kaum Fortschritte. Gleichwohl muss auf zwei bemerkenswerte Fakten aus dieser Periode hingewiesen werden: zum einen das Beharren der Gelehrten auf der Existenz eines »Luftmeeres« und zum anderen ihre Einsicht in den weitentfernten Ursprung eben jener Phänomene, die dieses ausmachten. Hinsichtlich beider Aspekte behauptet sich die Persönlichkeit des größten Forschers dieser Epoche: Alexander von Humboldt. Lesen wir einige Seiten seines berühmten Buches Kosmos, das zwar erst ab 1845 erschien, das jedoch frühere Erkenntnisse zusammenfasst.
Im Anschluss an seine Ausführungen zum Wissen über das Luftmeer schreibt er:
»Die zweite, und zwar äußerste und allgemein verbreitete Umhüllung unseres Planeten, das Luftmeer, auf dessen niederem Boden oder Untiefen (Hochebenen und Bergen) wir leben, bietet sechs Classen der Naturerscheinungen dar, welche den innigsten Zusammenhang mit einander zeigen, und aus der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre, aus den Veränderungen der Diaphanität, Polarisation und Färbung, aus denen der Dichtigkeit oder des Druckes, der Temperatur, der Feuchtigkeit und der Electricität entstehen.«
Einige Seiten weiter betont Alexander von Humboldt eine Gegebenheit, die in Zusammenhang mit dem Wind, unserem Thema, grundlegend ist, nämlich die weite Entfernung der Entstehungsursachen des atmosphärischen Geschehens. So lesen wir:
»Wichtige Witterungsveränderungen haben nicht eine örtliche Ursach an dem Beobachtungsorte selbst; sie sind Folgen einer Begebenheit, die in weiter Ferne durch Störung des Gleichgewichts in den Luftströmungen begonnen hat, meist nicht an der Oberfläche der Erde, sondern in den höchsten Regionen: kalte oder warme, trockene oder feuchte Luft herbeiführend, die Durchsichtigkeit der Luft trübend oder aufheiternd, die gethürmte Haufenwolke in zartgefiederten Cirrus umwandelnd. Weil also Unzugänglichkeit der Erscheinungen sich zu der Vervielfältigung und Complication der Störungen gesellt, hat es mir immer geschienen, daß die Meteorologie ihr Heil und ihre Wurzel wohl zuerst in der heißen Zone suchen müsse: in jener glücklichen Region, wo stets dieselben Lüfte wehen, wo Ebbe und Fluth des atmosphärischen Druckes, wo der Gang der Hydrometeore, wo das Eintreten electrischer Explosionen periodisch wiederkehrend sind.«3
Damit ist klar, dass der Autor diese wegweisenden Zeilen im unmittelbaren Vorfeld jener Entdeckungen schreibt, die in diesem Kapitel vorgestellt werden sollen.
Doch ist Alexander von Humboldt keineswegs der Einzige, der auf die große Entfernung der Entstehungsquellen der Winde, der Regenfälle und der Bewegung innerhalb der Atmosphäre abhebt. Auf seine eigene – sicherlich poetischere – Weise zeigte sich auch Bernardin de Saint-Pierre fasziniert von ihrem entlegenen Ursprung und träumte von ihrem weiteren Verlauf.
Ab 1854/55 macht die Erforschung des Wettergeschehens und damit auch jene des Windes plötzlich große Fortschritte. In jenen Jahren haben zwei Katastrophen allgemeine Bestürzung ausgelöst und Gewissheiten erschüttert. Am 14. November 1854 werden die englische und die französische Flotte in der Nähe der Krim von einem fürchterlichen Unwetter heimgesucht; eine Vielzahl von Schiffen wird vernichtet, so auch die Henri IV, das Schmuckstück der französischen Marine. Am 16. Februar 1855 sinkt die Fregatte Sémillante in der Straße von Bonifacio – niemand von der Besatzung überlebt das Unglück. Daraufhin fällt Kaiser Napoleon III. tief betroffen eine Reihe von Entscheidungen. In jenem Jahr übernimmt Urbain Le Verrier die Leitung des Pariser Observatoriums,