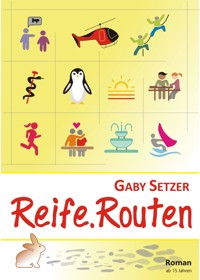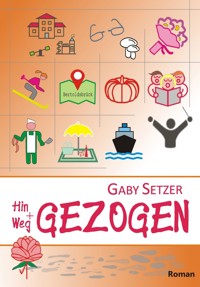
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dominik verliebt sich ganz spontan in Dana. Er kennt nur ihren Namen und die Stadt, in der sie lebt. Trotzdem zieht er wegen ihr um - aus Norddeutschland in die Eifel, nach Bertoldsbrück. Dort tritt er seine erste Stelle als Erzieher an und sucht nach Dana. Völlig neu in der unbekannten Stadt befindet er sich weit weg von Onkel und Tante, seinen einzigen Verwandten. Verschwindet er dadurch ebenfalls aus dem Fokus des nicht gerade lebensfrohen Onkel Veit, der ihn unbedingt als Nachfolger in seiner Metzgerei sieht. Wird Dominik Dana überhaupt treffen? Vielleicht beim großen Kürbisessen? Bei einem Besuch in Aachen? Während der Skifahrt nach Nevegrosso? Im Chor von Maike? Auf Pauls kulinarischen Spaziergängen? Wird die Suche nach Dana ein Ausweg, Umweg, Irrweg oder ein Weg zum Ziel für Dominik sein?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe LeserInnen,
auf Euer Feedback zu
Hin+Weg GEZOGEN bin ich schon gespannt.
Ihr erreicht mich unter
Aus dem Inhalt:
Dominik verliebt sich ganz spontan in Dana.
Er kennt nur ihren Namen und die Stadt, in der sie lebt. Trotzdem zieht er wegen ihr um - aus Norddeutschland in die Eifel, nach Bertoldsbrück. Dort tritt er seine erste Stelle als Erzieher an und sucht nach Dana.
Völlig neu in der unbekannten Stadt befindet er sich weit weg von Onkel und Tante, seinen einzigen Verwandten. Verschwindet er dadurch ebenfalls aus dem Fokus des nicht gerade lebensfrohen Onkel Veit, der ihn unbedingt als Nachfolger in seiner Metzgerei sieht.
Wird Dominik Dana überhaupt treffen? Vielleicht beim großen Kürbisessen? Bei einem Besuch in Aachen? Während der Skifahrt nach Nevegrosso? Im Chor von Maike? Auf Pauls kulinarischen Spaziergängen?
Wird die Suche nach Dana ein Ausweg, Umweg, Irrweg oder ein Weg zum Ziel für Dominik sein?
Für U.,
D., C.+S.,
M. und J.
Setzer, Gaby
Hin + Weg GEZOGEN
Texte und Umschlaggestaltung:
Copyright © Gaby Setzer
Herzogenrath
November 2023
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
1. Elmshorn
2. Förster-Garten
3. Erntedank
4. Wochenende
5. Freundschaften
6. Nevegrosso
7. Nick
8. Baustellen
9. Ostern
10. Neuanfänge
11. Ein Jahr später
Erläuterungen
1. Elmshorn
Bertoldsbrück – vor wenigen Wochen wusste ich noch nicht, dass dieser Ort überhaupt existiert. Jetzt wohne ich hier. Was zieht mich aus meiner Heimatstadt Elmshorn bei Hamburg in die Eifel?
Dana! Das Mädchen, in das ich mich auf den ersten Blick verliebt habe.
An einem Sonntag saß ich auf einer Bank am Elbufer bei Blankenese, war in meine Gedanken versunken, als zwei Freundinnen auf die Bank zukamen. Die eine, also Dana, fragte mich freundlich:
„Können wir uns dazu setzen?“
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, schaute in Danas dunkle Augen, dann war es um mich geschehen. Ich spürte ein sonderbar verwirrendes Gefühl in der Magengegend, mein Puls beschleunigte sich.
„Ja, gern!“, antwortete ich.
Die beiden jungen Frauen setzten sich neben mich, ignorierten meine Anwesenheit und plauderten munter drauflos. Die Sonne schien warm auf meine Schultern, der breite Fluss glitzerte. Große Containerschiffe fuhren ganz nah an unserer Bank vorbei, dabei schwappten die Bugwellen plätschernd gegen das Elbufer.
Durch die Wind- und Schiffsmotorengeräusche habe ich dem Gespräch von Dana und ihrer Freundin nur fragmentarisch folgen können. Eigentlich bin ich keineswegs der Typ, der fremde Gespräche belauscht. Trotzdem wusste ich meine Neugier in diesem Fall kaum zurückzuhalten. Nach einer Viertelstunde hörte ich heraus, dass ‚sie‘ Dana heißt. Nach weiteren Minuten verstand ich, dass Dana gerade einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte. Ob es eine Ausbildungsstelle oder erste Arbeitsstelle war, konnte ich nicht aufschnappen.
Später standen die beiden Mädels auf, um weiterzuschlendern. Danas Haar flatterte im Wind. Ich nahm aus dem Augenwinkel wahr, wie sie es sich mit einer behutsamen Bewegung hinter ihr Ohr strich. Sie verharrte kurz in dieser Geste und drehte sich schließlich um. Was an Dana war es, das mein Herz plötzlich derart schneller schlagen ließ?
Bevor die zwei Freundinnen langsam in Richtung Treppenviertel spazierten, vernahm ich einen letzten Wortwechsel der beiden:
„Dana, was willst du nur in Bertoldsbrück, das klingt sehr nach einem langweiligen Kaff in der Eifel!“
„Bertoldsbrück besitzt übrigens genauso viele Einwohner wie Elmshorn. Und die Eifel ist echt schön! Besuch mich doch einfach einmal dort, bevor …“, ein laut dröhnendes Schiffshorn übertönte die letzten Worte von Dana.
‚Sollte ich den Mädels unauffällig folgen?‘, überlegte ich, weil mich die pure Neugier trieb. Ich blieb auf der Bank sitzen.
Heute sitze ich nun hier in einer Dreizimmerdachgeschosswohnung in Bertoldsbrück mit all meinem Hab und Gut.
Schon immer war ich der Typ, der ein Ziel braucht, um es dann zu erkämpfen, zu erarbeiten oder oft auch starrköpfig durchzusetzen. Das Schlagwort Bertoldsbrück, das Lächeln, die behutsame Geste von dieser Dana, bewegten mich, einen völlig neuen Weg einzuschlagen. Es war ein total spontaner Entschluss.
Genau genommen ist Elmshorn meine zweite Heimat, obwohl mir der Ort nicht gerade besonders viel bedeutet. Durch meinen Umzug in die Eifel wage ich einen Neuanfang. Ein gutes Gefühl! Ich lasse alles, was mich mit Elmshorn verbindet, hinter mir.
Und das hat nicht nur mit Onkel Veit zu tun, aber er spielt dabei eine wichtige Rolle. Dominik Kirschbaum, sage ich zu mir selber, ein neuer Weg birgt auch neue Chancen. So ähnlich schrieb es Mama einmal in ihrem Tagebuch. Sicher hat sie sich nicht denken können, dass ihre Worte für mich eine Ermutigung bedeuten würden. Wahrscheinlich werde ich dies natürlich vor niemandem zugeben, vor wem auch? Meine Entscheidungen mache ich immer mit mir selber aus. Außerdem lässt sich ein dreiundzwanzigjähriger Mann doch nichts von seiner Mama sagen! Oder vielleicht doch? Ich wäre – ehrlich gesagt – in manchen Momenten froh, den Rat meiner Eltern zu kennen.
Im Juni 1988 gönnten sich meine Eltern eine einwöchige Parisreise. Sie brachten mich für diese Zeit zu Tante Maja und Onkel Veit, Papas Bruder in Elmshorn. Papa war Bauzeichner, Mama Grundschullehrerin, beide verband unter anderem das Interesse an Kirchenorgeln. Ich erinnere mich, wie meine Eltern häufig den Namen ‚Silbermann‘ erwähnten, der im Orgelbau sehr bekannt ist, was ich natürlich erst viel später mitbekam. Ein Bild von der zerstörten Frauenkirche in Dresden hing zudem in Papas Arbeitszimmer. Irgendwann erfuhr ich von Onkel Veit, dass mein Opa vor der Zerstörung in der Frauenkirche häufig die Orgel gespielt hat. „Eine wunderbare Silbermann-Orgel war das“, lautete Onkel Veits Aussage.
Am vorletzten Tag ihrer Parisreise besichtigten meine Eltern eine sehr alte Orgel einer bekannten Kathedrale südwestlich von Paris. In Mamas Aufzeichnungen lese ich, dass sie am Nachmittag ein Orgelkonzert in der Kathedrale besuchen wollten und sie beide schon in Vorfreude darauf waren. Auf der Rückfahrt von dem Konzert kamen meine Eltern bei einem Zugunglück am Gare de Lyon ums Leben. Mein siebter Geburtstag lag gerade sechs Wochen zurück, als ich zum Waisenkind wurde.
Wie selbstverständlich nahmen mich Tante Maja und Onkel Veit bei sich auf. Die beiden waren selber kinderlos. Für einige Jahre lebte ein Pflegekind in ihrem Haus. Ich erinnere mich nur noch schwach an Nikita von früheren Besuchen in Elmshorn. Nikita war sieben Jahre älter als ich. Er verließ mit vierzehn, also im März vor dem Zugunglück, das Haus von Maja und Veit. Über die Gründe wurde mir gegenüber nicht gesprochen.
Durch mich hatten Tante Maja und Onkel Veit nun wieder ein Kind im Haus, das sie umsorgen konnten.
Zunächst fühlte sich mein Aufenthalt bei ihnen wie ein verlängerter Urlaub an. Als jedoch das Schuljahr begann, in dem ich die zweite Klasse besuchte, fing ich an zu begreifen, dass Mama und Papa nun nicht mehr da waren. Viele Abende habe ich heimlich im Bett geweint, ich wollte meinen Kummer mit niemandem teilen. Zu Maja und Veit entwickelte ich wenig Vertrauen.
Mama schilderte mir schon lange vor der Einschulung in schillernden Farben, wie schön es würde, wenn sie und ich gemeinsam in unsere kleine Dorfschule bei Heilbronn gehen könnten. Das erste Schuljahr war für mich tatsächlich eine wunderbare Zeit. Manchmal durfte ich nach Schulschluss im Lehrerzimmer auf Mama warten, jeder Kollege hatte ein nettes Wort für mich übrig. Öfters bekam ich dort ein Buchstabenspiel der zweiten Klasse zum Ausprobieren. Ich war stolz auf meine Mama, die hier im Schulgebäude wie selbstverständlich alle Schränke und Schubfächer nutzen konnte, Türen öffnen durfte, wie bei uns zu Hause. In meiner Erinnerung sehe ich Mama fröhlich auf dem Pausenhof stehen, umringt von vielen Kindern. Ich glaube, sie war eine beliebte Lehrerin.
Papa arbeitete in einem Architekturbüro in Heilbronn. Ab und zu nahm er mich mit ins Büro. Das war jedes Mal ein Abenteuer für mich. Dort gab Papa mir häufig einen alten Tuschestift und verschiedene Lineale an die Hand. So professionell ausgestattet fertigte ich eigene Zeichnungen auf Transparentpapier an, während Papa am großen Zeichentisch arbeitete, wo er ein riesiges Blatt, damals hätte ich gesagt: ‚bemalte‘. Mit der Zeit konnte ich für mein Alter ganz gut mit dem Tuschestift umgehen. Papa legte eine unendliche Geduld an den Tag, mir die richtige Handhaltung beizubringen. Papas Kollegen sprachen mich manchmal mit ‚Herr Kollege Kirschbaum Junior‘ an, als sie meine Kritzeleien betrachteten. Nachdem Papa mir erklärt hatte, was das ‚Junior‘ bedeutet, kam ich mir ziemlich wichtig vor. Papa zwinkerte mir dann immer zu, als ob nur wir beide wüssten, dass ich eigentlich kein echter Kollege im Büro bin.
Einmal führte Papa mich auch in den Raum mit dem großen Bildschirm, an dem ebenfalls Zeich-nungen erstellt wurden, ganz ohne Tuschestifte.
In Mamas Tagebuch, welches Tante Maja mir zu meinem sechzehnten Geburtstag überreichte, steht, dass Papa in der Firma an einem Zeichenkurs für den Computer teilnahm. Heute würde Papa, als Bauzeichner, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mit Tuschestiften arbeiten, da die Architekturzeichnungen nur noch am Computer hergestellt werden.
Das Tagebuch von Mama ist, neben vielen Fotos meiner Eltern mit mir, das Einzige, was mir die Gedanken und Gefühle meiner Eltern mitteilt. Es ist nicht so, dass ich ständig an meine Eltern denken muss und deshalb traurig bin. Im Gegenteil, die Erinnerung an die Zeit mit meinen Eltern wird durchzogen von Leichtigkeit und Fröhlichkeit.
Mama konnte so herzlich lachen, dass ich oft mitlachen musste, ohne zu wissen aus welchem Grund Mama lachte. In ihrem Humor ergänzten sich meine Eltern. Auch Papa hatte vielfach einen Spaß auf den Lippen. Noch heute sehe ich seine zuckenden Mundwinkel vor mir, bevor er zu lachen begann. Diese Vergnügtheit gemeinsam mit der Gelassenheit meiner Eltern versuche ich nun in Bertoldsbrück als dreiundzwanzigjähriger Mann Stück für Stück in mir wiederzuentdecken. Viel zu lange war diese Eigenschaft in mir zugeschüttet von Einsamkeit und Verbissenheit.
Ich kann nicht behaupten, dass die Zeit bei Tante Maja und Onkel Veit dazu beitrug, in mir eine ausgelassene Lebensfreude zu erhalten. Die Jahre bei ihnen bedeuteten für mich ein beständiges Auf und Ab meiner Gefühle. Erst viel später verstand ich, dass meine Tante und mein Onkel selber in einer langandauernden Krise steckten, an der ich nicht direkt schuld war, die aber aufgrund meines Daseins immer wieder aufflackerte.
Waren die beiden schlechter Laune, dann bekam ich dies selbstverständlich zu spüren, durch Hausarrest oder Taschengeldentzug.
Zudem hatten Onkel und Tante verschiedene Ansichten zur Kindererziehung. Onkel Veit war der Meinung, dass ein Kind nur mit einer gewissen Strenge zu einem reifen Menschen heranwächst. Zu der gewissen Strenge gehörten für ihn sowohl die Ohrfeige als auch das mehrstündige Einsperren, um meinen Willen zu brechen. Die Ohrfeigen taten weh, waren aber schnell vorbei. Die vielen Stunden, die ich eingesperrt in meinem Zimmer verbracht habe, machten mich hingegen oft noch wütender auf Onkel Veit, als dass sie mich davon abhielten, erneut das Aufräumen, Schuheputzen oder die Hausaufgaben zu vergessen.
Ich glaube, das Fundament für meinen Starrsinn und die Verbissenheit, meinen Willen durchzusetzen, ist in den einsamen Stunden entstanden, die ich eingesperrt in meinem Zimmer verbringen musste.
War der Onkel allerdings gut gelaunt, dann konnte es sein, dass er mich abends, sogar weit nach Mitternacht, von einer Party abholte oder er erlaubte mir spätabends einen Film mit meinen Freunden anzuschauen.
Schon als ich zwölf Jahre alt wurde, richtete mir Onkel Veit einen eigenen Platz in seinem Werkkeller ein, in welchem ich früh anfing, mich mit Holz zu beschäftigen. Anfangs besaß ich nur eine Laubsäge, später kamen weitere Werkzeuge hinzu. Bei den Arbeiten in der kleinen Holz-werkstatt stellte ich mich nicht ungeschickt an.
Mit fünfzehn durfte ich mir ein Bettgestell selber bauen, auf das ich sehr stolz war. Onkel Veit half mir bei der Planung und gab mir so manchen Tipp. Er selber wusste eine Menge über Holz, Holzverbindungen und die Behandlung von Holz.
Trotzdem war ich selbst in solch schönen Momenten immer in Hab-Acht-Stellung, wann wohl die gute Stimmung des Onkels wieder umschlagen würde.
Tante Maja hingegen, die Sanftmütigere der beiden, sah darüber hinweg, dass ich mein Sport-zeug schon wieder vergessen hatte in den Wäschekorb zu räumen oder gar in der Turnhalle hatte liegen lassen. Sie begegnete mir oft mit Liebe und Zuneigung, kaufte mir die begehrte coole Kleidung und das teure Spielzeug. Zu ihr konnte ich kommen, wenn meine Klausuren abermals schlecht ausgefallen waren. Es kam vor, dass sie mich manchmal in den Arm nahm und mich ermunterte, dass das Klausurergebnis beim nächsten Mal bestimmt wieder besser ausfallen würde.
Böse Worte aber bekam ich trotz allem auch von ihr zu hören. Meistens, wenn gerade ein Streit mit dem Onkel in der Luft lag. Das passierte regelmäßig. In dem Fall war es für mich das Beste, nicht nur Onkel Veit, sondern auch Tante Maja aus dem Weg zu gehen, um nicht beider Zorn abzubekommen.
Die siebte Klasse musste ich wiederholen. Zu oft gab es Krach in diesem Schuljahr, zudem war ich mitten in der Pubertät. Der Zündstoff zu Konflikten war somit reichhaltig.
Mit dem Herauswachsen aus der Pubertät gelang es mir immer besser den Kontroversen von Maja und Veit bereits im Vorfeld auszuweichen. Allmählich hatte ich einen inneren Spürsinn entwickelt, wie sich gerade die Stimmungslage im Hause Kirschbaum gestaltete.
Hatte sich Onkel Veit etwa über einen Lieferanten geärgert, so konnte ich sicher sein, dass Veit irgendetwas findet, was zudem seine Wege durchkreuzt, um seine Stimmung lautstark zu entladen. Ihn störte manches, wie zum Beispiel zeitweise meine langen Haare oder auch mal ein von Maja verspätet zubereitetes Mittagessen.
Die Folge daraus war, dass mein inneres Lage-barometer versuchte, pausenlos auszuloten, wann wohl der nächste Streit zu erwarten war. Dadurch war ich selten fähig, richtig ausgelassen fröhlich zu sein. Meine Freude blieb stets verhalten. Ich entwickelte mich zu einer Art Seismograph. Dabei bemühte ich mich möglichst früh herauszufinden, wann sich das nächste Beben anbahnte, um mich aus dem Staub zu machen.
War alles in Ordnung zwischen Onkel und Tante, konnten wir gewiss schöne Tage miteinander verbringen. Die gemeinsamen Sonntagsausflüge in den Zoo habe ich genauso genossen wie die Schiffstour auf eine Nordseeinsel oder in ein angesagtes Restaurant.
Materiell habe ich in meiner Kindheit wenig vermisst. Kleidung und Geschenke bekam ich genug. Meine Vermutung war, es sollte im Ort nicht heißen, dass ‚dat Keerlke‘ der Metzgerei Kirschbaum unordentlich herumläuft.
‚Dat Keerlke‘, so wurde ich häufig von Onkel und Tante, aber besonders von ihren Freunden, Nachbarn und den Kunden, die in den Laden kamen, genannt. Erst viel später wurde mir klar, dass mit diesem Begriff mein unklarer Status in der Familie umschrieben wurde. Ich war ja nicht der Sohn des Hauses. Korrekterweise hätte man mich als Neffen von Maja und Veit vorstellen können. Die Bezeichnung ‚dat Keerlke‘ machte irgendwie ein Neutrum aus mir. Der Name blieb mir in der Metzgerei lange erhalten.
Mit vierzehn wurde ‚dat Keerlke‘ konfirmiert. Zu meiner Konfirmation durfte ich die Klamotten mit Tante Maja gemeinsam aussuchen, das hat echt Freude gemacht. Sie besitzt ein Händchen für den Geschmack von Jugendlichen. Schon Wochen vor dem Fest erlaubten mir Onkel und Tante, ein Restaurant für das festliche Mittagessen auszuwählen. Sie ließen mir freie Hand, zwei Freunde einzuladen.
Obwohl Onkel und Tante ihn selber nicht besonders gut kannten, erhielt sogar mein Patenonkel aus Berlin eine Einladung zu meiner Konfirmation. Der langjährige Freund von Papa aus der Schule wohnte seit Jahren mit seiner Familie in Berlin. Zum Anlass meines Festes schenkte er mir einen Gutschein für eine Freizeit auf Norderney, bei der auch seine eigenen Kinder im folgenden Sommer teilnahmen. Es wurde mein erster Urlaub alleine. Die drei Wochen auf der Insel habe ich in sehr positiver Erinnerung mit viel Lachen, Reden, Spielen – und sogar das gemeinsame Singen gefiel mir gut.
Wieder zu Hause zurück ging jedoch das Auf und Ab der Gefühle bezüglich Tante Maja und Onkel Veit weiter. Es bewirkte, dass ich sie auf eine Art irgendwie gern mochte, sie jedoch gleichzeitig fürchtete. Mein Verhältnis zu ihnen unterschied sich stark von der Liebe und Zuneigung, die ich meinen Eltern gegenüber empfunden hatte.
Ich glaube, ich entwickelte sehr früh eine ab-wartende Distanz zu Maja und Veit. Später merkte ich, dass mir dieser Abstand eine gewisse Sicherheitszone bot. Ich war Teil der Familie und doch fühlte ich mich nicht wirklich dazugehörig. Das klingt vielleicht traurig, doch durch diese Haltung konnte ich mir ein Stück Unabhängigkeit erobern.
Als dann die verschärften Diskussionen zwischen Onkel Veit und mir begannen, wurde es schwieriger. Viele Kontroversen hingen damals vordergründig mit dem Laden zusammen. Onkel Veit ist mit ganzem Herzen Metzgermeister. Gemeinsam mit Tante Maja führt er eine gutgehende Metzgerei in Elmshorn. Das Geschäft ist sein gesamter Stolz.
Bis ich acht Jahre alt war, blieb Tante Maja zu Hause, um mich zu versorgen, dann aber begann sie Stück für Stück wieder im Geschäft mitzuarbeiten. Ab dieser Zeit kam ich nach der Schule täglich in die Metzgerei, wo ich meine Hausaufgaben in dem beengten Nebenzimmer der Kühlräume erledigte.
Wenn ich an diese Räumlichkeiten denke, steigt mir heute immer noch der unangenehme Geruch der Fleischverarbeitung in die Nase. Ich mochte die kalte Atmosphäre an den verschiedenen Maschinen von Onkel Veit noch nie. Klar, als kleiner Junge war es anfangs spannend dabei zu sein, doch das rohe Fleisch mochte ich einfach nicht anfassen. Onkel Veit hingegen liebte es, am Cutter zu stehen und seine spezielle Würzmischung für Hackfleisch oder Würstchen mit den eigenen Händen unterzumengen. Mir wurde direkt übel, wenn er den Schafsdarm auswusch, um diesen anschließend zu füllen. Einmal schaute ich zu, als Onkel Veit Schweinehälften zerlegte. Zuerst arbeitete er sich mit einer Kreissäge durch Fleisch und Knochen, nachfolgend zog er sich ein Kettenhemd und Kettenhandschuhe an – schon diesen Anblick fand ich furchterregend –, um mit dem Messer die Filetstücke herauszuschneiden.
Erst mit sechzehn Jahren begann ich zu begreifen, weshalb ich weiterhin beständig emotional von Onkel und Tante auf Distanz ging.
Onkel Veit sprach in dieser Zeit sehr offen darüber, dass er mich gerne als zukünftigen Junior-chef in der Fleischerei Kirschbaum sehen würde. Er ließ verlauten, es sei vertane Zeit, das Abitur zu machen, wenn ich sowieso eines Tages in der Fleischerei mitarbeiten würde.
Nicht, dass ich bereits konkrete Berufspläne geschmiedet hätte, Metzgermeister jedoch, wäre nie für mich in Frage gekommen. Das stand damals absolut felsenfest.
Das Einzige, was ich für die Metzgerei übrighatte, war der Laden. Dort durfte ich bei Tante Maja und ihren Kolleginnen hinter der Theke sitzen und die Kunden beobachten. Dabei thronte ich als kleiner Junge manchmal auf dem alten, ausgemusterten Schneidebrett in der Ecke, in dem ‚dat Keerlke‘ Platz nehmen und sich ruhig verhalten sollte. Das fiel mir nicht schwer. Meine Fantasie wurde angeregt, mittels der Kunden, die den Laden betraten.
Warum hat die blonde Frau so viel rote Schminke im Gesicht? Weshalb blickt der junge Mann nur so traurig drein? Warum kann die alte Dame sich nur am Stock vorwärtsbewegen? Warum erscheint die Frau heute nun schon zum dritten Mal im Laden? Warum trägt der Mann mit der grünen Jacke einen verbeulten Hut?
Anfangs stellte ich mir nur die Fragen, später aber, dachte ich mir komplette Geschichten zu den Personen aus.
Die Eltern von dem jungen Mann hatten bestimmt einen Unfall, deshalb schaut er so betrübt. Sicherlich wohnt er bei Onkel und Tante und muss immer für sie einkaufen gehen. Vielleicht hat er keine Freunde, vielleicht war auch die Frau mit der roten Schminke seine strenge Lehrerin.
In dieser Weise entfaltete sich meine Fantasie hinter der Ladentheke. Oft war ich ganz versunken in eine meiner ‚Kundengeschichten‘, sodass ich nicht hörte, wenn mich Tante Maja ansprach.
Die Wurstküche und alles andere hinter dem Laden mied ich, soweit es mir möglich war.
Zum sechzehnten Geburtstag schenkte mir Onkel Veit ein gebrauchtes Moped. Eine geraume Zeit überlegte ich, ob ich mich nicht doch – Onkel Veit zum Gefallen – für das Metzgerhandwerk entscheiden könnte –, war er doch so großzügig!
Aber … Nein! Niemals!
Es begann zunächst ein Zeitraum mit lautstarken Diskussionen am Abend. Eine beständige Debatte drehte sich um meinen Schulbesuch. Vermutlich habe ich damals aus reinem Protest darauf beharrt, nach der Mittleren Reife weiter die Schule besuchen zu dürfen. Erstaunlicherweise war mein Kämpfen in dieser Angelegenheit letztendlich mit Erfolg gekrönt. Onkel Veit ließ es entgegen seinem Willen, wahrscheinlich nach vielen geduldigen Worten von Tante Maja, doch zu, dass ich die Oberstufe absolvierte. Mich bestätigte dieser Triumph. Mein verbissenes Ringen, um meinen eigenen Kopf durchzusetzen, hatte sich ausgezahlt.
In den Jahren bis zum Abitur jedoch steigerten sich trotz allem die Auseinandersetzungen mit Onkel Veit.
Vielmals malte er mir das Dasein als Juniorchef in leuchtenden Farben aus. Ich bräuchte schließlich nur die Metzgerausbildung und im Anschluss den Meisterkurs abzuschließen, dann könne ich einen eigenen Laden führen, wäre mein eigener Chef und hätte somit mehr als ein solides Auskommen. Um mir das Metzgerdasein schmackhaft zu machen, schleppte er mich mit zum Metzgerstammtisch der Innung – das hat hoffentlich niemand in meiner Stufe je erfahren! Einmal nahm das gesamte Kollegenteam der Fleischerei Kirschbaum, inklusive mir, an einem Innungsausflug in einen Freizeitpark teil. Selbst dieser lustige Ausflug ließ mich unbeeindruckt. Die Einwände, die ich bezüglich meiner Abneigung der Metzgersarbeit äußerte, ließ Onkel Veit nicht gelten.
„Man gewöhnt sich an vieles im Leben. Oft sieht man erst hinterher, wozu es gut war.“
Das war eine von Onkel Veits ständigen Aussagen, um mich zu seinem geliebten Beruf zu überreden.
Tante Majas zögerliche Anmerkungen wie ‚Lass doch den Jungen selber entscheiden, welchen Beruf er wählt‘, verhallten bei Onkel Veit ungehört.
Ich ahnte, dass es Tante Maja ebenfalls mehr als recht wäre, wenn ich in das Geschäft miteinsteigen würde. Auch sie versuchte, mich so manches Mal auf subtile Art und Weise für die Arbeit mit Wurst und Fleisch zu gewinnen.
Nach dem Abitur blieb mir noch die Zeit des Zivildienstes, um eine endgültige Berufsentscheidung zu treffen.
Zur bestandenen Führerscheinprüfung schenkte Onkel Veit mir einen guterhaltenen Gebraucht-wagen. Ich empfand dies als seinen letzten sogenannten Bestechungsversuch, mich zum Metzgerberuf zu überreden.
Als das Ende des Zivildienstes nahte, ich war gerade zwanzig geworden, gab es einen regelrechten Krach zwischen Onkel Veit und mir. Er warf mir vor, dass er mich in all den Jahren versorgt habe, sogar ein Moped habe er mir geschenkt, den Führerschein hätte ich machen dürfen, zuletzt schrie er mich fast an:
„Selbst das Autogeschenk konnte dir nicht die Augen dafür öffnen, dass ich nur das Beste für dich möchte! Das kann ich wirklich nicht verstehen! Wir haben dir wahrhaftig alles gegeben! Was erwartest du sonst noch alles von uns?“
Bei diesen Worten von Onkel Veit wurde auch ich richtig wütend und habe ihm Dinge an den Kopf geworfen, die einfach aus mir herausplatzten, ohne zu überlegen. Dieser Streit war letztlich der Auslöser, der mich bewog, aus dem Metzgerhaus von Tante Maja und Onkel Veit auszuziehen.
Meine finanzielle Situation war nicht ganz schlecht. Von dem Geld meiner Eltern hatte Onkel Veit vor Jahren eine Eigentumswohnung in Elmshorn gekauft. Die Hälfte der Miete floss zunächst auf mein Sparbuch und seit meinem achtzehnten Lebensjahr auf mein Konto. Die andere Hälfte benötigten Onkel und Tante für die Verwaltung sowie anstehende Renovierungsarbeiten, so sah vorerst unsere Einigung mit einem Rechtsbeistand aus.
Gemeinsam mit zwei Kumpels, Peter und Manfred, bezog ich also eine WG in Elmshorn. Kurz darauf erhielt ich die Lehrstellenzusage als Erzieher im Kindergarten. Die Leiterin der Einrichtung begeisterte sich schon während meines Zivildienstes dafür, dass ein Mann mit im Team sei. Nachdem sie schließlich meine Bewerbung vorliegen hatte, war ihre Entscheidung schnell getroffen. Zwar plagten mich noch manchmal Gewissensbisse, weil ich so unvermittelt bei Onkel und Tante ausgezogen war. Dessen ungeachtet signalisierte mir jedoch mein Starrsinn, dass dies die beste Lösung für beide Seiten sei.
Unter den Kindern fühlte ich mich wohl. Sie waren unvoreingenommen, echt und ehrlich. Die Kinder gaben mir ihr Vertrauen. Dies zu erleben, erfüllte mich sehr. Enno, ein Vierjähriger, rannte morgens meistens zuallererst auf mich zu. Er wollte nur von mir durch die Luft gewirbelt werden. Mara, eine kesse Fünfjährige, bestand darauf, dass ich neben ihr beim Frühstück sitzen solle. Oft erzählten mir die Kinder Geschichten, die mit Sicherheit der Schweigepflicht unterlagen. Ich bekam Einblicke in Familiensituationen, die teilweise haarsträubend, teilweise aber erstaunlich schön waren, erinnerten sie mich doch an die Zeit mit meinen Eltern.
Mein Leben und die Sicht auf mein Leben veränderten sich in meiner Ausbildungszeit. Ab und zu erwischte ich mich dabei, selber von einem Familienleben zu träumen. In diese Gedanken schlich sich der unkomplizierte, fröhliche Dominik. Der Dominik aus dem Dorf bei Heilbronn, in dem sich die heiteren Gesichtszüge seiner Eltern widerspiegeln.
Vielleicht fühlte ich mich deshalb im Kindergarten meinen Eltern plötzlich wieder nah. Häufig versuchte ich mich in sie hineinzuversetzen. Welchen Weg haben sie sich für mich, ihr Kind, vorgestellt?
„Dominik, du bist der geborene Kinderversteher!“ sagte meine Chefin nicht nur einmal zu mir im Zweiergespräch. Ein anderes Mal hakte sie nach und fragte:
„Wie kommt es, dass die Kinder solch ein Vertrauen zu dir entwickeln? Du kannst doch genauso streng mit ihnen sein, wie wir anderen im Team auch?“
Auf diese Frage hatte ich keine Antwort. Ich merkte selber, dass die Arbeit mit den Kindern für mich aus einem Geben und Nehmen bestand. Im Kontakt mit ihnen lernte ich mich selber neu kennen.
Mir wurde klar, dass ich bei Onkel Veit ständig im Zusammenhang der Metzgerei definiert wurde. Er war bestrebt, mich in ein Schema zu pressen, in das ich nicht passen wollte. Infolgedessen wurde ich bockig und rebellierte. In den Kindergarten hingegen ging ich freiwillig. Während des Zivildienstes spürte ich eine wachsende Begeisterung bei der Arbeit mit den Kindern. In den folgenden drei Ausbildungsjahren erfuhr ich Bestätigung und Freude in meinem gewählten Berufsweg.
Jetzt muss ich aufpassen, meine letzten Sätze klingen so, als wäre ich einzig allein der nette, begabte Kinderversteher im Kindergarten gewe-sen. Nein, das war ich mit Sicherheit nicht.
Ganz im Gegenteil! Bei Maja und Veit entwickelte ich mich letztendlich zum Rebellen und Starrkopf. Unter meinen Mitbewohnern Peter und Manfred, genannt Freddy, fand ich es erstrebenswert, genauso cool zu sein wie diese.
Freddy kannte ich noch aus der Schule. Er machte eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker, war deshalb mehrmals einige Wochen auf dem Wasser unterwegs. Seine Art Sprüche zu klopfen, bewunderte ich zu Anfang. Später fragte ich mich allerdings, welcher Mensch sich wohl hinter den lautstarken, oft zynischen Worten verbarg. Freddy bewohnte das kleinste unserer drei WG-Zimmer mit der geringsten Miete.
Peter studierte Deutsch und Mathe auf Lehramt. Er war zwei Jahre älter als Freddy und ich, ein besonnener Typ mit sicherem Auftreten. Das bemerkte ich schnell. Wenn er dem Vermieter gegenüber berichtete, dass die undichten Fenster uns eine überdimensional hohe Heizungsrechnung bescherten, überlegte der Vermieter nicht lange, bis er selbst in unserer Wohnung doppeltverglaste Fenster einbauen ließ. Peter war es auch, der nüchtern einen Plan anlegte, wann, wer, was in der WG zu erledigen habe. Befand sich Freddy unterwegs auf hoher See, stellte Peter seine Excel-Tabelle mühelos auf zwei Personen um. Im Großen und Ganzen funktionierte unser Männerhaushalt recht gut. Wahrscheinlich, weil wir alle drei ziemlich anspruchslos bezüglich Essen oder übertriebener Sauberkeit waren.
Jeden Mittwoch fand bei Peter ein Bibelkreis satt. Anfangs fragte ich ihn, was dort so abläuft. Er sprach souverän von Diskussionen über Bibelstellen, Spieleabende und gemeinsame Freizeiten. Einerseits war meine Neugier geweckt, an einem der Abende teilzunehmen, andererseits klangen die Discobesuche mit Freddy oder ein Samstagnachmittag im Fußballstadion natürlich attraktiver für mich. Oftmals tranken Freddy und ich unser abendliches Bier in meinem Zimmer, während nebenan Lieder mit Gitarrenbegleitung gesungen wurden. Wir schmunzelten manchmal über die Gesänge nebenan.
Zum Ende meiner Ausbildung, Freddy durchquerte wieder einmal mit einem Schiff die Ozeane, nahm ich dann doch an Peters Bibelkreis teil. Dabei fühlte ich mich zurückversetzt in die Zeit der Freizeit auf Norderney nach meiner Konfirmation, meinem ersten Urlaub ohne Onkel und Tante. Dort im Freizeithaus überwog ein unkomplizierter, vergnügter, aber ebenso respektvoller Umgang miteinander.
Erstaunlicherweise waren die Leute aus Peters Bibelkreis ähnlich sympathisch wie so manche Freizeitteilnehmer von damals. Was hatte ich eigentlich erwartet? Nun ja, Bibelkreis klang für mich nicht vordergründig danach, als würde ich dort besonders coolen Leuten begegnen.
An dem Abend, den ich in dem Kreis verbrachte, drehte sich die Diskussion von Peters Freunden um ‚Schuld und Vergebung‘ –, Themen also, die mir meilenweit von meiner Alltagsrealität entfernt zu sein schienen. Fast wäre ich nach kurzer Zeit wieder in mein Zimmer gegangen. Doch dann merkte ich plötzlich, dass die jungen Leute mich mit ihren Diskussionsbeiträgen mehr berührten, als ich dachte.
Nach einer Weile forderte ich die Runde heraus – das war zumindest meine Perspektive –, indem ich sie zum Thema Vergebung um ein Beispiel aus unserem heutigen Alltag bat. Für mich klangen die Worte der Bibel ziemlich altbacken, fern meiner Realität und zunächst unverständlich. Peter antwortete ruhig:
„Durch den Tod Jesu am Kreuz, wird die Schuld des Menschen vergeben. Der von Christus gerettete Mensch ist demzufolge frei, so zu leben, wie Jesus es vorgelebt hat. Er kann vergeben, wo ihm Unrecht getan wurde. Er kann Frieden stiften, wo Krieg herrscht.“
„Du meinst also, ich könnte somit ohne Gesichtsverlust gegen den Strom schwimmen, den ersten Schritt gehen und jemandem vergeben, der mich verletzt hat?“, fragte ich nach.
Kaum hatte ich diesen Satz ausgesprochen, spürte ich schlagartig, wie präzise das Thema genau mich selber betraf. Ich erschrak. Mit einem Mal waren die Bibelworte nicht mehr verstaubt und alt, sondern brandaktuell für mich. Mir wurde heiß. Ich dachte an Onkel Veit, die Auseinandersetzung, meinen Auszug im Streit. Was Peter oder die anderen an dem Abend noch sagten, habe ich nur bruchstückhaft mitbekommen.
Es überkam mich wie eine große Herzenswelle, auf der ich schwamm und angeschoben wurde, zum Friedenstiften, nämlich dadurch, dass ich selber vergeben musste. Wie das Ganze mit Jesus zusammenhing, kapierte ich in diesem Moment nicht vollständig.
Es war schließlich diese Herzenswelle, die mich dazu bewog nachzudenken. Sollte ich mich etwa mit Tante Maja und Onkel Veit wieder aussöhnen? Unser Streit lag nun drei Jahre zurück. Die Gegend um die Metzgerei habe ich seit dem Streit für gewöhnlich gemieden. Vielleicht könnte ich ja den ersten Schritt machen. Vergeben also, so wie Peter und seine Freunde es aus der Bibel überzeugend schilderten.
Es vergingen mehrere Tage, an denen ich viel nachdachte und mit Peter sprach. Tage, an denen mein Stolz immer wieder aufloderte. War es nicht Onkel Veit, der mich verletzt hatte? Und doch, desgleichen hatte ich ihm unüberlegte Worte an den Kopf geworfen. Tante Maja stand zwischen uns. Sie wollte, dass Veit seine Ruhe hat. Aber – sie wollte auch, dies würde ich mit absoluter Sicherheit behaupten, eine Versöhnung zwischen mir und ihm.
Somit war es die Herzenswelle, die mich zum Friedenstiften anschob und die mich letztendlich bewegte, einen Brief an Tante Maja und Onkel Veit zu schreiben.
Zunächst bedankte ich mich darin bei ihnen für ihre Fürsorge. Ich führte alles Gute an, was mir aus unserer gemeinsamen Zeit einfiel. Darüber hinaus nahm ich eine Entschuldigung bei Onkel Veit für meine unfairen Worte in meinem Brief auf. Zuletzt bekräftigte ich, wie dankbar ich ihnen sei, dass sie mich nach dem Tod meiner Eltern aufgenommen und versorgt hatten. Nach Peters Erläuterungen zur Vergebung und nach den nunmehr drei Jahren der Ausbildung nahm ich all meinen Mut zusammen, um diese Worte zu formulieren.
Eine Antwort erhielt ich eine Woche später von Tante Maja. Sie würde sich freuen, wenn ich zu Besuch käme, mündlich ließe sich manches besser besprechen.
Hm – besuchen? War ich dazu bereit? Ich zog Peter erneut ins Vertrauen. Er ermutigte mich zu diesem Schritt.
Heute bin ich richtig froh darüber, sowohl den Brief geschrieben zu haben, als auch zu Besuch in das Metzgerhaus zurückgegangen zu sein.
Tante Maja und Onkel Veit begegneten mir erst zögernd, dann aber wirkten sie echt erfreut über meine erneute Kontaktaufnahme zu ihnen. Sie erkannten an, dass ich den ersten Schritt zur Aussöhnung gewagt habe. Mündlich wiederholte ich noch einmal meinen Dank ihnen gegenüber.
Onkel Veit murmelte abschließend etwas von:
„Du musst wissen, welchen Weg du wählst, viel Glück dafür.“
Das war sicherlich das Äußerste, was ich zu dem Zeitpunkt von ihm an Zugeständnis für meinen gewählten Weg als Erzieher erwarten konnte. Jedoch rechnete ich ihm dies hoch an. Es fühlte sich gut für mich an, nun im Frieden mit Onkel und Tante zu stehen.
Als ich Onkel Veit berichtete, wie froh ich nach wie vor über das geschenkte Auto bin, meinte ich, ein leichtes Lächeln in seinem Gesicht zu entdecken. Tante Maja hatte beim Abschied Tränen in den Augen, als sie erfuhr, dass ich in die Eifel ziehen würde. Ich versprach beiden, mit ihnen in Kontakt zu bleiben und von mir hören zu lassen.
Vorgestern holte ich meine restlichen Sachen aus dem Metzgerhaus ab. Nachdem alles im Auto verstaut war, zog Tante Maja plötzlich ihr neues Handy aus der Hosentasche und zeigte es mir.
„Junge, du hast doch auch so ein Telefon. Magst du mir manchmal Nachrichten schreiben? Ganz kurze reichen aus, damit wir wissen, wie es dir geht.“
Ich war echt gerührt darüber.
„Klar, ich melde mich bei Euch, versprochen.“
Daraufhin verabschiedeten wir uns.
Zwischen meinem Brief und dem ersten Besuch bei Tante Maja und Onkel Veit fanden meine Abschlussprüfungen im Kindergarten statt. Nach der letzten Prüfung saß ich am Elbufer auf der Bank, um zu überlegen, ob ich die Stelle, die mir meine Chefin im Kindergarten in Elmshorn anbot, annehmen sollte. Dann kam Dana.
Ich war verliebt, wie ich es nie erlebt hatte. Davon war ich in diesem Moment vollkommen überzeugt. In der Vergangenheit gab es die eine oder andere Freundin, mit der ich ‚ging‘ und der ich in irgendeiner Weise verliebte Gefühle gegenüber empfand. Nie war es mir freilich so ernst wie jetzt. Denn ab sofort sah ich überall nur Dana. Dabei kannte ich doch nur ihren Namen sowie diesen verflixten Ort in der Eifel.
Mir kam die Idee am Hamburger Hauptbahnhof eine Zeitung mit Stellenangeboten aus dem Rheinland zu kaufen. Vielleicht finde ich ja etwas in der Nähe von diesem Bertoldsbrück. Am Samstag saß ich wieder auf einer Bank, dieses Mal in Hamburg an der Alster während ich die Stellenangebote durchsuchte. Plötzlich las ich:
Erzieher/in
in Vollzeit gesucht
im Bertoldsbrücker Förster-Garten
Deine Aufgaben sind:
• die Begleitung und Förderung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren
• Planung und Durchführung von Angeboten in der Familienarbeit
• Vermittlung christlicher Werte
Du bringst mit:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in
• Identifikation mit dem christlichen Glauben
• Liebe zum Beruf, Leidenschaft und ein großes Herz für Familien
• Kreativität und Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen
• eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten
Wir bieten Dir:
• eine unbefristete Stelle
• ein vielfältiges Aufgabenfeld bei der Weiterentwicklung unserer Einrichtung
• Finanzierung von Fort- und Weiterbildungen
Deine aussagekräftige Bewerbung sendest Du an: Julia Siebenberg ...
Ich musste nicht lange auf die Antwort warten. Eine Woche später fand das Bewerbungsgespräch statt. Die Zusage erfolgte am selben Nachmittag, sogar eine sehr nette Wohnung fand ich an dem verlängerten Wochenende, das ich in Bertoldsbrück verbrachte.
Und jetzt sitze ich hier, morgen beginnt meine neue Arbeitsstelle im Förster-Garten. Mein Dasein in Bertoldsbrück kommt mir ein wenig verrückt vor. Und doch empfinde ich tief in mir drin eine Art Hochgefühl.
Ich habe alles hinter mir gelassen, was mein bisheriges Leben ausgemacht hat. Nun bin ich allein auf mich gestellt. Ganz allein. Ohne richtige Familie, denn Maja und Veit betrachte ich eher mit gemischten Gefühlen als eine Familie –, trotz unserer Versöhnung. Und auch ohne echte Freunde bin ich hier. Ich war in der Schule nicht der Typ, der viele Kontakte pflegte oder Schul-kameraden nach Hause einlud.
Allerdings – wegen Dana bin ich hierhergezogen! Fast kommt es mir vor, als wäre ich bereits sehr nahe an meinem Ziel. Schließlich bin ich über fünfhundert Kilometer weit gereist, um in Bertoldsbrück neu zu beginnen.
Aber – wie kann ich sie finden? Wo fange ich an zu suchen? Bertoldsbrück ist größer, als ich dachte. Elmshorn schien mir übersichtlicher, obwohl beide Orte etwa 50.000 Einwohner aufweisen.
Leise Fragen werden in mir laut: War das wirklich eine gute Idee? Habe ich mich von meiner Sturheit leiten lassen? War es nicht öfter so bei mir, dass ich recht spontan ein Ziel formulierte, welches ich blind und verbissen verfolgte, um es zu erreichen? Das Abitur etwa! Den Zivildienst in einem Kindergarten! Die Ausbildung zum Erzieher!
Ist es mit Dana ähnlich? Was ist, wenn ich sie nie finde? Beziehungsweise was geschieht, wenn ich sie gefunden habe? An dieser Stelle höre ich immer auf zu denken. Ich habe keine Vorstellung davon, was sich dann abspielen wird.
2. Förster-Garten
Die Mütter von Ayla und Aurelia schwatzen an der Garderobe, während die beiden vier- und fünfjährigen Mädchen sie an den Händen zerren, um endlich nach Hause zu gehen. Wie häufig dreht es sich bei den Müttern um das Thema, welche Nachmittagsaktivität sie gemeinsam für ihre Kinder planen. Mein Eindruck ist, dass zumindest Aurelia jeden Tierpark, Spielplatz, jedes Schwimm- oder Spaßbad, jede Kinderbelustigung mit Hüpfburg, sowie manchen Klettergarten in der weitläufigen Umgebung schon besucht hat. Wenn das Mädchen nach dem Wochenende in unsere Reh-Gruppe kommt, dann tönt sie spätestens beim Frühstück:
„Wisst ihr wo ich gestern wa-har?“
Sie wartet selbstverständlich keine Antwort ab, sondern erzählt lautstark von ihren Abenteuern. Wie etwa von ihrem Erlebnis auf dem Baumwipfelpfad:
„Mein Papa kann mich ganz hoch auf einen Baum heben! Bis gaaaanz oben in die Spitze.“
Ich muss nicht lange warten, bis Kevin, der Dreijährige, darauf reagiert:
„Mein Papa kann mich viel höööcher heben!“
Auch wenn ich weiß, dass Kevin wahrscheinlich das Wochenende wieder bei seinen Großeltern verbracht hat, weil seine Eltern im Schichtdienst arbeiten und am Sonntag ausschlafen wollen. Aber Aurelia lässt sich von Kevins Bemerkungen überhaupt nicht beeindrucken, sie fährt fort:
„Und dann bin ich über eine Brücke gegangen, die war am Ast festgemacht und hat geschaukelt. Und dann war der Ast abgebrochen.“
Immer passiert in Aurelias Geschichten irgendeine Katastrophe oder Fast-Katastrophe. Auf meine Nachfrage erläuterte mir ihre Mutter, der Nachmittag auf dem Baumwipfelpfad sei ein netter Ausflug im Juli gewesen, ohne besorgniserregende Vorkommnisse. In Aurelias Version aber ist der Ast abgebrochen:
„Und dann …“, mit den beiden Wörtern verschafft sie sich Gehör und erklärt weiter:
„Und dann bin ich auch auf der Brücke geschaukelt und dann bin ich ganz tief …“
sie verdeutlicht allen wie tief es war, in dem sie die über dem Kopf gestreckten Hände ganz schnell auf den Boden führt.
„… und dann bin ich ganz tief runtergefallen!“
Spätestens an solch einer Stelle blicken alle Kinder mit offenem Mund zu Aurelia. Außer Kevin, der kräht:
„Ich bin auch runtergefallen!“
Das ist wiederum das Stichwort für Marie und Darius, ebenfalls zwei Fünfjährige, die oft gleichzeitig den Mund aufmachen, meist gewinnt Marie das Reaktionszeit-Duell, in dem sie sagt:
„Wenn du von so weit oben runterfällst, bist du jetzt schon tot!“
Aber Darius vergisst seinen Gedanken nicht, er schiebt sofort hinterher:
„… oder du liegst im Krankenhaus und musst immer dableiben, weil du sooo schlimm krank bist!“
Aurelia will aber ihre Geschichte weitererzählen, sie stellt einfach fest:
„Ich bin doch nicht tot, du Pupser! Und dann hab ich …, hab ich nämlich ein riesengroßes Eis gekriegt!“
Und dadurch weiß ich, sie ist beim Ende ihrer Episode angelangt. Fast jede ihrer Stories enden damit, dass sie ein Eis bekommt. Bisher habe ich noch nicht herausgefunden, ob sie wirklich an jedem Wochenende ein dickes Eis isst, oder ob sie sich das ebenso nur dazu dichtet.
Letztlich fragte ich Aurelia, wie viele Kugeln Eis sie denn gegessen habe.
„Hundertmilliontausend“, lautete ihre Antwort.
Aha.
Heute höre ich die beiden Mütter von einem Bobbycar-Rennen im Nachbarort sprechen. Somit bin ich gespannt, was Aurelia am Montag zu berichten hat.
Tarik wird von seinem Vater in Empfang genommen. Herr Tanrikulu erscheint mit einem Ball unter dem Arm im Fußballdress und im Laufschritt zum Abholen seines Sohnes. Freitags nachmittags trainiert er die Bambinis des FC Bertoldsbrück. Tarik verlässt lässig dribbelnd den Förster-Garten. Bis zum Auto ist er einmal mit dem Mülleimer kollidiert, ein anderes Mal schafft er es geschickt den Ball um die kleine Gesa aus der Fuchs-Gruppe zu führen.
Phillip und Judith Berger, die Zwillinge des Bertoldsbrücker Pfarrers, werden heute von Opa Berger abgeholt. Opa Berger strahlt über das ganze Gesicht, als seine beiden Enkel schon von Weitem rufen:
„Opaaaa, wir übernachten heute bei dir!“
Auch von den beiden werde ich am Montag sicherlich erfahren, was sie bei Oma und Opa erlebt haben.
Victor fährt mit einem Trecker auf dem Förster-Garten-Gelände herum, murmelt dabei etwas von Baustelle, Bagger, Sand und Abladen. Es scheint den Vierjährigen nicht zu bekümmern, wann seine Mutter eintrifft. Wenn man ihn lässt, beschäftigt er sich einen kompletten Vormittag nur auf dem Trecker. Zum Singen oder Brettspielen ist er schwer zu bewegen.
Nora Nachtigall dagegen müssen wir zum Draußenspielen überreden. Sie kann sich stundenlang mit diversen Zahlen-, Buchstaben- oder Kombinationsspielen beschäftigen. Jedoch muss ich höllisch aufpassen, dass ich ihr nicht zu langweilige Aufgaben anbiete.
„Dominik, das ist doch pipieinfach! Darf ich bitte etwas anderes?“
Auf diese Art signalisiert sie mir, dass sie neuen Input benötigt. Ich charakterisiere sie als kleinen Feingeist. Sie sagt:
„‘Darf ich bitte‘ etwas anderes?“ nicht etwa „‘Ich will‘ was anderes!“
Allerdings muss ich der Vierjährigen Nora daraufhin die Spiele für Sechsjährige anbieten. Sie ist intellektuell weit entwickelt. Frau Nachtigall trifft heute ein bisschen später zum Abholen ein, das hat sie mir angekündigt. Somit lege ich das Puzzle mit einhundertfünfzig Teilen zu Nora auf den Tisch, als die ersten Kinder abgeholt werden. Nora wird das Puzzle beenden, bevor ihre Mutter auftaucht.
Unser Kindergarten schließt freitags um sechzehn Uhr. Anschließend haben unsere Leiterinnen, Julia und Ella, die KT angesetzt. Die Kurz-Teamsitzung soll unserem Team einen knappen Wochenrückblick geben und einen ebenso schnellen Ausblick auf die anstehenden Aktivitäten oder Aufgaben der kommenden Woche.
Bei der MT, der Mittwochs-Teamsitzung, planen und tagen wir etwas länger und ausführlicher.
Sabrina und ich leiten die Reh-Gruppe im Förster-Garten, Ella und Julia die Fuchs-Gruppe. Unsere Auszubildende sowie die derzeitige Praktikantin, arbeiten wechselweise in den beiden Gruppen mit.
Wir alle sitzen in unserem kleinen Besprechungsraum mit Aussicht auf den Wald hinter dem weitläufigen Außengelände. Heute übernimmt Ella die Leitung der Teamsitzung. Sie strahlt uns alle an. Sie erzählt ausführlich, wie gut die Woche gelaufen sei. Wenn sie die Sitzung leitet, dann ist der Förster-Garten-Alltag meistens ‚echt schön‘ abgelaufen oder die Kinder sind ‚superlieb‘ gewesen. Auch wenn wir alle wissen, dass etwa Victor mit seiner Treckerschaufel zum wiederholten Male Sand, Gras und Steine in die blaue Mülltonne gekippt hat, wir die Tonne säubern mussten und dafür unnötig viel Zeit benötigten.
Ich schaue auf die Uhr, hoffentlich können wir heute pünktlich Feierabend machen. Ellas Wochenrückblick ist ausführlich und langatmig, erfahrungsgemäß klingt er so, als gäbe es keine Probleme in unserer Einrichtung und alle würden sich prima verstehen. Nicht, dass ich überall Probleme sehe. Trotzdem finde ich, sollten wir die Sitzungszeit damit verbringen, effektiv zu überlegen, was wir ändern könnten, um etwa solche Mülltonnensäuberungsaktionen zu vermeiden. Es müsste festgelegt werden, wer bei-spielsweise für Victor zuständig ist und wer mit dieser Aufgabe verantwortlich betraut wird. Oder wir sollten uns in unserem Verhalten ihm gegenüber zumindest abstimmen. Bisher fühlen wir uns alle irgendwie für Victor zuständig, wenn die Kinder im Außenbereich spielen.
„Victor, du hörst jetzt bitte sofort auf, den Sand in die Tonne zu kippen!“, in dieser Art spricht Julia zu den Kindern.