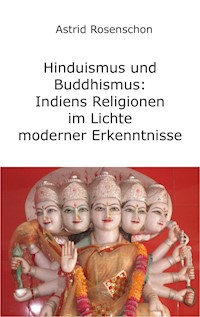
Hinduismus und Buddhismus: Indiens Religionen im Lichte moderner Erkenntnisse E-Book
Astrid Rosenschon
3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Von Indien werden viele Besucher in den Bann gezogen, weil es sehr fremdartig ist und weil die Religion so allgegenwärtig ist. Sie drückt allen anderen Lebensbereichen ihren Stempel auf. Indien gehört in vieler Hinsicht ins Guinness-Buch der Rekorde. In Indien ist die Wiege gleich zweier Weltreligionen (Hinduismus und Buddhismus). Die Offenheit des Hinduismus in Fragen des Glaubens und der Weltanschauungen ist bemerkenswert. Die tiefe Gläubigkeit hat Wunderwerke der Architektur entstehen lassen. Auch hat das Land brillante Wissenschaftler, Computerfachleute, Ärzte und Philosophen hervorgebracht. Die Mathematik etwa, die zum Berechnen der Opferplätze benötigt wurde und von der die ganze Welt profitiert, hat von Indien wesentliche Impulse erhalten. Gleichzeitig wirkt das immer noch weit verbreitete Kastensystem, das religiöse Wurzeln hat, als gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungsbremse par excellence. Der indische Wirtschaftswissenschaftler Deepak Lal schätzt, dass es in Indien 2000 Jahre lang - von 300 v. Chr. bis 1700 - zu keiner Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens gekommen ist. Auch zählt die Unterdrückung und Diskriminierung des weiblichen Geschlechts zu den religiös bedingten Schattenseiten des Subkontinents. Nach dem Aufzeigen der historischen Wurzeln der indischen Religions-philosophien stellt die Autorin zunächst die Grundelemente des Hinduismus dar. Dem hinduistischen System, das sich wie der Buddhismus aus dem Brahmanismus heraus entwickelt hat, wird dann die Kritik Buddhas an diesem gegenübergestellt. Im Hauptteil erörtert die Autorin durch die Brille moderner Erkenntnisse, wo die Stärken und Schwächen des Hinduismus liegen. Denn das heute vor allem hinduistisch geprägte Indien ist ein Land, das zunehmende internationale Aufmerksamkeit erfährt. Auch wenn Religionskritik ihre Grenze hat, weil sich das Absolute oder der Urgrund allen Seins einer wissenschaftlichen Betrachtung entziehen, gilt: Wo die Religion in die vom Menschen wissenschaftlich objektiv erfahrbare Wirklichkeit hineinspielt, dort sollte erlaubt sein, dass auch Nichttheologen mitreden. Die von Indien in den Bann gezogene Autorin, die zur Berufsspezies der Ökonomen gehört, nimmt in ihrer Abhandlung viele Anleihen aus der Indologie, der Theologie und aus den modernen Naturwissenschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
www.tredition.de
Für Claus-Friedrich und Stine
Astrid Rosenschon
Hinduismus und Buddhismus: Indiens Religionen im Lichte
www.tredition.de
© 2014 Dr. Astrid Rosenschon
Umschlaggestaltung, Illustration: arcfl,
Foto Frontseite: Vishnu-Statue in Rishikesh, © arcfl,
Foto Rückseite: die Autorin vor dem Hoysala-Tempel in Somnathpur, © arcfl
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-8095-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
1 – Problemstellung
2 – Die relative Bedeutung der indischen Religionen
3 – Historische Wurzeln der indischen Religionen
4 – Grundelemente des Hinduismus
4.1 – Definition
4.2 – Vom Götterhimmel, von “Gottmenschen“ und von weisen Männern im Hinduismus
4.3 – Karma, Seelenwanderung und Erlösung
4.4 – Wie der Hinduismus die Theodizee löst
4.5 – Opfer und Rituale
4.6 – Vielfalt von Heilszielen und Heilslehren
4.7 – Hinduismus – eine Mixtur aus Religionen
4.7.1 - Shivaismus und Vishnuismus als monotheistische Religionen
4.7.2 – Heilande, Erlöser und Bakthi
4.7.3 – Volksreligion und Polytheismus
4.7.4 – Die Welt als Illusion und das All-Eine hinter dem Schleier
4.8 – Askese und Yoga
4.9 – Die hinduistische Kosmologie und das Denken in Weltzeitaltern und ewigen abwärtsgerichteten Zyklen
4.10 – Wie die hinduistische Gesellschaft organisiert ist
4.10.1 - Die Kastenordnung der Hindus
4.10.2 – Der Hindu-Dharma oder Leben nach der göttlichen Ordnung
4.10.3 – Lebensstadien der Hindus
4.10.4 – Der Kult um den Sohn, die Rolle der Frau und der Familienclan
4.11 – Indische Religion und Wissenschaft
5 – Die Kritik Buddhas am Brahmanismus als Vorläufer des Hinduismus und ihre Schwächen
5.1 – Vorbemerkung
5.2 – Buddhas Leben
5.3 – Die Verhältnisse im Indien des 5. Jahrhunderts v.Chr.
5.4 – Der Buddhismus als mittlerer Weg
5.5 – Ablehnung des Kastensystems
5.6 – Die Vier Edlen Wahrheiten und der Achtfache Pfad
5.7 – Karma und Samsara
5.8 – Warum sich Buddha aus dem Rad der Wiedergeburten befreien möchte
5.9 – Die Lehre vom Nichtselbst, die fünf Skandhas und die „Ich-Illusion“
5.10 – Zur Rolle der Individualität
5.11 – Fazit zum „Ich-Problem“
5.12 – Die Vernetztheit aller Phänomene und das Prinzip der Leere
5.13 – Karma, Vernetztheit, Determinismus und Freiheit
5.14 – Menschlich erfahrbare Realität als empirisches Phänomen
5.15 – Die Erleuchtung und das Nirwana
5.16 – Meditation und Aufhebung der Subjekt-Objekt-Trennung
5.17 – Wie der Buddhismus die Zeit einstuft
5.18 – Besonderheiten des Mahayana-Buddhismus
5.19 – Die „Nur-Geist-Philosophie“
5.20 – Buddhistisches Weltbild und moderne Naturwissenschaft
5.21 – Warum in Indien der Buddhismus durch den Hinduismus verdrängt worden ist
6 – Der Jainismus
7 – Die Religion der Sikhs
8 – Hinduismus (im weiten Wortsinn) im Lichte der Moderne
8.1 – Vorbemerkung: Gott und Naturwissenschaften
8.2 – Indien: Paradefall für die Religionskritik berühmter Atheisten?
8.3 – Wunder und Zauber, Glaube und Wissenschaft
8.4 – Die Offenheit des Hinduismus
8.4.1 - Freiheit der Religionswahl und Toleranz
8.4.2 – Freiheit der Religionswahl und Wahrheit
8.5 – Vishnuismus und Brahman – moderne Gottesbilder
8.6 – Indische Heilsziele in der Kritik
8.7 – Religion und Kosmos
8.7.1 - Die Welt: ein Gaukelspiel unserer Sinne?
8.7.2 – Statt der „die-Welt-als-Illusions-These“: Naturkonstanten, die Leben ermöglichen
8.7.3 – Statt Negation der Welt - Ein anthropisches Prinzip?
8.7.4 – Die Realität – Universum, Mensch, Ich
8.7.5 – Die „Alles-ist-eins-Philosophie“ der Inder
8.7.6 – Wie Meditation zu beurteilen ist
8.7.7 – Gibt es empirische Anhaltspunkte für die zyklische Kosmologie der Hindus?
8.7.8 – Die Anfangssingularität und der Urknall
8.7.9 – Die Zukunft unseres Universums, das Ende des Menschen
8.7.10 – Leben wir gar in einem Multiversum?
8.7.11 – Wie die hinduistische Kosmologie das Verhältnis der Inder zu Geschichte und Zeit prägt
8.8 – Fortschritt oder Rückschritt in der Welt?
8.8.1 - Statt eines abwärts gerichteten Prozesses auf Erden säkularer Fortschritt – Adam Smith
8.8.2 – Evolution von Natur und Kosmos – Teilhard de Chardin
8.8.3 – Evolution durch Steuerung von oben (Zu-Fall) statt durch blinden Zufall?
8.8.4 – Trotz Fortschritts und Evolution: Die Realität – kein Heile-Welt-Szenario
8.9 – Die Rolle der Vorleben im hinduistischen Denken
8.9.1 - Indiens Lösung der Theodizee
8.9.2 – Kann die Seele wandern?
8.9.3 – Moral und Wiedergeburt – Die Denkweise der Jains
8.9.4 – Lässt sich der Bumerang-Effekt des Karmas empirisch nachweisen?
8.9.5 – Karma, nichts als Karma? Oder: Gesetz und Zufall?
8.9.6 – Fehlsteuerungen infolge der Karma-Kasten-Philosophie
8.10 – Hinduismus und Ethik
8.10.1 - Hindu-Denken - jenseits von Gut und Böse?
8.10.2 – Wo spielt im Hinduismus Ethik eine Rolle?
8.11 – Exkurs: Vom höheren Sinn
8.11.1 - Was könnte der Sinn des Leids, der Ungerechtigkeit und des Bösen auf Erden sein?
8.11.2 – Wie sich Gottes Wirken denken?
8.12 – Hinduismus – die gesellschaftliche Dimension
8.12.1 - Was war der entwicklungshistorische Sinn der Kastenordnung?
8.12.2 – Warum die Kastenordnung die Wohlfahrt mindert
8.12.3 – Kastendenken führt zur Vernachlässigung der Außenwelt und der gemeinsamen Belange
8.12.4 – Warum es die Kasten immer noch gibt
8.12.5 – Zur Zukunft der Kastenordnung
8.12.6 – Frauendiskriminierung, Armut und Kriminalität
8.12.7 – Die indische Großfamilie in der Kritik
8.13 – Das indische „sowohl-als-auch-Denken“ als Chance für die moderne Wissenschaft
9 – Abrundende Gedanken
LITERATUR
Danksagung
1 – Problemstellung
Nach Indien reist der Besucher aus der Fremde entweder zweimal, nämlich das erste und das letzte Mal, oder er kommt immer wieder dahin zurück. Für viele Menschen ist Indien ein Sehnsuchtsland, mit dem sie Faszination, zumindest aber eine Art Hassliebe verbindet. „Wer einmal nicht nur mit den Augen, sondern mit der Seele in Indien gewesen ist, dem bleibt es ein Heimwehland“ (Herrmann Hesse).
Indien ist voller Kontraste, schroffer Gegensätze, innerer Widersprüche und Zerrissenheit. So hat das Land brillante Wissenschaftler, Computerfachleute, Ärzte und Philosophen hervorgebracht. Es hat Pionierleistungen wie etwa die Erfindung der Mathematik erbracht, wovon die ganze Welt profitierte. Gleichzeitig kann ein hoher Anteil seiner Bevölkerung weder lesen noch schreiben, und die Korruption in Staat und Politik blüht. Allein im Unterhaus in New Delhi sollen 150 Abgeordnete mit krimineller Vorgeschichte sitzen (Hein 2012, (S. 73)).
Neben faszinierenden Weltkulturerbe-Stätten und prächtigen Palästen stößt man auf ärmliche Hütten, Slums und Müllhaufen, in denen sich die Schweine der Unberührbaren suhlen. Vor Zeugen des 3. Jahrtausends wie Software-Schmieden grasen heilige Kühe, die Plastiktüten recyceln und deren Output man per Hand formt und auf Hausdächern trocknet.
Ein wertvolles indisches Kulturerbe sind die Meditationstechniken, die auf innere Ruhe und Harmonisierung des Menschen abzielen. Gleichzeitig ist nirgendwo der allgemeine Lärmpegel so hoch und der Verkehr so hektisch und chaotisch wie in Indien. Indien ist schrill, buntscheckig und laut, aber auch märchenhaft schön und mystisch. Kein Land ist so aufregend und abwechslungsreich wie Indien. Trotzdem hört man überall die Zauberformel: no problem, relax.
In Indien sind zwei Weltreligionen oder Heilslehren erdacht worden – der Hinduismus und der Buddhismus. Um das irdische Heil und das materielle Los breiter Massen ist es aber – trotz des Wirtschaftsaufschwungs, den die Öffnung der Märkte durch den damaligen Finanzminister und späteren Premier Manhoman Singh im Jahr 1991 Indien seither beschert hat – schlecht bestellt: der Aufschwung, der derzeit wieder ins Stocken gerät (Hein 2012, (S. 73)), kommt bei den Armen, die unter dem Existenzminimum leben, kaum an und rund drei Viertel der Bevölkerung wird sozial geächtet. Es gibt nach wie vor Elend und krasse Armut breiter Massen – sei es nun in ländlichen Gegenden, sei es in den Slumvierteln indischer Molochstädte.
Dabei genoss Indien in früheren Zeiten den Ruf, sagenhaft reich zu sein. Indiens legendärer Reichtum ist bereits in der Bibel erwähnt und von chinesischen Geschichtsschreibern dokumentiert worden. Er hat auch Europäer wie Vasco di Gama angelockt, dessen Geschenke aus Europa am hinduistischen Königshof von Vijayanagar mitleidig belächelt worden sind. Christoph Kolumbus hat den Seeweg nach Indien, das in Europa als Märchenland gepriesen worden ist, über die Westroute gesucht.
Gleichwohl scheint dieser Reichtum auf die Herrschenden beschränkt gewesen zu sein. Der indische Wirtschaftswissenschaftler Deepak Lal schätzt, dass es in Indien 2000 Jahre lang – von 300 v. Chr. bis 1700 – zu keiner Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens gekommen ist. (Deepak Lal, nach Weede 2000, (S. 183)).
In kaum einem anderen Land der Erde greift die Religion derart in die Gestaltung der Lebensrealitäten ein wie in Indien – sei es nun im ökonomischen, rechtlichen, ethischen, sozialen, kulturellen, technischen oder wissenschaftlichen Sinn. Wie allgegenwärtig die Religion ist, wie stark sie alle Lebensbereiche durchdringt, sieht man schon daran, dass es in den Sprachen Indiens das Gegensatzpaar „religiös“ und „profan“ nicht gibt (Schweizer 2001, (S.20)).
Wer sich mit Indien befasst – egal aus welcher Betrachtungsperspektive heraus - kommt deshalb um eine Beschäftigung mit den in Indien entstandenen Religionen, vor allem dem Hinduismus, nicht umhin. Der bedeutende Soziologe Max Weber hat zu Beginn des letzten Jahrhunderts in seiner „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ auch vertieft den Hinduismus sowie Buddhismus analysiert. Wegen der Dominanz des Religiösen auch in den profanen Dingen des Lebens ist Indien dasjenige Land, in dem man die ökonomische Lebensrealität monokausal aus der Religionsphilosophie herleiten kann (Weede 2000, (S. 11)).
Es ist Ziel dieses Essays, die auf dem Boden Indiens und Nepals entstandenen Religionen in den Focus zu nehmen. Das sind neben dem Hinduismus und dem Buddhismus der dem Hinduismus ähnelnde Jainismus und der Sikhismus als Synthese aus Hinduismus und Islam. Diese Religionen sind aus moderner Sicht kritisch zu würdigen, wobei der Schwerpunkt beim Hinduismus gesetzt wird.
In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob es überhaupt legitim ist, Religionen kritisch zu hinterfragen und dabei ökonomische, moralische und naturwissenschaftliche Bewertungsmaßstäbe anzulegen. Sicher ist es so, dass es Grenzfragen gibt, bei denen die Theologie ein Monopol hat und andere Wissenschaften verstummen müssen. Das Absolute oder der Urgrund alles Seins entziehen sich einer naturwissenschaftlichen Betrachtung.
Aber wo die Religion in die vom Menschen objektiv erfahrbare Wirklichkeit hineinspielt, dort sollte es anderen Geistes- sowie den Naturwissenschaftlern erlaubt sein, kritisch mitzureden. Spätestens seit der Aufklärung gilt es als unwissenschaftlich, wenn sich Vertreter der Religionen hinter Autoritätsargumenten verschanzen, um Kritik abzuwettern. „Auch in der Theologie, wenn sie Wissenschaft und nicht steriler Dogmatismus sein will, ist prinzipiell das Wechselspiel von Entwurf, Kritik, Gegenkritik und Verbesserung möglich und oft geboten“ (Küng 2008, (S. 54)).
Kritik und eine Erneuerung der indischen Religionen sind die erforderliche Antwort auf den wirtschaftlich-technischen Fortschritt in der Welt, vor dem sich Indien nicht abschotten kann und sollte. Küng resümiert: „Die eigentliche Herausforderung für den Hinduismus… ist der europäische Modernisierungsprozess…, der nun auch Indien ganz und gar erfasst“ (Küng 2005, (S. 136)). Es geht darum, die Religion so anzupassen, dass ihre negativen Auswirkungen auf das reale Leben beseitigt werden und dass sie ihren ureigenen und unabdingbaren Beitrag für das Funktionieren des menschlichen Zusammenlebens wieder besser leisten kann. Religion sollte immaterielle und ethische Werte vermitteln und Antworten zu drängenden Gegenwartsproblemen bieten.
Unterbleibt diese Anpassung, wird Religion anachronistisch. Es besteht dann die Gefahr, dass viele Inder einseitig auf den Fortschrittszug springen, und die Güter und Werte verabsolutieren, die der Markt erzeugen kann: Das sind materielle Güter und Dienste, die das Leben erleichtern. Die immateriellen Werte aber, wie Dankbarkeit, Zufriedenheit, Optimismus, Sinnhaftigkeit und Lebensglück, die einen fundamentalen Beitrag zur Wohlfahrt leisten, bleiben auf der Strecke, wenn sich die Religion – die allein diese Güter anbieten kann – nicht an die Herausforderungen der Gegenwart anpasst und keine Botschaften mehr vermittelt, wenn sie also versagt.
In Indiens neuem Mittelstand zeichnen sich bereits Tendenzen in Richtung Religionsverlust ab, wie die Mitgiftmorde aus materieller Gier heraus zeigen. Man spricht bisweilen davon, dass Indien auf dem Weg in die Konsumgesellschaft ist und der neue Mittelstand plattem Materialismus anheimfällt. Daran ist aber nicht, wie dies meist immer unkritisch behauptet wird, die Marktwirtschaft schuld, sondern es ist Ausdruck von Religionsversagen oder Verlust an unsichtbaren Werten.
Indien sollte diesen Gefahren gegenhalten und einen Spagat wagen: Es sollte auf den Fortschrittszug springen und „Wohlstand für alle“ (Ludwig Erhard) anstreben. Und es sollte sich auf seine Tradition besinnen und nach „nichtmateriellen, spirituellen Werten und Maßstäben“ (Küng 2005, (S. 236)) streben – nach einem reformierten Hinduismus.
Indien hat großen materiellen Nachholbedarf, und es hat spirituellen Reichtum und große religiöse Tradition. Typisch für das indische Denken sind auch die „sowohl-als-auch-Kategorien“ statt der „entweder-oder-Kategorien“ des Westens. Deshalb erscheint Indien prädestiniert dafür, weltweit für Markt und Religion (und Staat als Regelsetzer für den Markt und als Anbieter von Sicherheit nach innen und außen) zu werben, statt darin Alternativen zu sehen. Ein marktfreundlicher Reform-Hinduismus, der Religion und Staat auf ihre eigentlichen Aufgaben verweist, wäre ein großer Hoffnungsträger für das Wohlergehen der Menschheit. Eine solche Philosophie würde auch das Christentum mit seiner verbreiteten Marktfeindlichkeit zum längst überfälligen Umdenken zwingen.
Die vorliegende Studie ist in mehrere Teile gegliedert: Zunächst wird nach der relativen Bedeutung der indischen Religionen in der heutigen Zeit gefragt. Ferner ist darzustellen, welche Kulturen im Lauf der Geschichte Einfluss auf die indischen Religionsphilosophien ausgeübt haben. Dem Aufzeigen der historischen Wurzeln folgt die Darstellung der Grundelemente des Hinduismus. Dem hinduistischen System, das sich wie der Buddhismus aus dem Brahmanismus heraus entwickelt hat, wird dann die Kritik Buddhas an diesem gegenübergestellt. Der religiöse Gegenentwurf wird dabei nicht nur dargestellt, sondern auch kritisch beleuchtet. Dem schließt sich eine moderne Würdigung des Hinduismus (im weiten Wortsinn), vor allem im Lichte von Ökonomie, Ethik und Naturwissenschaften an. Die von Indien in den Bann gezogene Autorin, die zur Berufsspezies der Ökonomen gehört, muss in ihrer Abhandlung viele Anleihen aus der Indologie, der Theologie und aus den modernen Naturwissenschaften nehmen.
2 – Die relative Bedeutung der indischen Religionen
Der Hinduismus ist nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte Religion der Erde. Der Hinduismus zählt rund 900 Millionen Anhänger, das sind etwa 13 Prozent der Weltbevölkerung (Wikipedia, Hinduismus) und 80,5 Prozent der Einwohner Indiens (Wikipedia, Indien). Heute ist der Hinduismus vor allem in Indien und Nepal verbreitet, aber auch in Sri Lanka, Bali, Malaysia, Singapur, Bangladesch und den arabischen Staaten am Persischen Golf. Selbst in Südafrika, Mauritius, Guyana, Fidschi, Suriname, Trinidad und Tobago leben Hindus.
Der Buddhismus ist im 5. Jh. v. Chr. vom Fürstensohn Siddhartha Gautama, der sich „Buddha“ („Erwachter“) nannte, in Nordindien und im heutigen Nepal gegründet worden. Der Buddhismus war ursprünglich eine sehr bedeutsame Religion in Indien, viele Könige, wie etwa der berühmte Herrscher der Maurya-Dynastie Ashoka, bekannten sich zum Buddhismus; ab dem 7. Jahrhundert n. Chr. ist der Buddhismus dann aber vom Hinduismus zurückgedrängt worden, im 12. Jahrhundert war er fast völlig ausgelöscht. Heute sind nur noch 0,8 Prozent der indischen Bevölkerung Buddhisten (Wikipedia, Indien). Sie leben vor allem in Maharastra, der Heimat des unberührbaren Politikers Ambedkar, der zum Buddhismus übergetreten ist, aber auch den Himalaya-Regionen, insbesondere in Ladakh, Sikkim und Darjeeling.
Dafür hat sich der Buddhismus als „Exportschlager“ erwiesen. Weltweit bekennen sich zu dieser Religion, die sich in verschiedene Schulen oder Strömungen unterteilt, je nach Quelle 230 bis 500 Millionen Menschen (Wikipedia, Buddhismus). Der Buddhismus ist in ganz Asien verbreitet, vor allem in China, Taiwan, Japan, Korea, Myanmar, Kambodscha, Laos, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Singapur, Malaysia, Nepal, Tibet, Bhutan und der Mongolei.
Der Jainismus war eine historisch bedeutsame Religion. Sie spaltete sich im 6. bis 5. Jh. v. Chr. aus dem Brahmanismus ab, dem historischen Vorläufer des Hinduismus. Mehrere indische Könige waren Anhänger des Jainismus. Im Jahr 2001/02 gehörten dem Jainismus aber nur noch 4,4 Millionen Gläubige an, davon in Indien 4,2 Millionen (Wikipedia, Jainismus) oder 0,4 Prozent der indischen Bevölkerung (Wikipedia, Indien). Die meisten von ihnen leben in Gujarat und Rajasthan. Trotz ihrer geringen Zahl sind die Jains wirtschaftlich sehr einflussreich. Sie sind vor allem in den Händlerkasten und unter den Intellektuellen stark vertreten.
Die monotheistische Religion der Sikhs ist von Guru Nanak im 15. Jahrhundert im Punjab in Nordindien begründet worden. Die Religion hat rund 23 Millionen Anhänger, wovon rund 80 Prozent in Indien leben, dort vor allem im Bundesstaat Punjab und in Neu Dehli. Der Bevölkerungsanteil der Sikhs in Indien liegt bei 2 Prozent. Sie sind weit überproportional in militärischen Berufen vertreten. Die Auslands-Sikhs konzentrieren sich auf Nordamerika, Großbritannien, Malaysia, Singapur und Thailand (Wikipedia, Sikh).
3 – Historische Wurzeln der indischen Religionen
Zwischen dem 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. wanderte ein Volk von Viehhaltern in mehreren Wellen in die Indusebene im heutigen Pakistan und ins nördliche Indien ein. Sie nannten sich „Arya“ (Arier oder „die Edlen“). Die Historiker vermuten, dass sie aus dem Gebiet zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer stammten, das zu Persien bzw. zum heutigen Iran zählt (Krack 2001 (S.15 ff)).
„Zweifelsfrei bewiesen werden die Wanderungen durch die vergleichende Sprachwissenschaft: Alle europäischen Sprachen, mit Ausnahme von Baskisch, Finnisch, Ungarisch und Estnisch, lassen sich auf eine Pro-Indo-Europäische Sprache – unter Fachleuten kurz PIE genannt – zurückführen, die auch die Basis für das indische Sanskrit war“ (Krack 2001 (S. 19)). Die Veden – die heiligen Schriften der Arya - waren in Sanskrit verfasst.
„Ursprünglich wurden die Veden nur mündlich überliefert, ihre Aufzeichnung war streng verboten. Das Verbot selbst war in den Veden verankert und das Mahabharata verdammte alle, die Veden niederschrieben, zur Hölle. Die Veden brachten angeblich nur spirituellen Verdienst, wenn sie aus dem Gedächtnis rezitiert wurden. Die Priesterklasse (sogenannte „Brahmanen“) sicherte sich so das Wissensmonopol auf die Veden“ (Krack 2001 (S. 23)).
Die „Edlen“ praktizierten das Ritual des Pferdeopfers und beteten zu ihren Naturgottheiten. Der Oberste in ihrem Götterhimmel war der Blitzeschleuderer Indra. Ihm und dem Feuergott Agni verdankten sie ihre Siege. In ihrem Olymp anzutreffen waren ferner der Sonnengott Surya, der Wassergott Varuna, die Göttin der Morgenröte Ushas, der Windgott Vayu und Yama, der Totengott (Krack 2001 (S. 15)). Man nimmt an, „dass die Arier, ehe sie nach Indien eindrangen, mit einer Hochkultur in Berührung waren, von der sie bestimmte Gottesvorstellungen übernahmen“ (Heinrich von Stietencron, zitiert nach Schlensog 2006, (S. 32)). Das kann die iranische, die babylonische oder auch die Induskultur gewesen sein, von der noch berichtet wird.
Die Aryas errichteten das Kastensystem in Indien, das heute immer noch bedeutsam ist. An der Spitze der Gesellschaftshierarchie waren die Priester (Brahmanen) angesiedelt, gefolgt von den Kriegern und Adeligen (Kshatryas). Weit unter diesen standen die Landbesitzer (Vaishyas), ganz unten die Masse der Menschen, die mit den Händen arbeitete (Landarbeiter, Handwerker). Sie wurden Shudras genannt. In den Veden ist das „Dharma“ überliefert, das ist das Leben gemäß der ständischen Ordnung. Jede Kaste hatte nach dem vermeintlichen Willen Gottes oder der Götter ihre fest umrissenen Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.
Da die Arier ein Volk waren, das über von Pferden gezogene Kampfwagen verfügte, waren sie einer am Indus angesiedelten städtischen Hochkultur militärisch überlegen, konnten diese beherrschen und dabei Teile ihrer Kultur assimilieren: Es handelt sich um die seit 3000 Jahren v. Chr. existierende Indus- oder Harrapakultur mit den bekannten städtischen Zentren Harrapa und Mohenjo Daro. Sie dehnte sich bis in die Gangesebene aus und umfasste ein Gebiet in der Größe von Ägypten und Mesopotamien zusammen (Schlensog 2006, (S. 25)). Die Harappa-Kultur zählt neben dem alten Ägypten, dem alten Mesopotamien und – tausend Jahre später - dem alten China zu den Wiegen der Menschheitsgeschichte. Die Induskultur pflegte rege Handelsbeziehungen mit den Ländern Mesopotamiens und war über den Oman mit Afrika vernetzt. (Kulke, Rothermund 2010, (S. 11.f.)).
Man weiß, dass die Induskultur neben Zeugnissen hochentwickelter Kunstfertigkeit und einer – noch nicht entzifferten - Schrift bereits über ein funktionstüchtiges Rohrleistungssystem verfügte. Es durchzog die städtischen Gebiete unterirdisch. (Kulke, Rothermund 2010, (S. 10), Siebert 2007, (S. 224)). Der perfekte Umgang mit Nutz-, Wasch- und Abwasser und der hohe Stand an Hygiene könnten (nicht nur) dem alten wie dem modernen Indien zum Vorbild gereichen. Die Induskultur „zeigte eine weit größere technische Perfektion und Uniformität als die Kultur Mesopotamiens…“(Kulke, Rothermund 2010, (S.11)).
„Die „Arya“ übernahmen möglicherweise von der Harrapa-Kultur den Kult um Gott Shiva. Er ist in der hinduistischen Religion neben Brahma und Vishnu einer der drei Hauptgötter. Man hat Münzen gefunden, auf denen eventuell Shiva abgebildet sein könnte. Das ist aber vielleicht nicht mehr als eine vage Annahme.
Die Archäologie rätselt, wodurch die Induskultur vor dreieinhalbtausend Jahren untergegangen ist. Als Ursachen kommen nach der herrschenden Lehre tektonische Verwerfungen oder vom Menschen verschuldete Umweltkatastrophen in Frage, etwa Beeinflussung des Klimas, Überweidung u. ä.“ (Kulke, Rothermund 2010, S. 41 f.)). Eine Zerstörung durch die „Arya“ wird für weniger wahrscheinlich gehalten, wenngleich manche Skelettfunde Zeichen der Gewaltanwendung aufweisen (Schlensog 2006, (S. 26.)). Es ist also vermutlich durchaus zu gewaltsamen Plünderungen seitens der Aryas gekommen.
Als die Arier weiter nach Indien vordrangen, übernahmen sie auch zahlreiche kulturelle Elemente der dunkelhäutigen Urbevölkerung, zu der möglicherweise auch Menschen aus der Harrapa-Kultur gehörten. Man nennt die Urbevölkerung Draviden (Krack 2001, (S. 20)). Sie sind bei der Invasion der Aryas in den Süden des indischen Subkontinents abgedrängt worden, wo sie heute meist leben, vor allem in Tamil Nadu und Kerala. Zu den geistigen Anleihen der Aryas von den Draviden „gehört vor allem der Mutter-Kult, die Verehrung einer allmächtigen Muttergottheit, die eine Art Fruchtbarkeitssymbol darstellt. Die Identitäten südindischer Götter begannen, mit denen der Eindringlinge zu verschmelzen“ (Krack 2001, (S. 20)).
Ferner hat die im 6. Jh. n. Chr. einsetzende Volksbewegung der Bhakti-Religiosität südindische Wurzeln. Bhakti bedeutet Liebe bzw. Hingabe an Gott und ist – neben dem intellektuellen Erfassen der Wahrheit – ein alternativer Weg im Hinduismus, um Erlösung zu erlangen. „Religionskritiker stimmen darin überein, dass Ansätze dieser Gottesmystik (allerdings, d. V.) bereits (schon, d. V.) in frühen Schriften, wie etwa der Bhagavadgita, zu erkennen sind, in der Krishna als Wagenlenker dem Arjuna verkündete: „Wer mich liebt, geht nicht zugrunde…““(Kulke, Rothermund 2010, (S. 181)).
„Auf ihrer langen Wanderung kolonisierten die Arier die Völker, die ihnen nicht gewachsen waren. Die Eroberer hatten nur abfällige Worte für die Unterjochten übrig. Sie bezeichneten sie als Dämonen, Gespenster, Affen, Schwarzhäute, Sklaven, als zwergenhaft und kurznasig, als Sprecher von derben Sprachen, als Priester- und Riten-los, als Indralos, sprich gottlos, und als Verehrer von verrückten Gottheiten….
…In Wirklichkeit waren es jedoch die Arier, die wie Barbaren auftraten und hochstehende Kulturen vernichteten. Im tiefen Süden Indiens, insbesondere im Bundesstaat Tamil Nadu, hat man ihnen dies bis heute nicht verziehen, und eine stark von dravidischem Stolz geprägte Bewegung sperrt sich gegen den übermächtigen kulturellen und linguistischen Einfluss des Nordens“ (Krack 2001, (S. 21))). Vermutlich sind unter den dunkelhäutigen Einwohnern Südindiens Nachfahren der hochstehenden Harrapa-Kultur.
Die religiösen Fundamente Indiens sind bis zum 5 Jh. v. Chr. vor allem durch das Denken der zugewanderten „Aryas“ geprägt worden, das sich teils mit dem der Urbevölkerung mischte. Man bezeichnet die geistige Strömung dieser Zeit, in deren Zentrum die Veden standen, als Brahmanismus. Es ist aber damals zur Krise der vedischen Religion gekommen, weil die „Dominanz der Brahmanen, die sich immer klerikaler gebärdeten und mit ihren komplizierten Ritualen den Vollzug des Opfers zur Expertenwissenschaft gemacht hatten“(Hierzenberger 2011, (S. 38)), auf Kritik gestoßen ist.
Kritik kam von großen Glaubenden, die neue Religionen begründeten: Nämlich zum einen von Mahavira, der aus Bihar stammte und der den Jainismus ins Leben rief. Von Bihar aus breitete sich der Jainismus über ganz Indien aus. Vom 5. bis zum 13. Jh. spielte der Jainismus eine relativ bedeutsame religiöse wie politische Rolle. Während er in Nordindien vom immer stärker werdenden Islam verdrängt worden ist, musste er in Südindien dem Einfluss des Vishnuismus und Shivaismus weichen. Das sind zwei bedeutsame monotheistische Strömungen innerhalb des Hinduismus (Hierzenberger 2011, (S. 149)).
Eine Generation nach Mahavira betrat zum anderen Buddha die weltgeschichtliche Bühne. Unter dem großen Herrscher des Maurya-Reiches Ashoka (268 bis 233 v. Chr.) erlebte der Buddhismus eine Hochblüte. Er war damals die bedeutsamste Religion.
Neben Jainismus und Buddhismus ging als dritte Entwicklungslinie der Hinduismus aus dem Brahmanismus hervor, da letzterer nicht auf breite Massen bzw. das einfache Volk zugeschnitten war.
Es gab auch Fremdherrschaften auf indischem Boden, die ihre Spuren in den indischen Religionsphilosophien hinterließen. Eine besondere Rolle spielten die Dynastien während der sogenannten „dark period“. Das ist die Zeitspanne zwischen dem Maurya-Reich (320 bis 180 v. Chr.) und der Gupta-Dynastie (320 bis 497 n. Chr.). Das Maurya-Reich wurde von König Chandragupta gegründet. Es ist vor allem mit dem Namen des zum Buddhismus übergetretenen Herrschers Ashoka verknüpft.
Während der „dark period“ haben in Nordindien erst die Nachfahren Alexanders des Großen regiert, dann die mit den Skythen verwandten Shakas, nur kurz die Indo-Parther und schließlich die Kushanas, die zur Volksgruppe der Yuezhis zählten. (Letztere sind ab 170 v. Chr. im Zuge der Völkerwanderung von den Xiongnu aus ihren Stammlanden im östlichen Zentralasien vertrieben worden) (Näheres bei Kulke und Rothermund 2010, (S. 91-108)).
Die „dark period“ wird im Urteil von Experten als „Wiege der klassischen Periode der indischen Kultur“ eingestuft (Kulke und Rothermund 2010, (S. 108)). Der Buddhismus, der von Buddha im fünften Jh. v. Chr. entwickelt worden ist, erlebte während der „dark period“ eine Blütezeit. Zu den großen buddhistischen Herrschern zählten der Indo-Grieche Menander und der kosmopolitische Kushana- Regent Kanishka, der durch die Einberufung eines buddhistischen Konzils nach Kaschmir Anstöße für die Entwicklung des Mahayana-Buddhismus – einer neuen Entwicklungslinie des Buddhismus - gegeben hat. (Kulke und Rothermund 2010, (S. 91-108); Schlensog 2006, (S. 165 f.)).
Aber auch der Hinduismus erlebte in dieser Epoche neue Impulse. „Zu beobachten ist der Niedergang der vedischen Götter und der Aufstieg von Gottheiten, die im Veda nur am Rande Erwähnung finden, besonders von Shiva und Vishnu, bzw. ihren Erscheinungsformen“ (Michaels 2006, (S. 57)). Insbesondere der Kushano-Herrscher Kadphises II scheint dem Kult um Gott Shiva gehuldigt zu haben, wie von ihm herausgegebene Münzen dokumentieren.
„In der „dark period“ entstanden nahezu alle klassischen Gesetzeswerke (Dharmashastra), allen voran das Gesetzbuch des Manu, das im 2. oder 3. Jh. n. Chr. verfasst worden sein dürfte. Nach einer Zeit der Verunsicherung im Gefolge des Zusammenbruchs der Maurya– und Shunga-Reiche folgte eine Zeit der Neubesinnung und in mancher Hinsicht sogar Rückbesinnung auf die Normen gesellschaftlichen Zusammenlebens“ (Kulke und Rothermund 2010, (S. 108)).
Ab dem 8. Jh. drang der Islam nach Indien vor. Im 12. Jh. stand bereits ganz Nordindien unter muslimischer Herrschaft. Die Dynastie der Mogule hatte zwischen dem 16. und 18. Jh. die Macht fast auf den gesamten Subkontinent ausgeweitet (Hierzenberger 2011, (S. 151)). Während der kosmopolitische Mogulherrscher Akbar der Große (1542 – 1605)) gegenüber dem Hinduismus tolerant war, und sich sogar zu einer Universalreligion bekannte (Küng und von Stietencron 1999, (S. 78)), versuchte der Despot Aurangzeb (1618 – 1707), den Hinduismus zurückzudrängen.
Der Hinduismus erwies sich allerdings als robust und befruchtete – wie auch umgekehrt – die islamische Kunst, Literatur und Religion. Auf diesem Nährboden der Kulturvermischung konnte der Sikhismus als Synthese aus Hinduismus und Islam gedeihen (Hierzenberger 2011, (S. 151)). Die Grundbausteine für diese religiöse Verschmelzung von Hinduismus und Islam legte der berühmte Mystiker Kabir (1440 – 1518), der vom Sufismus der Derwisch-Orden beeinflusst war. Es gibt Vermutungen, wonach die islamische Mystik vom indischen Denken inspiriert worden ist (Küng und von Stietencron, (S. 49)).
Die heutigen indischen Religionen haben sich also - abrundend betrachtet - aus vier Wurzeln heraus entwickelt, nämlich aus den Traditionen und Glaubensinhalten der Arier, jenen der Induskultur, (die wahrscheinlich ebenfalls dravidischen Ursprungs ist) und jenen der übrigen Dravidas, ergänzt um Fremdeinflüsse während der „dark period“ und der muslimischen Dynastien.
Die Grundlagen des Hinduismus sind nicht nur in den Veden, sondern auch in zahlreichen anderen Schriften niedergelegt. Zentrale Themen sind etwa die Ideen vom Geburtenkreislauf, den Einzelseelen und der Weltenseele in den Upanishaden, der klassische Konflikt zwischen Gut und Böse im Epos Mahabharata, die Erfüllung der religiösen Pflichten innerhalb einer als göttlich gewollt angesehenen Kastenordnung (Dharma), die Vorteile des Asketentums als selbstlose Hingabe an das Göttliche (Bhakti) und die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten (Moksha) in der Bhagavad Gita sowie die Tugenden der idealen Ehefrau im Ramayana. Die Jains haben eine heilige Schrift, das Kalpa-Sutra, die von 24 geistigen Führern (sogenannte Tirthankara) berichtet. Die Sikhs haben ein heiliges Buch, den Guru Granth. Es beginnt mit dem Glaubensbekenntnis an den höchsten Gott.
4 – Grundelemente des Hinduismus
4.1 – Definition
Der Hinduismus kennt verschiedene Spielarten oder Strömungen, die sich unterscheiden, aber auch gegenseitig beeinflussen und überlagern. Er ist also keine Religion aus einem Guss, was im Übrigen das Christentum und der Islam auch nicht sind, wie die verschiedenen Untergruppierungen zeigen. Man kann unter Hindus alle Gläubigen Indiens verstehen, die nicht Muslime, Buddhisten, Jainas, Shiks, Christen oder Juden sind. Die indische Verfassung bezieht aber Buddhismus, Jainismus und Sikhismus in den Hinduismus mit ein. „Die Mitglieder der Jain-Gemeinden, welche… mit bestimmten (Händler-)Kasten Konnubium (Ehegemeinschaften, d. V.) haben, werden von den Hindus gelegentlich… als „Hindu“ angesprochen“(Weber 1916-1920/1998, (S. 14)).
„‘Hinduismus’ (im engeren Sinn, d. V.) ist …ein Sammelbegriff für… Religionen, religiöse Gemeinschaften und sozio-religiöse Systeme, die… fünf Kriterien erfüllen: (a) sie sind auf dem südasiatischen Subkontinent entstanden oder verbreitet, (b) die soziale Organisation ist wesentlich durch besondere Abstammungs- und Heiratsvorschriften gekennzeichnet (das sogenannte Kastensystem), (c) es dominieren (ursprünglich) vedischbrahmanische Werte, Rituale und Mythen, (d) es wird eine Erscheinungsform von Shiva, Vishnu, Devi, Rama, Krishna oder Ganesha als Gott oder als göttliche Kraft verehrt oder zumindest nicht explizit abgelehnt, (e) es herrscht ein identifikatorischer Habitus vor…“(Michaels 2006, (S. 36)). Unter Letzterem ist der Glaube, dass alle Dinge grundsätzlich eins sind, zu verstehen.
Der Hinduismus im engeren Sinne hat sich, ebenso wie der Buddhismus und Jainismus, aus dem Brahmanismus heraus entwickelt. Darunter ist die Religion zu verstehen, die in Indien ca. 800 v. Chr. bis 500 v. Chr. dominierend gewesen ist. Der Hinduismus ist keine sogenannte “Buchreligion“ mit einer einzigen heiligen Schrift wie das Christentum, der Islam oder der Sikhismus. Im Hinduismus gibt es, wie schon erwähnt, eine ganze Fülle an Schriften. Auch hat er im Gegensatz zu den Buchreligionen und zum Buddhismus keinen Religionsgründer.
4.2 – Vom Götterhimmel, von “Gottmenschen“ und von weisen Männern im Hinduismus
Im Zuge der zuvor beschriebenen Kulturvermischung und der Assimilationsprozesse hat sich ein neuer hinduistischer Olymp herauskristallisiert (Näheres bei Buß 2009 und Schumann 2010), in dem es vor Göttern nur so wimmelt. Neben persönlichen Lieblingsgöttern, die der einzelne frei wählen kann, verehren die Hindus Familien- und Clangötter und regionale Gottheiten. Im Zentrum des hinduistischen Olymps steht aber die Götter-Trinität oder „Dreifaltigkeit“ oder “Trimurti“ Brahma (der Schöpfer), Vishnu (der Erhalter) und Shiva (der Zerstörer und Neuerer). Sie gehören so zusammen, wie die Sonne, die aufgeht (Brahma), ihren Höchststand erreicht (Vishnu) und untergeht (Shiva), ein und dieselbe Sonne ist.
Brahman spielt im praktizierten Hinduismus eine untergeordnete Rolle, weil seine Aufgabe auf die der Schöpfung beschränkt war, während Shiva und Vishnu auch im täglichen Leben bedeutsam sind. Es gibt die monotheistischen Sekten der Shivaisten und der Vishnuisten, deren Mitglieder leicht an ihren unterschiedlichen Stirnzeichnungen erkennbar sind. Sie verehren entweder Shiva oder Vishnu als Hauptgott oder Beherrscher des Universums.
Als abstrakte Prinzipien halten sich Vishnuismus und Shivaismus in der von allen Menschen gleicherhands beobachtbaren Realität letztlich die Waage: Die systemstabilisierenden Kräfte und die dynamischen Kräfte der „schöpferischen Zerstörung„ (Schumpeter) sind nämlich natürliche Komplementaritäten. Sie ergeben in ihrer Kombination wiederum ein natürliches Ganzes. Die philosophische Grundrichtung des im alten China entwickelten Taoismus hat analog dazu das natürliche Zusammenspiel von Yin und Yang als abstraktes Denkmodell zur Erklärung der vielfältigen und vielschichtigen Wirklichkeit und des laufenden Wandels entwickelt.
Die hinduistischen Hauptgötter haben Ehefrauen (Sarasvati, Lakshmi und Parvati), Reittiere (weiße Gans, Garuda, Nandi) und eine Fülle von Namen, wie etwa Narayan, Hari, Jagannath, Rudra, Bhairava, Nataraja und Pashupati. Dies erinnert an die hundert Namen Allahs, von denen die Gläubigen nur 99 kennen sollen. Den 100sten, so wird gesagt, wusste außer Mohammed allein das Kamel des Propheten. Deshalb sollen Kamele angeblich so arrogant dreinschauen…
Shivas sanfte Gattin Parvati wird in ihrer grausigen Form zu Kali, die besonders in Kolkatta verehrt wird. In ihrer wilden Form wird sie zu Durga, die auf einem Tiger reitet. Sohn von Shiva und Parvati ist der elefantenköpfige Gott Ganesha. Er genießt als Gott des Erfolgs und der Weisheit breite Wertschätzung, besonders in Mumbai. Sein Reittier ist die Ratte. Der Bruder von Ganesha ist Skanda, der Kriegsgott. Auch wird eine Urmutter oder die weibliche Energie (shakti) angebetet. Der sogenannte „Shakti-Kult“ ist ein Relikt aus den Glaubenssystemen der dravidischen Urbevölkerung aus dem Süden Indiens.
Der Hauptgott Vishnu hatte bisher 9 Erscheinungsformen (Inkarnationen). Er manifestierte sich als Fisch, Schildkröte, Eber, Mann-Löwe, Zwerg, Parashu-Rama oder „Rama mit der Axt“, Rama, Krishna und Buddha. Die 10. Inkarnation Vishnus als Kalki, der auf einem Pferd reiten soll, steht noch aus und wird von gläubigen Hindus am Ende des vierten (und letzten) Zyklus innerhalb unseres Weltzeitalters, das sich Kali-Yuga nennt, erwartet. In diesem Zeitalter wird die Welt angeblich zerstört, und es entsteht nach Hinduglauben eine neue Welt. Das Kali-Yuga soll 432 000 menschliche Jahre währen (Buß 2009 (S. 116)). Auch andere Religionen entwickelten übrigens Weltuntergangsszenarien. So sollte der Kalender der Mayas am 21. Dezember 2012 enden.
Das Kali-Yuga begann nach den hinduistischen Mythen am 18. Februar 3102 v. Chr. (Schweizer 2001 (S. 128)), als der in Mathura im nördlichen Indien geborene Gottmensch Krishna in Dwarka (im westlichen Bundesland Gujarat gelegen) starb (Schweizer 2001, (S. 128)). Der flötenspielende, jugendliche Gott Krishna ist – neben Ganesha - ein Lieblingsgott der Inder. Er ist Sinnesfreuden nicht abhold und er ist mit Radha verheiratet.





























