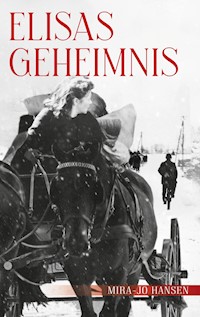Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Debütroman "Drei Leben" geht die Liebesgeschichte um Olivia und John weiter. Was verbirgt sich hinter dem Sturm? Gibt es eine neue Chance? Können sie die Dämonen der Vergangenheit besiegen und endlich gemeinsam glücklich werden? Begleite die zwei auf ihrem steinigen Weg zueinander und zu sich selbst. "Mit diesem Folgeband ist es der Autorin gelungen, den Leser abzuholen. Sofort ist man erneut gefangen in der Welt von Olivia und John: stürmisch, melancholisch, leidenschaftlich und voll Tiefsinn. Dies ist keine banale Liebesgeschichte, dies ist und bleibt etwas ganz Besonderes." Sandra Schmidt, Lektorin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für M.
Sehnsucht
Sehnsucht,
wie Säure frisst du dich
in meine Seele, meinen Körper.
Kann dich nicht verjagen,
nicht mit dir leben.
Bist da,
geliebt und gehasst zugleich.
Sehnsucht,
unsichtbar und unheilbar,
stiehlst mir das Jetzt, das Morgen,
machst den Boden schwammig,
auf dem ich gehe.
M.-J. Hansen
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel I
Olivia saß am späten Abend auf ihrem Balkon. Sie hielt eine Tasse, gefüllt mit Rotwein, in der Hand und starrte auf das, was auf dem kleinen Tisch vor ihr lag.
Beim Erklimmen des dritten Stockwerkes hatte sie wie immer die Post durchgesehen, die sie kurz zuvor aus dem Kasten geholt hatte. Es war ihr trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, die Schrift auf den Umschlägen zu entziffern, denn einige der Lampen im Treppenhaus hatten schon vor Wochen ihren Geist aufgegeben. Das spärliche Licht nervte. Der neu eingestellte Hauswart nahm es nicht so genau mit der Erfüllung seiner Pflichten. Dabei waren in diesem Fall nur ein paar Leuchtmittel zu ersetzen. Olivia hatte kurz inne gehalten und an bessere Zeiten gedacht. Der alte Hauswart genoss jetzt seine Rente und sie mussten sich mit dem unzureichenden Ersatz herumplagen. Auf der nächsten Eigentümerversammlung würde das wieder Thema sein, doch die Suche nach adäquatem Ersatz hatte sich schon vor Monaten schwieriger gestaltet als gedacht. Olivia hatte die Wohnungstür aufgeschlossen und dabei versucht, in Balance zu bleiben und diesmal nichts fallen zu lassen. „Ivonne, bist du da?“, hatte sie in den Flur hinein gerufen. Keine Antwort. Am Spiegel hatte eine Nachricht geklebt: „Komme heute spät, Arbeitsgruppe bis 22.00 Uhr. Iv.“
Ivonne hatte sich als Freundin ihrer Tochter und angenehme Mitbewohnerin so unentbehrlich gemacht, dass Olivia die Wohngemeinschaft der Mädchen nicht auseinanderreißen wollte. Sie hatte Ivonne ihr ehemaliges Schlafzimmer weiterhin überlassen und nutzte nun das kleine Gästezimmer, das nicht größer als eine Kammer war und für ein oder zwei Übernachtungen immer gereicht hatte. Dort gab es zwar nur Platz für ein Bett und eine kleine Kommode, doch das Wohnzimmer war groß genug und konnte ihren Kleiderschrank aufnehmen.
Ivonne kam oft spät und wirkte sehr gelöst in letzter Zeit. Soll sie, soll sie ihr Leben genießen. Das Glück kann so schnell vorbei sein. Olivia hatte geseufzt, die Taschen abgestellt und sich im hellen Flurlicht die Post noch einmal genauer angesehen.
„Oh, nein. Nicht schon wieder!“, war es ihr halblaut entfahren. Traurig hatte sie ihre Jacke ausgezogen.
Zögernd nahm sie den Brief in die Hand, der zum dritten Mal zurückgekommen war. Sie hatte ihn zuerst an Isabells alte Adresse in Exeter geschickt, dann an Pete, der, wie sie gehofft hatte, noch in Johns Haus lebte. Und nun zerbrach ihre letzte Hoffnung: Auch die Bank of Scotland, Johns Arbeitsplatz, hatte kein Erbarmen mit ihr. RETURN TO SENDER! Wieder kam der Brief zurück.
Olivia nahm einen großen Schluck aus der Nordseetasse, die sie eines Tages in einer der Kisten wiedergefunden hatte. Tja, die Kisten. Viele standen nach all der Zeit noch immer in der Wohnung herum. Etwas in ihr weigerte sich, sie auszupacken.
Langsam öffnete sie das Kuvert und zog den ursprünglich gesendeten Brief heraus, den, der die Zeilen an John enthielt. Die Zeilen, die sie lange Zeit nicht hatte schreiben können nach diesem schicksalhaften Tag. Doch dann konnte sie es eines Tages doch. Sie zog das Blatt aus dem Umschlag, klappte das Papier auseinander und las noch einmal, was sie vor Wochen verfasst hatte.
Berlin, im Juni 2008
Liebster John, bitte leg den Brief nicht gleich weg, lies weiter.
Ich möchte dir erklären, warum ich nicht zu dir fliegen konnte im März. Bitte lies alles, tue mir den Gefallen, um unserer schönen Zeiten willen.
Der Tag, an dem ich dir diese alles zerstörende SMS geschrieben habe, war der schlimmste meines Lebens. Emma hatte mich zum Flughafen bringen wollen. Nur wir beide, Mutter und Tochter, noch einmal zu zweit, das hatte sie sich gewünscht. Ich war so glücklich, sie hatte sich damit abgefunden, dass ich von nun an bei dir leben würde. Es machte sie nicht froh, doch war ihr bewusst geworden, dass ich nicht unerreichbar war, dass Kati und Ivonne, die Großeltern und am Ende auch ihr Vater für sie da sein würden. Alles schien in Ordnung, alles geregelt.
Und ich, ich konnte es kaum fassen. Nur noch ein paar Stunden trennten mich von dir. Mir machte nicht einmal mehr der bevorstehende Flug Angst, so sehr sehnte ich mich nach dir, nach unserer gemeinsamen Zukunft. Meine Tochter und ich saßen gemütlich im Café und unterhielten uns, als Emma plötzlich aufsprang und in Richtung Toilette eilte. Nach 20 Minuten ging ich ihr nach, denn die Zeit wurde knapp.
Ich fand meine kleine Emma ohnmächtig in einer der Kabinen auf dem Boden liegend. Die Panik, die mich ergriff, ist unvorstellbar, ich bekam diese Tür nicht auf und schrie wie von Sinnen laut um Hilfe. Eine Frau, die gerade den Raum betreten hatte, nickte nur kurz und rannte entschlossen wieder hinaus. Ich lag auf der Erde und hatte die ganze Zeit versucht, Emma zu wecken, hatte sie gestreichelt, unter der Tür hindurch, ohne Erfolg. Kurze Zeit später kam jemand mit dem Schlüssel und öffnete die Kabinentür. Jetzt robbte ich zu ihr und nahm ihren Kopf auf meinen Schoß. Emma atmete. Sehr schwach, doch sie atmete. Gott sei Dank, aber was war mit ihr los? Woher kam das Blut? Ich konnte den Gedanken nicht zu Ende bringen, denn die Eingangstür wurde kräftig aufgestoßen und ein Sanitäter steckte kurz darauf seinen Kopf in die Kabine. Er schob mich sacht beiseite und nun erreichten auch der Arzt und ein anderer Helfer den Unglücksort. Dann ging alles sehr schnell. Emma wurde auf eine Trage gehoben und ein Sanitäter hielt neben ihr einen Tropf in die Luft. Ich weiß nur noch, dass sie mir das Krankenhaus nannten und ich nicht verstand, warum ich nicht mit meiner Tochter fahren durfte. Die Passantin, die Hilfe geholt hatte, half nun auch mir. Sie kümmerte sich um mein Gepäck und setzte mich in ein Taxi, das mich zum Krankenhaus fahren würde. Ich habe mich nicht einmal richtig bei ihr bedankt.
Im Krankenhaus verwies man mich in den Warteraum, in dem ich umhertigerte wie eine eingesperrte Raubkatze. Die Angst hatte mich im Griff. Alle zwei Minuten nervte ich die Schwestern mit meinen Fragen, und endlich bekam ich Auskunft. Mir war, als hätte ich Stunden gewartet. Der Arzt sagte mir, dass es Emma den Umständen entsprechend ginge. Den Umständen entsprechend? Was sollte das heißen? Er erklärte mir, dass meine Tochter im fünften Monat schwanger wäre und sie sich nicht sicher seien, ob sie das Kind werden retten können. Sie hätten die Blutung gestoppt und hofften nun das Beste.
Ich starrte den Arzt ungläubig an. Wie bitte? Schwanger? Emma? Wie konnte mir das entgangen sein? War ich während der letzten Monate so sehr mit mir selbst beschäftigt gewesen? Mit uns? Warum hatte sie mir nichts davon gesagt?
Völlig durcheinander ließ ich mich von der Schwester zu Emmas Zimmer führen. Ich durfte es noch nicht betreten, so setzte ich mich auf einen der wackeligen Stühle, die sporadisch im Flur verteilt waren. Ich kämpfte mit der Übelkeit, die in mir aufgestiegen war, und dem Schwindel, der von mir verlangte, meinen Aufenthaltsort auf den Fußboden zu verlegen. Ich saß mit dem Rücken an der Wand, denn ich konnte nicht stehen ohne Halt, nicht sitzen ohne Halt. Irgendwann kramte ich mein Handy aus der Tasche und rief Erik an.
Dann legte ich das Handy vor mich hin und mein Verstand diktierte mir hämmernd, was ich als Nächstes zu tun hatte. Doch ich wollte es nicht wahrhaben. Nein! Nein! Ich schüttelte wie wild meinen Kopf. Alles in mir schrie. Eine Schwester eilte auf mich zu und versuchte, sich um mich zu kümmern. Ich hatte laut geschrien.
Ich winkte ab und nahm das Handy in die Hand. Kein Ausweg, mein Traum zerbrochen. Wie in Trance tippte ich die Nachricht an dich ein, und kurz nachdem ich auf SENDEN gedrückt hatte, übergab ich mich im Krankenhausflur. Irgendwann kam Erik um die Ecke und rief nach einer Schwester.
Lieber John, meine kleine Emma hat ihr Kind eine Woche später verloren. Die unendliche Trauer war für uns kaum zu verkraften.
Und sie? Sie hat es überhaupt nicht verkraftet. Wir konnten sie mühsam überreden, nach der körperlichen Genesung, eine stationäre Therapie anzufangen. Ich besuche sie dort, so oft ich darf, und halte den Kontakt mit ihrem Vater und mit Konrad.
Ich erwarte nicht von dir, dass du mir verzeihst, ich wollte nur, dass du weißt, warum ich nicht bei dir bin. Ich vermisse dich so sehr, doch mir ist klar, dass auch ich nun verloren habe.
Alles, was ich jetzt tun muss, ist, meiner Tochter zurück ins Leben zu helfen. Ich hatte mich so angestrengt, mit dir glücklich zu werden, doch es ist nicht so verlaufen, wie ich es wollte.
So werde du glücklich, denn ich liebe dich so sehr. Ich könnte es nicht ertragen, dass dein Leben mit meinem zusammen zerbricht.
Love Olivia
Olivia wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab und faltete den Brief zusammen.
Wohin sollte sie ihn nun noch schicken? Wer konnte ihr helfen? Hatte John den Brief zurückgehen lassen? Hätte er ihn nicht auch wegwerfen können?
Wo war John? Wie ging es ihm?
Sie trank aus der Tasse und holte ihr Amulett, das letzte Geschenk von John, aus der Tiefe ihres Ausschnittes. Es fühlte sich warm an und Olivia sah der zappelnden Kompassnadel so lange zu, bis sie endlich zur Ruhe kam.
„Wo bist du nur, John?“, flüsterte Olivia und küsste das Amulett, bevor sie es wieder dicht an ihrem Herzen verwahrte.
Sie hatte tausendmal versucht, ihn anzurufen, ohne Erfolg. Unter seiner ihr bekannten Nummer war er einfach nicht zu erreichen.
Olivia sah nur noch eine Möglichkeit: Mona. Wenn Mona Johns Glück wirklich so am Herzen lag, wie sie es immer betont hatte, dann würde sie den Brief weiterleiten. Vielleicht wusste sie, wo John war, was mit ihm passiert war.
Noch in dieser Nacht setzte sich Olivia an den Schreibtisch und schrieb den Brief an Mona.
Berlin, im August 2008
Liebe Mona,
ich wende mich mit einer großen Bitte an dich und ich appelliere an deine Gefühle für John und an dein Verständnis für meine Situation. Ich weiß, ich habe nicht Wort gehalten, doch ich hatte Gründe. Fürchterliche,
zerstörende Gründe.
Ich bitte dich also inständig: Wenn du weißt, wo John sich aufhält, sorge dafür, dass er meinen Brief bekommt und ihn liest. Ich bin ihm diese Erklärung schuldig. Mehr kann ich nicht sagen.
Ich möchte, dass auch du den Brief an John liest. Dann wirst du mich vielleicht verstehen. Wenn du es getan hast, klebe den Umschlag bitte zu. Ich werde dir dafür immer dankbar sein. Olivia
Es war nicht allzu schwer, Monas Anschrift herauszubekommen.
Olivias Herz schlug schwer und laut, als sie am nächsten Tag dem Brief an John eine neue Hülle gab und in den Umschlag steckte, der an Mona adressiert war. Dies war ihre letzte Chance, John zu finden. Sie klebte die Marken auf und ging zum Postkasten
Kapitel II
Emma saß auf dem Rasen vor den Sträuchern, die den Sportplatz umsäumten, und zupfte am Gras herum. Eine kleine, rote Katze schlich auf Samtpfoten an ihr vorbei und streifte mit erhobenem Schwanz ihr Bein. Emma griff nach ihr und streichelte sie. Schnurrend ließ sich das Kätzchen nieder und genoss die Zuwendung. Emma zog den kleinen Körper näher an sich heran, fühlte dessen Wärme und Weichheit und schloss die Augen.
Nun war sie schon einige Wochen in dieser Klinik. Anfangs hatte sie nicht verstanden, warum man sie wegschickte, weg von zu Hause, weg von ihrer Mutter, ihrem gewohnten Umfeld. Doch seit sie hier war, löste sich nach und nach der Nebel in ihrem Kopf auf und sie sah die Dinge ein wenig deutlicher, nach jeder Sitzung bei ihrer Psychotante, wie sie ihre Ärztin liebevoll nannte. Frau Dr. Scholl war selbst noch sehr jung, und Emma hatte bei ihr das Gefühl, verstanden zu werden. Lange konnte sie sich nicht öffnen, hatte oberflächlich geschwafelt, doch Frau Scholl hatte ihr die Zeit gegeben, die sie brauchte, hatte sie erreicht durch geschicktes Nachfragen, durch viel Verständnis.
Und sie bekam Denkaufgaben.
„Nachdenken, nicht Grübeln!“ Das gab sie Emma immer mit auf den Weg.
„Also gut, ich denke nach.“ Das Versprechen wollte Emma unbedingt einhalten, auch wenn es schmerzhaft war. Lange konnte sie das Unfassbare, was ihr passiert war, gar nicht aussprechen, nicht in Worte fassen. Dass sie bis hierher gelangt war, sich auseinandersetzt mit dem Tod ihres Kindes, war vor einigen Wochen noch undenkbar gewesen.
Die Katze löste den Kontakt und schlich davon. Emma schaute ihr ein wenig entrückt nach. Es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Die starken Medikamente, die sie nach dem Unglück bekommen hatte, wurden jetzt langsam abgesetzt. Das empfand sie einerseits als positiv, war sie doch nun wieder mehr bei sich, konnte sich wieder besser spüren, nahm die Welt nicht mehr wie durch Watte wahr. Andererseits lösten sich die Sperren auf, die den Schmerz zurückgehalten hatten, dem sie nun gegenübertreten musste, mit dem sie kämpfen musste. Und die Scholl schubste sie immer wieder in die Arena zurück, wenn Emma meinte, dem Gemetzel mal entkommen zu sein. So auch heute.
Emma hatte keine klaren Erinnerungen an den Tag, an dem es passiert war. Eben saß sie noch gemütlich mit ihrer Mutter im Café, es ging ihr ganz gut. Die Monate der Übelkeit waren gerade vorbei und sie hatte sich endlich damit angefreundet, dass ihre Mutter von nun an in England leben würde. Das war nicht ihre Idealvorstellung von Familienleben, doch am Ende wusste sie, dass sie geliebt wurde und immer die erste Geige spielen würde. Und zweisprachig aufzuwachsen, konnte einem Kind doch nicht schaden, dazu noch eine Oma in England …
Plötzlich bekam sie starke Bauchschmerzen und war kurz davor, sich zu übergeben. Auf der Toilette entleerte sie ihren Mageninhalt so heftig, dass ihr schwindlig wurde und alles um sie herum in schwarzem Dunst versank.
Das Nächste, an das sich Emma erinnern konnte, war der Aufwachraum im Krankenhaus. Schwestern, die beruhigend auf sie einredeten, und später ihre Eltern, die beide an ihrem Bett standen mit besorgten Gesichtern, streichelnden Worten und sanften Berührungen. Es stand eine Woche auf Messers Schneide, dann verlor sie. Sie verlor nicht nur ihr Kind, sie verlor auch den Verstand.
Man gab ihr Medikamente, die hüllten alles in eine rosarote Wolke. Sie fühlte sich stumpf, sie fühlte nichts mehr, sie war unfähig zu denken und unfähig, den Alltag zu bewältigen. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, kümmerte sich ihre Mutter in ihrem Zuhause um sie. Sie las ihr viel vor. Ein Buch nach dem anderen. Sie ging mit ihr spazieren, fuhr sie zu Therapiegesprächen und zum Arzt. Ab und zu tauchten in ihren Erinnerungen auch ihr Vater, die Großeltern und Kati auf. Konrad zu treffen, hatte sie abgelehnt. Sie konnte ihm nicht verzeihen. Immer hatte sie ihn vor Augen mit diesem anderen Mädchen. Ja, er hatte es ihr erklärt, sich tausendmal entschuldigt und um Verzeihung gewinselt. Doch es ging nicht, sie vertraute ihm nicht mehr.
Irgendwann hatte ihre Mutter ihr von diesen Therapieplätzen erzählt. „Die können dir da besser helfen, rund um die Uhr, das sind ausgebildete Kräfte. Du sollst doch wieder gesund werden“, so hatte Olivia stetig gesprochen und sich bemüht, nicht fordernd zu klingen. Irgendwann gab Emma nach. Mehr ihrer Mutter zum Gefallen, als aus Einsicht. Doch nun, nach all der Zeit und den Fortschritten, die sie machte, war sie dankbar. An den Wochenenden durfte sie Besuch empfangen. Ihre Mutter brachte ihr dann frische Kleidung und natürlich Süßigkeiten und Wackelpudding mit. Olivia schmuggelte auch stets ein Buch hinein, das war ihr kleines Geheimnis.
Emma ermahnte sich, Dr. Scholls Denkaufgabe zu verfolgen.
Ja, warum? Warum hatte sie keine richtige Beerdigung gewollt? Vielleicht, um nicht immer daran erinnert zu werden. Immer vor diesem Grabstein zu stehen und sich bewusst zu werden, dass da ein Menschlein liegt, das mal ihr Kind gewesen war. Noch nicht fertig zwar, doch es war da gewesen, in ihrem Bauch, hatte gestrampelt, getreten, sie hatte den Bauch gestreichelt, dem Kind etwas vorgesungen, mit ihm geredet.
Sie legte die Hände auf ihren Bauch und streichelte ihn und die Tränen durchnässten ihr Halstuch, als sie schluchzend zu sich selbst sagte: „Ja, es ist besser so. Ich werde mich auch ohne Friedhof an dich erinnern. Immer, wenn die Zeit es will. Ohne Pflicht und ohne Zwang, einfach so wirst du bei mir sein.“ Sie schickte ein Lächeln gen Himmel, stand auf und ging langsam auf ihr Zimmer, um sich für das Abendbrot fertig zu machen. Da war weit und breit kein Hunger, doch Rituale helfen.
Am Wochenende besuchte Olivia ihre Tochter wieder in der Klinik. Sie hatten genau diese Klinik ausgesucht, da sie weit draußen im Grünen lag und den Abstand zu allem Stress garantierte. Emma wartete schon auf sie.
Mutter und Tochter umarmten sich herzlich und Olivia packte als Erstes ihre Mitbringsel aus. Emma freute sich besonders über das Strickzeug, denn sie hatte als kleines Mädchen von ihrer Oma das Stricken gelernt, es dann aber aus den Augen verloren. Hier hatte sie Zeit. Die weiche Wolle quoll aus der Tüte und die angenehmen Farben gefielen Emma offensichtlich gut. Ihre Lieblingsfarben Orange und Olivgrün waren schließlich auch dabei.
„Du siehst so aus, als könntest du einen Spaziergang vertragen, du bist ganz schön blass!“, sagte Emma zu ihrer Mutter. „Du aber auch“, entgegnete Olivia und so gingen sie beide ein Stück den Waldweg entlang. Emma berichtete von ihrem Alltag und ihren Erfolgen. Olivia hatte den Eindruck, dass es ihrer Tochter viel besser ging.
„Wenn alles gutgeht, werde ich die Klinik in vier Wochen verlassen dürfen“, berichtete Emma froh. Olivia machte das glücklich.
Sie hatte einen Teilzeitjob im Theater angenommen, denn sie wollte erst wieder als Lehrerin arbeiten, wenn der Zustand ihrer Tochter wesentliche Verbesserungen zeigen würde. Und es war ungewiss, wie lange Emma noch brauchen würde, wann sie wieder am normalen Leben teilhaben konnte.
„Dr. Scholl hat mir wieder jede Menge Aufgaben verpasst“, erzählte Emma.
„Und wie kommst du damit voran?“
„Na ja, es geht so. Aber weißt du, eine kann ich gleich hier und jetzt bearbeiten.“
„Oh, gut, wenn ich dir helfen kann.“
„Ja, Mum, du hast dich bestimmt schon oft gefragt, warum ich euch nichts gesagt habe, von meiner Schwangerschaft meine ich.“
„Ja, das habe ich mich in der Tat oft gefragt.“
„Weißt du, am Anfang habe ich das gar nicht so gemerkt. Aber dann war es mir plötzlich klar und der Test positiv. Ich bin sofort zum Arzt und der hat es bestätigt. Irgendwie habe ich mich gefreut, obwohl es sich zu früh anfühlte, auch in einer unpassenden Lebenssituation halt.“
„Ach Schatz, um Kinder in diese Welt zu setzen, ist es irgendwie nie der richtige Zeitpunkt“, sagte Olivia und legte den Arm um Emmas Schulter.
„Das dachte ich dann auch. Ich wollte Konrad gleich am Abend mit der Nachricht überraschen, dass er Vater wird, und fand diesen beschissenen Zettel von der blöden Tussi. Dann hab ich ihm natürlich nichts mehr gesagt.“
„Und warum hast du es mir verschwiegen?“ „Mummy, ich habe gesehen, wie glücklich du warst, ich konnte nichts sagen, ich kenne dich doch. Dann hättest du deinen John verlassen, um für mich und das Kind zu sorgen. Das wollte ich dir nicht antun. Ich wäre schon irgendwie klargekommen.“ Emma sah schuldbewusst nach unten. „Tja, das ist dann wohl dumm gelaufen. Es tut mir so leid.“
„Aber Schatz, dein Glück ist mir doch tausendmal wichtiger!“, sagte Olivia. Das meinte sie auch so und doch krampfte sich ihr Magen zusammen.
Olivia drückte Emma fest an sich und Hand in Hand traten sie den Rückweg an.
Während sie schweigend nebeneinander her schlenderten, erinnerte sich Olivia an ihre eigene Mutter.
Olivia hatte sich als Kind nie Gedanken darüber gemacht, wie viel ihre Mutter auf sich genommen hatte: ihr Vollzeitjob, der große Garten, der zu bewirtschaften war, zusätzlich zu den harten Pflichten einer Hausfrau. Alles, um der Familie ein gutes Leben ermöglichen zu können. Sie hatte ihre persönlichen Bedürfnisse oft zurückgestellt. Olivia hatte es als Kind nie erkannt und gewürdigt. Vieles war selbstverständlich gewesen. Seitdem sie selbst eine Tochter hatte, wusste sie, zu welchen Opfern eine Mutter bereit ist. So ist das, Muttergefühle sind schwer zu erklären. Sie sind einfach da.
Und sie sind so übermächtig, dass eine Frau sogar bereit ist, ihr Lebensglück, ihr Liebesglück aufzugeben – für ihr Kind.
„Wie läuft es im Theater?“, wollte Emma wissen, als sich beide im Café über einen Eisbecher hermachten. „Oh, es macht mir Spaß, nach wie vor. Ich vertrete jetzt noch eine Kollegin, die länger ausfällt, bin Mädchen für alles, Garderobe, Kasse, Imbiss, Bar, die gute Seele der Proben und Seelsorger für die sensiblen Schauspieler und Musiker, auch für die weniger sensiblen, die sich nur mal auskotzen wollen. Es ist faszinierend mitzuerleben, wie so eine Aufführung sich entwickelt, die Akteure persönlich zu kennen, ist super. Vielleicht lassen sie mich ja mal eine Statistenrolle spielen. Dazu hätte ich große Lust.“
„Dann lädst du uns alle dazu ein und wir feiern dich als große Schauspielerin“, sagte Emma amüsiert. Sie war froh, ihre Mutter lächeln zu sehen. Doch das schlechte Gewissen, sie um ihre große Liebe betrogen zu haben, schleppte sie mit sich herum, es belastete sie sehr. Noch ein Thema, über das sie mit Dr. Scholl unbedingt reden musste.
Kapitel III
Dezember 2008
Kati hatte sie schon vor Wochen eingeladen. Die Silvesterparty sollte in den Räumlichkeiten des „Metallica-Fanclubs“ steigen. Ole, Jürgen und die anderen Mitglieder hatten alles organisiert. Damit nicht nur die üblichen Verdächtigen die Lokation bevölkern würden, waren Gäste und Freunde ausdrücklich erwünscht.
„Komm schon, jeder bringt was mit, du könntest deinen berühmten Kartoffelsalat machen. Komm doch, du brauchst mal wieder ein bisschen Spaß.“ Kati ließ nicht locker. Olivia hatte immer wieder abgeblockt. Ihr war nicht nach feiern. Gestern hatte Kati noch einmal angerufen und energisch in den Hörer gesprochen: „Olivia, du wirst an Silvester nicht allein zu Hause hocken, oder gar bei deinen Eltern die Silvestersendung im Fernsehen ansehen! Krieg den Hintern hoch! Es kommen fast 80 Leute, das wird toll!“
Olivia hatte keine Lust, sie versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen: „Aber ich kenne doch keinen und wenn Emma mich braucht?“
„Wenn du um neun nicht hier bist, komme ich dich persönlich holen!“, drohte Kati und ließ keine Widerworte mehr zu.
„Na gut, dir zuliebe.“
So schnitt Olivia also in ihrem schwarzen Outfit die Kartoffeln für den Salat, rührte das Dressing an und holte die anderen schon vorbereiteten Zutaten aus dem Kühlschrank. Während sie alles vermischte, fiel ihr der Sommerabend in Isabells Garten wieder ein. Da hatte sie diesen Salat zum letzten Mal zubereitet, für die kleine Grillparty am Vorabend ihrer Abreise zurück nach Deutschland.
Olivia seufzte. Ach John.
Bis heute hatte sie keine Reaktion auf ihren Brief an Mona bekommen. Aber er kam auch nicht zurück. Sollte sie das als gutes Zeichen werten? John ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. Kati redete nicht mehr von ihm. Sie vermied das Thema geflissentlich. Aus Rücksicht, wie Olivia annahm. Und doch, auch Kati fiel es manchmal schwer, Lebensfreude zu versprühen, wenn sie zusammensaßen und der Wein und ihre Musik sie in diese gewisse Stimmung brachten.
Die Wohnungstür fiel krachend ins Schloss. Olivia schreckte hoch. Emma war nach Hause gekommen und mit ihr Ivonne und vier andere Kommilitonen. Sie waren bepackt mit Tüten und übernahmen sofort laut und geschäftig die Küche und das Wohnzimmer.
Olivia hatte ihnen erlaubt, den Jahreswechsel hier in der Wohnung zu feiern. Sie war froh gewesen, dass Emma überhaupt Lust auf Gesellschaft hatte. Ein gutes Zeichen.
„Mhm! Kartoffelsalat nach Omi-Art!“ Emma schnupperte an der Schüssel, und kurz bevor sie ihren Zeigefinger im Salat versenken konnte, gab es einen Klaps auf die Hand. „Finger weg, du Dieb“, rief Olivia ihr lachend zu, „der ist nicht für euch.“ Einer der Jungs kam dazu, machte einen langen Hals und bemerkte beiläufig: „Das riecht ja lecker. Für die Party heute Abend? Ich wusste gar nicht, dass Heavy-Metal-Typen Kartoffelsalat essen, ich dachte, die reißen sich irgendwo auf der Wiese ein Schaf und dann rauf auf den Spieß.“ Er grinste unverschämt.
„Du hast eine ganz schön scharfe Zunge, mein Freund. Aber glaube mir, die meisten von denen wollen keiner Fliege was zuleide tun, geschweige denn einem Schaf.“
„Wann bist du morgen wieder hier?“, fragte Emma, drängte sich zwischen die beiden und kuschelte sich an ihre Mutter.
„Am besten du rufst mich an, wenn die Wohnung aufgeräumt und halbwegs zu betreten ist, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme, wenn ich zu früh auftauche.“
„Ist gut, Mum. Und vielen Dank noch mal.“ „Schon okay, mein Schatz, habt Spaß!“ Olivia zog sich an, warf noch einen letzten Blick in den Spiegel, nahm ihre Tasche, ihren Kartoffelsalat und verließ die Wohnung in Richtung S-Bahn.
Der Metallica-Fanclub hatte vor etlichen Jahren das Gebäude einer ehemaligen Kfz-Werkstatt günstig gemietet. Sie gehörte dem Vater eines der Gründungsmitglieder, der ihnen freie Hand ließ. Die zwei Räume waren zwar sehr groß, man hatte es trotzdem geschafft, alles gemütlich zurecht zu machen. Überall hingen Poster an den Wänden, das Licht war perfekt installiert und die Musikanlage ließ keine Wünsche offen.
Als Olivia die heiligen Hallen betrat, fühlte sie sich sofort zurückversetzt in ihre Jugendzeit, blieb erst einmal bewundernd am Eingang stehen und ließ ihren Blick schweifen. Einige Grüppchen hatten sich schon gefunden und frönten dem Biere. Kati kam freudig auf Olivia zu, drückte sie fest und nahm ihr die Schüssel aus der Hand. „Wie schön, du bist da“, freute sich ihre Freundin, die heute wieder daherkam wie der Tod auf Latschen. Sie konnte machen, was sie wollte, Schwarz stand ihr wirklich nicht. Im Gegensatz dazu sah Olivia in ihrer schwarzen Kleidung bombastisch aus. Kati stellte geschäftig den Salat auf das Buffet, das schon recht gefüllt war. Den mitgebrachten Sekt verstaute sie im Kühlschrank und weg war sie wieder. Olivia sah sich etwas scheu um und schlenderte dann zum Tresen, hinter dem sie Volker entdeckt hatte. Sie bekam sofort ein Bier in die Hand gedrückt. Gleichzeitig begrüßte er sie auf seine Art: „Na, sieht man sich auch mal wieder. Schwarze Klamotte, Bier in der Hand, Metal-Musik, fast wie damals in London, was?“
Olivia grinste ihn an. „Mensch, Volker, so viele Worte, sei mal sparsam damit, nicht, dass die Tagesration noch vor Mitternacht aufgebraucht ist.“
Volker musste lächeln und antwortete: „Wir hatten eine wirklich schöne Zeit in London mit Metallica im Ohr. Wenn ich allerdings an die Hotelbar denke, bekomme ich automatisch Kopfschmerzen.“
„Ich glaube nicht, dass die Barbesuche schuld an deinen Kopfschmerzen waren, wohl eher das Bier, das ihr euch literweise den ganzen Tag über gegönnt habt. Aber sei es drum. Schön, dass du auch da bist. So viele Leute kenne ich von denen da nicht. Eigentlich gar keinen.“ Olivia schaute in die Runde, aber sie sah nur fremde Männer und Frauen, eher mittleren Alters, die sich für den heutigen Abend besonders herausgeputzt hatten. Einigen war das gute alte Metallica-Shirt schon etwas zu eng geworden, doch sie trugen es voller Stolz, auch wenn sich der Schriftzug an gewissen Stellen etwas dehnte. Olivia schlürfte am Bier und wollte sich gerade bei Volker über die viel zu große Schaumkrone beschweren, als Katis Bruder aus der Küche kam, breit grinsend auf sie zusteuerte und sie ebenfalls begrüßte. „Da bin ich ja stolz auf meine Schwester, hat sie es geschafft, dich aus deinem Schneckenhaus zu holen. Ich freue mich, herzlich willkommen.“
Ole drückte Olivia fest an sich, etwas zu fest und etwas zu lange für ihren Geschmack. Sie wand sich aus seiner Umarmung und verschüttete dabei ein wenig Bier. „Du verlierst wirklich keine Zeit, Mann!“, meinte Volker das Geschehen kommentieren zu müssen. Olivia verdrehte die Augen und beugte sich nach vorn, um die Tropfen, die auf ihrer Bluse gelandet waren, abzuklopfen. Sie sah hoch und blickte in zwei starrende Augenpaare, die den Einblick in die Tiefen ihres Ausschnittes sichtlich genossen. „Der Abend fängt ja super an“, sagte Volker beiläufig und Ole verzog nur anerkennend das Gesicht.