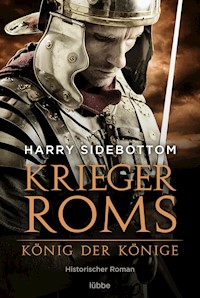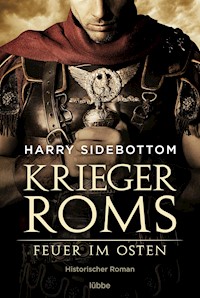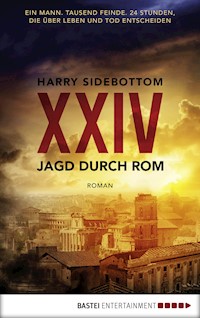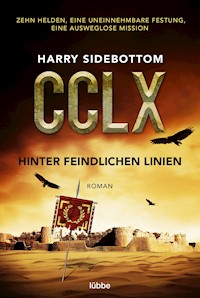
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zehn verwegene Männer, eine uneinnehmbare Festung, eine ausweglose Mission - niemand schreibt rasantere historische Romane als Harry Sidebottom!
Rom, im 3. Jahrhundert. Mit neun Soldaten aus den Reihen der frumentarii wird Marcus Aelius Valens, stellvertretender Tribun der kaiserlichen Leibgarde, ins Perserreich entsandt. Sie sollen einen jungen Prinzen aus der uneinnehmbaren Festung der Stille befreien und nach Rom bringen. Die Mission ist gefährlich - und streng geheim. Als Kaufleute getarnt begeben sich die zehn Unerschrockenen weit hinter die feindlichen Linien. Schon bald haben sie den Tod ihres Anführers zu beklagen, und Valens muss die Leitung des kleinen Trupps übernehmen. Weitere Männer sterben. Gibt es einen Verräter unter ihnen? Hat man sie bewusst auf ein Himmelfahrtskommando geschickt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Rom, im 3. Jahrhundert. Mit neun Soldaten aus den Reihen der frumentarii wird Marcus Aelius Valens, stellvertretender Tribun der kaiserlichen Leibgarde, ins Perserreich entsandt. Sie sollen einen jungen Prinzen aus der uneinnehmbaren Festung der Stille befreien und nach Rom bringen. Die Mission ist gefährlich – und streng geheim. Als Kaufleute getarnt begeben sich die zehn Unerschrockenen weit hinter die feindlichen Linien. Schon bald haben sie den Tod ihres Anführers zu beklagen, und Valens muss die Leitung des kleinen Trupps übernehmen. Weitere Männer sterben. Gibt es einen Verräter unter ihnen? Hat man sie bewusst auf ein Himmelfahrtskommando geschickt?
Über den Autor
Harry Sidebottom wuchs in den Rennställen von Newmarket auf, wo sein Vater als Trainer arbeitete. Dennoch entschied er sich für eine Laufbahn als Historiker – er promovierte in Alter Geschichte in Oxford und lehrte an verschiedenen Universitäten, unter anderem in Oxford. Nach einem gefeierten Sachbuch über antike Kriegsführung und zahlreichen Fachartikeln veröffentlichte er diverse Abenteuerromane aus dem antiken Rom. Jagd durch Rom – XXIV ist sein erster historischer Thriller.
HARRY SIDEBOTTOM
HINTERFEINDLICHENLINIEN
Zehn Helden,eine uneinnehmbare Festung,eine ausweglose Mission
ROMAN
Aus dem Englischenvon Rainer Schumacher
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Harry Sidebottom
Titel der englischen Originalausgabe: »The Lost Ten«
Originalverlag: Bonnier Zaffre
Originally published in the English language as THE LOST TEN by Bonnier Zaffre, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs, Scheeßel
Titelillustration: © shutterstock / gyn9037; © Butskykh Roman / shutterstock; © Eric Buermeyer / shutterstock; © Grigvovan / shutterstock; © Mohammed Kamaludheen / shutterstock
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-8809-1
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Michael Dunne16. Dezember 1958 – 17. August 2017
I
Die Festung der Stille
Niemand war je aus der Festung der Stille zurückgekehrt.
Der dunkle Turm mit seiner hohen Außenmauer stand auf einer schmalen Felsspitze hoch im Elburs-Gebirge. Die abgelegene Festung, die als Gefängnis diente, war uneinnehmbar. Von einem Gefangenen, der durch ihre Tore schritt, hörte man nie wieder. Allein ihren Namen zu erwähnen galt als Schwerverbrechen. Die Griechen nannten die Festung »Ort des Vergessens«.
Barbad der Eunuche betrachtete die fürchterliche Szenerie. Zuerst, im Vorgebirge, waren sie durch Birken- und Eichenwälder gereist. Hirsche hatten in den Tälern gegrast. Die Kolonne hatte sich die Straße mit Hirten geteilt, die ihre Herden in der Frühlingssonne auf die Hochweiden getrieben hatten. Doch jetzt waren sie in einer anderen Welt. Die einzigen Bäume hier waren verkümmerter Wacholder und die einzigen Lebewesen die Bussarde, die sich von den kalten Winden zwischen den zerklüfteten Gipfeln tragen ließen. In der Ferne waren die höchsten Gipfel schneebedeckt.
Barbad lehnte sich wieder zurück und ließ den Vorhang seiner Kutsche fallen. Die Kälte drang durch seine alte Haut und ließ die alten Knochen schmerzen. Er schaute zu Prinz Sassan. Der Junge saß aufrecht und war still. Seine dunklen Augen verrieten keinerlei Gefühl. Der Junge war erzogen zu reiten, zu schießen und die finstere Lüge der Gottlosigkeit zu hassen, doch nichts hatte das Kind auf das hier vorbereitet. Es war nicht seine Schuld, und auch sein Vater hatte sich nichts zuschulden kommen lassen. Prinz Papak war nicht gottlos gewesen. Barbad kannte die Wahrheit. Barbad war dort gewesen. Er hatte alles mit eigenen Augen gesehen …
Die Jagd hatte tief im Süden stattgefunden, unweit der Grenze des Großen Marschlandes am Persischen Golf. Der Hof hatte sich in Babylon einquartiert. Wenn Shapur, der König der Könige, auf die Jagd ging, dann bedurfte das der gleichen Vorbereitung wie bei einem Feldzug. Tausende begleiteten den Herrscher. Da waren Verwandte und Würdenträger, Höflinge, Priester, der königliche Harem, Schreiber und Künstler, fremde Gesandte, Soldaten sowie unzählige Diener und ein Heer von Jägern.
Das Jagdrevier war riesig und voller Wild. Es wimmelte nur so von Gänsen und Enten, und Wildschweine wühlten sich durchs Unterholz. Doch der Oberste Jäger des Königs hatte Shapur einen Löwen versprochen, den König der Tiere für den König der Könige. Und es sollte nicht nur irgendein Löwe sein, sondern ein riesiges, vernarbtes, listiges altes Männchen. Die ausgewählte Bestie hatte, so hieß es, bereits zwei Sklaven des Königs getötet.
Doch Barbad jagte nicht. Nicht, seit er vor all diesen Jahren beschnitten worden war. Sein Platz war bei den anderen Eunuchen und den Frauen. Als Oberster Schreiber von Prinz Papak, einem Bruder des Königs der Könige, hatte sich Barbad dem königlichen Harem angeschlossen. Sie lagerten auf einem niedrigen Hügel. Die Kuppe wurde von Bäumen beschattet, doch von hier oben hatte man einen hervorragenden Blick. Flankiert von seinen Brüdern und einigen seiner vielen Söhne hatte Shapur unter ihnen Position bezogen.
Ganz in Purpur und Gold gehüllt war der König der Könige wahrlich prachtvoll anzusehen. Während er mit den Fürsten gelacht und getrunken hatte, hatten seine mit Kajal umrandeten Augen und ungewöhnlich weißen Zähne gefunkelt. Kaum weniger elegant war auch sein Bruder dabei, Papak, und auch er war gut gelaunt gewesen. Ihre Kelch- und Fächerträger sowie jene Soldaten, die ihre Waffen trugen, warteten in stummer Demut.
Aus weiter Ferne war der Lärm der Treiber zu hören, die sich im Halbkreis durch das Unterholz arbeiteten und das Wild auf die königliche Jagdgesellschaft zutrieben.
Selbst im Schatten war es schon den ganzen Tag lang heiß gewesen. Es war windstill und die Luft drückend. Barbad hatte sich auf einen Klappstuhl gesetzt. In seinem Alter war es eine Qual, sich von einem Teppich auf dem Boden zu erheben. Um ihn herum tranken die Eunuchen und Konkubinen kühlen Wein aus großen Fässern, die in Schnee aus den fernen Bergen standen. Sie aßen Zuckerwerk und plauderten. In leuchtend bunte Seide gehüllt glichen sie einem Schwarm exotischer, doch domestizierter Vögel.
Barbad hatte Prinz Papak, seinen Herrn, eine Zeit lang beobachtet, dann war er eingedöst.
Ein furchtbarer Lärm weckte ihn wieder auf.
Das tiefe Brüllen eines Löwen ließ die Frauen und Eunuchen spitze Schreie ausstoßen. Die Wachen versuchten, den Harem zu beruhigen. Dabei hatte man am Fuß des Hügels ein Netz aufgespannt, das von Speerträgern gesichert wurde. Sie waren in Sicherheit.
Barbad ignorierte den Tumult um ihn herum und konzentrierte sich auf die Jäger. Shapur war mit dem Bogen in der Hand vor seine Verwandten getreten. Groß, hoch aufgerichtet und mit einem Pfeil auf der Sehne, war er der Inbegriff der Majestät. Allein und mutig stellte er sich dem Feind. Das war, was es hieß, ein König zu sein.
Prinz Papak stand ein paar Schritte hinter und rechts von ihm. Er trug einen schlanken Jagdspeer mit einer kleinen Querstange unter der Spitze. Auch ein paar weitere Verwandte des Königs hatten Speere dabei, die meisten jedoch Bögen. Aber niemand würde sich einmischen, es sei denn, es war absolut notwendig. Der erste Schuss war das alleinige Recht des Herrschers. Der König der Tiere war keine Beute für das gemeine Volk. Er war für den König der Könige reserviert, und Shapurs Geschick mit dem Bogen war geradezu legendär.
Die Jäger hatten all ihre Aufmerksamkeit auf das Unterholz gerichtet. Barbad folgte ihrem Blick. Fünfzig Schritte vor Shapur befand sich eine Wand aus Schilf, und auch wenn auf dem Hügel kein Wind zu spüren war, so bewegten sich die Halme leicht.
Barbad stand auf und beugte sich leicht nach vorn wie ein Vorstehhund.
Der Löwe brüllte erneut. Das Geräusch brachte die Luft zum Beben und vibrierte in Barbads Brust. Und dann teilte sich das Schilf.
Es war ein erwachsener Löwe, ein Männchen, gelbbraun, schlank und noch recht jung. Sein wilder Gestank drang bis zu den Menschen auf dem Hügel herauf. Ein Eunuch wimmerte.
Die Bestie schaute zum Schilf zurück. Die Treiber waren offenbar recht nah. Ihre Schreie und das Schlagen von Speeren auf Schilden ließ Vögel in die Luft flattern.
Der Löwe drehte sich zu denjenigen um, die ihm den Weg versperrten. Seine leeren Augen richteten sich auf den Mann, der ihm am nächsten stand. Allein.
Shapur spannte den Bogen halb.
Der Löwe sammelte sich und brüllte ein drittes Mal.
Der König der König zog die Sehne bis hinters Ohr und zielte.
Einen Augenblick lang herrschte vollkommene Stille. Der Lärm der Treiber und das Flügelschlagen der fliehenden Vögel schienen unglaublich weit weg zu sein.
Shapurs Arm zitterte leicht vor Anstrengung.
Der Löwe sprang vor. Er bewegte sich so schnell, dass man ihm kaum mit den Augen folgen konnte. Dann drang Shapurs Pfeil in seine Brust. Die Bestie taumelte, sprang aber erneut. Der zweite Pfeil traf sie am Hals. Dieses Mal brach der Löwe bei der Landung zusammen, doch es war ein wildes Tier. Blutiger Schaum quoll aus seiner Schnauze, und es kroch auf die Kreatur zu, die ihm solche Schmerzen zugefügt hatte.
Shapur gab den Bogen einem seiner Söhne, dann zog der König sein langes, gerades Schwert. Mit eleganten Schritten ging er auf den Löwen zu. Rasch floss der Lebenssaft aus der Bestie heraus. Ihr Maul war rot, und ihr trotziges Brüllen nur noch ein ersticktes Husten.
Shapur stieg auf den Rücken des Löwen und drehte sich zu seinem Gefolge um. Dann schwang er das Schwert und gab dem Tier geschickt den Gnadenstoß zwischen die Schulterblätter.
»Heil, Shapur, unserem Herrn, geliebt von Ahura-Mazda!« Die hohen Schreie des Harems gesellten sich zu den tiefen der Jäger.
Während sich Shapur im Applaus sonnte, bemerkte Barbad eine Bewegung im Schilf.
»König der Könige, Sohn der Götter, gerühmt für seinen Mut!«
Entgegen jeder Hofetikette lief Papak auf den König zu.
»Mögen die Götter …« Der Gesang verhallte.
Erneut teilte sich das Schilf.
Der Löwe, der nun kam, war alt, mit grauen Schultern und stark. Eine lange weiße Narbe zog sich über seine gesamte Flanke, von der Mähne bis zu den Hinterbeinen, und seine Augen waren die eines listigen Menschenfressers.
Shapur, der sich der Gefahr nicht bewusst war, drehte sich verärgert um, als Papak an ihm vorbeistürmte.
Ohne Vorwarnung sprang der Menschenfresser. Er beschleunigte so schnell, dass es seine massige Gestalt Lügen strafte. Mit dem dritten Sprung hatte die Bestie Papak erreicht. Der Prinz hatte keine Zeit mehr, in Kampfhaltung zu gehen, doch irgendwie gelang es ihm, mit dem Speer zuzustoßen. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Schaft, und Papak wurde zu Boden geworfen wie ein Kind.
Um sich tretend krachte der Löwe zu Boden und rutschte fast genau bis vor die Füße des Königs. Mit Zähnen und Klauen riss das Tier große Wunden in sein eigenes Fleisch, um den brennenden Schmerz tief in seinen Eingeweiden zu bekämpfen, den Stahl, der ihm das Leben raubte.
Das Gesicht des Königs war starr wie eine Maske, als er auf seinen Bruder hinabblickte, der verletzt im Dreck lag. Wortlos steckte Shapur sein Schwert weg und ging.
Die Jagd war vorbei.
Der Abend war mild. Eine sanfte Brise wehte durch die Tamarisken und Bäume. Die Sterne strahlten klar am Himmelsgewölbe. Doch im Pavillon von Prinz Papak war die Atmosphäre so angespannt wie vor einem Gewitter.
Barbad kümmerte sich um seinen Herrn, während dieser gebadet und seine Wunden versorgt wurden. Er hatte zwei tiefe Schnitte und viele blaue Flecken davongetragen, doch ernstlich verletzt war Papak nicht. Während der Prinz sein Abendmahl serviert bekam, wurde nur wenig geredet – und sogar noch weniger, als er allein zu Bett ging. Niemand, noch nicht einmal der junge Prinz Sassan, hatte über den Löwen gesprochen. Niemand stellte die Frage, die alle umtrieb. Würde der König der Könige Papak für seine Tapferkeit belohnen, oder würde er ihn für seine Anmaßung bestrafen? Wie alle anderen auch behielt Barbad seine Meinung für sich.
Doch es sollte nicht lange dauern, bis er die Antwort erhielt …
Aufgrund seines Alters schlief Barbad nur wenig, und das schlecht. Mitten in der Nacht hörte er die schweren Schritte der Soldaten, die das Zelt umstellten. Barbad trug noch immer seine Tunika. Nun schlang er sich eine Schärpe um die Hüfte, zog seine Sandalen und einen Mantel an und lief zum Schlafgemach seines Herrn.
Wie erwartet begegnete Prinz Papak seinem Schicksal ruhig und tapfer. Er rief seinen Sohn und die wichtigsten Mitglieder seines Haushalts zu sich. Im sanften Licht der Lampen sprach er zu ihnen, leise und ruhig. Es waren allerdings keine Worte der Beruhigung, sondern des Mutes und der Ergebenheit. Respektiert den Willen der Götter und verachtet die Lüge.
Als die Soldaten den Pavillon betraten, schlug Barbad das Herz bis zum Hals. Wo auch immer er hinschaute, er sah nur Stahl, Leder und bärtige, grausame Gesichter. Doch was nun geschah, geschah mit Respekt. Es kam weder zu Gewalt noch zu Beleidigungen. Sie legten Papak in silberne Ketten, wie es seinem Status entsprach.
Und dann las der Offizier das Dekret des Königs der Könige vor.
Selbst da bewahrte Prinz Papak die Fassung. Er schaute Barbad in die Augen und sagte leise zu seinem Eunuchen: »Tu deine Pflicht. Diene meinem Sohn bis zum Ende.«
Barbad verneigte sich.
Und in dieser Nacht begannen Prinz Sassan und Barbad ihre lange Reise in die ferne Provinz Hyrkanien und zur Festung der Stille …
Der letzte Aufstieg war steil. Ein paar Reiter saßen ab, um den Wagen mit ihren Schultern zu stützen. Als sie das Tor erreichten, legten sie Keile unter die Räder.
Barbad und Sassan wurde befohlen, auszusteigen.
Der Wind riss an Barbads Mantel. Überall um sie herum waren schwindelerregend hohe Klippen. Das einzige Geräusch waren die dünnen Schreie der Bussarde über ihnen.
Der Hauptmann ihrer Wache rief zu den Posten auf den Zinnen hinauf. Vor dem Hintergrund der gewaltigen Berge wirkte seine Stimme geradezu erbärmlich dünn, und der Wind trug seine Worte fort.
Einer der Posten ging, der andere befahl ihnen zu warten. Das Tor blieb geschlossen.
Bis auf die Knochen durchgefroren, verließ Barbad der Mut. Die griechischen Ärzte am Hof behaupteten, das Herz eines Mannes schrumpfe im Alter, bis es nicht mehr viel größer sei als das eines Kindes. Und Barbad war schon wirklich alt. Im Sommer würde er fünfundsiebzig sein – wenn er dann noch lebte, hieß das. Von einem Eunuchen erwartete man nicht das gleiche Maß an Tapferkeit wie von einem ganzen Mann.
Als er Barbads Zittern bemerkte, berührte der Junge ihn tröstend am Arm.
Barbad nahm all seine Kraft zusammen und erwiderte das Lächeln. Sassan war erst zehn. Ein tapferer Junge.
Barbad drehte den Kopf weg, damit der Junge die Tränen in seinen Augen nicht sehen konnte, und betrachtete die Festung. Die Außenmauern waren mit Steinen verkleidet. Sie waren perfekt eingepasst und glatt, sodass man sie nicht erklettern konnte. Auf der Reise hatte Barbad ein paarmal über Flucht sinniert, doch das war Fantasie. Die Wachen waren stets aufmerksam gewesen. Außerdem hatte man Sassan genau wie seinen Vater in silberne Ketten gelegt. Und wie hätten ein alter Eunuch und ein kleiner Junge auch von Flucht träumen können? Und selbst wenn ihnen das gelungen wäre, wo sollten sie hin? Zu den wilden Nomaden in die nördliche Steppe? Zu den Römern weit im Westen? Ohne Geld oder Freunde würden sie weder die einen noch die anderen erreichen.
Schließlich öffnete sich das Tor. Es war schwer und mit Eisen beschlagen.
Als Barbad und Sassan das dunkle Torhaus betraten, nahm der Junge Barbads Hand. Seine Haut war warm und glatt.
Licht fiel durch Löcher in der Decke und durchdrang die Dunkelheit. Das Klappern der Pferdehufe und das Knarren der Wagenräder folgten Barbad und Sassan und hallte von den Wänden wider. Am anderen Ende des Torhauses öffnete sich ein weiteres Tor, und dahinter traten sie auf einen Hof.
Die Festung war größer, als sie von außen aussah. Die Ringmauer beschrieb in etwa ein Oval und folgte den Unebenheiten der Felsspitze. Innerhalb der Mauer standen mehrere Gebäude: rechts Baracken und links Ställe und Lagerhäuser. Geradeaus vor ihnen lag eine weitere, kleinere Pforte, direkt dem Tor gegenüber und eingeklemmt zwischen den Baracken und dem inneren Turm. Letzterer war kreisrund und vier Stockwerke hoch. Auf Bodenhöhe gab es keine Tür, und die wenigen Fenster weiter oben waren schmal, mehr Schießscharten, in jedem Fall zu schmal für einen ausgewachsenen Mann. Steinstufen führten von rechts nach links zu einer Tür im ersten Stock, und auf der obersten Stufe wartete der Herr der Festung.
Naduk, der Zendanig, war ein riesiger Mann mit einem breiten roten Bart, der seine gesamte Brust bedeckte. Barbad hatte ihn schon früher bei Hofe gesehen. Wie es seiner finsteren Berufung entsprach, trug Naduk stets dunkle Kleidung. Kein Zendanig war je geliebt worden, doch Naduk strahlte eine derartige Bedrohlichkeit aus, dass die Menschen selbst im Gefolge des Königs der Könige vor ihm zurückschreckten.
Barbad und Sassan stiegen die Stufen hinauf. Der Junge ging vor, ruhig und aufrecht. Wieder drohte der Mut des jungen Prinzen Barbad den kläglichen Rest seiner Männlichkeit zu rauben, den das Messer übrig gelassen hatte.
»Willkommen, Prinz Sassan, Sohn von Prinz Papak aus dem Hause Sassans.«
Die Augen des Herrn über das Gefängnis waren kalt und schwarz wie Kiesel in einem Bach. Seine Worte waren höflich, doch da lag noch nicht einmal ein Hauch von Mitgefühl in seiner Stimme.
»Deine Unterkunft liegt oben.«
»Du bist sehr freundlich«, erwiderte Sassan.
Naduk drehte sich um und ging voraus. Die Wachen bildeten die Nachhut.
Als sie schließlich die Spitze des Turms erreichten, schmerzten Barbad die alten Beine, und er bekam kaum noch Luft.
»Essen und Trinken wird man dir bringen.« Naduk winkte sie durch die Tür. »Die Fesseln wird man dir abnehmen.«
Die Tür schloss sich hinter dem Jungen und dem Eunuchen. Sie hörten, wie der Schlüssel im Schloss gedreht wurde.
Es gab zwei Haupträume: eine Tageskammer und dahinter ein Schlafzimmer. In die Wand des Wohnzimmers war ein winziger Abort gebaut. Eine Tür gab es nicht. Die Räume waren jedoch gut möbliert. Es gab Teppiche auf dem Boden und an den Wänden, und in den Kohlebecken brannten Feuer. Tatsächlich konnte man die Einrichtung sogar als fürstlich bezeichnen.
Der Junge öffnete die Fensterläden. Dort, wo vor Kurzem Eisenstäbe eingesetzt worden waren, war frisches Mauerwerk zu sehen. Sassan schaute hinaus.
Der kalte Bergwind drang pfeifend in den Raum und ließ die Kohle in den Becken glühen.
Barbad packte ihre armseligen Habseligkeiten aus: ein paar Kleider, Sandalen, ein Gedichtband und Sassans Lieblingsspielzeug, einen Stofflöwen. Schminkutensilien sowie Medizin hatten sie ebenso wenig mitbringen dürfen wie Schreibmaterialien oder scharfe Gegenstände. Ihre Gürtel und Schleifen hatte man ihnen abgenommen. In den Räumen gab es kein Versteck, und nirgends waren Stoffbänder oder dergleichen zu sehen.
Entgegen der Etikette setzte sich Barbad auf eine Polsterbank und dachte nach.
Ihr Gefängniswärter war in der Tat sehr höflich gewesen. Er hatte Sassan mit Namen und Titel angesprochen und auch die seines Vaters erwähnt. Die Silberketten wurden von den Händen und Füßen des Prinzen entfernt. Vielleicht war ihre Zukunft ja doch nicht hoffnungslos. Vielleicht würde der König der Könige ja doch noch Gnade walten lassen.
Menschlichkeit und Mitgefühl waren die guten Schwestern der Tugenden. Für einen weisen Menschen, einen König der Könige, war es nicht ungewöhnlich, den Mantel eines Übeltäters auspeitschen zu lassen anstatt dessen Leib – zumindest, wenn die Tat nicht wirklich furchtbar war. Auch schnitten die Henkersknechte in so einem Fall nur die Quasten vom Kopfputz statt die Ohren vom Kopf.
Doch Shapur war nicht gerade für seine Milde bekannt. Bei der Belagerung von Arete hatte er die römischen Gefangenen mit kochendem Öl blenden lassen. Barbad hatte auch einmal gesehen, wie man einen Rebellen an einen Esel gebunden und so in seine Stadt zurückgeschickt hatte. Ohren, Hände und Füße des Mannes hatte man vorher abgeschnitten. Und bei Ktesiphon hatte man einen Verräter zehn Tage lang aufs Rad geflochten. Zum Schluss hatte man ihm die Augen ausgestochen und ihm geschmolzenes Messing in die Ohren gegossen. Und dann war da noch die noch langsamere und schrecklichere Hinrichtung im Trog. Vor vielen Jahren hatte Barbad so etwas einmal gesehen. Am liebsten würde er diesen Tag vergessen, doch das war unmöglich.
In jedem Fall würde Barbad nicht zulassen, dass den Jungen solch ein Schicksal ereilte. Die meisten Menschen hielten Eunuchen für verachtenswert und schwach, doch da irrten sie sich. Sicher, wenn man ein wildes Pferd kastrierte, dann biss und trat es nicht mehr, aber es eignete sich noch immer für die Schlacht. Das Gleiche galt für Bullen. Wurden sie kastriert, waren sie zwar nicht mehr so widerspenstig, aber sie behielten ihre Kraft. Auch kastrierte Hunde waren nicht mehr wirklich wild, dennoch dienten sie nach wie vor als Jagd- und Wachhunde.
Barbad würde seine Pflicht gegenüber Prinz Papak erfüllen. Er würde Papaks Sohn dienen – bis zum Tod.
Naduk war ausgesprochen gründlich gewesen, um dem Jungen keine Möglichkeit zum Selbstmord zu geben. Nur eines hatte er übersehen: die Kohlebecken. Wenn man glühende Kohlen schluckte, bedeutete das den Tod, und der Schmerz wäre auch nicht größer als der, den die Henkersknechte einem zufügen würden. Aber so weit war es noch lange nicht.
Barbad hatte ein Messer im Ärmel versteckt. Es war zwar nur so lang wie ein Finger und nur ein Drittel so breit, ein Nagelmesser, doch es würde seinen Zweck erfüllen.
II
Rom
Das Lager der Fremden war ein Ort der bösen Omen. Es lag auf dem Caelius und war das Hauptquartier der frumentarii, der Spione und Meuchelmörder des Kaisers. Politische Gefangene, die wichtig genug waren, um aus den Provinzen nach Rom gebracht zu werden, wurden hier gefangen gehalten und warteten auf ihre Hinrichtung oder Befragungen. Die Folterknechte hier waren qualvoll effektiv. Gewöhnliche Bürger mieden diesen Ort. Nur Denunzianten, die entweder von Gier oder Boshaftigkeit getrieben wurden, traten hier freiwillig über die Schwelle.
Murena liebte dieses Lager, seit er es vor Jahren zum ersten Mal erblickt hatte. Kaum hatte er es betreten, da hatte er seine Macht gefühlt. Hier wurden alle Geheimnisse des Imperiums gesammelt, alle verborgenen Pläne enthüllt. Von hier aus ritten unauffällig aussehende Männer selbst in die fernsten Winkel des Reiches. Dabei trugen sie Briefe bei sich, die Armeen in Marsch setzen oder ihre Generäle töten konnten. Manchmal waren diese Schriftstücke jedoch auch nur eine List, um den Männern Zugang zu ihren Zielen zu verschaffen. In so einem Fall war ihre Mission direkt und brutal.
Als er nun im ersten Licht des Morgens zwischen den Baracken hindurchging, blieb Murena an einer Apsis stehen, die den Schrein des Herkules beherbergte. Wie es seine Gewohnheit war, legte er die Hand auf die Brust und sprach ein kurzes Gebet an den Gott. Herkules war durch die ganze Welt gereist, hatte Tyrannen gestürzt und das Böse bekämpft – ein wahrlich passender Schutzpatron für die frumentarii.
Nachdem er seiner Frömmigkeit Genüge getan hatte, überquerte Murena den gepflasterten Hof in der Mitte des Lagers und stieg die Treppe zum Haus des Befehlshabers hinauf. Er erwiderte den Gruß der beiden Wachen, und einer von ihnen öffnete ihm die Tür.
Im Inneren blieb Murena erst einmal stehen und ließ seinen Blick durch den schlichten, unscheinbaren Raum schweifen. Da war ein Schreibtisch und darauf ein Stift und andere Schreibutensilien, zwei Lampen und ein Stapel Berichte. Hinter dem Schreibtisch stand ein Stuhl, und davor gab es zwei weitere für Besucher. Ein Rüstungsständer in der Ecke war das einzige weitere Möbelstück, während die Wände voller Löcher waren, vollgestopft mit Dokumenten.
Wie jeden Morgen betrachtete Murena voller Zufriedenheit die Szenerie. Vor vier Jahren war er als einfacher Kundschafter ins Lager gekommen. Abgestellt von der IV. Legion Scythica hatte er eine wichtige Depesche aus dem Osten gebracht. Die darin enthaltenen Neuigkeiten hatten große Freude ausgelöst. Die Generäle Odaenathus und Ballista hatten eine persische Invasion zurückgeschlagen, und ein sassanidischer Thronanwärter war getötet worden. Zur Belohnung hatte man Murena zu einem Centurio der frumentarii gemacht, und jetzt hatte man ihn auch noch zum Princeps Peregrinorum befördert, zum Führer der Fremden, dem Oberbefehlshaber der frumentarii. Wenn man sich den Geheimdienst des Kaisers als Spinnennetz vorstellte, das das gesamte Reich umspannte, dann saß Murena genau in der Mitte, zog die Fäden und fing jene, die sich heimlich gegen Rom oder seinen Herrscher verschworen. Selbst jene, die nur daran dachten, lockte er in den Untergang.
Murena kam gern schon früh am Morgen. Da er erst vor Kurzem zum Princeps ernannt worden war, hatte er noch viel zu lernen, und jeden Tag trafen neue Gerüchte über irgendwelche Verschwörungen ein. Sein Sekretär stapelte die Berichte auf seinem Schreibtisch. Jeder einzelne wurde sorgfältig gelesen, und manche bewegten die frumentarii dann auch zum Handeln. Murena hängte seinen Mantel an den Rüstungsständer – im Spätfrühling war es noch immer kalt – und setzte sich. Er war begierig darauf, neue Beweise zu finden und potenzielle Verschwörer zu entlarven.
Doch kaum saß er an seinem Schreibtisch und hatte den ersten Papyrus entrollt, da klopfte es an der Tür.
»Herein.«
»Ein Besucher für dich, Herr«, sagte die Wache.
Eine große Gestalt in einem Kapuzenmantel betrat den Raum, ohne darauf zu warten, hereingebeten zu werden.
Murena blieb sitzen. Er mochte vielleicht ein wenig in seiner Würde verletzt sein, aber Sorgen machte er sich nicht. Heimlichtuerei gehörte zum Handwerkszeug der frumentarii, und die Wachen ließen nur Leute herein, die auch das Recht dazu hatten.
Der große Mann zog seine Kapuze zurück, und ein rötliches, breites Gesicht kam zum Vorschein.
Murena sprang auf. »Bitte, verzeih, Herr. Ich habe dich nicht erwartet.«
»Du musst dich nicht entschuldigen.« Der wettergegerbte Mann lächelte. »Hast du warmen Wein? Lass drei Becher bringen. Da draußen ist es so kalt wie eine Hexentitte.«
Als Murena hinausging, um sich um die Getränke zu kümmern, schlug ihm das Herz bis zum Hals. Der Präfekt der Prätorianer hatte sicherlich einen guten Grund dafür, ihn unangekündigt und dann auch noch inkognito aufzusuchen.
Als Murena in den Raum zurückkehrte, hatte Volusianus den Mantel über den Rüstungsständer geworfen und saß hinter dem Schreibtisch. Der Präfekt winkte Murena, auf einem der Besucherstühle Platz zu nehmen.
»Ich habe ein diskretes Treffen arrangiert«, sagte Volusianus. »Der Offizier sollte gleich hier sein. Du wirst bleiben. Wie du weißt, ziehe ich in ein paar Tagen im Gefolge des Kaisers nach Norden. Kaiser Gallienus ist fest entschlossen, die Alpen zu überqueren und Postumus, den falschen Thronprätendenten, zu zerschmettern, der gegenwärtig noch Gallien hält. Für den Fall, dass mir etwas geschehen sollte, brauche ich einen vertrauenswürdigen Mann, der über dieses Arrangement Bescheid weiß.«
Murena quittierte das Kompliment mit einem Nicken.
Mehr sagte Volusianus nicht. Er saß nur da und wartete stumm.
Als Kommandeur der frumentarii berichtete Murena dem Präfekten der Prätorianer, und Volusianus wiederum war direkt dem Kaiser unterstellt. Nach seiner heiligen Majestät, dem Kaiser, war der Präfekt der Prätorianer der mächtigste Mann im Reich. Ein Präfekt wurde im Rahmen eines Rituals ernannt. Dabei nahm der Kaiser das Schwert des Präfekten. Wenn ich gut herrsche, dann nutze dies um meinetwillen. Herrsche ich schlecht, dann richte es gegen mich. Der Präfekt befehligte die Leibwache des Kaisers. Die Prätorianer – insgesamt zwölftausend Mann, die höchstbezahlten Soldaten des Reiches – bewachten den Palast in Rom und begleiteten den Kaiser auf allen seinen Reisen. Auch hatten die Präfekten der Prätorianer im Laufe der Jahre weitere Aufgaben übernommen. So sprachen sie zum Beispiel im Namen des Kaisers Recht.
Doch eine derartige Macht stellte auch eine Bedrohung für die Kaiser selbst dar. Deshalb hatte man weitere Truppen in und um die Hauptstadt stationiert, um ein Gegengewicht zu den Prätorianern zu schaffen: die Stadtkohorten in der Stadt selbst und die II. Legion Parthica in den Albaner Bergen. Die meisten Kaiser unterhielten überdies noch eine persönliche Leibgarde aus germanischen Kriegern, die man jenseits der Reichsgrenzen rekrutiert hatte. Um Untreue vorzubeugen, gab es zudem stets zwei Prätorianer-Präfekten. Volusianus’ Gegenstück befand sich im Augenblick allerdings in Mediolanum und sammelte die Truppen, die über die Alpen marschieren sollten. Außerdem entstammten die Präfekten nie dem Stand der Senatoren, um ihren Ehrgeiz einzudämmen, sondern aus den Reihen der Ritter, dem zweiten Stand. Es herrschte die Vorstellung vor, dass der Senat nur widerwillig einen Mann von niederem Stand als Kaiser akzeptieren würde, sollte solch ein Mann den Kaiser ermorden und selbst nach dem Thron streben.
Doch nichts von alledem funktionierte. Nur ein Kaiser war bisher von Barbaren erschlagen worden, doch gleich mehrere hatten den Tod durch die Schwerter der Prätorianer gefunden. Und zwei Prätorianer-Präfekten hatten nicht nur die Ermordung jener Männer befohlen, die zu schützen sie geschworen hatten, sondern auch den Purpur für sich selbst beansprucht. Und die Gefahr war geblieben. Wie hatte schon der Dichter Juvenal geschrieben: Quis custodiet ipsos custodes? Wer wacht über die Wächter?
Ein Klopfen an der Tür verkündete das Eintreffen des Weins. Murena stand auf, entließ den Soldaten und servierte die Getränke selbst.
Volusianus nahm einen tiefen Schluck und wärmte sich dann die Hände am Becher. »Als ich noch jung war und an Donau und Rhein gedient habe, da war mir nie kalt.«
Murena gab ein vages Geräusch von sich, das sowohl Mitgefühl ausdrücken als auch verneinen sollte, dass sein Vorgesetzter inzwischen alt geworden sei.
»Letzte Nacht hat es gefroren. Das ist nicht gut für das Frühlingsgemüse.«
Volusianus hatte nie einen Hehl aus seiner bäuerlichen Herkunft gemacht. Tatsächlich lenkte er häufig sogar die Aufmerksamkeit darauf. Manch einer behauptete, das sei pure Eitelkeit, dass er damit nur zeigen wolle, wie weit er gekommen war.
Volusianus war ein Favorit von Valerian gewesen, dem vorherigen Kaiser, und sein Aufstieg hätte nicht steiler sein können: durch die Ränge der Armee, dann in den Ritterstand erhoben und schließlich zum Präfekten der Prätorianer ernannt mit dem Status eines Senators. Auch die Gefangennahme Valerians durch die Perser hatte seinen Aufstieg nicht stoppen können. Kaiser Gallienus, Valerians Sohn, vertraute ihm angeblich voll und ganz. Aber ob dem nun wirklich so war oder nicht, in jedem Fall hatte Gallienus Volusianus als Präfekten bestätigt. Tatsächlich hatte er sogar gemeinsam mit dem ehemaligen Bauern das Amt des Konsuls bekleidet. Nun würde das Jahr 1013 seit Gründung der Stadt für alle Zeiten als das Jahr bekannt sein, da Gallienus und Volusianus Konsuln gewesen waren. Das war eine äußerst stolze Form der Unsterblichkeit.
Treue und gnadenlose Effizienz waren die öffentlichen Qualitäten, die den kometenhaften Aufstieg des Prätorianer-Präfekten auszeichneten. Natürlich gab es auch Gerüchte, doch wenn Murena in das harmlose Bauerngesicht blickte, dann fiel es ihm schwer, sie zu glauben. Und Gerüchte gab es ja schließlich immer. Aber wie dem auch sei – Murena verdankte sein Amt Volusianus.
Erneut klopfte es an der Tür.
»Gnaeus Claudius Severus«, verkündete die Wache.
Der Offizier salutierte, und die Tür schloss sich hinter ihm.
»Wir tun, was auch immer man uns befiehlt. Allzeit bereit«, sagte Severus.
Nach diesen formellen Worten eines Soldaten an seinen Vorgesetzten senkte sich erst einmal Schweigen über den Raum. Severus stand so steif da wie ein Physiognomiker, der versuchte, sein innerstes Wesen zu erkunden.
Murena kannte Severus, allerdings nur vage. Er hatte ihn einmal gesehen, doch das war schon Jahre her. Der stoppelige Bart, das kurze Haar, die grauen Augen und die leicht abstehenden Ohren, all das kam ihm vertraut vor, doch Murena wusste nicht mehr genau, wo er dem Mann begegnet war.
Die Stille zog sich in die Länge und wurde rasch bedrückend.
Murena bemühte sich, so ausdruckslos wie möglich dreinzuschauen. Was war hier los? Ging es um die Verhaftung eines Verräters, um die Beförderung eines verdienten Offiziers oder um etwas weit Finstereres? Es waren keine Wachen im Raum, und Severus war bewaffnet. Also war er mit großer Wahrscheinlichkeit kein Verräter.
Murena hatte einen furchtbaren Verdacht. War vielleicht er es, der verhaftet werden sollte? Würde man ihn gleich in den Kerker schleppen und schrecklich foltern? In der zwielichtigen Welt der frumentarii war niemand frei von Verdacht. Unschuld war keine Garantie für Sicherheit. Murena schob den Gedanken rasch wieder beiseite.
»Du bist Gnaeus Claudius Severus, Sohn des Publius, ein Ritter aus Samosata in Kappadokien.« Ohne auf eine Bestätigung zu warten, fuhr Volusianus fort. »Du hast die 1. Aquitanische Kohorte in Britannien befehligt, die 3. Afrikanische Reiterei in Germanien und die 2. Thrakische Kohorte in Syrien.«
Da hatte Murena Severus gesehen, zu Beginn von Valerians schicksalhaftem Feldzug, irgendwo nördlich von Carrhae. Murena hatte Severus und seinen Thrakern einen Bericht überbracht. Jetzt erinnerte er sich wieder. Severus war ein zäher, erfahrener Offizier.
»Seitdem hast du als Prokurator der kaiserlichen Besitzungen in den Provinzen Arabien und Makedonien gedient.« Volusianus hatte sich keine Notizen dazu gemacht, sondern sich das alles gemerkt.
»Ja, Herr.«
»Und bist du bereit, unter die Adler zurückzukehren?«
»Bereit, Herr.«
Mit einer Leidenschaft, die sein Alter Lügen strafte, sprang Volusianus auf. Lächelnd streckte er die Hand aus. Severus schüttelte sie.
»Setz dich, Severus.«
Die Anspannung im Raum war verflogen.
Volusianus schenkte dem Offizier einen Becher Wein ein, setzte sich wieder und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Dabei strahlte er die Freundlichkeit eines Bauern auf einem Erntefest aus.
»Gesundheit und große Freude.«
Sie prosteten einander zu.
»Severus, du bist ja im Osten aufgewachsen. Gehe ich da recht in der Annahme …«, Volusianus betonte den Namen, als seien sie die besten Freunde, »… dass du Griechisch sprichst sowie Syrisch und Persisch?« Volusianus strahlte wie die Sonne.
»Ja, das tue ich, Herr.«
»Dann bist du genau der Mann, den ich suche.« Volusianus’ Leutseligkeit war genauso schnell verschwunden, wie sie gekommen war. »Sag mir – was weißt du über die Festung der Stille?«
In dem Versuch, sich zu erinnern, kniff Severus die Augen zusammen. »Das ist eine persische Festung irgendwo in den Bergen südöstlich des Kaspischen Meeres. Die Perser nutzen sie als Gefängnis.«
»In der Tat«, sagte Volusianus.
Murena wollte hinzufügen, dass es in Persien schon als Kapitalverbrechen galt, den Namen der Festung auch nur zu erwähnen, doch er hielt sich zurück. Ein frumentarius musste wissen, wann er den Mund zu halten hatte.
»Prinz Sassan, ein Neffe des Königs der Könige, ist in die Festung gebracht worden.« Volusianus musterte Severus aufmerksam. »Und jetzt wirst du ihn dort rausholen.«
Man musste Severus zugutehalten, dass er diesen Befehl mit der gleichen Ruhe entgegennahm wie ein Stoiker die Aufforderung zum Selbstmord. Und genau das war dieser Befehl: Selbstmord.
»Was für Truppen stehen mir dafür zur Verfügung, Herr?«, fragte er nach kurzem Schweigen.
»Zehn Mann. Der Kommandeur der frumentarii«, Volusianus deutete auf Murena, »wird dir einen Trupp von acht seiner besten Männer geben sowie einen Offizier im Rang eines Ritters.«
Severus schaute zu Murena.
»Ihr werdet euch als Kaufleute aus Antiochia tarnen«, fuhr Volusianus fort. »Murena wird euch Reit- und Lasttiere besorgen sowie entsprechende Waren. Fragen?«
Konzentriert legte Severus die Stirn in Falten. »Wenn wir den Prinzen befreit haben, wie sollen wir dann wieder ins Reich zurückkehren? Nach der Rettung wird man uns verfolgen. Dann sind wir enttarnt und werden nicht mehr als Kaufleute über die syrische Grenze können.«
»Ihr werdet auch nicht nach Syrien zurückkehren«, antwortete Volusianus. »Murena, hol mal eine ordentliche Karte.«
Während Murena eine Karte suchte, sinnierte er über Severus’ Selbstvertrauen. Wenn, nicht falls, er den Prinzen befreit hatte, hatte er gesagt. Dabei bezweifelte Murena, dass sie auch nur in die Nähe der Festung der Stille gelangen würden.
Als die Karte ausgebreitet auf dem Schreibtisch lag, schauten sich die drei Männer die darauf verzeichneten Städte, Straßen und die beeindruckend gemalten Berge, Flüsse und Meere an.
Volusianus deutete auf die leere Steppe, und sein Finger bewegte sich vom Nordosten des Schwarzen zum Osten des Kaspischen Meeres. »Dieses ganze Gebiet hier wird von Naulobatus, dem König der Heruler beherrscht. Seit Ballistas Mission vor zwei Jahren ist der König als Freund und Verbündeter des römischen Volkes anerkannt. Wir werden Naulobatus über euer Kommen informieren.«
»Herr …« Severus räusperte sich. »Wäre es nicht besser, einen Mann zu schicken, den Naulobatus kennt?«
»Für Ballista habe ich andere Pläne.« Volusianus winkte ab. »Sobald ihr den Prinzen habt, werdet ihr nach Norden reiten, um das Kaspische Meer herum, bis ihr zu den Herulern kommt.«
Da sein Schicksal nun besiegelt war, nickte Severus nur und wandte sich praktischeren Fragen zu. »Wo werde ich mich mit den frumentarii treffen?«
Volusianus deutete wieder auf die Karte. »In Zeugma am Euphrat. Dort werdet ihr dann auch die Grenze zwischen Syrien und Mesopotamien überschreiten.«
Murena dachte an die kleine Stadt an dem breiten braunen Fluss. Er war dort geboren worden, als Sohn eines Legionärs der IV. Legion Scythica. Als kleiner Junge hatte er gesehen, wie sich das Heer von Kaiser Severus Alexander nach der Niederlage gegen die Perser wieder über den Fluss geschleppt hatte. Als Mann hatte er sich dann bei derselben Legion eingeschrieben wie sein Vater und in den öden Wüsten Mesopotamiens gekämpft. Zwar wurden die Städte dort inzwischen von den Römern gehalten, doch alle waren sie irgendwann einmal erobert und geplündert worden. Als dieses Schicksal auch Zeugma ereilt hatte, war Murena nur knapp mit dem Leben davongekommen. Nachdem Kaiser Valerian bei Carrhae in persische Gefangenschaft geraten war, hatten die Götter Severus gerettet. Die öde Landschaft Mesopotamiens war ein Niemandsland, in dem Perser und umherziehende Araberstämme immer wieder auf Beutezug gingen. Severus und sein Rettungstrupp würden von Glück sagen können, wenn sie überhaupt so weit kommen würden, ganz zu schweigen von der Festung der Stille.
Das Gespräch zwischen dem Präfekten und Severus hatte sich inzwischen der Frage zugewandt, welche Waren die vorgeblichen Kaufleute mitführen sollten. Während die beiden miteinander redeten, dachte Murena über die entscheidende Frage nach, die noch gar nicht gestellt worden war. Warum wollte Volusianus Prinz Sassan retten?
Es war weithin bekannt, dass der Präfekt der Prätorianer Kaiser Gallienus schon lange bedrängte, eine Expedition zur Befreiung seines Vaters Valerian aus persischer Gefangenschaft auszurüsten. Gallienus wollte das jedoch nicht, aber sollte Prinz Sassan in römische Hände fallen, dann war Krieg unvermeidlich. Selbst wenn er gewollt hätte, könnte Shapur in so einem Fall den Schlag gegen sein Prestige als König der Könige unmöglich ignorieren. Gallienus würde entsprechend antworten müssen, und Volusianus hätte sich durchgesetzt und seinen Einfluss auf den Kaiser demonstriert.
Aber war Rom wirklich bereit für einen großen Krieg gegen die Perser? Die römischen Streitkräfte im Osten waren massiv unterbesetzt und hatten große Probleme mit der Disziplin. Außerdem wollte Gallienus mit der Hauptarmee in diesem Sommer die Alpen überschreiten, um Postumus im Westen zu bekämpfen. Offenbar spekulierte Volusianus darauf, dass der Feldzug bereits im Herbst beendet sein würde, doch das war ein großes Risiko. Schließlich hatte es schon einmal einen solchen Feldzug gegeben, der jedoch ergebnislos geblieben war.
Sardonyx und Achat. Volusianus und Severus hatten sich auf Waren aus dem Imperium geeinigt, die in Persien nicht allzu weit verbreitet waren. Edelsteine und Kameen waren klein und teuer. Damit konnte man auch die verhältnismäßig kleine Karawane mit nur zehn Mann erklären, die überdies auch noch schwer bewaffnet war.
Ob Volusianus wohl auch einmal im Osten gedient hat?, fragte sich Murena. Vielleicht betrachtete er die Perser aber auch nur als dekadente, feige Orientalen. Viele Westler taten das. Falls ja, dann irrte sich der Präfekt. Die Perser hatten bereits vier römische Armeen in der Schlacht geschlagen, und das vernichtend. Drei davon waren sogar von Kaisern geführt worden. Gordian III. hatten sie verwundet und Valerian gefangen genommen. Nur Severus Alexander war ungeschoren davongekommen. Murena erinnerte sich noch gut daran, wie die persischen Krieger über die Mauern von Zeugma geströmt waren. Er hatte gesehen, wie sie seinen Vater erschlagen hatten. Sie mochten sich die Augen schminken und sich parfümieren, aber sie waren alles andere als schwach oder weibisch.
Murena war stolz auf seine Treue, und die schuldete er Volusianus, aber mehr noch Rom. Ein Krieg mit Persien wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine Katastrophe. Sie durften dem König der Könige in keinem Fall einen Vorwand dafür geben, und das hieß, dass dieser Prinz Sassan nicht gerettet werden durfte. Aber natürlich konnte sich Murena nicht offen gegen den Präfekten der Prätorianer stellen, und er konnte sich auch nicht direkt an den Kaiser wenden. Sollte er Gallienus vor diesem Plan warnen, dann würde Volusianus davon erfahren, und Murena würde im Kerker des Palastes landen. Doch vermutlich würde es gar nicht so weit kommen, denn es war mehr als unwahrscheinlich, dass Severus Erfolg haben würde. Doch unwahrscheinlich war nicht gut genug, Murena musste sicher sein. Und dafür zu sorgen, war nicht schwer. Murena war der Befehlshaber der frumentarii. Wenn er es sorgfältig genug plante, dann würde Severus’ Trupp in die Wüste Mesopotamiens ziehen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden.
III
Der Euphrat
Von allen staubigen Städten des Ostens, durch die Valens auf seiner langen Reise gekommen war, war Zeugma die deprimierendste. Natürlich hatte er Vorurteile. In den anderen Städten hatte er nur jeweils ein, zwei Nächte verbracht. In Zeugma wartete er jedoch seit fast einem halben Monat.
Es war der Tag vor den Kalenden des Augusts, Hochsommer in Syrien. Es war heiß, heißer noch als in Rom. Valens hatte den Westen noch nie verlassen, und in Zeugma war es so heiß, wie er es sich nie auch nur hatte vorstellen können. Um den stickigen Straßen zu entkommen, hatte sich Valens die Stufen zur Zitadelle hinaufgequält. Unterhalb des Tempels und des Palastes lag ein Obsthain. Der junge Ritter saß mit dem Rücken an einem Apfelbaum im Schatten und hoffte auf eine leichte Brise.
Die Obstbäume wuchsen an dem steilen Hang bis hin zu einer niedrigen, bröckelnden Mauer. Jenseits davon erstreckte sich ein Gewirr von roten Ziegeldächern bis zum Fuß des Hügels. Der Hang war so steil, dass es so aussah, als wären die Häuser aufeinander gebaut worden. Auf halbem Weg nach unten gab es einen flachen Platz mit einem weiteren Tempel, einem Triumphbogen, einem Theater und anderen öffentlichen Gebäuden. Abschätzig ließ Valens seinen Blick über diese Symbole hellenistischen Lebens schweifen. Die Einwohner von Zeugma mochten ja behaupten, Griechen zu sein, aber sie sahen aus wie Orientalen. Einige trugen sogar Ohrringe, und viele hörten auf syrische Namen.
Weit unten lagen der Euphrat und die Brücke, der die Stadt ihren Namen verdankte. Valens ließ seinen Blick über den Fluss nach Apamea wandern, der Siedlung am gegenüberliegenden Ufer. Im Gegensatz zu Zeugma war Apamea mit seinen schmalen Straßen in einem regelmäßigen Gitter auf der Ebene angelegt. Doch egal ob Zeugma oder Apamea, auf beiden Seiten des Flusses gab es jede Menge verlassene Behausungen mit eingestürzten Dächern und verkohlten Balken. Dabei war es schon mehr als ein Jahrzehnt her, seit die Perser die beiden Zwillingsstädte geplündert hatten. Bis dahin waren sie blühende Handelsstädte gewesen, die ihren Reichtum Karawanen aus dem Osten verdankt hatten, doch jetzt war der Karawanenverkehr nahezu zusammengebrochen, und die beiden Städte waren mehr und mehr verfallen.
Valens schaute nach Osten und über die Mauer hinweg, die die Perser nicht hatte aufhalten können. Dort waberte die Luft von der Hitze, und das flache Land erstreckte sich bis zu einer Hügelkette, die wie eine Fata Morgana schien. Das waren die Ausläufer der großen Hochebenen von Nord-Mesopotamien, und in diese weite Ödnis voller räuberischer Nomaden und plündernden persischen Reitern würde Valens schon bald aufbrechen.
Der beunruhigende Gedanke ließ ihn zu dem Militärlager im Nordviertel von Zeugma schauen. Auch die Heimat der IV. Legion Scythica hatte schon bessere Tage gesehen. Einst hatten sich dort kaiserliche Expeditionsheere versammelt. Die Paradeplätze waren voller marschierender Legionäre gewesen, und der Klang der Trompeten hatte von den Mauern widergehallt. Jetzt war die Legion weit von ihrer vollen Stärke entfernt, und viele der verbliebenen Männer waren außerhalb der Stadt eingesetzt. Die Handvoll, die noch hier war, schlurfte nur dann und wann lustlos über die nackte Erde. Aber wie auch immer, morgen würde sich Valens nach der langen Reise von Rom und der ewigen Warterei dort zum Dienst melden.
Der Ruf des Führers der Fremden war so plötzlich gekommen wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel, wie ein böses Omen. Obwohl das Hauptquartier der frumentarii nur einen Steinwurf von Valens eigenem Lager auf dem Caelius entfernt lag, hatte Valens noch nie einen Fuß an diesen Ort gesetzt. Tatsächlich würde niemand, der noch einigermaßen bei Verstand war, freiwillig dorthin gehen. Wie alle Mitglieder der römischen Oberklasse verachtete und fürchtete Valens die frumentarii zugleich. Die Geheimsoldaten waren nichts anderes als Spione und Meuchelmörder. Die Kaiser nutzten sie, um in den Leben der Elite herumzuschnüffeln und jeden Ansatz von Verrat im Keim zu ersticken – oder das, was sie für Verrat hielten. Gerüchten zufolge waren die frumentarii in Zivilkleidung unmöglich zu erkennen. Nirgends war man vor ihnen sicher. Ein falsches Wort in einem beiläufigen Gespräch, im Bad oder bei einem Abendessen, und schon war man verhaftet. Und wenn es an Beweisen fehlte, dann waren die frumentarii berüchtigt dafür, belastende Details auch schon mal zu erfinden. Und war man erst einmal in den Fängen der Folterknechte, dann gestand man sowieso alles, was sie wollten.
Murena, der Princeps Peregrinorum, war ein vulgärer kleiner Mann, der offensichtlich aus den Rängen der einfachen Soldaten stammte. Aber er war sehr freundlich gewesen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sein Gegenüber tatsächlich Marcus Aelius Valens war, stellvertretender Tribun der berittenen Leibgarde des Kaisers, da war er äußerst offen gewesen. Es sei weithin bekannt, hatte Murena gesagt, dass Valens vom Garnisonsdienst in der Hauptstadt gelangweilt war. Das hatte Valens bestätigt. Er hatte sich nur gefragt, woher Murena das gewusst hatte. Aber es war wohl die Aufgabe der frumentarii, genau so etwas herauszufinden.
Dann hatte man ihm einen weiteren Offizier vorgestellt, einen groß gewachsenen Mann mittleren Alters mit einem kurzen Bart und abstehenden Ohren. Gnaeus Claudius Severus sollte einen zehn Mann starken Trupp nach Mesopotamien und von dort in persisches Gebiet führen. Severus würde so tun, als wäre er ein Schmuckhändler. Frumentarii würden seine Karawane bewachen. Valens wiederum würde sein Stellvertreter sein und sich als Severus’ Neffe ausgeben. Ziel der Mission war die Befreiung eines persischen Prinzen mit Namen Sassan aus einem Gefängnis, das man die Festung der Stille nannte und das im Südosten des Kaspischen Meeres lag. Sobald sie den Prinzen befreit hatten, sollten sie nach Norden in die Steppe reisen. Dort würde der Herrscher der nomadischen Heruler sie zum Schwarzen Meer geleiten, von wo sie dann per Schiff ins Reich zurückfahren sollten.
»Noch Fragen?«, sagte Murena zum Schluss.
Tatsächlich hatte Valens Dutzende davon: zu Routen, Logistik, Geld, Waffen und vor allem, was ihre Überlebenschancen betraf.
»Nein, Herr«, antwortete er jedoch.
»Gut«, sagte Murena. »Du wirst dich im Militärlager von Zeugma am Euphrat bei Severus melden, und zwar an den Kalenden des Augusts. Du wirst allein reisen, noch nicht einmal mit einem Sklaven.«
»Herr.«
»Eines noch. Du wirst deinen Dienst bei der Reitergarde beenden. Du wirst nicht formell zu den frumentarii versetzt werden. Du wirst kein Abzeichen der miles arcanus bekommen. Die anderen werden ihre Abzeichen in Zeugma abgeben. Wenn du gefangen wirst, dann bist du kein Soldat von Rom. Wir werden leugnen, dich zu kennen oder Kenntnis von deiner Mission zu haben.«
»Herr.«
Murena lächelte. »Willkommen in der Welt der geheimen Soldaten.«
Als er jetzt an das Gespräch in diesem unscheinbaren Arbeitszimmer zurückdachte, da wusste Valens, dass er keine Wahl gehabt hatte. Nachdem man ihm die Mission erklärt hatte, hatte er sich nicht mehr weigern können, denn dann hätte Murena ihn nicht mehr gehen lassen. Valens hatte keine Ahnung, warum man ausgerechnet ihn ausgesucht hatte, aber es stimmte, dass er von all den zeremoniellen Pflichten in Rom die Nase voll hatte. Schließlich hatte er sich nicht so sehr bemüht, ein Offizierspatent zu bekommen, um auf dem Palatin Wache zu schieben oder im Circus Maximus zu paradieren.
Valens hatte den Kampf gesucht. Tatsächlich war er am Boden zerstört gewesen, als man ihm verkündet hatte, er würde bei der berittenen Garde in der Hauptstadt bleiben und nicht mit dem Kaiser in den Krieg nach Gallien ziehen. Doch jetzt, hier im Osten, würde er ohne Zweifel in Kämpfe verwickelt werden. Andererseits war das eine sinnlose, vielleicht sogar selbstmörderische Mission. Die ganze Idee war einfach nur verrückt. Das hatte er auch nicht gewollt. Er hatte sich vorgestellt, Männer in eine offene Schlacht zu führen und an der Spitze seiner Reiter unter den Augen des Kaisers gegen den Feind zu stürmen. Stattdessen sollte er nun herumschleichen wie ein dreckiger Kaufmann, der nur darauf wartete, die armen Trottel übers Ohr zu hauen, die dumm genug waren, sich für seine Waren zu interessieren.
Und dann war da noch das Problem der frumentarii. Valens traute ihnen nicht. Wie sollte man auch jemandem vertrauen, dessen Handwerk die Täuschung war? Sie würden allesamt Veteranen sein, und als solche würden sie rasch erkennen, wie unerfahren er war. Selbst für einen erfahrenen Befehlshaber wie Severus würde es nicht leicht sein, einen solchen Trupp zu kommandieren.
Die leichte Brise war abgeflaut. Allmählich wurde es heiß im Hain. Etwas zu trinken wäre jetzt nicht schlecht, dachte Valens.
Severus war ein weiterer Grund zur Sorge. Der Mann stammte aus einer respektablen Ritterfamilie, aber er war auch äußerst wortkarg und nicht gerade freundlich zu Valens gewesen. Vielleicht hatte jemand mit seiner Erfahrung ja schlicht keine Lust auf einen Stellvertreter bei so einer schwierigen Mission, den er als unreifen Geck aus der kaiserlichen Garde betrachtete.
Götter der Unterwelt, ich brauche was zu trinken. Trinken, ja, aber nicht besaufen. Es würde nicht gerade einen guten Eindruck machen, wenn er morgen im Lager mit einem dicken Kopf erschien. Die Lösung waren die Bäder unten am Fluss: eine Massage, ein Sprung ins kalte Wasser und ein paar Getränke, während man einem Philosophen oder Sophisten lauschte, wer auch immer da gerade einen Vortrag hielt. Vielleicht hatte Valens Glück, und er würde einen halbwegs ordentlichen Dichter treffen. Selbst in so einem verschlafenen Nest gab es stets ein, zwei Intellektuelle, die auf der Suche nach Publikum durch die öffentlichen Gebäude zogen. Wie Lucian in einer seiner Satiren geschrieben hatte, war es leichter, in einem Ruderboot zu stürzen, ohne auf eine Planke zu fallen, als zu vermeiden, auf der Straße von einem heruntergekommenen Mann des Wortes angesprochen zu werden.
Doch als Valens die Stufen zur Stadt hinuntergestiegen war, hatte er seine Meinung wieder geändert. Am Ufer gab es eine Taverne, nicht weit von seiner Unterkunft entfernt. Sie war nichts Besonderes, doch im Schankraum war es kühl und dunkel, und der Wein war gar nicht mal schlecht.
Kurz stand Valens in der Tür, bis sich seine Augen an das Zwielicht gewöhnt hatten. Rechts befand sich ein langer Tresen, und hinten war eine ausgetretene Treppe zu erkennen, über die die Gäste mit den Mädchen verschwinden konnten, die hier Wein ausschenkten. Eine Tür unter der Treppe führte zu einem Abort in einem kleinen Innenhof. Ansonsten gab es hier noch vier Tische mit Bänken. An einem davon saßen zwei Schauermänner, und in der hintersten Ecke war eine außergewöhnliche Gestalt mit gelb-grün gestreifter Hose und einer blauen Tunika zu erkennen. Der Mantel des Mannes war himmelblau und lag ordentlich gefaltet auf der Bank neben ihm, und am Tisch lehnte ein langer Stock aus Ebenholz. Der Mann war schon seit Tagen regelmäßig Gast in der Taverne. Wie immer aß er Obst und trank keinen Wein, sondern Wasser.
Als Valens den Raum betrat, hob der Mann den Blick. Sein riesiger Kopf war haarlos. Sogar die Augenbrauen fehlten. Sein im Vergleich dazu seltsam kleines Gesicht glich dem eines zufriedenen Säuglings. Er nickte dem Neuankömmling zu. Valens erwiderte das Nicken. Der Mann aß ein Stück Melone und furzte laut und sichtlich zufrieden.
Valens setzte sich auf einen Hocker am Tresen und rief nach einem Krug vom besten Wein. Der Wirt behauptete, der Wein stamme von Chios. Valens bezweifelte das. Er goss sich einen Becher ein und gab etwas Wasser dazu. Da er sich nicht betrinken wollte, holte er ein paar Münzen aus der Börse an seinem Gürtel und bezahlte direkt.
Valens betrachtete sein eigenes Spiegelbild in dem angelaufenen Messingspiegel hinter dem Tresen. Mit seinen kurzen Haaren und dem glatt rasierten Gesicht sah er jünger aus als fünfundzwanzig. Seine Tunika war schlicht, aber aus gutem Stoff. Er trug keinerlei Schmuck, abgesehen von einem Siegelring. Das Siegel selbst bestand aus Silber. Von seiner goldenen Jugend in Rom war nichts mehr übrig. Sein Aussehen passte hervorragend zu seiner Rolle als Neffe eines nicht allzu wohlhabenden Kaufmanns aus der Provinz.
Zwei Männer kamen von der Straße herein. Als hätten sie sich abgesprochen, standen die Schauermänner auf und gingen. Die Neuankömmlinge waren wie typische Soldaten außer Dienst gekleidet: Stiefel, Gürtel und Schwerter. Doch der Schmuck an ihren Gürteln war nicht militärisch, und ihre Kleidung war viel zu schlampig für Legionäre. Wahrscheinlich handelte es sich um einheimische Schläger, wie sie Ratsherren oder dergleichen oft als Leibwächter anheuerten. Sie ignorierten Valens und den kahlen Mann und gingen direkt an den Tresen.
Ein zweiter Krug würde wohl nicht schaden. Valens rief nach dem Mädchen. Sie servierte ihm flüchtig. Offenbar wollte sie so schnell wie möglich zu den Neuankömmlingen zurück. Verärgert drehte sich Valens halb um und musterte die Männer. Einer hatte ein ungewöhnlich langes Gesicht, das von einem dünnen Spitzbart noch akzentuiert wurde, sowie eine abnormal lange Nase, eine hohe Stirn und zurückweichendes Haar. Der andere machte das fehlende Haar seines Gefährten jedoch wieder wett. Er trug einen buschigen, eckig gestutzten Bart, und dicke Locken fielen ihm bis auf die Schultern. Auch trug er eine Perle im Ohr. Die Männer sprachen auf Griechisch mit dem Mädchen, aber mit deutlichem orientalischen Akzent.
Valens drehte sich wieder zum Spiegel um. Hinter ihm schrieb der kahle Mann in ein kleines Ringbuch. Der Stift und der Schreibblock wirkten geradezu winzig in seinen großen Fingern. Valens konzentrierte sich auf sein Spiegelbild. All seine Mühen, die Stelle eines 2. Tribuns bei der Reitergarde zu bekommen – die Empfehlungsschreiben, die er Freunden der Familie aus dem Kreuz geleiert hatte, die Bettelei bei seinem Vetter, dem 1. Tribun –, und wo war er gelandet? In Zeugma. Anstatt jenseits der Alpen Ehre und Ruhm zu erlangen oder sich zumindest auf rauschenden Festen in Rom zu amüsieren, trank er allein in einer von Fliegen verseuchten Stadt am Rande des Reichs. Dabei bezweifelte er, dass er überhaupt zur Armee gegangen wäre, wäre seine Familie nicht von einer großen Katastrophe heimgesucht worden. Sein Leben wäre mit Sicherheit anders verlaufen, würden seine Eltern noch leben. Doch grausam waren die Götter nicht, die Menschen kümmerten sie schlicht nicht.
Der Mann mit dem langen Gesicht strich im Vorbeigehen an ihm entlang. Valens zuckte unwillkürlich zusammen. Der Mann entschuldigte sich mit einem Lächeln. Er hatte Zähne wie ein Pferd.
Das Mädchen empfing den Mann am anderen Ende des Tresens und führte ihn die Treppe hinauf. Sie war besser darin, Leidenschaft vorzutäuschen, als das andere Mädchen, das im Schankraum arbeitete. Valens hatte sie beide schon probiert. Keuschheit war schlecht für die Gesundheit, und niemand warf einem Mann vor, sich zu nehmen, was ihm angeboten wurde.