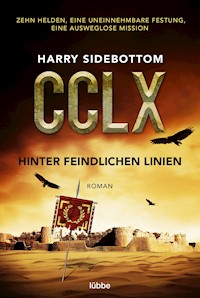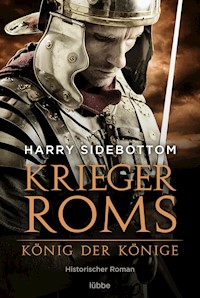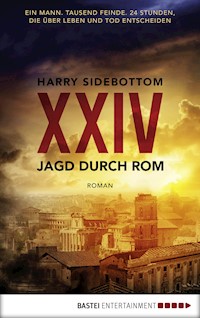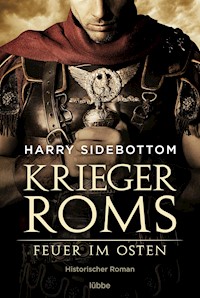
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Krieger Roms
- Sprache: Deutsch
Sie sind in der Unterzahl, doch sie verlieren nie den Mut ...
Rom, im Jahr 255. Von allen Seiten stoßen die Feinde Roms vor, um sich Teile des angeschlagenen Weltreiches einzuverleiben. Auch Sassanidenherrscher Shapur steht mit seinem mächtigen Heer vor Arete, dem östlichsten Bollwerk des Imperiums. Um die Festung zu verteidigen, sendet Kaiser Valerian seinen Tribun Ballista aus. Ballista ist Germane, steht aber seit Langem in Diensten Roms. Unerschrocken und loyal folgt er seinem Auftrag, obgleich er weiß, wie aussichtslos die Lage ist, denn er verfügt nur über wenige Krieger ...
Fesselnd, detailreich, brillant - Marcus Clodius Ballista, der germanischstämmige Krieger Roms, in seinem ersten Einsatz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungFragment aus dem sassanidischen Buch AyinProlog – Frühsommer 238 A. D.Navigatio: Herbst 255 A. D.IIIIIIIVVPraeparatio: Winter 255–256 A. D.VIVIIVIIIIXXXIObsessio: Frühling–Herbst 256 A. D.XIIXIIIXIVXVXVIXVIIAnhangHistorisches NachwortDanksagungGlossarListe der Kaiser in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts A. D.Liste der handelnden PersonenÜber dieses Buch
Sie sind in der Unterzahl, doch sie verlieren nie den Mut …
Rom, im Jahr 255. Von allen Seiten stoßen die Feinde Roms vor, um sich Teile des angeschlagenen Weltreiches einzuverleiben. Auch Sassanidenherrscher Shapur steht mit seinem mächtigen Heer vor Arete, dem östlichsten Bollwerk des Imperiums. Um die Festung zu verteidigen, sendet Kaiser Valerian seinen Tribun Ballista aus. Ballista ist Germane, steht aber seit Langem in Diensten Roms. Unerschrocken und loyal folgt er seinem Auftrag, obgleich er weiß, wie aussichtslos die Lage ist, denn er verfügt nur über wenige Krieger …
Fesselnd, detailreich, brillant – Marcus Clodius Ballista, der germanischstämmige Krieger Roms, in seinem ersten Einsatz
Über den Autor
Harry Sidebottom wuchs in den Rennställen von Newmarket auf, wo sein Vater als Trainer arbeitete. Dennoch entschied er sich für eine Laufbahn als Historiker – er promovierte in Alter Geschichte in Oxford und lehrte an verschiedenen Universitäten, unter anderem in Oxford. Nach einem gefeierten Sachbuch über antike Kriegsführung und zahlreichen Fachartikeln veröffentlichte er diverse Abenteuerromane aus dem antiken Rom. Jagd durch Rom – XXIV ist sein erster historischer Thriller.
H A R R Y S I D E B O T T O M
Historischer Roman
Aus dem Englischen vonWinfried Czech
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Dr. Harry Sidebottom
Titel der englischen Originalausgabe:
»Warrior of Rome: Fire in the East«
Originalverlag: Penguin Books Ltd., London
The author has asserted his moral rights.
All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs, Scheeßel
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
unter Verwendung von Illustrationen von
© shutterstock: ZRyzner; © ArcAngel: Collaboration JS
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-9431-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Frances, Lisa, Tom und Jack Sidebottom
Und lasst sie, wenn sie eine Festung belagern, danach trachten, möglichst alle für euch Erreichbaren innerhalb der Festung zu gewinnen, um mit ihrer Hilfe zwei Ziele zu erreichen: erstens – ihnen ihre Geheimnisse zu entreißen, und zweitens – sie durch ihr eigenes Zutun einzuschüchtern und zu verängstigen. Und lasst einen Mann verdeckt unter ihnen weilen, der ihre Gedanken in Unruhe versetzt und ihnen jede Hoffnung auf Erfolg raubt und ihnen sagt, dass ihr listiges Geheimnis enthüllt wurde und Geschichten über ihre Festung verbreitet werden und Finger auf ihre befestigten und ungeschützten Bereiche und auf die Stellen zeigen, gegen die Rammböcke eingesetzt werden, und auf die Stellen, unter die Stollen getrieben werden, und auf die Stellen, an denen Leitern aufgestellt werden, und auf die Stellen, an denen die Mauern überklettert werden, und auf die Stellen, an denen Brände gelegt werden – mit dem Ziel, dass all dies ihre Herzen mit Angst und Schrecken erfüllen wird …
Fragment aus dem sassanidischen Buch Ayin
Prolog
Frühsommer 238 A. D.
Krieg ist die Hölle. Bürgerkrieg ist schlimmer. Und dieser Bürgerkrieg nahm eine schlechte Entwicklung. Nichts lief wie geplant. Die Invasion Italiens war zum Stillstand gekommen.
Die Alpen zu überqueren, bevor die Frühlingssonne den Schnee auf den Pässen tauen konnte, hatte den Truppen schwer zugesetzt. Sie waren davon ausgegangen, als Befreier begrüßt zu werden. Man hatte ihnen versprochen, dass die gesamte Bevölkerung ihnen mit Olivenzweigen in den Händen entgegenlaufen, die Kinder vorschieben, um Gnade flehen und vor ihnen auf die Knie fallen würde.
Doch es war nicht wie erhofft gekommen. Die Soldaten waren aus dem Gebirge in ein verwaistes Land hinabgestiegen. Die Bevölkerung war geflohen und hatte alles mitgenommen, was sie irgendwie schleppen konnte. Selbst die Türen der Häuser und Tempel waren verschwunden. Die Ebenen, in denen normalerweise emsige Geschäftigkeit herrschte, waren menschenleer. Das einzige Lebenszeichen, das die Soldaten entdeckten, als sie Emona durchquerten, war ein Rudel Wölfe.
Mittlerweile campierte die Armee bereits seit mehr als einem Monat außerhalb der Stadtmauern der norditalienischen Stadt Aquileia. Die Legionen und ihre Auxiliartruppen waren hungrig, durstig und erschöpft. Die in aller Hast eingerichtete Nachschubkette war zerbrochen, und in der näheren Umgebung gab es nichts zu holen. Was die Bürger nicht hinter den Stadtmauern in Sicherheit hatten bringen können, war von den Soldaten bereits kurz nach ihrer Ankunft verbraucht worden. Es gab keinerlei Unterkünfte. Sämtliche Gebäude in den umliegenden Dörfern waren abgerissen worden, um die Materialien für die Belagerungsmaschinen und -geräte zu verwenden. Der Fluss war durch Leichname beider Parteien verseucht.
Die Belagerung erzielte keine Fortschritte. Die Stadtmauern konnten nicht durchbrochen werden, es gab nicht genügend Belagerungsmaschinen, und die Verteidigung der Stadt war zu effektiv. Alle Versuche, die Mauern mithilfe von Leitern und mobilen Belagerungstürmen zu überwinden, waren blutig gescheitert.
An mangelndem Mut des großen Mannes lag es nicht, dass der Erfolg ausblieb. Kaiser Maximinus Thrax ritt täglich in Bogenschussweite der Feinde um die Stadt herum, um seine Männer an vorderster Front der Belagerungsreihen zu ermutigen, versprach ihnen, dass er ihnen freie Hand mit der Stadt und allen Menschen in ihr gewähren würde. Doch während an seinem Mut keinerlei Zweifel bestand, traf das nicht auf seine Urteilskraft und seine Entscheidungen zu. Und mit jedem Rückschlag wurde er wilder und brutaler. Wie ein verwundetes Tier oder – wie viele sagten – wie der halb-barbarische Bauernsohn, der er im Herzen immer bleiben würde, schlug er rücksichtslos um sich. Die Offiziere, die für die gescheiterten Versuche, die Stadtmauern zu überwinden, verantwortlich waren, ließ er mit ständig neu erdachten Methoden exekutieren. Wobei er diejenigen, die adligen Blutes waren, mit besonderem Einfallsreichtum bedachte.
Ballista war sogar noch hungriger, durstiger und schmutziger als die meisten anderen. Er war ein hochgewachsener Jüngling, gerade einmal sechzehn Winter alt, fast zwei Meter groß, und er wuchs immer noch. Niemand spürte den Nahrungsmangel so heftig wie er. Das lange blonde Haar fiel ihm strähnig tief in den Rücken. Ein Überbleibsel alter Zimperlichkeit hielt ihn davon ab, sich regelmäßig am Fluss zu waschen. Und seit dem letzten Tag hatte sich noch der durchdringende Geruch nach verbranntem Fleisch zu den zahlreichen Ausdünstungen gesellt, die er verströmte.
Doch seiner Jungend und seinem Status als diplomatischer Geisel seines Stammes zum Trotz waren alle einhellig der Meinung gewesen, dass einem jungen Burschen, einem Abkömmling Wotans, gebührte, eine der irregulären germanischen Einheiten anzuführen. Die Römer hatten die Höhe der Mauern berechnet, etliche Leitern mit der richtigen Länge zusammengestellt und die rund fünfhundert verzichtbaren Barbaren mit Ballista als Anführer angreifen lassen. Die Männer waren inmitten eines dichten Geschosshagels geduckt losgetrabt. Die Körpergröße der Germanen und die Tatsache, dass sie keine Rüstungen trugen, hatten sie zu dankbaren Zielen für die Verteidiger Aquileias gemacht. Wieder und wieder waren Übelkeit erregende Geräusche ertönt, wenn eines der Geschosse ins Ziel getroffen hatte. Die Männer waren in Scharen gefallen, die Überlebenden tapfer über sie hinweggestürmt. Schon bald hatten sie den Fuß der fugenlosen, hoch über ihnen aufragenden Mauern erreicht. Wieder waren viele gefallen, als sie die Schilde beiseitelegen mussten, um die Leitern aufrichten zu können.
Ballista hatte zu den Ersten gehört, die die Sprossen erklommen. Er benutzte nur eine Hand beim Aufstieg, hielt den Schild mit der anderen schützend über sich, das Schwert noch in der Scheide. Ein herabstürzender Felsbrocken prallte auf den Schild und stieß ihn beinahe von der Leiter. Der Lärm war unbeschreiblich. Er sah, wie sich eine lange Stange über die Mauerkrone hinweg auf die Leiter neben ihm zuschob. Am Ende der Stange befand sich eine Amphore. Die Stange wurde langsam gedreht und mit ihr die Amphore, aus der sich eine brennende Mischung aus Pech und Öl, Schwefel und Bitumen über die Männer auf der Leiter ergoss. Sie brüllten vor Schmerzen, ihre Kleidung fing Feuer, zog sich um sie herum zusammen und schnürte sie ein. Das Fleisch verschmorte ihnen bei lebendigem Leib. Einer nach dem anderen stürzten sie in die Tiefe. Die lodernde Flüssigkeit prasselte auf die anderen Männer am Fuß der Leiter herab. Sie schlugen mit bloßen Händen verzweifelt auf ihre brennende Kleidung und wälzten sich auf dem Boden, doch es war unmöglich, die Flammen zu ersticken.
Als Ballista in die Höhe spähte, entdeckte er eine weitere Stange mit einer Amphore direkt über seinem Kopf, die sich soeben zu drehen begann. Ohne zu zögern katapultierte er sich von der Leiter zurück und schlug hart auf dem Boden auf. Einen Moment befürchtete er, sich einen Fußknöchel gebrochen oder verdreht zu haben und gleich bei lebendigem Leib verbrennen zu müssen. Doch der Überlebenswille war stärker als die Schmerzen. Er schrie seinen Männern zu, ihm zu folgen, machte kehrt und rannte davon.
Ballista war schon vor einiger Zeit zu dem Schluss gelangt, dass eine Verschwörung gegen den Kaiser unausweichlich war. Wie sehr ihn die römische Disziplin auch immer beeindruckte, kein auch noch so großes Heer konnte diese Belagerung viel länger fortführen. Weshalb es ihn auch nicht im Mindesten überraschte, als er nach dem Desaster dieses Tages von Gleichgesinnten angesprochen wurde.
Während er nun darauf wartete, seine Rolle bei dem Vorhaben zu spielen, wurde ihm plötzlich das Ausmaß seiner Angst bewusst. Er verspürte nicht das geringste Verlangen, den Helden zu spielen. Doch ihm blieb kaum eine andere Wahl. Wenn er nichts unternahm, würde er entweder auf Befehl von Maximinus Thrax exekutiert oder aber von den Verschwörern umgebracht werden.
Die Verschwörer hatten sich nicht getäuscht. Es waren nur sehr wenige Wachen um das kaiserliche Zelt herum postiert. Viele der Anwesenden schliefen. Es war die träge Zeit unmittelbar nach Mittag. Die Phase, in der die Belagerung kurzfristig ausgesetzt wurde. Die Zeit, in der der Kaiser und sein Sohn ruhten.
Auf ein Nicken eines Mitverschwörers hin steuerte Ballista das riesige purpurfarbene Zelt mit den Standarten davor an. Plötzlich wurde ihm besonders deutlich bewusst, was für ein schöner Tag es war, ein perfekter italienischer Tag im frühen Juni. Eine sanfte Brise milderte die Hitze. Eine Honigbiene summte ihm über den Weg. Schwalben zogen hoch am Himmel ihre Kreise.
Ein Wächter der Prätorianer versperrte ihm den Weg mit seinem Speer. »Was glaubst du, wohin du gehst, Barbar?«
»Ich muss den Kaiser sprechen.« Ballista sprach recht gut Lateinisch, wenn auch mit starkem Akzent.
»Wer muss das nicht?« Der Prätorianer zeigte sich unbeeindruckt. »Und jetzt verpiss dich, Junge.«
»Ich habe Informationen über eine Verschwörung gegen ihn.« Ballista senkte die Stimme. »Ein paar Offiziere, einige von den Adligen, planen ihn zu ermorden.« Er registrierte die unverkennbare Unschlüssigkeit des Wachpostens. Die potenzielle Gefahr, die ihm drohte, wenn er einem misstrauischen und rachsüchtigen Imperator Informationen über eine mögliche Verschwörung vorenthielt, wog letztendlich schwerer als die nackte Angst davor, einen zunehmend reizbaren und gewalttätigen Mann wecken zu müssen, für den die Dinge alles andere als gut liefen.
»Warte hier.« Der Prätorianer rief einen Kameraden herbei, um den Barbaren im Auge zu behalten, und verschwand in dem kaiserlichen Zelt.
Kurze Zeit später tauchte er auch schon wieder auf und befahl dem anderen Prätorianer, den jungen Barbaren zu entwaffnen und zu durchsuchen. Nachdem er sein Schwert und den Dolch abgegeben hatte, wurde Ballista in das Zelt geführt, zuerst in einen kleinen Vorraum und dann weiter ins Allerheiligste.
Zuerst konnte er kaum etwas erkennen. Nach dem hellen Sonnenschein draußen war das purpurne Halbdunkel im Inneren des Zeltes fast undurchdringlich. Als sich seine Augen nach und nach auf die neuen Lichtverhältnisse einstellten, erblickte er das heilige Feuer, das stets vor dem herrschenden Kaiser hergetragen wird, schwach in seinem tragbaren Altar flackern. Dann entdeckte er ein großes Feldbett. Aus ihm hob sich das riesige bleiche Gesicht des Kaisers Caius Julius Verus Maximinus, besser bekannt als Maximinus Thrax, Maximinus der Thraker. An seinem Hals glitzerte der berühmte goldene Torques, den er für seine Tapferkeit als Soldat im persönlichen Stab von Imperator Septimus Severus erhalten hatte.
»Erweise dem Kaiser deine Verehrung – küss den Ring«, grollte eine Stimme vom anderen Ende des Zeltes her. Während der Prätorianer ihn auf die Knie drückte, sah Ballista, wie sich Maximinus Thrax’ attraktiver Sohn aus der Dunkelheit schälte. Ballista ließ sich widerwillig auf den Boden sinken, und als Maximinus Thrax seine Hand ausstreckte, küsste er den schweren goldenen Ring, den ein Edelstein in Form eines Adlers zierte.
Maximinus Thrax setzte sich auf den Rand des Feldbettes. Er trug nur eine schlichte weiße Tunika. Sein Sohn stand neben ihm in seinem üblichen kunstvoll verzierten Brustpanzer und dem dekorativen Silberschwert mit dem wie ein Adlerkopf gestalteten Griff. Ballista blieb auf den Knien liegen.
»Ihr Götter, wie er stinkt«, sagte der Sohn und drückte sich ein parfümiertes Tuch auf die Nase. Sein Vater brachte ihn mit einer knappen Handbewegung zum Schweigen.
»Du hast also Kenntnis von einem geplanten Anschlag auf mein Leben.« Maximinus Thrax’ große graue Augen waren auf Ballistas Gesicht gerichtet. »Wer sind die Verräter?«
»Die Offiziere, die meisten Tribune und einige Centurios der LegionII Parthica, Dominus.«
»Nenn ihre Namen.«
Ballista zögerte.
»Lass meinen Vater nicht warten«, sagte der Sohn. »Nenn die Namen.«
»Es sind mächtige Männer. Sie haben viele Freunde und großen Einfluss. Wenn sie erfahren, dass ich sie denunziert habe, werden sie mir Schlimmes antun.«
Der große Mann lachte, ein furchtbares knurrendes Geräusch. »Wenn das, was du sagst, wahr ist, werden sie schon bald nicht mehr in der Lage sein, dir oder irgendwem sonst etwas anzutun. Wenn das, was du sagst, jedoch nicht wahr ist, wird das, was sie dir möglicherweise antun wollen, die geringste deiner Sorgen sein.«
Ballista zählte langsam eine Reihe von Namen auf. »Flavius Vopiscus, Julius Capitolinus, Aelius Lampridius.« Insgesamt waren es zwölf Namen. Bei diesem Stand der Dinge spielte es kaum noch eine Rolle, dass es sich dabei um die echten Namen der Verschwörer handelte.
»Woher weißt du, dass diese Männer mich töten wollen? Welchen Beweis hast du dafür?«
»Sie haben mich aufgefordert, mich ihnen anzuschließen.« In der Hoffnung, den zunehmenden Lärm draußen zu übertönen, sprach Ballista lauter. »Ich habe sie um schriftliche Instruktionen gebeten. Ich habe sie dabei.«
»Was ist das für ein Krach?«, bellte Maximinus Thrax. In seinem Gesicht zuckte es wie üblich vor Gereiztheit. »Prätorianer, befiehl den Männern, leise zu sein.« Er streckte eine riesige Pranke nach den Dokumenten aus, die Ballista ihm hinhielt.
»Wie du sehen kannst …«, fuhr Ballista fort.
»Ruhe!«, befahl der Kaiser.
Statt nachzulassen, schwoll der Lärm vor dem Zelt sogar noch an. Maximinus, dessen Gesicht sich mittlerweile vor Zorn verzerrt hatte, wandte sich seinem Sohn zu. »Geh raus und sag den Kerlen, sie sollen die Schnauze halten!«
Er widmete sich wieder den Dokumenten. Ein erneutes Aufbrausen des Lärms draußen ließ ihn das bleiche Gesicht heben, in dem Ballista die ersten Anzeichen von Misstrauen aufflackern sah.
Ballista sprang auf, ergriff den tragbaren Altar mit dem heiligen Feuer und schwang ihn in Richtung von Maximinus’ Kopf. Der Kaiser packte sein Handgelenk mit einem unvorstellbar festen Griff und schlug ihm gleichzeitig mit der freien Hand ins Gesicht. Der Kopf des Jünglings flog zurück. Der große Mann verpasste ihm einen Fausthieb in den Magen. Ballista brach zusammen. Sofort riss der Kaiser ihn mit einem Arm wieder auf die Füße und schob sein Gesicht, das hart wie ein Fels war, dicht an das Ballistas heran. Sein Atem stank nach Knoblauch.
»Du wirst einen langsamen Tod sterben, du kleiner Wichser.«
Mit einer fast beiläufig anmutenden Bewegung schleuderte er Ballista von sich. Der junge Bursche pflügte wie ein Geschoss durch eine Reihe von Stühlen und stieß einen Kartentisch um.
Als der Kaiser sein Schwert packte und zum Zeltausgang ging, rang Ballista verzweifelt nach Luft und versuchte wieder auf die Füße zu kommen. Er sah sich nach einer Waffe um. Da er nirgendwo eine entdecken konnte, schnappte er sich einen Schreibgriffel von einem Schreibpult und stolperte hinter dem Kaiser her.
Vom Vorzelt aus betrachtet, wirkte die Szenerie draußen wie der hell erleuchtete Ausschnitt eines Gemäldes auf der Wand eines Tempels oder Portikus. Die meisten der Prätorianer waren in heilloser Flucht begriffen. Einige jedoch hatten sich den Legionären der LegioII angeschlossen und rissen die imperialen Porträts von den Standarten. Ganz in der Nähe drängte sich ein Pulk wild kämpfender Leiber zusammen. Der mächtige Rücken von Maximinus Thrax füllte den größten Teil des Zelteinganges aus. Er hielt sein Schwert in der Hand, und sein riesiger Kopf drehte sich hin und her.
Plötzlich legte sich der Tumult, als der abgetrennte Kopf von Maximinus Thrax’ Sohn auf der Spitze eines Speeres in die Höhe wuchs. Sein Gesicht, obwohl blutverschmiert und schmutzig, wirkte immer noch schön.
Der Laut, den der Kaiser bei seinem Anblick ausstieß, klang nicht menschlich. Noch bevor er sich bewegen konnte, sprang ihn Ballista, noch immer halb benommen von dem Schlag des Hünen, von hinten an, den Schreibgriffel in der Hand. Wie ein Wildjäger in der Arena beim Versuch, einen Bullen zu töten, stieß Ballista Maximinus Thrax den Griffel in den Hals. Mit einer einzigen ausholenden Armbewegung schleuderte der große Mann Ballista quer durch das Vorzelt zurück, wirbelte herum, zog sich den Griffel aus dem Hals und schleuderte das blutverschmierte Schreibgerät Ballista hinterher. Dann stapfte er mit erhobenem Schwert auf ihn zu.
Der Jüngling rappelte sich mühsam auf, ergriff einen Stuhl, hielt ihn wie einen improvisierten Schild vor sich und wich zurück.
»Du verräterischer kleiner Scheißer, du hast mir dein Wort gegeben, du hast den militärischen Eid geleistet, das Sacramentum.« Ein beträchtlicher Blutstrom rann den Hals des Kaisers hinab, schien ihn jedoch nicht zu beeinträchtigen. Mit zwei Hieben seines Schwertes hackte er den Stuhl in Ballistas Händen in Stücke.
Ballista verdrehte den Körper, um den Hieben zu entgehen, doch ein brennender Schmerz durchzuckte seine Brust, als die Klingenspitze das Fleisch über seinen Rippen aufschlitzte. Er sank zu Boden und versuchte, die Hände auf die klaffende Wunde gepresst, kriechend zurückzuweichen. Maximinus Thrax baute sich über ihm auf und schickte sich an, den tödlichen Schlag auszuführen.
Der geschleuderte Speer bohrte sich in den ungeschützten Rücken des Kaisers. Der riesige Mann stolperte unwillkürlich einen Schritt vorwärts. Ein zweiter Speer traf seinen Rücken. Maximinus machte einen weiteren Schritt, kippte vornüber und brach auf Ballista zusammen. Sein gewaltiges Gewicht zerquetschte den Jüngling beinahe. Sein Atem, heiß und faulig, strich über das Gesicht des jungen Burschen. Seine Finger näherten sich Ballistas Augen, um sie ihm aus den Höhlen zu reißen.
Irgendwie war der Schreibgriffel plötzlich wieder in Ballistas Hand zurückgekehrt. Mit aller aus seiner Verzweiflung geborenen Kraft rammte der Jüngling ihn dem Kaiser in die Kehle. Maximinus’ Finger zuckten zurück. Sein Blut brannte Ballista in den Augen.
»Ich werde dich wiedersehen«, stieß der riesige Mann mit gurgelnder Stimme hervor, die zuckenden, mit blutigem Schaum bedeckten Lippen zu einem hässlichen Grinsen verzerrt.
Ballista sah reglos zu, wie die Legionäre die Leiche des Kaisers ins Freie schleiften und wie eine Meute wilder Hunde über sie herfielen. Wie zuvor seinem Sohn hackten sie auch Maximinus den Kopf ab und spießten ihn auf einen Speer. Den kopflosen Rumpf ließen sie liegen, auf das jeder, der es wollte, darauf herumtrampeln und ihn verstümmeln konnte. Die Reste sollten streunende Hunde und Aas fressende Vögel in Stücke reißen.
Etliche Zeit später wurden die Köpfe von Maximinus Thrax und seinem Sohn nach Rom geschickt, um dort öffentlich ausgestellt zu werden. Was von ihren verstümmelten Leichen übrig geblieben war, wurde in den Fluss geworfen, um ihnen ein ehrenvolles Begräbnis zu verweigern, auf dass ihre Seelen keine Ruhe finden würden.
NAVIGATIO
Herbst 255 A. D.
I
Als das Kriegsboot das Brackwasser des Hafens von Brundisium hinter sich gelassen hatte, hatten die Spione zusammengefunden. Unerkannt hockten sie inmitten der anderen Männer des DuxRipae. Von ihrer Position nahe der Bugspitze aus konnten sie über den schmalen Rumpf hinweg das Objekt ihrer professionellen Aufmerksamkeit in einer Entfernung von knapp fünfzig Schritten im Auge behalten.
»Ein beschissener Barbar. Die einzige Aufgabe von uns dreien besteht darin, einen beschissenen Barbaren zu beobachten.« Der Frumentarius sprach leise, seine Lippen bewegten sich kaum merklich.
Seinem Akzent nach zu urteilen stammte er aus den Slums von Subura, gelegen in einem dicht bevölkerten Tal zwischen zwei der sieben Hügel der ewigen Stadt Rom. Wenn auch von niederer Herkunft, zählte er wie auch seine beiden Kollegen als Frumentarius zu den am meisten gefürchteten Männern des römischen Imperiums. Der Name Frumentarii legte eigentlich nahe, dass ihre Träger etwas mit der öffentlichen Getreidezuteilung oder Truppenverpflegung zu tun hätten, doch diesen Denkfehler beging niemand. Genauso gut hätte man das wilde Schwarze Meer das »freundliche Meer« nennen oder die Dämonen der Vergeltung als die »Sanftmütigen« bezeichnen können. Ein jeder – vom höchsten patrizischen Konsul bis hinab zum niedrigsten Sklaven in einer abgelegenen Provinz wie Britannien – kannte und hasste die Frumentarii als das, was sie wirklich waren, Mitglieder der Geheimpolizei des Kaisers – seine Spione, Attentäter, Auftragsmörder. Wenigstens war die Geheimpolizei nicht so geheim, dass niemand von ihrer Existenz gewusst hätte. Es handelte sich um eine Spezialeinheit der Armee, deren Mitglieder aus anderen Truppenteilen rekrutiert und in das Lager auf dem caelischen Hügel überstellt worden waren. Die Identität der einzelnen Frumentarii wiederum war in der Regel unbekannt. Es hieß, dass man einen Frumentarius nur dann als solchen erkannte, wenn dieser es so wollte, weil es dann ohnehin zu spät war, sein Geheimnis zu verraten.
»Ich bin da nicht so skeptisch«, erwiderte einer der beiden anderen. »Es könnte durchaus eine gute Idee sein, ein wachsames Auge auf ihn zu haben. Barbaren sind von ihrer Natur her nicht vertrauenswürdig und häufig verschlagener, als man glauben möchte.« Seine Stimme beschwor Bilder der sonnenversengten Berge und Ebenen des fernen Westens herauf, der Provinzen des Äußeren Spaniens oder sogar Lusitanias, wo sich die Wogen des Atlantiks an der Küste brachen.
»Schwachsinn«, sagte der Dritte. »Einverstanden, die Baschtarde sind alle nicht vertrauenschwürdig. Die lügen, seit sie kriechen können. Aber die Typen aus dem Norden, wie der Baschtard da, sind träge und schwerfällig. Die Leute aus dem Norden sind immer groß, wild und dumm, während die aus dem Osten klein, verschlagen und verdammt feige sind.« Die etwas nuschelnde und undeutliche Aussprache des Mannes verriet, dass seine Muttersprache nicht Lateinisch, sondern das Punisch aus Nordafrika war, die Sprache, die auch Hannibal, der große Feind Roms, vor fast einem halben Jahrtausend gesprochen hatte.
Alle Männer auf dem Deck und die Besatzung unter den Planken verstummten, als Marcus Clodius Ballista, Vir egregius, Römischer Ritter und DuxRipae, Kommandant der Flussufer, die Arme gen Himmel hob, um das übliche Ritual, das zu Beginn jeder Reise vollführt wurde, zu eröffnen. Hier in Küstennähe, wo sich die Gewässer des Hafens von Brundisium zur Adria hin öffneten, war die See ruhig. Mit ihren ausgefahrenen Rudern in Ruhestellung lag die Galeere wie ein riesiges Insekt auf dem Wasser. In gutem Latein, in dem immer noch die Spur eines Akzents aus den Wäldern und Marschen des fernen Nordens mitschwang, intonierte Ballista die traditionellen Worte: »Jupiter, König der Götter, halte deine schützenden Hände über dieses Schiff und all die, die auf ihm segeln. Tyche, Geist des Schiffes, halte die Hände über uns.« Ballista nahm eine große, kunstvoll gearbeitete goldene Schale von einem Adjutanten entgegen und goss den Wein aus dem Gefäß langsam und mit gebührender Gemessenheit in drei Schüben als Opfergabe ins Meer.
Irgendjemand nieste. Ballista verharrte in seiner Pose, die Arme weit ausgestreckt. Das Niesen war eindeutig gewesen und nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Niemand regte sich oder gab einen Laut von sich. Wie jedermann wusste, war das unmissverständlichste Anzeichen für das Missfallen der Götter ein Niesen während der Rituale, die den Aufbruch eines Schiffes begleiteten. Trotzdem behielt Ballista die Pose unbeirrbar bei. Eigentlich hätte die Zeremonie jetzt vorbei sein sollen. Ungeduld und Anspannung machten sich auf der Galeere breit. Schließlich schleuderte Ballista die Schale mit einer kraftvollen Bewegung aus dem Handgelenk heraus von sich. Ein kollektives Aufseufzen ertönte, als sie klatschend in den Wellen aufschlug. Einen Moment lang schimmerte sie noch unter der Wasseroberfläche, bevor das Meer sie für immer verschluckte.
»Typisch beschissener Barbar«, knurrte der Frumentarius aus Subura. »Immer die große bescheuerte Geste. Aber sie kann das Omen nicht ungeschehen machen. Nichts kann das.«
»Für diese Schale hätte man sich zu Hause ein schönes Stück Land kaufen können«, sagte der Nordafrikaner.
»Wahrscheinlich hat er das Ding geklaut«, stellte der Spanier fest und kehrte zu ihrem ursprünglichen Thema zurück. »Sicher, die Barbaren aus dem Norden mögen dumm sein, aber Verrat geht ihnen genauso leicht von der Hand wie den Leuten aus dem Osten.«
Verrat war der Grund für die Existenz der Frumentarii. Der überlieferte Ausspruch Kaiser Domitians, dass so lange niemand an eine Verschwörung gegen einen Kaiser glaubte, bis dieser ermordet worden war, traf auf sie mit Sicherheit nicht zu. Ihre Gedanken kreisten ständig um Verrat, Verschwörungen und Gegenverschwörungen, ihre rücksichtslose Kombination aus Verschwiegenheit, Effizienz und Besessenheit war der Garant dafür, dass sie von jedermann gehasst wurden.
Nachdem er Ballistas Erlaubnis eingeholt hatte, forderte der Kapitän des Kriegsschiffs allgemeines Schweigen von der Mannschaft ein, bevor sie endgültig aufbrachen, und so hing jeder der drei Frumentarii seinen eigenen Gedanken nach. Für jeden von ihnen gab es genug nachzudenken. Wer von ihnen hatte den Auftrag erhalten, über die anderen Bericht zu erstatten? Oder gab es womöglich einen vierten Frumentarius unter den Männern des DuxRipae, so gut getarnt, dass sie ihn bisher nicht hatten entdecken können?
Demetrius saß zu Füßen von Ballista, den er in seiner Muttersprache, dem Griechischen, stets Kyrios nannte, Gebieter. Trotz seiner Stellung als Sklave dankte er einmal mehr seinem persönlichen Dämon dafür, ihn auf seinen derzeitigen Pfad geführt zu haben. Es fiel schwer, sich einen besseren Kyrios auch nur vorzustellen. »Ein Sklave sollte nicht auf die Hand seines Gebieters warten«, lautete ein altes Sprichwort. Ballista hatte in den vier Jahren, seit seine Frau ihm Demetrius als neuen Sekretär gekauft hatte – eins von zahlreichen Hochzeitsgeschenken –, nicht einmal die Hand gegen ihn erhoben. Demetrius’ frühere Besitzer hatten keine derartige Zurückhaltung darin geübt, ihre Fäuste zu gebrauchen oder ihm Schlimmeres anzutun.
Der Kyrios hatte gerade eben, als er seine Gelöbnisse sprach und die schwere goldene Schale in die See warf, einen wahrhaft prächtigen Anblick geboten. Es war eine Geste gewesen, die Alexander dem Großen würdig gewesen wäre, dem Helden des griechischen Jungen. Eine impulsive Geste der Großzügigkeit, der Pietät und Geringschätzung materieller Reichtümer. Er hatte seinen persönlichen Besitz für ihrer aller Wohl den Göttern geopfert, um das böse Omen durch das Niesen abzuwenden.
Demetrius fand, dass Ballista einiges mit Alexander gemein hatte: das glatt rasierte Gesicht, das goldene, nach hinten gekämmte Haar, voll wie eine Löwenmähne, das ihm in Locken beide Wangen hinabfiel, die breiten Schultern und die geraden, wohlgeformten Gliedmaßen. Natürlich war Ballista größer, Alexander war bemerkenswert klein gewesen. Und dann waren da noch die Augen. Alexander hatte verstörend wirkende verschiedenfarbige Augen gehabt, Ballistas Augen waren dagegen von einem tiefdunklen Blau.
Der junge Grieche ballte eine Hand zur Faust, den Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger geschoben, eine Schutzgeste gegen den bösen Blick, als ihn der Gedanke durchzuckte, dass Ballista in etwa zweiunddreißig Jahre alt sein musste, genau das Alter, in dem Alexander gestorben war.
Er sah verständnislos zu, wie sich das Schiff in Bewegung setzte. Offiziere der Seesoldaten brüllten Befehle, ein Flötist entlockte seinem Instrument schrille Töne, Deckarbeiter zerrten an in geheimnisvollen Mustern auf dem Deck liegenden Tauen, und aus dem Bauch des Schiffes ertönte das Keuchen der Ruderer, das Klatschen der Ruderblätter auf das Wasser und das Geräusch des Rumpfes, der immer schneller durch die Wellen pflügte. Nichts in den großen Werken über die unsterbliche griechische Geschichte – Herodot, Thukydides und Xenophon – hatte den belesenen jungen Sklaven auf den ohrenbetäubenden Lärm einer Galeere in voller Fahrt vorbereiten können.
Demetrius blickte zu seinem Kyrios auf. Ballistas Hände bewegten sich nicht, hielten scheinbar die aus Elfenbein gefertigten Armlehnen des zusammenklappbaren kurulischen Stuhls fest umklammert, ein römisches Symbol seines hohen Ranges. Wurde er etwa seekrank? War er jemals weiter gesegelt als von der Spitze des italienischen Festlandes hinüber nach Sizilien? Nach kurzer Überlegung verbannte Demetrius die Idee, sein Herr könnte das Opfer menschlicher Schwächen sein, aus seinen Gedanken. Er wusste, was oder wer seinem Kyrios wirklich zu schaffen machte. Niemand anderes als Aphrodite, die Göttin der Liebe, und ihr boshafter Sohn Eros. Mit anderen Worten: Ballista vermisste seine Frau.
Die Ehe zwischen Ballista und der Kyria hatte nicht als Liebesbeziehung begonnen. Sie war ein Arrangement gewesen, wie alle Ehen der Elite. Eine Senatorenfamilie von der Spitze der sozialen Pyramide, wenn auch ohne viel Geld und politischen Einfluss, übergab ihre Tochter einem jungen aufstrebenden Offizier. Zugegeben, einem Mann barbarischer Herkunft. Doch er war ein römischer Bürger, ein Mitglied des Reiterordens, im Rang unmittelbar unterhalb dem eines Senators stehend. Er hatte sich in Feldzügen an der Donau ausgezeichnet, auf den Inseln des fernen Ozeans und in Nordafrika, wo er als Erster die Festungsmauer einer feindlichen Stadt betreten und dafür die Mauerkrone errungen hatte. Wichtiger noch, er war am kaiserlichen Hof ausgebildet worden und ein Favorit des damaligen Kaisers Gallus gewesen. Wenn auch von Geburt her ein Barbar, dann immerhin der Sohn eines Königs, der als politische Geisel nach Rom geschickt worden war.
Durch die Ehe hatte Julias Familie politischen Einfluss am kaiserlichen Hof gewonnen, und sie würde bald, mit etwas Glück, auch wohlhabend werden. Ballista wiederum hatte an Renommee gewonnen. Demetrius hatte mitverfolgen können, wie aus diesem konventionellen Beginn einer Ehe echte Liebe erwachsen war. Eros’ Pfeile hatten den Kyrios so tief getroffen, dass er mit keiner Dienstmagd geschlafen hatte, auch nicht dann, als seine Frau mit seinem Sohn schwanger war, ein Umstand, über den in den Unterkünften der Dienerschaft häufig diskutiert wurde, gerade in Hinblick auf seine barbarische Herkunft und die damit verbundene Triebhaftigkeit sowie den Mangel an Selbstbeherrschung.
Demetrius wollte sich bemühen, seinem Kyrios der Gefährte zu sein, den dieser so dringend benötigte, und ihm während der Mission beizustehen – einer Mission, bei der sich ihm der Magen umdrehte, wenn er nur daran dachte. Wie weit würden sie der aufgehenden Sonne entgegenreisen, über stürmische Meere hinweg und durch wilde Länder? Und welche furchtbaren Schrecken würden sie am Rand der bekannten Welt erwarten? Der junge Sklave dankte seinem griechischen Gott Zeus aufrichtig dafür, dass er unter dem Schutz eines römischen Soldaten wie Ballista stand.
Was für ein Schmierentheater, dachte Ballista. Ein ganz und gar hirnrissiges Schmierentheater. Irgendwo an Bord hatte also irgendwer geniest. Na und? Es war wohl kaum eine Überraschung, dass sich einer unter den rund dreihundert Männern eine Erkältung eingefangen hatte. Sollten die Götter beabsichtigt haben, ihm ein Omen zu senden, hätten sie ihm mit Sicherheit ein eindeutigeres Zeichen zukommen lassen.
Ballista hielt die Idee dieser griechischen Philosophen, von der er gehört hatte, dass es sich bei allen Göttern sämtlicher Völker im Grunde genommen um dieselben Götter handelte, die nur unterschiedliche Namen trugen, für äußerst unwahrscheinlich. So unterschied sich beispielsweise Jupiter, der Göttervater der Römer, doch sehr von Wotan, dem höchsten Gott von Ballistas eigenem Volk, den Angeln. Natürlich gab es hier und da auch Ähnlichkeiten. So traten beide gern in anderer Gestalt auf. Beide trieben es gern mit sterblichen Mädchen. Beide konnten ziemlich gemein werden, wenn man ihnen in die Quere kam. Andererseits gab es auch große Unterschiede zwischen ihnen. Jupiter hatte Spaß daran, sterbliche Jungen zu vögeln, während so etwas nun überhaupt nicht Wotans Ding war. Die Römer glaubten, dass Jupiter einem tatsächlich zu Hilfe kommen würde, wenn man sich ihm auf die angemessene Art und Weise mit den richtigen Opfergaben näherte. Auch schien Jupiter weniger böswillig als Wotan zu sein. Was Wotan betraf, konnte man nur darauf hoffen – selbst, wenn man wie Ballista einer seiner Abkömmlinge war –, dass der Allvater einen bis zu seiner letzten Schlacht in Ruhe ließ. Erst dann, sofern man zuvor heldenhaft gekämpft hatte, würde er seine Schildmaiden aussenden, um den Gefallenen nach Walhalla zu geleiten. Was Ballista darüber nachgrübeln ließ, warum er soeben diese goldene Schale geopfert hatte. Mit einem tiefen Seufzen beschloss er, seine Gedanken anderen Dingen zuzuwenden. Theologie war nichts für ihn.
Er konzentrierte sich wieder auf seine Mission. Es war eine ziemlich unkomplizierte Aufgabe. Gemessen an den Maßstäben römisch-imperialer Bürokratie sogar ausgesprochen unkompliziert. Er war zum neuen DuxRipae ernannt worden, zum Kommandanten sämtlicher römischer Streitkräfte entlang der Flüsse Euphrat und Tigris und dem Land dazwischen. Der Titel nahm sich auf dem Papier großartiger aus, als er es in der Realität war. Vor drei Jahren hatten die sassanidischen Perser, das neue und aggressive Imperium des Ostens, die östlichen römischen Territorien angegriffen. Erfüllt von brennendem religiösem Eifer, waren ihre Reiterhorden entlang der Flussufer durch Mesopotamien geprescht und in Syrien eingefallen. Bevor sie zurückkehrten, reich beladen mit geplünderten Schätzen und zahllose Gefangene vor sich hertreibend, hatten sie ihre Pferde an den Gestaden des Mittelmeeres getränkt. Was der Grund war, weshalb es dort heute so gut wie keine römischen Truppen mehr gab, die der neue DuxRipae hätte befehligen können.
Ballistas Instruktionen, seine Mandata, machte die Schwäche der römischen Streitkräfte im Osten zwangsläufig sichtbar. Er hatte Befehl, nach Arete in der Provinz »Hohles Syrien«, CoeleSyria, zu marschieren, den östlichsten Bezirken des Imperiums. Dort sollte er die Stadt befestigen und gegen eine Belagerung durch die Sassaniden absichern, die im Laufe des nächsten Jahres erwartet wurde. Es standen lediglich zwei reguläre römische Einheiten unter seinem Befehl, eine Vexillatio, eine aus rund tausend schwer bewaffneten Infanteristen bestehende Abteilung der LegioIIII Scythica und eine Kohorte Auxiliartruppen, eine Kohorte, die sich sowohl aus berittenen Bogenschützen als auch solchen der Infanterie zusammensetzte. Man hatte ihm aufgetragen, so viel Abgaben wie möglich in Arete einzutreiben und die Vasallenkönige der nahe gelegenen Städte Emesa und Palmyra um die Bereitstellung zusätzlicher Truppen zu bitten, natürlich nur so viele, dass ihre eigene Verteidigungsfähigkeit nicht darunter litt. Sein Auftrag lautete, Arete bis zu seiner Ablösung durch eine imperiale Feldarmee zu halten, die Kaiser Valerian höchstpersönlich befehligen würde. Um die Ablösung durch die Feldarmee zu gewährleisten, war er des Weiteren instruiert worden, sich um die Verteidigung des Haupthafens von Syrien zu kümmern, um Seleukia und um die Provinzhauptstadt Antiochia. Während der Abwesenheit des Statthalters von Coele Syria erhielt der DuxRipae die volle Befehlsgewalt und sämtliche Befugnisse eines Gouverneurs. War der Statthalter zugegen, hatte sich ihm der DuxRipae unterzuordnen.
Ballista ertappte sich dabei, wie er grimmig über die Absurditäten seiner Instruktionen lächelte, Absurditäten, wie sie typischerweise immer zustande kommen, wenn militärische Unternehmungen von Politikern geplant werden. Das Potenzial für Spannungen und Missverständnisse zwischen ihm und dem Statthalter von Syrien war gewaltig. Und wie sollte er angesichts der ihm zur Verfügung stehenden völlig unzureichenden Truppen sowie der wenigen einheimischen Bauern, die er zusätzlich rekrutieren konnte, mindestens zwei weitere Städte verteidigen können, während Arete von einer gewaltigen persischen Armee belagert wurde?
Ihm war die Ehre zuteilgeworden, persönlich zu den Kaisern Valerian und Gallienus gerufen zu werden. Der kaiserliche Vater und sein Sohn hatten äußerst freundlich mit ihm gesprochen. Ballista bewunderte beide Männer. Valerian hatte seine Mandata unterschrieben und ihm eigenhändig das Amt des DuxRipae übertragen. Trotzdem ließ sich einfach nicht bestreiten, dass die Mission schlecht geplant und mit unzureichenden Ressourcen ausgestattet worden war. Zu wenig Zeit und zu wenige Männer für ein viel zu großes Gebiet. Oder pathetischer ausgedrückt: Der Auftrag erinnerte stark an eine Hinrichtung.
Im Verlauf der drei letzten hektischen Wochen vor seiner Abreise hatte Ballista alles über das ferne Arete in Erfahrung gebracht, was er in Erfahrung bringen konnte. Die Stadt lag am Westufer des Euphrat, etwa fünfzig Meilen unterhalb des Zusammenflusses von Euphrat und Chaboras. Wie es hieß, waren ihre Mauern äußerst solide, und die glatten Felsklippen, die Arete von drei Seiten umgaben, machten die Stadt praktisch uneinnehmbar. Von einigen unbedeutenden Wachtürmen abgesehen, bildete sie den entferntesten östlichen Außenposten des Imperium Romanum. Arete war der erste Ort auf römischem Gebiet, auf den eine sassanidische persische Armee, die entlang des Euphrat stromaufwärts vorrückte, stoßen würde. Sie würde die volle Wucht eines Angriffs aushalten müssen.
Was Ballista über die Stadt in Erfahrung hatte bringen können, weckte wenig Zuversicht in ihm. Gegründet von einem der Nachfolger Alexanders des Großen, war sie zuerst den Parthern, dann den Römern und schließlich, vor gerade einmal zwei Jahren, den Sassaniden in die Hände gefallen, die ihrerseits die Parther gestürzt hatten. Sobald sich der größte Teil der persischen Armee in das Kernland weiter im Südosten zurückgezogen hatte, hatten sich die Einheimischen mithilfe einiger römischer Einheiten gegen ihre Besatzer erhoben und alle Männer der von den Sassaniden zurückgelassenen Garnison massakriert. Trotz der sie umgebenden steilen Felsklippen und ihrer massiven Mauern hatte die Stadt eindeutig ihre Schwachstellen. Worin diese konkret bestanden, würde Ballista herausfinden, sobald er Syrien erreichte. Der Kommandant der in Arete stationierten aus Auxiliarkräften bestehenden Kohorte hatte Befehl, Ballista im Hafen von Seleukia zu treffen.
Nichts schien jemals wirklich so zu sein, wie es bei den Römern den Anschein hatte. So gingen Ballista einige Fragen durch den Kopf. Woher wussten die Kaiser, dass die Sassaniden im nächsten Frühjahr in Syrien einfallen würden? Warum ausgerechnet entlang des Euphrat, statt eine der nördlichen Routen zu nehmen? Wenn die Erkenntnisse der militärischen Aufklärung solide waren, warum deutete dann nichts darauf hin, dass eine imperiale Feldarmee mobilisiert wurde? Und eine viel persönlichere Frage, warum war ausgerechnet er, Ballista, zum DuxRipae ernannt worden? Zwar hatte er tatsächlich einen gewissen Ruf als Belagerungskommandant erworben – vor fünf Jahren war er mit Gallus im Norden bei der erfolgreichen Verteidigung der Stadt Novae gegen die Goten dabei gewesen, und davor hatte er diverse Siedlungen der Einheimischen sowohl im fernen Westen als auch im Atlasgebirge erobert –, aber der Osten war absolutes Neuland für ihn. Warum hatten die Kaiser keinen ihrer erfahrensten Belagerungsingenieure nach Syrien geschickt? Sowohl Bonitus als auch Celsus kannten den Osten gut.
Hätte man ihm nur gestattet, Julia mitzunehmen. Als Tochter einer alteingesessenen Senatorenfamilie war das politische Labyrinth des römischen kaiserlichen Hofes – für Ballista so undurchschaubar – für sie ihre natürliche zweite Heimat. Sie hätte zum Kern des sich ständig verändernden Gespinsts aus Begünstigungen und Intrigen vorstoßen und den Nebel der politischen Ahnungslosigkeit fortblasen können, der ihren Ehemann einhüllte.
Der Gedanke an Julia versetzte Ballista einen geradezu körperlich schmerzhaften Stich der Sehnsucht – ihr locker fallendes ebenholzfarbenes Haar, Augen so dunkel, dass sie schwarz zu sein schienen, die Rundung ihrer Brüste und ihrer Hüften. Ballista fühlte sich einsam. Er würde sie körperlich vermissen, mehr aber noch fehlten ihm ihre Gesellschaft und das herzerweichende Plappern ihres kleinen Sohnes.
Er hatte um Erlaubnis gebeten, von seiner Familie begleitet werden zu dürfen. Valerian hatte ihm die Bitte mit Hinweis auf die mit der Mission verbundenen Gefahren abgeschlagen. Doch jeder wusste, dass der wahre Grund für die Ablehnung ein anderer war. Die Kaiser benötigten Geiseln, um sich das Wohlverhalten ihrer militärischen Befehlshaber zu sichern. Zu viele Generäle der letzten Generation hatten rebelliert.
Ballista war sich bewusst, dass er trotz all der Leute, die ihn umgaben, einsam sein würde. Er hatte einen fünfzehnköpfigen Mitarbeiterstab um sich geschart, vier Schreiber, sechs Boten, zwei Ausrufer, zwei Haruspicies, die die Omen deuteten, und Mamurra, seinen Praefectus fabrum, seinen Ersten Ingenieur. Es lag in der Natur der Dinge, dass einige dieser Männer auch Frumentarii sein würden.
Zusätzlich zu seinem offiziellen Mitarbeiterstab hatte er auch einige Angehörige seines persönlichen Haushalts mitgenommen: Calgacus, seinen Leibdiener, Maximus, seinen Leibwächter und Demetrius, seinen Sekretär. Dass er den jungen Griechen, der nun zu seinen Füßen saß, dazu bestimmt hatte, die Leitung seines Hauptquartiers zu übernehmen, sein Accensus zu sein, würde zwar das Missfallen aller Mitglieder seines offiziellen Stabes erregen, aber er benötigte jemanden auf diesem Posten, dem er vertrauen konnte. Nach römischen Maßstäben waren all diese Leute zwar Teil seiner Familia, doch für Ballista stellten sie nur einen kümmerlichen Ersatz für seine echte Familie dar.
Eine Unregelmäßigkeit in der Bewegung des Bootes erregte Ballistas Aufmerksamkeit. Die gewohnten Gerüche – Kieferpech zum Abdichten des Rumpfes, Hammelfett zum Schutz der ledernen Ruderbuchsen gegen Spritzwasser und alter sowie frischer menschlicher Schweiß – erinnerten ihn an seine Jugend auf dem wilden nördlichen Ozean. Mit ihren über drei Ebenen verteilten hundertachtzig Ruderern, zwei Masten, zwei riesigen Steuerrudern, zwanzig Deckarbeitern sowie rund siebzig Seesoldaten war die Trireme Concordia etwas gänzlich anderes als die Langboote des Nordens. Der Unterschied entsprach in etwa dem zwischen einem Rennpferd und einem Lasttier. Aber genau wie ein Rennpferd war auch eine Trireme nur für einen speziellen Zweck gedacht, und das waren Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bei ruhiger See. Bei rauer See war man in einem primitiven Langboot des Nordens sicherer, wie Ballista wusste.
Der Wind hatte auf Süden gedreht und frischte auf. Schon wühlten kurze harte Kreuzwellen die Wasseroberfläche auf, die gegen den Bug der Trireme klatschten und es den Ruderern erschwerten, die Riemen hoch genug aus dem Wasser zu heben, sodass das Boot unangenehm zu schlingern begann. Am südlichen Horizont ballten sich dunkle Sturmwolken zusammen. Ballista registrierte, dass der Kapitän und der Steuermann schon seit einiger Zeit in ein konzentriertes Gespräch vertieft waren. Während er sie noch beobachtete, gelangten sie offenbar zu einer Entscheidung. Sie wechselten noch ein paar Worte und nickten einander bekräftigend zu, dann legte der Kapitän die wenigen Schritte zu Ballista zurück.
»Das Wetter schlägt um, Dominus.«
»Was empfiehlst du?«, erkundigte sich Ballista.
»Da wir geplant hatten, direkt nach Osten zum Kap Acroceraunia und von dort aus weiter südwärts nach Korkyra zu segeln, befinden wir uns nach dem Willen der Götter nun ungefähr auf halbem Weg zwischen Italien und Griechenland. Und da wir nicht damit rechnen können, irgendwo Schutz vor dem Sturm zu finden, müssen wir ihm davonfahren.«
»Verfahre so, wie du es für richtig hältst.«
»Ja, Dominus. Dürfte ich dich bitten, deinen Männern zu befehlen, sich von den Masten zu entfernen?«
Während Demetrius über das Deck krabbelte, um die Anweisungen weiterzugeben, beriet sich der Kapitän erneut kurz mit dem Steuermann, bevor er eine Reihe von Befehlen erteilte. Nachdem die Deckarbeiter und Seesoldaten Ballistas Leute zur Steuerbord- und Backbordreling gescheucht hatten, senkten sie den Baum des Hauptmastes etwas. Die Maßnahme fand Ballistas Zustimmung. DieTrireme musste einerseits genügend Wind einfangen, um besser manövrierbar zu sein, andererseits aber nicht so viel, dass sie zu schwer kontrollierbar wurde.
Sie schwankte jetzt heftig, und der Kapitän befahl, Kurs nach Norden zu setzen. Der Steuermann gab dem Leiter der Ruderer und Bugoffizier entsprechende Anweisungen. Auf sein Zeichen hin riefen alle drei den Ruderern die Befehle zu, der Pfeifer blies in seine Pfeife, und der Steuermann legte die Ruder um. Die Galeere neigte sich beängstigend zur Seite, als sie den neuen Kurs einschlug. Auf eine weitere Reihe von Befehlen hin wurde das Hauptsegel gesetzt und so stark gerefft, dass es nur wenig Segelfläche bot, die Riemen auf den beiden unteren Ruderreihen wurden eingezogen.
Das Stampfen des Bootes ließ nach. Der Zimmermann erschien auf der Deckleiter, um dem Kapitän Bericht zu erstatten.
»Drei Riemen auf der Steuerbordseite sind gebrochen. Wir hatten einen nennenswerten Wassereinbruch, als die trockenen Steuerbordseitenplanken unter die Wasserlinie getaucht sind, aber die Pumpen arbeiten und die Planken müssten jetzt aufquellen, die Fugen sich schließen und so von selbst den Wassereinbruch stoppen.«
»Legt jede Menge Ersatzriemen in Reichweite bereit«, befahl der Kapitän. »Es könnte ein bisschen ruppig werden.«
Der Zimmermann salutierte flüchtig und verschwand wieder unter Deck.
Die letzte Stunde des Tages war gerade angebrochen, als der Sturm mit voller Wucht zuschlug. Der Himmel wurde dunkel wie der Hades, schwarz-blau mit einem unirdischen gelblichen Farbstich, der Wind heulte, die Luft war voller Gischt, und das Schiff neigte sich so weit vor, dass das Heck hoch aus dem Wasser ragte. Ballista sah, wie zwei seiner Leute über das Deck schlitterten. Einer wurde von dem Arm eines Seesoldaten gepackt und festgehalten, der andere prallte gegen die Reling. Sein Schmerzensschrei übertönte das Heulen des Sturmes.
Ballista sah zwei Hauptgefahren für die Concordia. Eine riesige Woge konnte sich über das Deck ergießen, die Pumpen konnten ausfallen und das Schiff so viel Wasser nehmen, dass es nicht mehr auf die Steuerruder reagierte, sich dann irgendwann quer in den Wind drehen und schließlich kentern. Oder aber eine Woge hob sein Heck so weit an, dass sein Bug unter Wasser gedrückt wurde und es sich längs überschlug, kieloben im Meer trieb oder sogar unterging. Letzteres würde wenigstens einen schnellen Tod bringen. Ballista wünschte sich, er könnte aufstehen und sich irgendwo festhalten, versuchen, das Stampfen und Rollen des Schiffes durch Bewegungen seines Körpers auszugleichen. Doch wie in einer Schlacht musste er seinen Untergebenen auch in dieser Situation ein leuchtendes Vorbild sein und auf dem Sessel des Kommandanten sitzen bleiben. Jetzt begriff er, warum der Sessel so fest mit dem Deck verankert war. Als er hinabblickte, sah er, dass der junge Demetrius seine Beine in der klassischen Pose eines Bittstellers umschlungen hielt. Er drückte dem Jungen ermutigend die Schulter.
Der Kapitän kämpfte sich nach achtern und bellte die rituellen Worte: »Alexander lebt und herrscht!« Wie als Antwort schoss ein gezackter Blitz backbords in die See, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnerschlag. Das Heben und Senken des Decks unter seinen Füßen geschickt kompensierend, erreichte er Ballista halb rennend, halb schlitternd. Ohne auch nur im Geringsten den Unterschied im Rang zwischen ihnen zu beachten, eine Hand um die Rückenlehne des kurulischen Throns gekrallt, die andere um Ballistas Arm, brüllte er über das Tosen des Sturms hinweg: »Muss ihr gerade genug Fahrt lassen, um sie manövrierfähig zu halten! Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass ein Steuerruder bricht! Es sei denn, der Sturm wird noch schlimmer! Wir sollten zu unseren Göttern beten!«
Ballista dachte an Ran, die grimmige Meeresgöttin des Nordens mit ihrem magischen Netz voller Ertrunkener, und gelangte zu dem Schluss, dass die Dinge auch so schon schlimm genug standen.
»Gibt es nördlich von uns irgendwelche Inseln, in deren Windschatten wir uns begeben könnten?«, rief er.
»Wenn uns der Sturm weit genug nach Norden treibt und wir noch nicht zu Neptun gegangen sind, wären da die Inseln des Diomedes. Aber – angesichts der Umstände – wäre es vielleicht besser für uns, uns von ihnen fernzuhalten.«
Plötzlich begann Demetrius zu schreien. Seine dunklen Augen leuchteten vor Angst, seine Worte waren kaum verständlich.
»… dumme Geschichten! Ein Grieche – ins Meer geweht – Inseln, die kein Mensch je gesehen hat, voller Satyre, denen Pferdeschweife aus dem Arsch wachsen, mit riesigen Schwänzen – hat ihnen ein Sklavenmädchen zugeworfen – haben sie furchtbar vergewaltigt – einzige Möglichkeit zu fliehen – geschworen, dass es die Wahrheit ist!«
»Wer weiß schon, was wahr ist!«, schrie der Kapitän zurück und verschwand wieder in Richtung des Bugs.
Im Morgengrauen, drei Tage nach Beginn des Sturms und mit zwei Tagen Verspätung umrundete die kaiserliche Trireme Concordia die Landspitze der Insel Korfu und fuhr in den winzigen halbkreisförmigen Hafen Kassiopi ein. Das Meer spiegelte das perfekte Blau eines wolkenlosen Himmels wider. Ein schwacher Hauch der vom Land her wehenden Brise, der mit der Nacht starb, strich den Männern über das Gesicht.
»Kein guter Beginn deiner Reise, Dominus«, kommentierte der Kapitän.
»Ohne deine Seemannskunst und die deiner Mannschaft hätte es sehr viel schlimmer kommen können«, erwiderte Ballista.
Der Kapitän quittierte das Kompliment mit einem Nicken. Auch wenn er ein Barbar war, dieser Dux hatte Manieren. Außerdem war er kein Feigling. Er hatte während des Sturmes nicht einen falschen Schritt gemacht. Zeitweise hatte es sogar den Anschein gehabt, als würde er die Sache regelrecht genießen, zumindest dem irren Grinsen in seinem Gesicht nach zu urteilen.
»Das Boot hat einige harte Schläge einstecken müssen. Ich fürchte, es wird mindestens vier Tage dauern, bis wir wieder in See stechen können.«
»Das lässt sich nun mal nicht ändern«, sagte Ballista. »Wenn es repariert ist, wie lange werden wir für die Fahrt nach Syrien brauchen?«
»Die Westküste Griechenlands runter, über Delos durch die Ägäis, von Rhodos nach Zypern über die offene See, dann noch einmal über die offene See von Zypern nach Syrien …« Der Kapitän runzelte nachdenklich die Stirn. »Um diese Jahreszeit …« Sein Gesicht hellte sich auf. »Bei perfektem Wetter, wenn auf dem Schiff nichts kaputtgeht, die Männer nicht krank werden und wir nirgendwo an Land länger als eine Nacht bleiben, werde ich dich in nur zwanzig Tagen nach Syrien bringen, Mitte Oktober.«
»Wie oft kommt es vor, dass eine Reise so reibungslos verläuft?«, wollte Ballista wissen.
»Ich habe Kap Tainaron mehr als fünfzigmal umrundet, und bisher ist das noch nie geschehen.«
Ballista lachte und wandte sich Mamurra zu. »Praefectus, trommle die Leute zusammen, und besorg ihnen Unterkünfte im Ausrüstungslager des Cursus publicus. Das liegt irgendwo links da drüben oben auf dem Hügel. Dafür wirst du unsere Diplomatabrauchen, die offiziellen Pässe. Nimm meinen Leibdiener mit.«
»Ja, Dominus.«
»Demetrius, du kommst mit mir.«
Maximus, Ballistas Leibwächter, schloss sich ihm an, ohne einen Befehl abzuwarten. Die beiden wechselten wortlos einen reumütigen Blick. »Aber vorher statten wir den Verletzten noch einen Besuch ab«, fügte Ballista hinzu.
Glücklicherweise war niemand getötet worden oder über Bord gegangen. Die acht Verletzten lagen in der Nähe des Bugs an Deck, fünf Ruderer, zwei Deckarbeiter und ein Mann aus Ballistas Gruppe, ein Nachrichtenbote. Alle hatten Knochenbrüche erlitten. Ein Arzt war bereits bestellt worden. Es war ein reiner Höflichkeitsbesuch, den Ballista den Männern abstattete. Er wechselte mit jedem ein paar Worte, steckte ihnen ein paar kleinere Münzen zu, und damit war die Sache erledigt. Die Geste war nötig, schließlich würde Ballista mit dieser Mannschaft noch bis nach Syrien reisen müssen.
Er streckte sich und gähnte. Niemand hatte viel Schlaf abbekommen, seit der Sturm hereingebrochen war. Er blickte sich um, die Augen im hellen Licht der Morgensonne zusammengekniffen. Das schroff aufragende ockerfarbene Epirusgebirge zeichnete sich jenseits der ionischen Meerenge in einigen Meilen Entfernung klar umrissen vor dem Himmel ab. Ballista strich sich über den vier Tage alten Bart und durch sein Haar, das ihm, steif geworden durch das getrocknete Meersalz, vom Kopf abstand. Er wusste, dass sich jeder Betrachter bei seinem Anblick an irgendeine beliebige Barbarenstatue erinnert fühlen musste – auch wenn die meisten dieser Statuen nördliche Barbaren darstellten, die mit Ketten gefesselt worden waren oder im Sterben lagen. Doch bevor er sich rasieren und ein Bad nehmen konnte, gab es noch etwas anderes zu erledigen.
»Das dort oben muss der Tempel des Zeus sein«, murmelte er.
Die Priester des Zeus warteten bereits auf den Stufen des Tempels. Sie hatten gesehen, wie die beschädigte Trireme in den Hafen eingelaufen war, und begrüßten die Männer mit offenen Armen. Ballista gab ihnen einige größere Münzen, worauf die Priester das obligatorische Räucherwerk und einen Opferhammel besorgten, um das Gelübde zu erfüllen, mit dem Ballista zum Höhepunkt des Sturmes für alle sichtbar sichere Landung von den Göttern erfleht hatte. Einer der Priester begutachtete die Leber des geschlachteten Hammels und erklärte das Ergebnis als sehr ermutigend. Die Götter sollten sich am Rauch der mit Fett umwickelten verbrannten Knochen laben, während die Priester selbst später ein viel substanzielleres Mahl aus gegrilltem Fleisch genießen würden. Dass Ballista großzügig auf seinen Anteil verzichtete, wurde als freundlicher Akt gegenüber den Menschen und Göttern begrüßt.
Nachdem sie den Tempel verlassen hatten, ergab sich eines der üblichen kleineren Probleme, wie sie jede Reise mit sich bringt. Die drei Männer waren allein, und keiner wusste, wo genau die Poststation lag.
»Ich habe nicht vor, den ganzen Morgen damit zu verbringen, kreuz und quer in den Hügeln herumzulaufen«, sagte Ballista. »Maximus, würdest du bitte zurück zur Concordia gehen und dich erkundigen, wo die Station liegt?«
Der Leibwächter war kaum außer Hörweite, als sich Ballista an Demetrius wandte. »Ich dachte, ich sollte lieber warten, bis wir allein sind. Was hat es mit diesem ganzen verrückten Zeugs über Mythen und Inseln voller Vergewaltiger auf sich, von dem du während des Sturmes gequatscht hast?«
»Ich – kann mich nicht erinnern, Kyrios.« Demetrius’ dunkle Augen wichen denen Ballistas aus. Ballista wartete schweigend, und plötzlich sprudelte es geradezu hastig aus dem Jungen hervor. »Ich hatte Angst, habe Unfug geredet, weil ich mich so gefürchtet hatte – der Sturm. Das Wasser und so – ich dachte, wir würden sterben …«
Ballista musterte ihn unverwandt. »Der Kapitän hatte gerade von den Inseln des Diomedes gesprochen, bevor du losgelegt hast. Was hat er gesagt?«
»Ich weiß nicht, Kyrios.«
»Demetrius, als ich es das letzte Mal überprüft habe, warst du immer noch mein Sklave, mein Eigentum. War es nicht einer deiner geliebten alten Schriftsteller, der Sklaven als ›Werkzeuge mit Stimme‹ bezeichnet hat? Sag mir, worüber hast du mit dem Kapitän gesprochen?«
»Er hatte vor, dir von dem Mythos der Insel des Diomedes zu erzählen, und ich wollte ihn davon abhalten. Deshalb bin ich ihm ins Wort gefallen und habe stattdessen die Geschichte von der Insel der Satyre erzählt. Sie stammt aus Die Beschreibung Griechenlands von Pausanias. Ich wollte damit zeigen, dass alle diese Geschichten wahrscheinlich nicht wahr sind, auch wenn einige davon manchmal so verführerisch klingen, dass ihnen sogar so gebildete Schriftsteller wie Pausanias auf den Leim gehen.« Der Junge verstummte verlegen.
»Also, was hat es mit dem Mythos über die Inseln des Diomedes auf sich?«, hakte Ballista nach.
Die Wangen des Jungen erröteten. »Das ist nur eine alberne Geschichte.«
»Raus damit!«, befahl Ballista.
»Man erzählt sich, dass der griechische Held Diomedes nach dem Trojanischen Krieg nicht nach Hause zurückgekehrt ist, sondern sich auf zwei fernen Inseln in der Adria niedergelassen hat«, berichtete Demetrius widerstrebend. »Es soll dort ein Heiligtum geben, das ihm gewidmet ist und um das herum große Vögel mit großen scharfen Schnäbeln hocken. Die Vögel bleiben der Legende nach ruhig, wenn ein Grieche an Land geht. Sollte es aber ein Barbar versuchen, steigen sie auf, stoßen durch die Luft herab und versuchen, ihn zu töten. Angeblich sind es die Gefährten Diomedes’, die in Vögel verwandelt wurden.«
»Und da wolltest du wohl meine Gefühle nicht verletzen?« Ballista warf den Kopf in den Nacken und lachte schallend. »Es gibt da etwas, das dir offensichtlich niemand erzählt hat. In dem barbarischen Stamm, aus dem ich komme, spielen Gefühle bei niemandem eine große Rolle – es sei denn, wir sind sehr betrunken.«
II
Die Götter zeigten sich der Concordia gegenüber seit ihrer Abfahrt aus Kassiopi wohlgesinnt. Die überraschende Wildheit von Notus, dem Südwind, war von Boreas, dem Nordwind abgelöst worden, der sanft und freundlich blies. Die Berghänge des Epirus, Akarnaniens und des Peloponnes zur Linken, war die Concordia größtenteils unter Segeln die Westküste Griechenlands hinabgefahren. Dann hatte sie Kap Tainaron umrundet, war zwischen Malea und Kythira hindurchgesegelt und hatte danach, diesmal unter Einsatz der Ruderer, Kurs Nordost in die Ägäis hinein auf die Kykladen gesetzt, auf Melos, Seriphos und Syros. Nun, sieben Tage später, brauchte sie nur noch Rheina zu umrunden, um Delos in wenigen Stunden zu erreichen.
Delos, eine winzige, fast vegetationslose Felsinsel im Zentrum der Kykladen, war schon immer etwas Besonderes gewesen. Anfangs war sie unstet durch das Meer gewandert. Nachdem Leto, verführt durch den Göttervater Zeus und gejagt von dessen eifersüchtiger Frau Hera, von allen anderen Orten zurückgewiesen worden war, hatte sie Zuflucht auf Delos gefunden und dort Apollon sowie dessen Schwester Artemis geboren. Zur Belohnung dafür war Delos für alle Zeiten an Ort und Stelle fest verankert worden. Kranke und Frauen kurz vor der Niederkunft wurden nach Rheineia übergesetzt, denn niemand sollte auf Delos geboren werden oder dort sterben. Lange Jahre hatten die Insel und ihre Schreine gut floriert, unbefestigt in sicherer Obhut der Götter. Während des goldenen Zeitalters Griechenlands war Delos zum Hauptquartier des von den Athenern zum Freiheitskampf gegen die Perser gegründeten Attischen Seebunds bestimmt worden.
Mit dem Aufkommen Roms, der Gewitterfront aus dem Westen, hatte sich alles verändert. Die Römer hatten Delos zum Freihafen erklärt, nicht aus religiösen Gründen, sondern aus ganz profanem wirtschaftlichem Interesse. Ihr Wohlstand und ihre Gier hatten die Insel in den größten Sklavenmarkt der Welt verwandelt. Es hieß, auf dem Höhepunkt wären mehr als zehntausend geschundene Männer, Frauen und Kinder täglich auf Delos verkauft worden. Und doch hatten es die Römer versäumt, Delos zu schützen. Zweimal innerhalb von zwanzig Jahren war die Insel geplündert worden. Es entbehrte nicht einer bitteren Ironie, dass ausgerechnet diejenigen, die jahrelang gut an der Sklaverei verdient hatten, letztendlich selbst von Piraten in die Sklaverei verschleppt worden waren. Noch immer zogen Delos’ Heiligtümer und seine günstige Position als Rastplatz auf halbem Weg zwischen Europa und Kleinasien jede Menge Seeleute, Händler und Pilger an, aber die Insel war nur noch ein Schatten ihrer früheren Größe.
Demetrius’ Blick hing wie gebannt an Delos. Zu seiner Rechten zeichneten sich die grauen, zackigen Konturen des Berges Cynthus ab. Auf seinem Gipfel stand das Heiligtum von Zeus und Athene. Darunter drängten sich die Heiligtümer anderer Gottheiten, nicht nur griechischer, sondern auch ägyptischer und syrischer. Wiederum darunter befand sich die Altstadt, ein wildes Durcheinander aus weiß getünchten Häuserwänden und mit roten Ziegeln gedeckten Dächern, die im Sonnenlicht leuchteten. Die kolossale Statue Apollons erregte Demetrius’ Aufmerksamkeit. Der Kopf mit dem langen geflochtenen Haar, vor etlichen Generationen erschaffen, war zur Seite gedreht. Das lächelnde Gesicht blickte nach links auf den heiligen See. Und dort neben dem heiligen See lag das, dessen Anblick Demetrius fürchtete, seit er erfahren hatte, wohin die Concordia unterwegs war.
Er hatte den furchtbaren Ort nur einmal gesehen, und das war vor fünf Jahren gewesen, aber er würde die Agora der Italiener nie vergessen. Man hatte ihn entkleidet und gebadet – die Ware musste schließlich gut aussehen – und dann zu dem Versteigerungspodest geführt. Dort hatte er – nach der Androhung von Schlägen oder Schlimmerem – das Musterbeispiel eines fügsamen Sklaven abgegeben. Er konnte die Ausdünstungen der dicht zusammengepferchten Menschen in der gnadenlosen mediterranen Sonne riechen. Der Versteigerer spulte seine Litanei ab: »… gebildet – würde einen guten Sekretär oder Buchhalter abgeben …« Fetzen derber Kommentare drangen an seine Ohren: »… gebildetes Arschloch, würde ich sagen – oft benutzt, wenn er aus Turpilius’ Besitz stammt …« Eine kurze Versteigerung, und das Geschäft war beendet. Die Erinnerung daran ließ Demetrius’ Gesicht heiß werden und seine Augen, die die Tränen der Wut mühsam zurückgehalten hatten, brennen.
Er hatte sich immer bemüht, nie an die Agora der Italiener zurückzudenken. Für ihn war sie der Tiefpunkt von drei Jahren Finsternis nach dem frühlingshaften Licht der Zeit davor gewesen. Er sprach auch nie von seinem früheren Leben, er vermittelte nach außen hin immer den Eindruck, in die Sklaverei hineingeboren worden zu sein.
Das Theaterviertel der Altstadt bestand aus einem Gewirr schmaler gewundener Gassen, über denen sich die nach außen geneigten Wände der schäbigen Häuser beinahe berührten. Das Sonnenlicht hatte Mühe, seinen Weg bis auf den Boden zu finden. Jetzt, da die Sonne sich anschickte, hinter Rheneia zu versinken, herrschte hier beinahe völlige Dunkelheit. Die Frumentarii hatten nicht daran gedacht, eine Fackel mitzubringen oder einen Fackelträger zu mieten.
»Scheiße!«, fluchte der Spanier.
»Was?«
»Scheiße. Ich bin gerade in einen großen Haufen Scheiße getreten!« Nun, nachdem er es erwähnt hatte, registrierten die beiden anderen, wie sehr es in der Gasse stank.
»Da. Ein Wegweiser für die Matrosch’n, wo’s zum Hafen geht«, sagte der Nordafrikaner. In Augenhöhe befand sich eine große Phallusskulptur. Unter den Hoden prangte ein lächelndes Gesicht. Die Spione schlugen die Richtung ein, in die der Phallus zeigte. Hin und wieder blieb der Spanier kurz stehen, um die Sohle seiner Sandale am Straßenpflaster abzustreifen.
Nach einer kurzen Strecke in der zunehmenden Dunkelheit erreichten die drei Männer eine von zwei Phallusskulpturen gesäumte Tür. Ein großer, brutal aussehender Türsteher ließ sie eintreten. Man geleitete sie zu einer Bank vor einem Tisch, an dem eine unvorstellbar hässliche alte Vettel saß. Sie verlangte ohne Umschweife Geld, bevor sie ihnen ihre Getränke brachte, Wein und Wasser im Mischverhältnis zwei zu fünf. Die restliche Kundschaft bestand aus zwei Einheimischen, die völlig in ihr Gespräch vertieft waren.
»Perfekt. Absolut verfickt perfekt«, sagte der Spion aus Subura. Wenn überhaupt möglich, war der Gestank hier drinnen sogar noch schlimmer als draußen. Schaler Weindunst und alter Schweiß mischten sich in den alles überlagernden Geruch von Moder und Fäulnis, Pisse und Scheiße. »Wie kommt es eigentlich, dass ihr zwei gut bezahlte und geachtete Schreiber im persönlichen Stab des Dux seid, während ein gebürtiger Römer wie ich, einer von Romulus’ Kindern, die Rolle eines einfachen Boten spielen muss?«
»Ist es etwa unsere Schuld, dass du so schlecht schreiben kannst?«, fragte der Spanier.
»Friss Scheiße, Sertorius.« Der Spitzname stammte von einem berühmten römischen Rebellen ab, der in Spanien gelebt hatte. »Für dich und unseren Hannibal hier ist Rom nicht mehr als eine Stiefmutter.«
»Ja, es musch wunderbar sein, direkt aus Romulus’ Jauchegrube zu stammen«, sagte der Nordafrikaner.