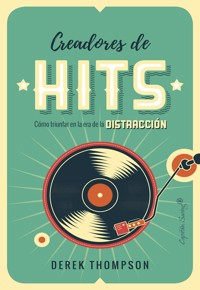2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hit Makers ist ein Buch über die mit Abstand wertvollste Währung in der vernetzten Businesswelt des im 21. Jahrhunderts: die Aufmerksamkeit der Menschen. Derek Thompson ergründet spannend und mit vielen Beispielen die Geheimnisse dieser Währung – bei Filmen, Musik, Kunst und Design. Wann wird ein Film ein Blockbuster? Wann ein Song ein Nummer-eins-Hit? Und wie wird aus einem Filmchen im Internet ein Klick-Hit? Und mit am wichtigsten: Wie verbreiten sich Idee und Produkte? Er belegt: Nichts geht einfach "viral", sondern es wirken psychologische Mechanismen im Hintergrund. Thompson schreibt nichts weniger als eine Geschichte der Popularität, von Bill Haleys "Rock Around the Clock" bis hin zu Facebook. Und schafft ein unerlässliches Werk für alle Künstler, Produktdesigner, Marketingschaffende, Kommunikationsexperten und Unternehmen – eine Anleitung für Hits.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Derek Thompson
Hit Makers
Aufmerksamkeit im Zeitalter der Ablenkungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:[email protected]
1. Auflage 2017
© 2017 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,Nymphenburger Straße 86D-80636 MünchenTel.: 089 651285-0Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2017 by Derek ThompsonDie englische Originalausgabe erschien 2017 bei Penguin Press, einem Imprint der Penguin RandomHouse LLC, unter dem Titel Hit Makers.Teile des Buches erschienen bereits im The Atlantic. Copyright © 2013, 2014, 2016 by Derek Thompson
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Jordan T.A. Wegberg, BerlinRedaktion: Matthias Michel, WiesbadenUmschlaggestaltung: Karen Schmidt, MünchenSatz: Helmut Schaffer, Hofheim-WallauDruck: GGP Media GmbH, PößneckPrinted in Germany
ISBN Print 978-3-86881-672-3ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-928-3ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-929-0
Weitere Informationen zum Verlag finden sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Einleitung: Das Lied, das die Welt eroberte
TEIL 1: POPULARITÄT UND VERSTAND
1. Die Macht der Publicity
Ruhm und Vertrautheit – in Kunst, Musik und Politik
2. Die MAYA-Regel
Aha-Momente in Fernsehen, Technologie und Design
3. Die Musik der Geräusche
Die Macht der Wiederholung in Lied und Sprache
Zwischenspiel: Schauder
4. Der Mythen schaffende Geist I: Die Macht der Story
Die Summe der tausend Mythen
5. Der Mythen schaffende Geist II: Die dunkle Seite der Hits
Warum Geschichten wie Waffen sind
6. Die Geburtsstunde der Mode
»Ich mag es, weil es beliebt ist.«»Ich hasse es, weil es beliebt ist.«
Zwischenspiel: Kurze Geschichte des Teenagers
TEIL 2: POPULARITÄT UND MARKT
7. Beliebigkeit und Rock’n’Roll
Grillen, Chaos und der größte Hit in der Geschichte des Rock’n’Roll
8. Der virale Mythos
Fifty Shades of Grey und die Wahrheit darüber, warum manche Hits so erfolgreich werden
9. Das Publikum meines Publikums
Cluster, Cliquen, Sekten
Zwischenspiel: Le Panache
10. Was die Leute wollen I: Die Ökonomie der Prophezeiung
Das Business des überwiegenden Irrtums
11. Was die Leute wollen II: Die Geschichte von Pixeln und Tinte
Was die Leute von den Nachrichten erwarten (… oft genug nicht die Nachrichten)
Zwischenspiel: 828 Broadway
12. Die Zukunft der Hits: Reich und Stadtstaat
Vertraute Überraschungen, Netzwerke und magischer Feenstaub
Danksagung
Anmerkungen
Register
Einleitung: Das Lied, das die Welt eroberte
Marco Polo beschreibt eine Brücke, Stein für Stein. »Aber welcher davon ist der Stein, der die Brücke trägt?«, fragt Kublai Khan. »Die Brücke wird nicht von diesem oder jenem Stein getragen«, antwortet Marco, »sondern von der Linie des Bogens, den sie bilden.«
Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte
»Die Kollegs der Kartographen erstellten eine Karte des Reichs, die die Größe des Reichs besaß und sich mit ihm in jedem Punkt deckte. Die nachfolgenden Geschlechter, dem Studium der Kartographie minder ergeben, hielten diese ausgedehnte Karte für unnütz und überließen sie, nicht ohne Ruchlosigkeit, den Unbilden der Sonne und der Winter. In den Wüsten des Westens überdauern zerstückelte Ruinen der Karte, behaust von Tieren und von Bettlern …«
Jorge Luis Borges, Von der Strenge der Wissenschaft
Das erste Lied, das ich liebte, war das meiner Mutter. Jeden Abend saß sie auf der linken Seite meines Bettes und sang dasselbe Schlaflied. Ihre Stimme war süß und zart und passte genau in ein Schlafzimmer. Wenn wir bei meinen Großeltern mütterlicherseits in Detroit waren, sang meine Momi dasselbe Lied mit etwas tieferen Tönen, mit einem rauchigeren Timbre und deutschem Text. Ich wusste nicht, was die Worte bedeuteten, aber ich liebte sie wegen ihrer altertümlichen Rätselhaftigkeit in dem alten Haus: »Guten Abend, gut’ Nacht …«
Damals glaubte ich, das Lied sei ein Familienerbe. Aber in der ersten Klasse, bei einer meiner ersten Auswärtsübernachtungen in meiner Heimatstadt in Virginia, drehte mein Klassenkamerad an der kleinen Spieluhr neben seinem Bett, und digitale Glöckchen klimperten die vertraute Melodie.
So erfuhr ich, dass das Lied meiner Mutter kein Familiengeheimnis war. Es war erstaunlich weitverbreitet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben auch Sie es schon Dutzende, vielleicht sogar Tausende Male gehört. Es handelt sich um Johannes Brahms’ »Wiegenlied« mit dem Text »Guten Abend, gut’ Nacht, mit Rosen bedacht …«
Millionen von Familien singen seit über einem Jahrhundert allabendlich eine Version des Brahms’schen Schlaflieds für ihre Kinder. Es ist eine der meistverbreiteten Melodien der westlichen Welt. In Anbetracht der Tatsache, dass ein Schlaflied jeden Abend an Hunderten Tagen des Jahres und über mehrere Jahre im Leben eines Kindes hinweg gesungen wird, besteht eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass Brahms’ Wiegenlied eins der meistgehörten Lieder der westlichen Hemisphäre, wenn nicht sogar der gesamten Welt ist.
Das »Wiegenlied« ist unbestreitbar schön und schlicht und repetitiv – alle notwendigen Elemente, die ein Lied haben muss, das die Kehlen müder Eltern für ihre Kinder hervorbringen. Aber eine derart universelle Melodie ist auch ein Geheimnis. Wie konnte ein deutsches Gesangsstück des 19. Jahrhunderts zu einem der beliebtesten Lieder der Welt werden?
Johannes Brahms wurde 1833 in Hamburg geboren und war einer der bekanntesten Komponisten seiner Zeit. Das »Wiegenlied« war sein unmittelbarster Erfolg.1 Es erschien auf dem Höhepunkt seiner Popularität im Jahre 1868 und war als Schlaflied für das neugeborene Kind einer alten Freundin geschrieben worden. Doch bald wurde es auf dem gesamten Kontinent und auf der ganzen Welt zum Hit.
Einer von Brahms’ Tricks zum Auffüllen seiner sprudelnden Quelle hübscher Melodien war die Vermischung von Genres. Er studierte die Musik seiner Heimat und bediente sich raffiniert griffigen Refrains. Wenn er durch Europa reiste, besuchte er in den Städten oft die Bibliotheken und stöberte in deren Sammlungen von Volksliedern, um ganze Stapel von Notenblättern zu studieren und seine Lieblingsstellen abzuschreiben. Genau wie ein fachkundiger moderner Songwriter die Hookline eines anderen Künstlers für seine eigene Musik sampelt – oder wie ein cleverer Designer sich die Schnörkel anderer Produkte zu eigen macht –, fügte Brahms von überallher aufgeschnappte Volksliedmelodien in sein musikalisches Werk ein.
Ein paar Jahre, bevor er sein berühmtes Schlaflied schrieb, verliebte Brahms sich in Hamburg in eine junge Sopranistin namens Bertha. Sie sang ihm viele Lieder vor, darunter auch Alexander Baumanns österreichisches Volkslied »S’is anderscht«. Einige Jahre später heiratete Bertha einen anderen Mann; sie benannten ihren Sohn Johannes nach dem Komponisten. Brahms wollte ihr seine Dankbarkeit zeigen – und vielleicht seine anhaltende Zuneigung. Er schrieb dem Paar ein Wiegenlied auf Grundlage des alten österreichischen Volksliedes, das Bertha ihm früher immer vorgesungen hatte. Den Text entnahm Brahms einer berühmten deutschen Gedichtsammlung, Des Knaben Wunderhorn:
Guten Abend, gut’ Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf unter die Deck.
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.
Im Sommer 1868 schickte Brahms der Familie die Noten zu dem Lied mit einer Anmerkung. »Frau Bertha wird nun gleich sehen, dass ich das Wiegenlied gestern ganz bloß für ihren Kleinen gemacht habe; sie wird es auch, wie ich, ganz in Ordnung finden, dass, während sie den Hans in Schlaf singt, der Mann sie ansingt und ein Liebeslied murmelt.« Die erste größere Aufführung des Liedes erfolgte ein Jahr später, am 22. Dezember 1869, in Wien. Sie wurde ein riesiger kommerzieller Erfolg. Brahms’ Verleger beeilte sich, vierzehn verschiedene Arrangements des Liedes herauszubringen – bei Weitem die meisten aller Brahms-Stücke –, darunter für vier männliche Singstimmen, für drei Pianos, für Harfe und für Zither.
»Viele von Brahms’ Melodien sind wunderschön, aber das ›Wiegenlied‹ erfüllt auf einzigartige Weise die allgemeine Struktur, die moderne Musikzuhörer in Refrains erkennen«, sagte Daniel Beller-McKenna, ein Brahms-Forscher und Mitglied im Vorstand der American Brahms Society. »Es besitzt die zentralen Elemente von Wiederholung und milder Überraschung«, fuhr er fort und summte während unseres Gesprächs immer wieder die Melodie. Das »Wiegenlied« war ein Original. Aber es war auch überraschend vertraut, eine Kombination aus Volkslied-Anspielungen und Hamburger Erinnerungen. Ein Musikhistoriker sagte, das Stück ähnele Baumanns usprünglichem Volkslied so sehr, dass man es als »verschleierte, aber erkennbare Parodie« bezeichnen könne.2
Doch das beantwortet immer noch nicht die wichtigste Frage in Bezug auf das Schlaflied: Wie hat es sich weltweit verbreitet? Im 20. Jahrhundert wurden die meisten Popsongs bekannt, weil sie immer und immer wieder im Radio gespielt oder über andere Massenmedien gesendet wurden. Die Songs fanden den Weg zum Ohr des Zuhörers über Autolautsprecher, Fernsehgeräte und Kinos. Um einen Song zu mögen, mussten Sie ihn zuerst mal finden; oder, aus einer anderen Perspektive, der Song musste Sie finden.
Im 19. Jahrhundert dagegen wurden die Lieder berühmter Komponisten vielleicht in verschiedenen Konzerthäusern aufgeführt, aber es gab keine geeignete Technologie, um sie rasch auf aller Welt zu verbreiten. Um ein Gespür für die Langsamkeit zu bekommen, mit der Kultur sich in Brahms’ Zeiten ausbreitete, denken Sie an die gemächliche transatlantische Reise von Beethovens 9. Symphonie.3 Ihre Uraufführung fand 1824 im Wiener Theater am Kärntnertor statt, als Beethoven Berichten zufolge schon so taub war, dass er den donnernden Applaus nicht hören konnte. Doch erst zweiundzwanzig Jahre später, nämlich 1846 in New York, gab es die erste Aufführung in den Vereinigten Staaten. Neun weitere Jahre dauerte es, bis die Symphonie erstmals in Boston gespielt wurde.
Stellen Sie sich vor, jedes künstlerische Meisterwerk würde heutzutage einunddreißig Jahre brauchen, um den großen Teich zu überqueren. Michael Jacksons Album Thriller kam 1982 heraus, was bedeutet, dass Jackson bereits seit vier Jahren tot gewesen wäre, ehe die Londoner 2013 den Titelsong »Billie Jean« hätten hören können. Please Please Me, das erste Album der Beatles, erschien im März 1963 in Großbritannien, also hätten die Amerikaner erst mitten in Clintons Amtszeit die Fab Four kennengelernt. Für das Jahr 2021 könnten die Europäer sich auf die erste Staffel von Seinfeld freuen.
Ende der 1870er-Jahre wanderten noch keine Radiowellen hin und her. Dafür aber deutsche Familien. Während Brahms seinen künstlerischen Höhepunkt erreichte, war Mitteleuropa eine Brutstätte von Chaos, Krieg und Hungersnöten. In den zwanzig Jahren nach der Uraufführung des »Wiegenlieds« in Wien 1869 schoss die Zahl deutscher Auswanderer in die Höhe und erreichte in den 1880er-Jahren einen Rekord.4 Zwischen 1870 und 1890 nahmen die Vereinigten Staaten mehr deutsche Auswanderer auf als im gesamten 20. Jahrhundert. Ein beliebtes Schlaflied profitierte von einer zufälligen Zeiterscheinung und wurde nach ganz Europa und Amerika exportiert, besonders in den nördlichen Teil des Landes, wo sich die meisten Deutschen ansiedelten, vom Nordosten und Pennsylvania über Ohio und Michigan bis nach Wisconsin.
Ein historischer Exodus deutschsprachiger Familien erreichte, was 1870 weder das Radio noch andere Technologien leisten konnten. Eine beispiellose transatlantische Migrationswelle brachte das Wiegenlied nach Amerika.
Im Jahre 1879, auf dem Höhepunkt der deutschen Einwanderung, lebte ein Teilzeit-Rabbiner namens Joseph Kahn in der kleinen Stadt Echternach im östlichen Luxemburg. Joseph und seine Frau Rosalie reisten mit ihren fünf Kindern per Schiff in die Vereinigten Staaten, auf der Suche nach einem besseren Leben. Wie viele deutschsprachige jüdische Immigranten ließen sie sich schließlich im Mittleren Westen nieder, in Michigan.
Josephs und Rosalies Enkel war ein gut aussehender, frühzeitig kahl werdender junger Mann namens William, genannt Bill, der es liebte, auf seinem Anwesen in Franklin, einem grünen Vorort von Detroit, Poolpartys zu veranstalten. Eines Nachmittags im Jahr 1948 begegnete er auf einer Wiese in der Nähe seines efeuumrankten Hauses einem jungen Mädchen namens Ellen, dessen Familie vor den Nazis aus Deutschland geflohen war. Sie verliebten sich ineinander und heirateten innerhalb von acht Monaten. Im Oktober darauf bekamen Bill und Ellen eine Tochter. Sie sollte das Schlaflied von Brahms im deutschen Original im Lauf ihres Lebens Tausende Male zu hören bekommen. Ich kannte dieses Mädchen ebenfalls. Es war meine Mutter.
In diesem Buch geht es um Hits, jene wenigen Produkte und Ideen, die in der Popkultur und in den Medien außergewöhnliche Beliebtheit und kommerziellen Erfolg erzielen. Die These dieses Buches lautet: Obgleich viele Nummer-eins-Songs, Fernsehsendungen, Kinohits, Internet-Memes und allgegenwärtige Apps aus dem Nichts zu kommen scheinen, wird dieses kulturelle Chaos von bestimmten Regeln geleitet: der Psychologie dessen, warum Menschen das mögen, was sie mögen, den sozialen Netzwerken, über die Ideen verbreitet werden, und der Ökonomie der kulturellen Märkte. Es gibt Möglichkeiten, Hits zu manipulieren, und, was noch wichtiger ist, es gibt die Möglichkeit, zu erkennen, wann Popularität manipuliert wird.
Im Kern stellt dieses Buch zwei Fragen:
1.Was ist das Geheimnis, ein Produkt zu erzeugen, das andere mögen – in der Musik, bei Filmen, im Fernsehen, bei Büchern, Spielen, Apps und in der gesamten weiten Kulturlandschaft?
2.Warum scheitern einige Produkte auf diesen Märkten, während ähnliche Ideen Fuß fassen und zu gewaltigen Hits werden?
Diese beiden Fragen hängen miteinander zusammen, doch sie sind nicht dasselbe, und die Antwort auf die erste Frage hat sich im Laufe der Zeit weniger verändert als die Antwort auf die zweite. Produkte verändern sich, Moden kommen und gehen. Aber die Beschaffenheit des menschlichen Geistes ist uralt, und die meisten menschlichen Grundbedürfnisse – dazugehören, davonkommen, nach etwas streben, verstehen und verstanden werden – währen ewig. Das ist der Grund, warum die Geschichten von Hits sich im Laufe der Geschichte ähneln, und wie wir sehen werden, spiegeln sowohl ihre Schöpfer als auch ihr Publikum immer und immer wieder die Ängste und Freuden vergangener Kulturen wider.
In der Geschichte des Brahms’schen »Wiegenlieds« kann man Antworten auf beide zentrale Fragen finden. Warum war das Publikum augenblicklich begeistert von diesem Lied? Vielleicht, weil viele von ihnen die Melodie schon mal gehört hatten, oder zumindest etwas Ähnliches. Brahms hatte Anleihen bei einem bekannten österreichischen Volkslied gemacht und es mit Konzertsaal-Grandezza ausgeschmückt. Sein Schlaflied war nicht deshalb ein sofortiger Erfolg, weil es eine mit nichts zu vergleichende Neuheit darstellte, sondern weil es eine vertraute Melodie im neuen Rahmen bot.
Manche neuen Produkte und Ideen fügen sich in die ausgefahrenen Furchen der menschlichen Erwartungen. In fünfzehn der letzten sechzehn Jahre war der erfolgreichste Kinofilm in Amerika die Fortsetzung eines bereits zuvor erfolgreichen Films (z. B. Star Wars) oder die Adaption eines zuvor erfolgreichen Buches (z. B. Der Grinch).5 Die Macht der wohlverborgenen Vertrautheit erstreckt sich aber weit über die Filmbranche hinaus. Es kann auch ein politischer Essay sein, der mit neuer und beeindruckender Klarheit eine Idee formuliert, die der Leser schon hatte, die er aber nie in Worte gefasst hat. Das kann eine Fernsehsendung sein, die eine fremde Welt zeigt, jedoch mit so wiedererkennbaren Figuren, dass der Zuschauer das Gefühl hat, er stecke in ihrer Haut. Es kann ein Kunstwerk sein, das mit einer ganz neuen Form verblüfft, aber dennoch eine Bedeutung durchscheinen lässt. In der Psychologie der Ästhetik gibt es eine Bezeichnung für jenen Augenblick zwischen der Angst vor dem Neuen und dem befriedigenden Einsetzen des Begreifens: das »ästhetische Aha«.
Das ist die erste These dieses Buches. Die meisten Verbraucher sind gleichzeitig neophil – neugierig auf die Entdeckung von Neuem – und zutiefst neophob – voller Angst vor allem, das zu neu ist. Die besten Hitmacher haben das Talent, durch die Verknüpfung von Alt und Neu, von Furcht und Begreifen Augenblicke der Sinnhaftigkeit zu erzeugen. Sie sind Architekten vertrauter Überraschungen.
Das »Wiegenlied« war für sein deutsches Publikum eine solche vertraute Überraschung. Doch das allein machte es nicht zu einem der beliebtesten Lieder der gesamten westlichen Welt. Ohne die Kriege, die Europa in den 1870er- und 1880er-Jahren erschütterten, wären Millionen von Deutschen nicht ausgewandert, und vielleicht hätten Millionen von Kindern, die das Lied heute in- und auswendig kennen, es niemals gehört. Brahms’ musikalisches Genie verlieh dem Lied seine Anziehungskraft. Aber die deutsche Emigration verschaffte ihm seine Reichweite.
Die Art und Weise, wie Ideen sich ausbreiten, sowohl auf als auch innerhalb von Gruppen, ist überaus wichtig und wird häufig missverstanden. Die meisten Menschen denken nicht viel über all die Songs, Bücher und Produkte nach, die ihnen noch nie begegnet sind. Doch ein brillanter Artikel in einer unbekannten Zeitschrift bleibt ungelesen, ein mitreißender Song ohne Radioausstrahlung welkt im Verborgenen dahin, und ein bewegender Dokumentarfilm ohne Sendeplatz ist zur Vergessenheit verdammt, egal, wie großartig er sein mag. Die erste Frage für Menschen mit einem neuen Produkt lautet also: Wie bringe ich meine Idee an meine Zielgruppe?
Das »Wiegenlied« wurde nur vor einigen Tausend Menschen live gespielt. Doch heute kennen Millionen diese Melodie. Das Lied verbreitete sich weit über das Wiener Opernhaus hinaus durch Familien und Freunde und eine Vielzahl sozialer Netzwerker auf aller Welt. Die tiefer liegende Frage für Menschen mit einem neuen Produkt oder einer Idee lautet also: Wie kann ich etwas machen, das Menschen aus freien Stücken an andere weitergeben – an die Zielgruppe meiner Zielgruppe? Es gibt keine Formel dafür. Aber es gibt ein paar grundlegende Fakten darüber, was Leute zusammen- und zum Reden bringt – zum Beispiel, warum der Verkauf einer Dating-App genau die entgegengesetzte Strategie erfordert wie der Verkauf einer angesagten Modekollektion, und warum die Menschen schlechte Nachrichten ihren Freunden erzählen und gute Nachrichten bei Facebook posten. Etwas Schönes zu machen ist das Entscheidende. Aber diese menschlichen Netzwerke zu verstehen ist ebenso essenziell für Hitmacher.
Manche Menschen halten Vertrieb und Werbung für sinnlos, langweilig, geschmacklos oder alles auf einmal. Doch dies sind die unterirdischen Wurzeln, die schöne Dinge an die Oberfläche bringen, wo die Zielgruppe sie entdecken kann. Es genügt nicht, die Produkte selbst zu untersuchen, um den ihnen innewohnenden Reiz zu begreifen, denn häufig können die beliebtesten Dinge kaum als »das Beste« bezeichnet werden. Sie sind deshalb überall die beliebtesten, weil sie einfach überall sind. »Content is king« – der Inhalt ist der König, heißt es. Aber der Vertrieb ist das Königreich.
Es ist aufschlussreich, die Geschichte des »Wiegenlieds«, eines Hits der alten Welt, mit jener eines durch und durch neuzeitlichen Hits zu vergleichen, nämlich der Foto-App Instagram, um die gemeinsamen Themen des Vertrauten und der Macht der Netzwerke zu betrachten.
Wenn der Markt für Klaviermusik des 19. Jahrhunderts überlaufen war, so gilt das erst recht für Foto-Sharing-Apps der letzten Jahre. Im Jahr 1999 wurden laut Jahresbericht 2000 der Firma Kodak weltweit 80 Milliarden Bilder gemacht und 70 Millionen Kameras verkauft.6 Heute werden jeden Monat mehr als 80 Milliarden Fotos auf etlichen Milliarden Handys, Tablets, Computern und Kameras gespeichert.7
Wie mit vielen anderen Apps kann man mit Instagram Bilder machen und sie mit Retro-Filtern versehen. Die Gestaltung war beinahe perfekt für ihre Zwecke: einfach und ansprechend mit intuitiven Möglichkeiten, Bilder aus dem menschlichen Alltag zu bearbeiten und weiterzuleiten. Aber es gab viele einfache, ansprechende Apps in diesem Bereich, und Instagram hat den Filter nicht erfunden.8 Was war also so Besonderes an Instagram?
Der Erfolg der App verdankte sich gleichermaßen der Kunst und der Verbreitung. Ehe Instagram auf den Markt kam, stellten seine Gründer einigen Tech-Tycoons aus San Francisco wie dem Unternehmer Kevin Rose, dem Journalisten M. G. Siegler, dem Technik-Evangelisten Robert Scoble und dem Twitter-Mitgründer Jack Dorsey frühe Versionen der App zur Verfügung.9 Diese Technologie-Promis posteten mehrere Instagram-Fotos auf Twitter, wo sie alle zusammen Millionen von Followern hatten. Durch den Zugang zu bereits existierenden riesigen Netzwerken erreichte Instagram Tausende von Menschen, ehe es überhaupt zur Markteinführung kam.
Als Instagram am 6. Oktober 2010 auf den Markt kam, luden sich 25.000 Menschen die App herunter, was sie an die Spitze des App Store katapultierte.10 Viele iPhone-Nutzer, die Dorseys Instagram-Bilder in ihren Twitter-Nachrichten gesehen hatten, luden sich die App voller Begeisterung herunter, als sie verfügbar war. Silicon-Valley-Berichterstatter sagten, sie hätten noch nie erlebt, dass ein Start-up noch vor dem Auftakt so viel Werbung und Aufmerksamkeit auf Technik-Blogs bekommen habe. Der Erfolg von Instagram hatte etwas mit einem einwandfreien, witzigen und einfachen Produkt zu tun. Und mit dem Netzwerk, in dem es eingeführt wurde.
Ob durch eine Atlantiküberquerung oder durch einen Twitter-Nutzer aus San Francisco, die Geschichte der Verbreitung eines Produkts ist ebenso wichtig wie die Beschreibung seiner Merkmale. Es wird kaum genügen, das perfekte Produkt zu entwickeln, ohne sich ebenso intensive Gedanken darüber zu machen, wie man es an die richtigen Leute bringt.
Zu Brahms’ Zeiten mussten Sie Musiker und einen Konzertsaal ausfindig machen, wenn Sie wollten, dass die Leute Ihre Symphonie zu hören bekamen. Kommerzielle Musik war Mangelware, und das Musikgeschäft gehörte jenen, die die Konzerthäuser und die Presse kontrollierten.
Doch heute passiert etwas Interessantes. Die Verknappung ist dem Überfluss gewichen. Der Konzertsaal ist das Internet, die Instrumente sind billig, jeder kann seine eigene Symphonie schreiben. Die Zukunft der Hits ist demokratisch, chaotisch und ungleich. Millionen wetteifern um Aufmerksamkeit, ein paar Glückliche kommen groß heraus, eine mikroskopisch kleine Minderheit wird unvorstellbar reich.
Am deutlichsten ist die Revolution im Medienbereich während der letzten sechzig Jahre bei Kino- und Fernsehfilmen. Als der Bibel-Kassenschlager Ben Hur am 18. November 1959 vor einem Publikum von über 1.800 Prominenten im New Yorker Loew’s State Theatre uraufgeführt wurde, war die Filmindustrie die drittgrößte Verkaufsbranche in den Vereinigten Staaten nach der Lebensmittel- und der Autoindustrie.11 Der Film brach die Hollywood-Rekorde für das größte Produktionsbudget und die teuerste Werbekampagne und wurde nach Vom Winde verweht zum zweiterfolgreichsten Kinofilm jener Zeiten.
Das Blitzlichtgewitter bei der Premiere mag einige Filmmogule für die Tatsache blind gemacht haben, dass die monogame Beziehung Amerikas mit der Kinoleinwand bereits ihrem Ende zuging. Das Fernsehen erwies sich als unwiderstehliche Verführung. Bis 1965 besaßen über 90 Prozent aller Haushalte ein Fernsehgerät und verbrachten mehr als fünf Stunden täglich davor.12 Die Wohnzimmercouch ersetzte den Kinosessel, die Zahl der Kino-Eintrittskarten pro Erwachsenem sank von rund fünfundzwanzig im Jahr 1950 auf vier im Jahr 2015.13
Das Fernsehen ersetzte den Film als beliebtestes Medium des visuellen Storytelling und brachte eine starke Verlagerung von Aufmerksamkeit und Dollars mit sich – von wöchentlich gekauften Kinokarten zu Online-Abonnements, deren monatliche Zahlungen ein riesiges Ökosystem von Live-Sportübertragungen, brillanten wie klischeehaften Dramen und endlosen Reality-Shows ermöglichen. Die bekanntesten Filmgesellschaften der Welt, zum Beispiel die Walt Disney Company und Time Warner, machen schon seit Jahren mehr Gewinne mit Kabelsendern wie ESPN und TBS als mit ihrer gesamten Filmabteilung.14 Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist jedes Filmunternehmen mehr oder weniger heimlich auch im TV-Geschäft aktiv.
Quelle: Barak Orbach (2016)
Doch heutzutage ist der Bildschirm des Fernsehapparats lediglich die größte in einer Welt glitzernder Glasscheiben. Erstmals 2012 brachten die Amerikaner mehr Zeit mit digitalen Geräten wie Laptops und Handys zu als vor dem Fernseher.15 2013 betrug die weltweite Produktion von LCD-Bildschirmen über 3,5 Milliarden Quadratmeter oder rund 50 Quadratzentimeter für jeden lebenden Menschen.16 In Entwicklungsregionen wie China, Indonesien und Nordafrika wurde die Desktop- und Laptop-Ära gleich ganz übersprungen und begann mit dem Computer in der Hosentasche.
Bloomberg eMarketer, Analyse des Autors/Matthew Ball
Im Großen und Ganzen verlagert sich die weltweite Aufmerksamkeit von weniger häufigen, großen und ausgestrahlten Inhalten (z. B. wöchentlicher Kinobesuch von Millionen Menschen) auf häufige, kleine und soziale Inhalte (z. B. Milliarden von Menschen, die alle paar Minuten auf ihren eigenen Displays die Beiträge sozialer Medien abfragen).
Noch 2000 wurde die Medienlandschaft dominiert von Eins-zu-eine-Million-Produktionen auf Kinoleinwänden, Fernsehbildschirmen und in Autoradios. Doch heute leben wir in einer mobilen Welt, in der Hits wie Angry Birds und Imperien wie Facebook auf winzigen Glasflächen existieren. 2015 berichtete die Technologie-Analytikerin Mary Meeker, ein Viertel der amerikanischen Medienaufmerksamkeit gelte mobilen Geräten, die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab.17 Das Fernsehen stirbt nicht aus, sondern es entwickelt sich zu Milliarden von Videostreams auf einer Vielzahl von Bildschirmen, von denen die meisten in der Hand gehalten werden können. Einst hat das Fernsehen die »Bewegtbilder« aus dem Griff der Kinosäle befreit; im historischen Ablauf emanzipiert die Mobiltechnologie nun das Video vom Wohnzimmer.
Mit dem Medium haben sich auch die Botschaften verändert. Die traditionelle Fernsehübertragung war live, werbefinanziert und wurde einmal wöchentlich ausgestrahlt. Das machte sie zur perfekten Heimat von Dramen und Krimis, die in jeder Folge mehrere Cliff-hanger aufwiesen (um die Zuschauer während der Werbeblöcke zu binden) und offen endeten. Beim Streaming, das häufig werbefrei ist, werden diejenigen Zuschauer belohnt, die mehrere Stunden am Stück dabeibleiben. Sie müssen nicht nach einer Folge House of Cards bei Netflix oder Downton Abbey bei Amazon Video aufhören; sie können so viel schauen, wie sie wollen. Durch die Kombination der Ästhetik des Films, des episodischen Charakters traditioneller Fernsehserien und des »exzessiven« Potenzials eines Romans oder einer Wagner-Oper trägt das Fernsehen der nahen Zukunft nicht mehr die Zwangsjacke von Ein-Stunden-Blöcken. Es hat ein »Lang-format« – oder vielleicht ein beliebiges Format.
Inzwischen wird das Fernsehen von kleineren Inhalten untergraben. Im April 2013 postete Robby Ayala, Student an der Florida Atlantic University, mehrere spaßige Videos der Campus-Waschbären auf Vine, einem nicht mehr existierenden sozialen Netzwerk von sechssekündigen Loops, das für viele junge Leute die bessere Alternative zum Fernsehen darstellte. Als er einen Monat später über eine Million Follower versammelt hatte, brach er sein Jurastudium ab und arbeitete bei einem zu Twitter gehörigen Netzwerk für Vine-Stars. Er brachte es auf 3,4 Millionen Follower und eine Milliarde Aufrufe seiner Videos und lebte davon, dass er in gesponserten Beiträgen für Unternehmen wie HP auftrat. Früher gingen Schauspieler nach Los Angeles oder nach New York, weil in diesen Städten die Entscheidungsträger saßen, denen das mediale Distributionsnetz gehörte. Doch heute kann jeder Mensch mit einem Handy oder einem Computer zur viralen Sensation der Woche werden. In dieser Zeit der ungeladenen Gäste und der globalen Aufmerksamkeit kann jeder ein Hitmacher sein.
Von jeher hat die Technologie die Unterhaltung geprägt – und unsere Erwartungen dessen, welche Arten von Inhalten »gut« sind. Im 19. Jahrhundert bezahlten die Besucher von Symphonien für eine lange Abendaufführung. Anfang des 20. Jahrhunderts verlagerte sich die Musikindustrie auf Radio und Vinyl. Die ersten Zehn-Inch-Schallplatten konnten mühelos drei Minuten Musik enthalten, was zu der Erwartungshaltung beitrug, dass eine moderne Pop-Single nicht länger sein sollte als 240 Sekunden. Heute ist ein Vine-Video nur sechs Sekunden lang.
Ist sechssekündige Unterhaltung lächerlich kurz? Das ist sie – wenn Sie mit Schubert, Brahms und Konzertsälen aufgewachsen sind. Sie ist es nicht – wenn Sie mit Robby Ayala, Facebook und dem 3,5-Zoll-Bildschirm eines Smartphones groß geworden sind. So oder so, die Menschen tendieren immer zum Vertrauten, und die Technologie prägt diese Gewohnheiten.
Die Bildschirme werden immer kleiner und immer leistungsfähiger. Früher haben bloß wir die Inhalte konsumiert. Jetzt konsumieren die Inhalte auch uns – unsere Verhaltensweisen, unsere Rituale und unsere Identität. Vor den 1990er-Jahren hatte die Musikindustrie keine täglichen Informationen darüber, wer sich zu Hause und im Radio Musik anhörte. Heute hört die Musikindustrie mit, wann immer Sie über Ihr Handy einen Song abspielen, und verwendet diese Informationen, um den nächsten Hit auf den Weg zu bringen. Facebook, Twitter und digitale Verlage haben Tools, die ihnen nicht nur sagen, welchen Text Sie anklicken, sondern auch, wie weit Sie lesen und was Sie als Nächstes anklicken. Früher haben wir einfach Hits gespielt; jetzt spielen die Hits mit uns.
Diese smarten Geräte haben ein gewisses Maß an Wissenschaft in die Arbeit des Hitmachens eingeführt und helfen den Unternehmen, den ultimativen Code für Konsumenten und Zielgruppen zu knacken: Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit und warum?
Wenn ein Buch den Geschmack von Milliarden Menschen und den Erfolg oder das Scheitern von Millionen Produkten zu erklären versucht, müssen darin einige Annahmen getroffen werden, die zwar zusammengenommen durchaus zu rechtfertigen sind, bestimmte Ausnahmen jedoch nicht berücksichtigen. Ich habe Pauschalaussagen zu vermeiden versucht, die nicht von maßgeblichem Zahlenmaterial gestützt werden. Aber sich sehr um die Vermeidung von Irrtümern zu bemühen, ist nicht dasselbe, wie immer richtigzuliegen.
Einige Monate, bevor ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, fand ich zwei Zitate, die mir gefielen. Ich kopierte sie auf einen Notizzettel meines Computers, wo ich sie immer sehen konnte. Es sind die Zitate am Anfang dieses Kapitels.
Das erste Zitat stammt aus Italo Calvinos Buch Die unsichtbaren Städte. Es ist eine Ode an die Vielschichtigkeit. Kublai Khan fragt, ob es einen einzelnen Stein gibt, der die Brücke stützt. Marco Polo erwidert, dass eine Brücke nicht auf einem einzelnen Stein ruhe, sondern auf einem Bogen, der von vielen Steinen gebildet wird.
Im Non-Fiction-Bereich gab es in den letzten zwanzig Jahren einen Reigen von kleinen Büchern über das Leben, die einige allgemeine Kritik erfahren haben. Sie übervereinfachen die Beschaffenheit des menschlichen Geistes, der, wie Polos Brücke, nicht durch den einen oder anderen Stein zu erklären ist, sondern durch die Interaktion einer Vielzahl stützender Elemente. Auch dieses Buch stellt ein paar schwer zu beantwortende Fragen: Warum erlangen manche Ideen und Produkte Popularität? Welche Faktoren markieren die Grenzlinie zwischen Hits und Flops? Das Bestreben, befriedigende Antworten auf diese Fragen zu finden, erfordert natürlich ein gewisses Maß an Verallgemeinerung. Aber während des gesamten Prozesses habe ich im Gedächtnis zu behalten versucht, dass der menschliche Geschmack nicht von einem einzigen Konzept oder einem Naturgesetz bestimmt wird. Vielmehr sind die individuellen Vorlieben so etwas wie ein Brückenbogen, der sich aus vielen Steinen zusammensetzt.
Das Calvino-Zitat wäre ein gutes Argument gegen ein Buch wie dieses gewesen, in dem großartige Theorien für die Funktionsweise der Welt aufgestellt werden. Doch da kommt das zweite Zitat ins Spiel.
Borges beschreibt ein Reich mit einer derart fortgeschrittenen Kartografenzunft, dass sie eine Landkarte in Originalgröße des Reiches gestalten. Doch die Menschen lehnen diese Errungenschaft der Präzision ab, und die Fetzen der Karte dienen letztlich den Bettlern in der Wüste als Kleidung. In der Einfachheit liegt die Tugend. Eine papierene Landkarte in genau derselben Größe wie das Reich, das sie darstellt, ist »unnütz«, weil eine Karte nur dann von Nutzen sein kann, wenn sie klein genug ist, um sie in der Hand zu halten und zu lesen. Die Welt ist komplex. Aber jeder Sinnhaftigkeit liegt eine kluge Vereinfachung zugrunde.
Eins der Themen dieses Buches ist, dass die Menschen nach Sinnhaftigkeit hungern und dass ihre Vorlieben durch das Zusammenspiel des Komplexen und des Einfachen bestimmt werden, die Stimulation des Neuen und die tiefe Geborgenheit des Vertrauten. Statt übervereinfachender Abkürzungen zu den Gründen, warum einige Kulturprodukte so erfolgreich sind, besteht mein Ziel darin, auf einfache Art eine komplexe Geschichte zu erzählen. Das Rückgrat dieses Buches ist zu klein, um Marco Polos Brücke zu stützen. Doch im Idealfall finde ich gute Steine, zeichne eine nützliche Landkarte.
Teil 1:
POPULARITÄT UND VERSTAND
1. Die Macht der Publicity
Ruhm und Vertrautheit – in Kunst, Musik und Politik
An einem regnerischen Herbsttag ging ich allein durch die Impressionisten-Abteilung der National Gallery of Art in Washington. Während ich vor einer Wand mit berühmten Gemälden stand, stellte sich mir eine Frage, die sich wohl insgeheim viele Menschen in einem Museum stellen, selbst wenn es unhöflich wäre, sie laut in Gesellschaft von Fremden auszusprechen: Warum ist das Ding so berühmt geworden?
Es war die Japanische Brücke von Claude Monet mit dem blauen Steg, der sich über einen smaragdgrünen Teich wölbt, gesäumt von gelben, rosafarbenen und grünen Tupfern – den legendären Seerosen. Es war unmöglich, das nicht zu erkennen. In einem meiner Lieblingsbilderbücher als Kind hatte es mehrere der Seerosen-Bilder von Monet gegeben. Es war auch unmöglich zu ignorieren, was an ein paar Jugendlichen lag, die sich durch die älteren Besucher drängelten, um einen näheren Blick auf das Bild zu werfen. »Ja!«, sagte ein Teeniemädchen und hielt das Handy vors Gesicht, um ein Foto zu machen. »Oh!«, rief der etwas größere gelockte Junge hinter ihr. »Das ist das berühmte!« Ein paar andere Oberschüler hörten ihre Rufe, und innerhalb von Sekunden hatte sich eine ganze Gruppe um den Monet versammelt.
Ein paar Räume weiter zeigte das Museum die Sonderausstellung eines anderen impressionistischen Malers, Gustave Caillebotte. Das war eine ruhigere, gemächlichere Angelegenheit. Es gab dort keine Schüler und keine ekstatischen Ausrufe des Wiedererkennens, nur eine Menge Mhm-hms und feierliches Nicken. Caillebotte ist nicht weltberühmt wie Monet, Manet oder Cézanne. Das Schild an der National Gallery, das seine Ausstellung ankündigte, bezeichnete ihn als den »vielleicht am wenigsten bekannten französischen Impressionisten«.18
Aber Caillebottes Gemälde sind wundervoll. Sein Stil ist impressionistisch und dennoch präzise, wie mit einer etwas schärfer eingestellten Kamera aufgenommen. Häufig durch ein Fenster betrachtet, gibt er die bunte urbane Geometrie vom Paris des 19. Jahrhunderts wieder – die gelben Rauten der Gebäude, die weißen Bürgersteige und das spiegelnde Grau der regennassen Boulevards. Seine Zeitgenossen betrachteten ihn als Phänomen, auf gleicher Stufe mit Monet und Renoir. Émile Zola, der große französische Schriftsteller, der die Aufmerksamkeit auf die »zarten Farbtupfer« der Impressionisten lenkte, bezeichnete Caillebotte als »einen der Kühnsten dieser Gruppe«. Noch heute, 140 Jahre später, ist Monet einer der berühmtesten Maler der Geschichte, während Caillebotte relativ anonym blieb.
Ein Mysterium: Zwei rebellische Maler zeigen ihre Kunstwerke 1876 in derselben impressionistischen Ausstellung. Man hält sie für gleich talentiert und vielversprechend. Doch die Seerosen des einen werden zu einem weltweiten kulturellen Erfolg – verewigt in Bildbänden, untersucht von Kunsthistorikern, begafft von Oberschülern und bei jeder Führung durch die National Gallery of Art hervorgehoben –, und der andere Künstler ist den Liebhabern der Malerei kaum bekannt. Warum?
Viele Jahrhunderte lang haben Philosophen, Künstler und Psychologen die moderne Kunst untersucht, um die Wahrheit über Schönheit und Beliebtheit herauszufinden. Aus nachvollziehbaren Gründen konzentrierten sich viele auf die Gemälde selbst. Aber die Tupfer Monets und die Pinselstriche Caillebottes zu erforschen sagt nichts darüber aus, warum der eine berühmt ist und der andere nicht. Man muss tiefer in die Geschichte eintauchen. Berühmte Gemälde, Hits und Kassenschlager, die mühelos auf dem kulturellen Bewusstsein dahintreiben, haben eine verborgene Entstehungsgeschichte; sogar Seerosen haben Wurzeln.
Ein Forschungsteam der Cornell University untersuchte die Geschichte des impressionistischen Grundprinzips und stellte fest, dass etwas Überraschendes die bekanntesten Künstler von den anderen unterschied.19 Es waren nicht ihre gesellschaftlichen Verbindungen oder ihre Bekanntheit im 19. Jahrhundert. Die Geschichte geht darüber hinaus. Und es fängt alles an mit Caillebotte.
Gustave Caillebotte wurde 1848 in eine wohlhabende Pariser Familie geboren. Als junger Mann studierte er zunächst Jura, dann Ingenieurwissenschaft, dann trat er im Deutsch-Französischen Krieg in die Armee ein. Mit Mitte zwanzig entdeckte er seine Leidenschaft und sein enormes Talent für die Malerei.
1875 reichte er Die Parkettschleifer bei der Akademie der Künste in Paris ein. Auf diesem Gemälde strömt weißes Licht durch ein Fenster und erhellt die nackten weißen Rücken einiger auf den Knien arbeitender Männer, die den dunkelbraunen Holzfußboden eines leeren Raumes abziehen, während sich die Holzspäne neben ihren Beinen zu Spiralen ringeln. Doch das Bild wurde abgelehnt. Ein Kritiker fasste später die erboste Antwort mit den Worten zusammen: »Wenn schon Nackte, dann schöne – oder gar keine.«
Die Impressionisten – oder, wie Caillebotte sie auch nannte, les Intransigents – waren anderer Meinung. Einigen von ihnen, darunter Auguste Renoir, gefiel sein alltäglicher Blick auf die Parkettschleifer, und er bat Caillebotte, gemeinsam mit seinen Mit-Rebellen auszustellen. Er schloss Freundschaft mit einigen der umstrittensten jungen Künstler der Epoche, wie Monet und Degas, und kaufte Dutzende ihrer Werke zu einer Zeit, da sich nur ein paar wenige reiche Europäer dafür interessierten.
Caillebottes Selbstporträt zeigt ihn in mittleren Jahren mit kurzem Haar und einem Gesicht wie eine Pfeilspitze, knochig und straff, mit ernstem grauem Bart. Auch charakterlich war er eine ernste Natur. Caillebotte war überzeugt, dass er jung sterben würde, und wies den französischen Staat in seinem Testament an, seine Kunstsammlung anzunehmen und fast siebzig seiner impressionistischen Gemälde in einem Nationalmuseum aufzuhängen.20
Seine Befürchtungen waren nicht grundlos. 1894 starb Caillebotte im Alter von fünfundvierzig Jahren an einem Schlaganfall. Zu seinem Nachlass gehörten mindestens sechzehn Gemälde von Monet, acht von Renoir, acht von Degas, acht von Cézanne und vier von Manet, außerdem achtzehn Bilder von Pissarro und neun von Sisley.21 Es ist durchaus vorstellbar, dass seine Sammlung bei einer Christie’s-Versteigerung des 21. Jahrhunderts mehrere Milliarden Dollar eingebracht hätte.
Damals war seine Sammlung jedoch weitaus weniger begehrt. In seinem Testament hatte Caillebotte verfügt, dass alle Gemälde im Pariser Musée du Luxembourg aufgehängt werden sollten. Doch selbst gegenüber Renoir als Testamentsvollstrecker lehnte die französische Regierung die Kunstwerke zunächst ab.
Die französische Elite, darunter konservative Kritiker und sogar prominente Politiker, hielten das Ansinnen für anmaßend, wenn nicht gar lächerlich. Wer war denn dieser Bursche, dass er glaubte, die französische Regierung posthum zwingen zu können, Dutzende von hingeklecksten Frechheiten an ihre eigenen Wände zu hängen? Mehrere Kunstprofessoren drohten, aus der École des Beaux-Arts auszuscheiden, wenn der Staat die impressionistischen Gemälde annehmen würde. Jean-Léon Gérôme, einer der bekanntesten akademischen Künstler seiner Zeit, ging scharf mit der Spende ins Gericht: »Ehe die Regierung solchen Schmutz annimmt, müsste die Moral massiv geschwächt werden.«
Aber was anderes ist die Geschichte der Kunst, wenn nicht die einer großen Schwächung nach der anderen? Nachdem Renoir jahrelang dafür gekämpft hatte, dass sowohl der französische Staat als auch Caillebottes eigene Familie dem Ansinnen nachgaben, überredete er die Regierung, wenigstens ungefähr die Hälfte der Sammlung anzunehmen. Bei einer Zählung umfassten die akzeptierten Bilder acht Werke von Monet, sieben von Degas, sieben von Pissarro, sechs von Renoir, sechs von Sisley, zwei von Manet und zwei von Cézanne.
Als die Kunstwerke 1897 endlich in einem neuen Flügel des Musée du Luxembourg aufgehängt wurden, war dies die erste nationale Ausstellung impressionistischer Malerei in Frankreich oder überhaupt in einem europäischen Land.22 Das Publikum strömte in das Museum, um sich Kunst anzusehen, die es zuvor verrissen oder schlicht ignoriert hatte. Der lange Kampf um Caillebottes Nachlass (in der Presse als l’affaire Caillebotte bezeichnet) hatte genau den Effekt, auf den er vermutlich gehofft hatte: Er erzielte beispiellose Aufmerksamkeit und sogar ein wenig Respekt für seine unnachgiebigen Freunde.
Ein Jahrhundert nach der Ausstellung der Caillebotte-Sammlung zählte James Cutting, Psychologe an der Cornell University in Ithaca, New York, über fünfzehntausend Erwähnungen impressionistischer Gemälde in Hunderten von Büchern der Universitätsbibliothek. Er schloss daraus »zweifelsfrei«, dass es einen Kern aus sieben (»und nur sieben«) impressionistischen Malern gab, deren Namen und Werke weitaus häufiger auftauchten als die ihrer Kollegen. Dieser Kern bestand aus Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Manet, Pissarro und Sisley. Ohne Zweifel war dies der impressionistische Kanon. Was hob diese sieben Künstler heraus? Sie hatten keinen gemeinsamen Malstil. Sie wurden nicht auf besondere Weise von zeitgenössischen Kritikern gelobt und unterlagen nicht gleichermaßen der Zensur. Es gibt keine Berichte darüber, dass diese Gruppe sich exklusiv zusammengeschlossen hatte, eine exklusive Sammlung der jeweiligen Werke besaß oder exklusiv ausstellte. Genau genommen schien es nur eine Eigenschaft zu geben, die den berühmtesten Impressionisten gemeinsam war.
Der Kern aus sieben impressionistischen Malern bestand aus den einzigen sieben Impressionisten in Gustave Caillebottes Nachlass.
Genau einhundert Jahre nach Caillebottes Tod, im Jahre 1994, stand James Cutting vor einem der berühmtesten Gemälde im Pariser Musée d’Orsay und ihm kam ein vertrauter Gedanke: Warum ist das Ding so berühmt?
Bei dem fraglichen Gemälde handelte es sich um Renoirs Ball im Moulin de la Galette (Bal du moulinde la Galette). Das 131 Zentimeter hohe und 175 Zentimeter breite Bild zeigt eine Reihe von gut gekleideten Pariser Bürgern, die zu einer Freiluftveranstaltung zusammengekommen sind, tanzen, trinken und sich im gesprenkelten nachmittäglichen Licht des Montmartre um Tische scharen.
Cutting erkannte das Werk augenblicklich. Aber er fragte sich, was so Besonderes an dem Gemälde war, abgesehen von der Tatsache, dass er es kannte. Ja, der Ball im Moulin ist faszinierend, das musste er einräumen, aber das Kunstwerk war nicht erkennbar besser als die der weniger berühmten Kollegen in den angrenzenden Räumen.
»Ich hatte wirklich ein Aha-Erlebnis«, sagte mir Cutting. »Ich erkannte, dass Caillebotte nicht nur der Ball im Moulin, sondern auch viele andere Gemälde in dem Museum gehört hatten, die außerordentlich berühmt geworden waren.«
Nach seiner Rückkehr nach Ithaca begann er, seine Erkenntnis zu teilen. In der Bibliothek der Cornell University studierten er und ein Forschungsassistent rund tausend Bücher über impressionistische Maler, um eine Liste der meistabgedruckten Künstler zu erstellen. Cutting zog den Schluss, dass der impressionistische Kanon sich auf einen festen Kern von sieben Künstlern konzentriert: Manet, Monet, Cézanne, Degas, Renoir, Pissarro und Sisley – Caillebottes Sieben.
Cutting entwickelte eine Theorie: Gustave Caillebottes Tod trug dazu bei, den impressionistischen Kanon zu schaffen. Sein Vermächtnis an den französischen Staat bildete die Brille, durch die zeitgenössische und zukünftige Kunstliebhaber den Impressionismus betrachteten. Kunsthistoriker konzentrierten sich auf Caillebottes Sieben, was deren Werken Ansehen verschaffte, andere Maler jedoch ausschloss. Die Gemälde von Caillebottes Sieben hatten die auffälligeren Plätze in Galerien, wurden für höhere Beträge an Privatsammler verkauft, fanden mehr Wertschätzung bei Kunstkennern, wurden in mehr Kunstbildbänden abgedruckt und von mehr Kunstgeschichtsstudenten erforscht, die zur nächsten Generation von Kunstexperten heranwuchsen und den ererbten Ruhm von Caillebottes Sieben bereitwillig weitergaben.i
Cutting hatte noch eine weitere Theorie: Die Tatsache, dass Caillebottes Nachlass den impressionistischen Kanon prägte, barg eine tiefe und universelle Wahrheit über Medien, Unterhaltung und Popularität. Die Menschen haben eine Vorliebe für Gemälde, die sie schon einmal gesehen haben. Das Publikum liebt Kunst, die jenen Ruck der Bedeutsamkeit auslöst, der oft durch das Wiedererkennen erfolgt. An der Cornell University überprüfte Cutting seine Theorie. Er versammelte 166 Personen aus seinen Psychologieseminaren und zeigte ihnen Paare impressionistischer Kunstwerke. Jeweils eins davon war deutlich »berühmter« – tauchte also mit höherer Wahrscheinlichkeit in einem der Lehrbücher der Cornell University auf. Sechs von zehn Studenten gaben an, das bekanntere Bild gefalle ihnen besser.
Das konnte bedeuten, dass die berühmten Gemälde besser waren. Oder es konnte bedeuten, dass die Cornell-Studenten kanonische Kunstwerke bevorzugten, weil sie mit ihnen vertraut waren. Um das Letztere zu beweisen, musste Cutting eine Umgebung schaffen, in der die Studenten unwissentlich, aber wiederholt mit den weniger bekannten Bildern konfrontiert wurden, und zwar auf dieselbe Art, auf die Kunstliebhaber unwissentlich, aber wiederholt von ihrer Kindheit an mit dem impressionistischen Kanon konfrontiert werden.
Sein nächster Schritt war sehr clever:23 In einem separaten Psychologiekurs bombardierte Cutting die Studenten mit unbekannten Kunstwerken des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Den Studenten dieses zweiten Kurses wurden wenig bekannte impressionistische Gemälde viermal so häufig gezeigt wie berühmte. Das war Cuttings Versuch, ein Paralleluniversum der Kunstgeschichte zu konstruieren, in dem Caillebotte nicht vorzeitig verstarb, sein legendärer Nachlass zu keinem impressionistischen Flügel führte und Caillebottes Sieben nicht von einem zufälligen historischen Ereignis profitierten, das ihre Präsentation und ihre Popularität steigerte.
Am Ende des zweiten Kurses bat Cutting die hunderteinundfünfzig Studenten, unter einundfünfzig Paaren ihre Favoriten auszuwählen. Die Ergebnisse des Beliebtheitstests stellten den Kanon auf den Kopf. Bei einundvierzig der einundfünfzig Paare bevorzugten die Studenten nicht mehr die Werke der berühmtesten Impressionisten. Der smaragdene Zauber von Monets Gärten, die elektrisierende Buntheit von Renoir und das Genie von Manet wurden beinahe ausgelöscht durch etwas anderes – die Macht der wiederholten Präsentation.
Es ist außergewöhnlich, dass Caillebottes Vermächtnis den Kanon des Impressionismus prägte, weil er absichtlich die am wenigsten beliebten Gemälde seiner Freunde kaufte. Er machte es sich zum Prinzip, »schwerpunktmäßig jene Werke seiner Freunde zu kaufen, die besonders unverkäuflich zu sein schienen«, schrieb der Kunsthistoriker John Rewald. Zum Beispiel war Caillebotte bei Renoirs Ball im Moulin de la Galette Käufer der letzten Instanz. Heute gilt das Gemälde, das Caillebotte vor der Vergessenheit rettete und Cuttings berühmte Studie der Kunstpsychologie anstieß, als Meisterwerk. Bei seiner Versteigerung für 78 Millionen Dollar im Jahr 1990 war es das zweitteuerste jemals verkaufte Gemälde. Man kann Renoirs Malerei wunderschön finden – das tue auch ich –, aber seine kanonische Berühmtheit ist untrennbar mit dem absurden Glücksfall verknüpft, zur Caillebotte-Sammlung gehört zu haben.
Mary Morton, die Kuratorin für französische Malerei in der National Gallery of Art, organisierte 2015 die Caillebotte-Ausstellung des Museums. Sie sagte mir, der Mangel an Publicity könne auch noch aus einem anderen Grund zu Caillebottes Anonymität beigetragen haben: Der wichtigste Sammler des Impressionismus hatte nie versucht, seine Kunst zu verkaufen.
Eine der bedeutendsten Figuren hinter den Kulissen der Geschichte des Impressionismus war Paul Durand-Ruel, ein französischer Sammler und Kunsthändler, der schon als Ein-Personen-Clearinghaus für impressionistische Gemälde fungierte, bevor sie Weltberühmtheit erlangten. Seine unablässigen Bemühungen, Arbeiten von Monet und anderen zu verkaufen, schufen die Bewegung und erhielten sie aufrecht, während man ihren flickenartigen Stil in den französischen Salons und beim europäischen Adel für einen unverfrorenen Angriff auf die französische Romantik hielt. Durand-Ruel war erfolgreicher bei amerikanischen Sammlern. »Während die industrielle Revolution und das Einkommenswachstum sich entwickelten, zogen Neureiche in große neue Wohnungen in Paris und New York«, sagte mir Morton. »Sie brauchten erschwingliche, hübsch aussehende und leicht verfügbare Dekorationsgegenstände, und die impressionistischen Gemälde erfüllten alle drei Voraussetzungen.« Neuer Reichtum schuf den Raum für einen neuen Geschmack. Der Impressionismus füllte die Lücke.
Aber Caillebotte passt nicht in diese Geschichte der Beliebtheit des Impressionismus bei den Neureichen. Er war Millionär, Erbe eines großen Vermögens aus der Textilbranche, und brauchte mit seinem Malereihobby kein Geld zu verdienen. Monet werden über 2.500 Gemälde, Zeichnungen und Pastellbilder zugeschrieben. Trotz seiner schweren Arthritis schuf Renoir überwältigende 4.000 Werke. Caillebotte fertigte rund 400 Gemälde an und bemühte sich nur wenig, sie an Sammler oder Museen zu verkaufen. Er fiel zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Vergessenheit anheim, während seine Kollegen in überfüllten Galerien und Privatsammlungen hingen, ein Widerhall von Caillebottes großem Talent im Fortgang der Geschichte.
Wenn Oberschüler heutzutage Monets Seerosen erkennen, erblicken sie mehr als ein Jahrhundert der Publicity und des Ruhms. Caillebotte ist der am wenigsten bekannte französische Impressionist. Aber nicht, weil er der schlechteste wäre. Sondern weil er seinen Freunden ein Geschenk angeboten hat, das er sich selbst vorenthielt: das Geschenk der Publicity.
Seit Jahrhunderten versuchen Philosophen und Wissenschaftler, die enorme Komplexität der Schönheit in eine passende Theorie zu verpacken.
Schlummert da wirklich eine Formel im Kalkül des Universums, die erklärt, warum uns gefällt, was uns gefällt? Da waren sich viele gar nicht so sicher. Es gab die Skeptiker, die argumentierten, dass Schönheit immer subjektiv ist und eher im Individuum liegt als in der Mathematik. Der schottische Philosoph David Hume sagte: »Wahre Schönheit oder wahre Missgestalt zu suchen ist ein so fruchtloses Unterfangen, als wolle man vorgeben, die wahre Süße oder die wahre Bitternis zu bestimmen.« Der deutsche Philosoph Immanuel Kant stimmte zu, dass Schönheit subjektiv sei, doch er hob hervor, dass der Mensch über ein ästhetisches »Urteilsvermögen« verfüge. Stellen Sie sich vor, ein wunderschönes Lied zu hören oder vor einem herausragenden Gemälde zu stehen. Sich dem Wunder preiszugeben ist das Gegenteil von Gedankenlosigkeit. Freude ist eine Art des Denkens.
Der lang währende Streit zwischen den Formeljägern und den Skeptikern entbehrte einer wichtigen Stimme: jener der Wissenschaftler. Beweisbare Fakten spielten in dieser Diskussion keine Rolle, bis ein nahezu blinder deutscher Physiker namens Gustav Theodor Fechner Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Plan trat und im Verlauf der Untersuchung des Kunstgeschmacks zur Erfindung der modernen Psychologie beitrug.
In den 1860er-Jahren war Fechner entschlossen, die Gesetze der Schönheit zu erkennen. Seine Vorgehensweise war einzigartig, denn nur wenige hatten zuvor daran gedacht, das Naheliegende zu tun, wenn es um die Erforschung der menschlichen Vorlieben ging: einfach die Menschen zu fragen, was ihnen gefiel. Bei seinem berühmtesten Experiment ging es um Formen. Er befragte Versuchsteilnehmer der verschiedensten Altersstufen und sozialen Hintergründe, welche Rechtecke sie am schönsten fanden. (Es war die Anfangszeit der Wissenschaft.) Dabei erkannte er ein Muster: Den Menschen gefielen Rechtecke, deren Proportionen dem Goldenen Schnitt entsprachen, das heißt, ihre langen Seiten waren ungefähr 1,6-mal länger als die kurzen Seiten.
Es wäre schön, berichten zu können, dass die erste Studie in der Geschichte der Psychologie sich als Triumph erwies. Leider ist die Wissenschaft ein langer Abschied von Irrtümern, und Fechners Schlussfolgerungen waren geradezu legendär irrtümlich. Nachfolgende Forscher scheiterten wiederholt daran, sie zu replizieren. Nicht alle Gründerväter haben bewundernswerte Ideen.
Fechners Erkenntnisse waren Blindgänger, aber sein erster Instinkt war brillant: Wissenschaftler sollten Menschen erforschen, indem sie sie über ihr Leben und ihre Vorstellungen befragen. Im Laufe der Zeit brachte dieses Prinzip alle möglichen wertvollen Schlussfolgerungen hervor. In den 1960er-Jahren führte der Psychologe Robert Zajonc eine Reihe von Experimenten durch, in denen er den Probanden sinnlose Wörter, beliebige Formen und eine Art chinesischer Schriftzeichen zeigte und sie fragte, welche sie bevorzugten. Studie auf Studie ergab, dass die Befragten sich zuverlässig für die Wörter und komischen Formen entschieden, die sie am häufigsten gesehen hatten. Es war nicht so, als wären einige Rechtecke vollständig rechteckig gewesen. Es war nicht so, als wären die chinesisch anmutenden Schriftzeichen vollständig chinesisch gewesen. Die Menschen mochten einfach diejenigen Formen und Wörter am liebsten, die sie am meisten zu sehen bekamen. Ihre Vorliebe lag in der Vertrautheit.
Diese Entdeckung ist als »Mere-Exposure-Effekt« oder einfach als »Exposure-Effekt« bekannt und gilt als eine der belastbarsten Erkenntnisse der modernen Psychologie. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen Freunde gegenüber Fremden bevorzugen oder bekannte gegenüber unbekannten Gerüchen. In Hunderten von Studien und Metastudien entschieden sich die Probanden weltweit für vertraute Formen, Landschaften, Gebrauchsgüter, Lieder und menschliche Stimmen. Der Mensch ist sogar parteiisch für die vertrauteste Version dessen, was er auf der ganzen Welt am besten kennen sollte: sein eigenes Gesicht. Das menschliche Gesicht ist leicht asymmetrisch, was bedeutet, dass ein Foto ein etwas anderes Bild wiedergibt als ein Spiegel. Manche Menschen stöhnen auf, wenn sie sich auf einem Foto sehen, und etliche Studien zeigen, dass die Menschen das Gesicht bevorzugen, das sie im Spiegel erkennen. Gibt eine glänzende Oberfläche Ihr Erscheinungsbild in seiner objektiv schönsten Form wieder? Vermutlich nicht. Es ist einfach nur das Gesicht, das Sie mögen, weil Sie daran gewöhnt sind, es auf diese Weise zu sehen. Die Vorliebe für das Vertraute ist so universell, dass angenommen wird, sie sei in unserem genetischen Code angelegt aus der Zeit, als unsere Urahnen durch die Steppen wanderten. Die evolutionäre Erklärung für den Exposure-Effekt ist einfach: Wenn Sie ein Tier oder eine Pflanze wiedererkennen, dann sind Sie davon noch nicht getötet worden.
Der Philosoph Martin Heidegger meinte einmal, jeder Mensch werde als viele geboren und sterbe als Einzelner. Es gibt eine Handvoll Vorlieben, die von fast allen Kindern geteilt werden – zum Beispiel für Süßes und für Harmonien ohne Dissonanzen.24 Doch der Geschmack von Erwachsenen ist vielfältig, zum großen Teil, weil sie durch ihre Lebenserfahrung geprägt werden und jeder das Leben auf verschiedene Art genießt und erleidet. Der Mensch wird durchschnittlich geboren und stirbt einzigartig.
Es gibt nichts Wichtigeres für die jagenden Gruppen, als sich fortzupflanzen und von Ort zu Ort zu wandern.25 Betrachten wir also diese beiden Säulen ihrer Psychologie – Was macht ein Gesicht schön? Was macht eine Landschaft erstrebenswert? –, um die potenziellen Ursprünge der Vorliebe für das Vertraute zu erkennen.
Allgemein sagt man, dass symmetrische Gesichter besonders bevorzugt werden. Aber die horizontale Entsprechung allein ist nicht der beste Schönheitsfaktor. Denken Sie mal darüber nach: Können Sie die Attraktivität eines Menschen nicht auch bestimmen, wenn Sie nur eine Seite seines Gesichts betrachten? Und ein unattraktives Gesicht perfekt symmetrisch zu machen schafft auch nicht plötzlich ein Supermodel. Die wissenschaftlich belastbare Erklärung für Schönheit ist, dass Menschen sich von Gesichtern angezogen fühlen, die wie viele andere Gesichter aussehen.
Wenn es ums Aussehen geht, ist der Durchschnitt wahrhaftig schön. Etliche Studien mit Computersimulationen haben ergeben, dass die Vermischung vieler Gesichter von Menschen desselben Geschlechts ein attraktiveres Erscheinungsbild ergibt, als die jeweiligen Individuen besitzen. Mischt man eine Menge extrem gut aussehender Menschen miteinander, ist das Ergebnis sogar noch betörender.26 Was ist nun so schön an einem durchschnittlichen Gesicht? Da sind sich die Forscher nicht ganz sicher. Vielleicht ist es evolutionsbedingt, und ein Gesicht aus vielen Gesichtern impliziert genetische Vielfalt. Auf alle Fälle ist die Anziehungskraft universell und vielleicht sogar angeboren. Bei Studien mit Erwachsenen und Kindern in China, die sich auf Europa und die Vereinigten Staaten erstreckten, wurden die durchschnittlichsten Gesichter als die attraktivsten beurteilt.iii
Vom Durchschnittlichen abgesehen, gehen die Vorlieben jedoch weit auseinander. Es gibt keine universelle Anziehungskraft von Lippentellern, Lippenstift oder Ponyfransen, obwohl sich auf der ganzen Welt Tausende von Menschen davon verführen lassen. Viele Leute finden Brillen sexy, aber das ist evolutionär betrachtet recht rückständig. Wenn exakt kalibrierte Glastechnologie notwendig ist, um durch den Tag zu kommen, signalisiert das schlechte Gene in Bezug auf die Sehkraft. Die urzeitlichen Jäger wären vermutlich nicht allzu begeistert gewesen von Drähten, die auf der Nase und den Ohren auflagen, um vor den Augen geschliffene Glaslinsen zu fixieren, aber das mindert nicht die Beliebtheit der Vorstellung von einer attraktiven Bibliothekarin. Wenn es überhaupt biologische Präferenzen für Gesichter gibt, sind sie formbar wie weicher Ton, und die Kultur kann sie in unzählige Gestalten pressen.
Auch bei der Darstellung von Landschaften lassen sich die weitverzweigten Vorlieben von Erwachsenen beobachten. Eine weltweite Studie mit Landschaftsbildern – etwa von Regenwäldern, Steppen und Wüsten – ergab, dass Kinder auf der ganzen Welt dieselbe Topografie zu bevorzugen scheinen. Sie sieht aus wie eine Savanne mit Baumbestand, was zufälligerweise der ostafrikanischen Landschaft entspricht, in der möglicherweise die Wiege der Spezies des Homo sapiens stand. Es scheint, als würde der Mensch mit etwas geboren, das Dennis Dutton, Professor für Kunstphilosophie, als »fortdauernde Pleistozänvorliebe für Landschaften« bezeichnet.27
Doch die Präferenzen Erwachsener in Bezug auf Landschaften sind weder fortdauernd noch pleistozän. Sie sind breit gefächert. Manche mögen die Scharfzahnigkeit des Matterhorns, manche einen See, der im rosafarbenen Licht des Sonnenuntergangs leuchtet, andere fühlen sich angezogen von Marokkos sonnengebleichten Sanddünen. Einige landschaftliche Details scheinen von universeller Attraktivität zu sein. Zum Beispiel gibt es weltweit eine Vorliebe für die Anwesenheit von sauber aussehendem Wasser, eine uralte und ewige Lebensnotwendigkeit. Einiges deutet darauf hin, dass die Betrachter verschiedenster Hintergründe und Kulturen den Anblick von Bergen mögen, die von sich windenden Flüssen geteilt werden, und von Wäldern, durch die Pfade bis zum Horizont reichen.28 Diese Details stehen für etwas, das schon unsere menschlichen Vorfahren gerne sahen: einen begehbaren Weg durch das Chaos der Natur. Doch so wie erwachsene Menschen verschiedene Filme, Kalender, Zeitschriften, Fotografien und Aussichten mögen, geht ihre Vorstellung von der »perfekten« Landschaft in Millionen verschiedene Richtungen.
Der abschließenden Analyse zufolge liegt Schönheit nicht in Formen oder kosmischen Proportionen oder auch in der herkömmlichen Prägung des menschlichen Geistes, Herzens oder Gefühls. Sie existiert in dem Zusammenspiel zwischen Welt und Menschen – mit anderen Worten: im Leben. Die Menschen passen sich an. Um Tennyson zu paraphrasieren, sie sind die Summe all dessen, dem sie begegnet sind. Sie werden durchschnittlich geboren und sterben einzigartig.
Noch bevor es die sozialen Medien gab, Telegramme oder Fernsehsender, bevor es sogar die modernen nationalen Zeitungen gab, existierten bereits öffentliche Museen. Lassen wir das Amphitheater beiseite, so war das öffentliche Museum wohl die erste Technologie zur Verbreitung von künstlerischem Ausdruck – heute allgemein als »Content« bekannt – unter einem Massenpublikum. Vielleicht ist es merkwürdig, sich das Museum als eine moderne Innovation vorzustellen, denn für viele ist es verknüpft mit Altertümlichkeit, dem Geruch nach Mottenkugeln und kleinen Kindern, die Pipi müssen. Doch wie so viele Technologien, von der Dampfmaschine bis zum Smartphone, demokratisierte das öffentliche Museum einen Markt – Kunst und Artefakte –, indem es den Massen etwas zugänglich machte, was zuvor nur den Reichen zur Verfügung stand.
Auch wenn die Massen schon seit Jahrtausenden öffentlich ausgestellte Kunstwerke betrachten, waren die meisten Kunstsammlungen der Geschichte Privatbesitz und wurden vom Adel sorgsam gehütet. Das moderne öffentliche Museum war eine Erfindung der Aufklärung und ihrer radikalen Vorstellung, dass das gemeine Volk Bildung verdiene. Das erste nationale Museum war das British Museum, das im Jahre 1759 als »Kuriositätenkabinett« eröffnet wurde und Artefakte aus dem alten Ägypten sowie Pflanzen aus Jamaika enthielt.29 In den folgenden Jahrzehnten florierten Nationalmuseen in ganz Europa und auch jenseits des Atlantiks. Der amerikanische Universalgelehrte Charles Willson Peale gründete 1786 in Philadelphia das erste moderne Museums Amerikas,30 in dem er Tausende Pflanzenarten und Tiergemälde aus seiner Sammlung ausstellte.iv In Paris wurde 1793 der Louvre eröffnet, der Prado in Madrid folgte 1819. Der Nachlass Caillebottes schmückte die Wände des Musée du Luxembourg auf dem Höhepunkt dieses Aufschwungs der neuen öffentlichen Museen in Europa. Allein in Großbritannien wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einhundert Museen eröffnet.
Wenn Museen einige Hundert Jahre lang die wichtigsten Orte der Kunst waren, dann war das Radio das Museum der Popmusik, die große Halle der Massenpräsentation. Eine Ausstrahlung war so wichtig für die Popularität neuer Musik Mitte des 20. Jahrhunderts, dass die Musiklabel komplizierte »Payola«-Muster erarbeiteten, um die Radiosender direkt für das Spielen ihrer Songs zu bezahlen. Noch bis in dieses Jahrhundert hinein ist die allgegenwärtige Ausstrahlung entscheidend, um einen Hit zu landen. »Jede einzelne Marktstudie, die wir je vorgenommen haben, beweist eine durchgängige Tatsache: Das Radio ist die Nummer eins für die Verkaufszahlen und der stärkste Faktor für den Erfolg eines Songs«, sagt Dave Bakula, Senior Vice President of Analytics bei Nielsen, wo Plattenverkäufe und Radioausstrahlung nachverfolgt werden. »Man erlebt fast unweigerlich, dass die größten Songs zuerst das Radio erobern und sich dann ausweiten [auf andere Plattformen].« Die öffentliche Publicity im Radio kann sogar noch wirksamer sein als die »reine« Publicity, denn wenn ein Song bei einem Top-40-Sender vertreten ist, sagt das etwas über seine Qualität aus, in dem Sinne, dass Stilpräger und andere Hörer ihn bereits gehört und gebilligt haben.
Selbst in der Anfangszeit des amerikanischen Musikbusiness war eine einprägsame Melodie zweitrangig gegenüber einer genialen Werbekampagne, wenn ein Song zum Hit werden sollte. »In der Tin Pan Alley wussten die Verleger: Egal wie clever, wie eingängig, wie zeitgemäß ein Song war, sein [Erfolg] beruhte auf seinem Vertriebssystem«, schrieb der Musikhistoriker David Suisman in Selling Sounds: The Commercial Revolution in American Music.31 Im New York des ausgehenden 19. Jahrhunderts entwickelten Autoren und Musikverleger an einer Ecke des Union Square, die den Spitznamen »Tin Pan Alley« trug, einen ausgeklügelten Prozess, um die Werbetrommel für neue Musik zu rühren. Sie verteilten Notenblätter an lokale Musiker, die dann jeden Song in verschiedenen Gegenden spielten, von der Lower East Side bis Upper West, und Bericht darüber erstatteten, welche der Songs zündeten. Die amerikanischen Klassiker, die auf diese Zeit zurückgehen – zum Beispiel »The Band Played On«, »Take Me Out to the Ball Game« und »God Bless America« –, waren die Produkte einer durchdachten Test- und Vertriebsstrategie, die auf Notenblättern und Schuhsohlen basierte.
Die Werber der Tin Pan Alley bereiteten den Weg für das Radio, und heute bereitet das Radio den Weg für neue Formen des Vertriebs, die offener, gleichberechtigter und unvorhersehbarer sind. Heutzutage entstehen Hits aus Fernsehwerbespots, Facebook-Posts und Online-Videos. Es wird allgemein anerkannt, dass eine Spotify-Playlist des Napster-Mitgründers Sean Parker für den Überraschungshit des Jahres 2013 »Royals« von Lorde verantwortlich war.32 Zwei Jahre zuvor hatte eine kanadische Singer/Songwriterin namens Carly Rae Jepsen einen peppigen Song herausgebracht, »Call Me Maybe«, der auf Platz 97 der kanadischen Hot 100 einstieg. Bis zum Jahresende hatte er es immer noch nicht in die Top 20 geschafft. Doch dann hörte ein anderer kanadischer Popsänger, Justin Bieber, den Song im Radio und lobte ihn auf Twitter. Anfang 2012 machte Bieber ein YouTube-Video, das ihn und ein paar Freunde mit falschen Schnurrbärten zeigte, darunter Popstar Selena Gomez, wie sie zu dem Song tanzen. Dieses Video ist inzwischen über 70 Millionen Mal aufgerufen worden und verhalf »Call Me Maybe« (das selbst über 800 Millionen Mal bei YouTube angesehen wurde) dazu, einer der größten Popsongs des Jahrzehnts zu werden.
Musik – und Kultur ganz allgemein – ist an solche Momente geknüpft, und inzwischen können diese Momente von überallher kommen. Terrestrische Radiosender haben immer noch eine große Reichweite – auf diese Weise hat Bieber »Call Me Maybe« schließlich auch zum ersten Mal gehört –, aber sie besitzen nicht länger das Sendemonopol. Jedes Social-Media-Profil, jeder Blogger, jede Website und jedes vielfach geteilte Video ist im Prinzip ein Radiosender.
Es ist eine schöne Vorstellung, dass auf einem kulturellen Markt wie bei der Musik nur die Qualität zählt und jeder Nummer-eins-Hit auch gleichzeitig der Klassenbeste ist. Zudem ist es ungeheuer schwer, das Gegenteil zu beweisen. Wie soll man beweisen, dass ein Song, von dem noch niemand je gehört hat, »besser« ist als die meisten beliebten Songs im Lande? Dazu bräuchte man etwas Verrücktes: ein Paralleluniversum zum Vergleich, in dem Tausende von Menschen dieselben Lieder gehört haben und ohne die Macht der Werbung zu anderen Schlüssen gelangt sind.