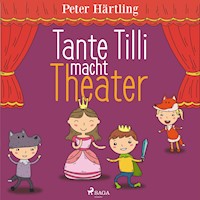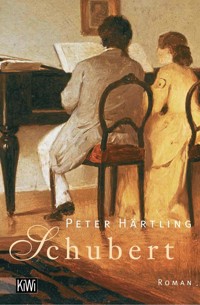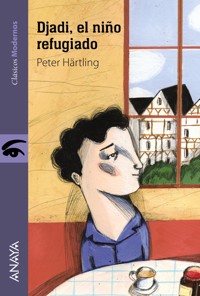9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Roman erzählt Peter Härtling von E.T.A. Hoffmann und dessen Bamberger Jahren, als der vielseitig begabte romantische Künstler Julia, das Urbild seiner Kindfrauen, kennenlernte, um ihr zu verfallen. Ein mit hoher Intensität geschriebener, kühn komponierter Roman. Fünf Jahre verbrachte der Musiker, Komponist, Maler, Schriftsteller und Richter E.T.A. Hoffmann (1776-1822) in Bamberg, als Theaterkapellmeister, Direktionsgehilfe und vieles mehr, ein irrlichternder Geist und Erotiker in mitunter quälenden, provinziell engen Verhältnissen. Umrahmt von der Vor- und Nachgeschichte konzentriert sich Peter Härtlings neuer Roman auf diese Bamberger Jahre und vor allem auf Hoffmanns nicht ganz platonische Liebe zu sehr jungen Sängerinnen, auf seine Verfallenheit an die Gesangsschülerin Julia, dem Urbild seiner Kindfrauen, beschreibt aber auch Hoffmanns turbulente Ehe mit seiner polnischen Frau Mischa. Der kompakte, mit intensiver, flirrender Nervosität erzählte Roman begibt sich ins Innerste von Hoffmanns Begehren, er ist geradezu von einer Erotik zwischen Idealisierung und körperlicher Lust beseelt und zeichnet nach, wie aus den Energieströmen dieser Liebe die explosive Ausdruckskraft des Multigenies Hoffmann erwächst. Innerhalb der romantischen Periode ist E.T.A. Hoffmann die vielleicht hinreißendste und modernste Figur, und aus diesem Roman springt sie uns buchstäblich entgegen, überkochend vor Begabung, Lust und Erkenntnisraserei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Peter Härtling
Hoffmann oder Die vielfältige Liebe
Eine Romanze
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Härtling
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Härtling
Peter Härtling wurde 1933 in Chemnitz geboren. Er arbeitete als Redakteur und Herausgeber bei Zeitungen und Zeitschriften. Anfang 1967 Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt a. M., dort 1968 bis 1973 Sprecher der Geschäftsleitung, seitdem freier Schriftsteller.
Das gesamte literarische Werk von Peter Härtling ist lieferbar bei Kiepenheuer & Witsch. Zuletzt erschienen der Band »Erzählungen, Aufsätze, Vorlesungen« aus der Härtling Werkausgabe, die damit abgeschlossen ist, und der Gedichtband »Ein Balkon aus Papier« sowie in KiWi die Romane »Hölderlin« und »Schubert«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Fünf Jahre verbrachte derMusiker, Komponist, Maler, Schriftsteller und Richter E.T.A. Hoffmann (1776–1822) in Bamberg, als Theaterkapellmeister, Direktionsgehilfe und vieles mehr, ein irrlichternder Geist und Erotiker in mitunter quälenden, provinziell engen Verhältnissen. Peter Härtlings mit hoher Intensität geschriebener, kühn komponierter Roman konzentriert sich auf die Bamberger Jahre – vor allem auf Hoffmanns nicht ganz platonische Liebe zu ganz jungen Sängerinnen, auf seine Verfallenheit an die Gesangsschülerin Julia, dasUrbild seiner Kindfrauen, aber auch auf Hoffmanns turbulente Ehe mit seiner polnischen Frau Mischa. Mit kompakter, flirrender Nervosität erspürt der Roman das Innerste von Hoffmanns Begehren, atmet geradezu von einer Erotik zwischen Idealisierung und körperlicher Lust und zeichnet nach, wie aus den Energieströmen dieser Liebe die explosive Ausdruckskraft des Multigenies Hoffmann erwächst.
E.T.A. Hoffmann, die hinreißendste, modernste, schrillste und wegweisendste Figur der Romantik, springt uns aus diesem faszinierenden Roman buchstäblich entgegen, überschäumend vor Begabung, Lust und Erkenntnisraserei.
»Härtling ist ein Virtuose einer Nähe, die etwas Hypnotisches hat … Eine der schönsten, skandalösesten und elendsten Liebesgeschichten der Romantik.« Die Zeit
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2001, 2002, 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: Juan Lascano, Abbildung © ARTOTHEK
ISBN978-3-462-30030-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Warschauer Vorspiel
Berliner Vorspiel
Bamberger Hauptstück
Coda für Julia
Sächsisches Nachspiel
Berliner Nachspiel
Quellen
Die Liebe des Künstlers.
Der kühle Augenblick.
Klang aus dem Norden.
Klang aus dem Süden.
Mystik der Instrumente.
Musikalisches Helldunkel.
TonArten.
Ahnungen der Musik des Himmelreichs.
E.T.A. Hoffmann
Für M.
Warschauer Vorspiel
Komm. Geh. Komm.
Jetzt, zu Beginn, weiß ich mehr als er, doch es könnte sein, daß er am Ende mehr weiß als ich.
Am 1. September 1808, gegen Abend, kommt Hoffmann in Bamberg an.
Doch bis dahin, bis Julia, nehme ich mir Zeit, hole ihn in Warschau ab.
Wie finde ich, wie erreiche ich sein Tempo? Welche Wörter sind schnell genug, mit welchen Sätzen kann ich ihn bewegen? Er ist rasch, er ist sich voraus. Kreisler steckt schon in ihm, »der Kapellmeister Johannes Kreisler, bloß deshalb seines Amtes entlassen …, weil er standhaft verweigert hat, eine Oper, die der Hofpoet gedichtet, in Musik zu setzen; auch mehrmals an der öffentlichen Wirtstafel von dem Primo Huomo verächtlich gesprochen und ein junges Mädchen, die er im Gesange unterrichtet, der Primadonna in ganz ausschweifenden, wiewohl unverständlichen Redensarten vorzuziehen getrachtet«.
Das ist bereits eine Geschichte, ein Anfang, der vom Ende her angeschaut werden kann oder, um genauer zu sein: von Hoffmann, der sich in Kreisler gefunden hat, von dem andern, der seine Liebste unaufhörlich verwandelt, durch seine Erzählungen treibt und seine rastlose Begierde in Anreden und Anschauungen befriedigt. Er zählt nicht zu jenen, die Spuren verwischen. Er sorgt, im Gegenteil, dafür, daß sie deutlich bleiben, allzu deutlich, weil seine Wirklichkeit immer in der Phantasie aufgeht.
Seit Monaten lese ich in seinen Werken, aber ich habe es längst aufgegeben, hinter jeder seiner Maskeraden eine Bedeutung zu suchen, die andere, die gemeinte Person. Er ist nicht nur einer, in seinen Erzählungen steckt er überall: Dapertutto, der durch die Zeit und den Raum springt. Lese ich ihn, höre ich Musik. Nicht unbedingt die seine. Aber ich höre Mozart vor allem, und in einem mich rührenden Nachhall Carl Maria von Weber.
Im Grunde suche ich nach Hoffmann nur in Bamberg. Im Zeitraum von fünf Jahren. Dort empfängt ihn, den Theaterdirektor, der eingeladen wurde, aber nicht angestellt ist, eine Person, die er erwartet, schon erfunden hat. Eine schmerzliche, um so köstlichere Inkarnation der Liebe.
Ich bin ihm in seinen Tagebüchern gefolgt, habe seine Briefe gelesen, habe die Metamorphosen Julias in »Berganza«, in den »Abenteuern der Sylvesternacht« und in anderen Erzählungen studiert. Wobei das Wort »studiert« nur auskühlen soll, was mich erhitzte: die Gedanken an ein Geschöpf, das geliebt wurde, um sich in ungezählten und unendlich anregenden Bildern aufzulösen. In Gefühle, die nach Gestalt verlangen.
Noch bin ich nicht soweit mit ihm. Meine Ungeduld, endlich Julia zu treffen, drängt mich. Aber Hoffmann taucht ja nicht aus dem Nirgendwo auf. Er hat gelebt, vielleicht schon für Julia, obwohl er die Erwartungen, die ihr galten, oft genug und verzweifelt an andere verschwendete.
Auf Bamberg wäre er, während seiner Zeit als Regierungsrat in Warschau, nie gekommen. Es war ein Name, den er noch nicht kannte, eine Stadt, die er sich noch nicht auszudenken brauchte. Er hatte sein Einkommen. Michalina, die Polin, seine Frau seit zwei Jahren, erwartete ein Kind.
Er konnte sich an der Gesellschaft messen, in die er nun eintrat, nicht besonders geübt, aber zu jeder Verstellung fähig: ein etwas eigenwilliger, vielleicht sogar verdrehter, aber überaus gewissenhafter Beamter. Warschau gefiel ihm. Er fand in der Stadt eine Bühne, die ihm paßte. Was für ein Unterschied zwischen dem preußischen »alten Land«, aus dem er kam, und dem preußisch verwalteten Warschau. Das Bizarre, die Gegensätze bestimmten das Leben der Stadt. Paläste àla Versailles standen neben brüchigen Holzhütten. Die Reichen traten auf wie Schmierenkomödianten, die Armen wie Gelehrte oder Propheten. Auf den Straßen quirlten sie durcheinander, die Juden im Kaftan und die Mönche, die Lebenslust und Gotteslob nicht trennten, die polnischen Mädchen, schön und provokant, die uniformierten Beamten, berufene Gockel, und die alten polnischen Adligen, die ihren Stolz aus den Knien in den gekrümmten Leib drückten – ein großes Theater, das Hoffmann herausfordert, nicht nur aufzutreten, sondern aufzufallen: Hier bin ich, Dichter, Musiker und Maler.
Hippel, dem Freund aus Königsberger Kindertagen, schildert er in seinem ersten Brief aus Warschau sein Entree: »Ich bin in Warschau angekommen, bin heraufgestiegen in den dritten Stock eines Palazzo’s in der Freta-Gasse No 278, habe den freundlichen Gouverneur, den Präsidenten, der die Nase 1/8 Zoll über den Horizont emporhebt und drei Orden trägt, und ein ganzes Rudel Collegen gesehen und schwitze jetzt über Verträgen und Relationen! Schriftstellern und komponieren wollte ich, und nun? Erschlagen von acht und zwanzig Conkurs-Akten wie von Felsen, die Zeus’ Donner herabschleuderten, liegt der Riese Gargantua …«
Der er auf keinen Fall war. Vielmehr ein dürrer, stets hastiger, durstiger Hüpfer und Springer. Bewegungssüchtig. Die Gliedmaßen unruhig und aus der Kontrolle. Dazu kommt der Musiker, der mit gierigem und empfindlichem Gehör geschlagen war.
Wie? Hinter der lakonischen Frage verschanzte er sich.
Wie? fragte er den Gouverneur und stieß mit ihm und den anderen an:
Auf den Anfang!
Wenn der Gouverneur ahnte! Er plante gleich mehrere Anfänge. Eine Erzählung, ein Libretto, eine Oper, eine Klaviersonate – und das genügte noch nicht. Denn jedem einzelnen Stück mußte Erfahrung vorausgehen, Geschmack auf der Zunge, ein Blick, ein aufreizend begonnenes Gespräch, zwei, drei himmlische oder alberne Sätze, die er zufällig las und die aufquollen wie Hirsekörner.
Ihre Arbeit erwartet Sie.
Wie?
Die Arbeit, die Akten, die Fälle.
Prosit!
Er hat die Gesellschaft, die Ministerialräte gezeichnet. Mehrfach. Die meisten Blätter warf er fort, augenblickliche Reflexe seiner Wut, seines Ekels. Popanze auf Stelzen, bereit zu einem phantastischen Puppenspiel.
Sie sollten sich vor allem der Konkurse annehmen, Rat Hoffmann.
Aber gewiß, Euer Exzellenz, obwohl die natürlich schon passiert sind.
Jetzt fragt Exzellenz: Wie?
Und Hoffmann prostet.
Die Verwalter von Warschau, das nach der Teilung Polens zwischen Preußen, Rußland und Österreich als Hauptstadt von Süd-Ostpreußen bestimmt wurde, richteten sich, wie auch anders, für die Ewigkeit ein.
Er arbeitete oft zu Hause in der Senatorgasse, im Rösslerschen Haus. Mischa, darauf bedacht, ihn nicht zu stören, flanierte in der Stadt, genoß das bunte Treiben rund um die Teiche im Lazienko Park, vernachlässigte den Haushalt, was ihn weniger ärgerte als ihr Vergnügen daran, daß fast ganz Warschau polnisch sprach, ihre Sprache.
Mach es nicht zu deiner Gewohnheit, Mischa, ich bitte dich.
Und du, Hoffmann, du vertiefst dich ins Italienische. Wozu und wofür? Hier spricht kein Mensch italienisch. Er schwieg. Er verriet sich nicht, dachte nicht daran, ihr von Venedig zu erzählen, seinem Venedig, und einer Italienreise, die er plante, aber nie antrat, was ihn nicht daran hinderte, sein Venedig zu finden, Doge und Dogaresse.
Daß du dich immer wieder …
Was? Er mischte die Akten wie ein Kartenspiel, lief zum Klavier und schmeckte vor, was ihr auf der Zunge lag.
Über die Schulter schaute er zu ihr hin. Sie stand vorm Fenster, im Licht. Das machte sie leichter, graziöser, als sie war. Aber er liebte ja ihre Rundungen, ihren schwer werdenden Leib. Und vergaß ihn auch wieder, wenn ihn der Anblick eines Mädchens fesselte, das er immer gleich beim erfundenen Namen nannte, nicht schon Julia, oder womöglich doch schon.
Manchmal, in Gesellschaft, fand sich die Gelegenheit, eine junge Dame anzusprechen, sie mit Poetischem, Musikalischem so zu verwirren, daß er sie für betört hielt. Es genügte ihm die Sensation des Anfangs, die Liebe in Phantasie. Seine Gier führte Selbstgespräche.
Mischa konnte ihn erlösen. Wenn er von einem Schriftsatz über Hehlerei zum Klavier wechselte, um wenigstens die ersten Takte einer Sonate auszuprobieren, wenn er, nachdem er einen gestisch verstärkten Monolog über die Wichtigtuer unter seinen Kollegen gehalten hatte, diese politischen Seimspeier, wenn er dann doch wieder auf Mozart kam, aus der »Zauberflöte« zitierte, im Zimmer hin und her schoß, immer wieder eine Phrase auf dem Klavier wiederholte, wenn er schließlich, aus Übermut fast schon erschöpft, Verse aus dem neuesten Drama seines Freundes Zacharias Werner zitierte, diese erhabenen Albernheiten – »Hochbedrängt sind wir in Nöten,/Feind und Hölle will uns töten,/Wollest uns vor Gott vertreten,/Hochgelobter Adalbert« –, dann konnte es passieren, daß er Mischa plötzlich ins Auge faßte, sie in seine Arme riß, mit ihr ein paar Walzerschritte tanzte, ihr mit fistelnder Stimme nahelegte, sie sollte sogleich, nein, sie müsse unverzüglich sein Adalbert sein.
Wogegen sie sich sträubte, er verwechsle sie, noch dazu mit einem Mann, was ihn wiederum entzückte: Hochbedrängt in meinen Nöten! Und sie wußte, was folgen würde: Er hielt sie umschlungen, trippelte, tänzelte, drängte sich an sie, sie bewegten sich von einem Zimmer ins andere, von der Bühne zum Bett. Er warf sie hin. Sie zog sich, um seinen wildernden Händen zuvorzukommen, von selber hastig aus, vergaß dabei nicht, ihn vor Elena, der Köchin, zu warnen: Sie könnte uns überraschen, Hoffmann! Nur störte es ihn nicht, wenn sie hinter der Tür lauschte und an der Liebe teilnahm.
Mischa ließ ihn, spielte die Ergebene, wehrte sich nur mit Seufzern gegen seine knochigen Attacken. Sie ahnte, daß Hoffmann in Gedanken eine andere liebt, stets wechselnd, eine neue, ein Ideal, dem sie nie entsprach. Diese Mädchen, diese jungen Sängerinnen, denen er den Hof machte, im Spaß und aus Vergnügen, die er in seinen Träumen heimsuchte.
Manchmal rächte sich Mischa, wenn sie erschöpft aufgaben, sie sich anzog und er sich hastig atmend auf einen Sessel fallen ließ. Dann konnte sie Sätze sagen, ebenfalls in Gedanken, die ihn aus seinen Träumen rissen und zurechtwiesen, sehr lässig: Du hüpfst auf mir herum, Hoffmann, daß ich am liebsten weinen möchte.
Und diese Sätze gelangen ihr, zu seinem Verdruß, fehlerlos.
Wie kommt es, Mischa, daß du mir nichts, dir nichts die Grammatik beherrschst? Ist es die Liebe, die Eifersucht? Darauf bekam er nie eine Antwort.
Er sagt: Ich liebe. Er sagt nicht: Ich liebe dich. Obwohl Mischa es so versteht und immer verstehen wird, bis an sein Ende.
An diesem Warschauer Anfang ist er mir nicht geheuer. Er schlottert in seinen Kleidern. Aus seinen Briefen höre ich nicht seine Stimme. Er erzählt Hippel, was er vorhat, was er schon wieder hinter sich hat, plant mit ihm eine Reise, deren Ziel er offenläßt, nur gemeinsam müßten sie unterwegs sein, und Hippel müßte sich mit einfachen Unterkünften zufriedengeben, da er sich eine Reise eigentlich nicht leisten könne. Er ist achtundzwanzig, probiert ständig Anfänge, ist lustlos in Fortsetzungen. Zweifellos plagt ihn seine Phantasie. Sein Amt in Warschau – immerhin trägt er schon den Titel eines Regierungsrats – erscheint ihm als eine haltbare Grundlage. Er trinkt viel und gern, schätzt Kumpaneien, denen er sich jedoch blitzschnell entzieht, sobald er die Depressionen nutzen kann, zeichnend und komponierend. Manchmal läßt er, wenn er allein ist, schon bekannte oder befreundete Personen sprechen, verwandelt sie, treibt ihnen Ängste ein und die letzten Sicherheiten aus, gibt ihnen neue Namen. Noch haben sie keine Sprache, oder die verflüchtigt sich, ehe er sie endgültig formulieren kann.
Immer wieder hat er sich porträtiert, spiegelnärrisch, auf den Doppelgänger scharf. In solchen Momenten spüre ich ihn endlich. Natürlich betrüge ich mich, mache mir etwas vor, indem ich ein altes Bild belebe. Viel dazu braucht es nicht. Er kennt, was ihn auszeichnet: die Nase wie ein überdimensionierter Raubvogelschnabel, gekrümmt und mit scharfem Grat. Dazu die eng stehenden, dunklen, wohl auffallend großen Augen. Ich schreibe »dunkel« und frage mich: War es ein tiefes Blau, waren es durch den Rausch vergrößerte Pupillen? Über dem vorspringenden Kinn, das der starken Nase gleichsam parodistisch antwortet, ein verkniffener Mund, die Lippen eingesogen. Ein alter Mund in einem jungen Gesicht. Wie klang, frage ich mich, seine Stimme, wie hat er gesprochen? Auf alle Fälle singt er oft. Seine Musikalität wird schon in seiner Kindheit gefördert. Nun, in Warschau, komponiert er die Messe in d-Moll und die Sinfonie in Es-Dur. Er ist fleißig, traktiert das Klavier auch nachts, was Mischa beunruhigt, denn er ölt seine Inspiration mit Mengen von Bier und Wein. Vorher, in den ersten Warschauer Monaten, ehe er sich zusammen und die Musik ganz ernst nahm, komponierte er Arien und Chöre für »Das Kreuz an der Ostsee«, ein Trauerspiel von Zacharias Werner. Ein paar Notizen für die Messe hat er nach Warschau mitgebracht. Das Kyrie gelingt ihm, das Gloria ebenso.
Ich höre, während ich schreibe, diese Musik, unterbreche die Arbeit, um mich zu konzentrieren. Auf ihn, auf Hoffmann, auf seine »erste« Sprache. Er wechselt nicht nur die Tonarten, sondern den Tonfall. Er zitiert, erinnert sich an Mozart, Haydn, Gluck, an Beethoven. Er bereichert und verstellt sich, und doch könnte ich ihn unter anderen heraushören. Es ist seine Gestikulation, sein Tempo. Bald wird er seine Sinfonie dirigieren. Bis dahin entlasse ich ihn wieder in meine Erzählung, die ich beschleunigen werde, da es mich nach Bamberg drängt (und er sich ohnehin noch in Berlin aufhalten muß, eine elende Strecke), um endlich mit ihm Julia und das Gesetz der Liebe zu entdecken.
Er befreundete sich mit Hitzig, dem Assessor Julius Hitzig, der ihm schon ein paar Tage lang bei Sitzungen im Kollegium am Tisch gegenübersaß, aber nicht weiter auffiel. Den er, wie alle Vorgesetzten, übersah, falls sie ihn nicht ansprachen. Sie begegneten sich vor dem Präsidium, zufällig, stellten fest, in der Senatorgasse Nachbarn zu sein, gleiche Bekannte zu haben, Zacharias Werner zu schätzen, die Musik sowieso, und Hitzig wurde von einem Tag zum andern innigster Freund. Ein Genießer, ein Freßsack, in kürzester Zeit Kenner der Warschauer Lokale.
Erinnerst du dich, mein lieber Hoffmann, an unser erstes Gespräch?
Aber ja, vor dem Portal des Präsidiums. Du verbeugtest dich mehrfach.
Du ebenso.
Du sagtest deinen Namen.
Du ebenso.
Und du fragtest mich, ob ich denn der abendliche Klavierspieler in der Nachbarschaft sei, in der Senatorgasse.
Worauf du eher mürrisch reagiertest, keine deutliche Antwort gabst, bis –
Ja, bis?
Ich mich über die steifleinernen Figuren in unserem Kabinett beklagte –
Steifleinern, ja, du sagtest das Stichwort, Hitzig –
Und wir gaben uns als Partei zu erkennen –
Gegen die Steifleinernen, Hitzig, gegen eine gewaltige Mehrheit.
Hoffmann nahm ihn von diesem Augenblick an in Anspruch.
Hippel und Hitzig – ein Freundesduo, eine einsinnige Zweistimmigkeit oder eine zweigeteilte Einstimmigkeit. Immer werden sie ansprechbar, meistens anrufbar sein, verständnisvoll auch dann, wenn die Vernunft des geliebten Hoffmann flöten geht.
Die Frauen fanden ebenfalls Gefallen aneinander. Eugenie Hitzig schaute, wenn es paßte, nach nebenan, half Mischa, die bald niederkommen würde. Und die Sommerabende gehörten der Musik. Hoffmann, der früher als die anderen zur Arbeit ging, ein Kurzschläfer mit wüsten Träumen, streifte nachmittags durch die Stadt, die Kneipen, und nach dem Abendessen legte er sich ins Fenster, versicherte sich mit einem Blick, daß Hitzig und Eugenie ebenfalls im Nachbarhaus auf gleicher Höhe ihre Beobachterposition eingenommen hatten, wartete, bis sich unten auf der Gasse Ruhe eingestellt hatte und die Laternen angezündet waren, lief ans Klavier und hämmerte das Signal, die ersten Takte der »Figaro«-Ouvertüre.
Hitzig hatte ihm geholfen, das Klavier nahe ans Fenster zu rücken.
Ständig war er unterwegs zwischen Instrument und Fenster.
Was habe ich gespielt? fragte er. Was wird gewünscht? fragte er.
Mischa, die Arme auf einem Kissen gebettet, machte den Rücken rund, wagte ab und zu Zwischenrufe: Du wirst noch hinschlagen, Hoffmann, wir werden deine Gliedmaßen einzeln auflesen müssen.
Paß auf, daß du mich wieder richtig zusammensetzt, Mischa.
Er erinnerte sich, spielend, variierend, folgte eigenen Einfällen. Der Applaus aus dem Nachbarhaus kam regelmäßig und heftig. Wenn sein öffentliches Konzert, wie er es nannte, ein Ende gefunden hatte, überkam es ihn, er liebte Mischa, liebte die Musik, die sich ihm verkörperte.
Ich liebe, sagte er.
Mich, ergänzte sie.
Dich, korrigierte er.
Das Kind wird bald kommen. Er spüre nicht nur seine Bewegungen, behauptete er, er höre es wispern. In der Musik verwarf er einen Plan nach dem andern und wurde immer schneller.
Hitzig blieb ihm auf den Fersen. Zwar vergrößerte sich Hoffmanns Freundeskreis, nicht zuletzt durch seine musikalischen Unternehmungen – er sammelte Bewunderer und Förderer um sich –, aber Hitzig vertraute er sich an. Am 7. September 1807 porträtierte er die Hitzigs. Die Zuneigung hinderte ihn nicht, dennoch zu karikieren. Zwei verschränkt gestellte Büsten, die sonderbar aufgedunsen wirken. Mann und Frau gleichen sich geradezu geschwisterlich in ihrer Pausbäckigkeit und in ihrer Bereitschaft zu staunen.
Sind wir das? fragte Hitzig, mit dem fertigen Blatt vor den Spiegel tretend. Komm, schau dich an, rief er Eugenie.
Sie standen nebeneinander, betrachteten sich auf dem Aquarell, danach im Spiegel, mehrmals, und Hoffmann beobachtete sie dabei, in Gedanken schon wieder woanders.
Wir sind es, stellte Hitzig zögernd fest.
So, wie er uns sieht, fand Eugenie.
Hoffmann nickte zustimmend und sagte das Gegenteil: Ich müßte es noch mal versuchen.
Als Wehen die Geburt des Kindes ankündigten, erschien Hoffmann bei Hitzigs, er habe die Köchin schon zur Hebamme geschickt. Ob Frau Eugenie Mischa nicht beistehen könne? Er müsse ins Amt.
Hitzig begleitete ihn. Er arbeitete zügig wie üblich, verschwand gegen Mittag aus dem Büro, nicht ohne Hitzig seine Adresse zu hinterlassen, die Kneipe, in der er nach einem ausgiebigen Spaziergang das Weitere abwarten werde. Dort kam er gar nicht dazu, seiner Anspannung nachzugeben. Er trank und plante, gemeinsam mit einem Beamten aus dem Präsidium, Elias Krumbiegel, dem er zufällig über den Weg lief. Er schätzte ihn als Musikliebhaber, mied ihn jedoch, wenn er sich in seinem Enthusiasmus überschlug. Dieses Mal war Hoffmann ganz Ohr: Krumbiegel hatte vor, eine musikalische Vergnügungsgesellschaft zu gründen, die nicht nur Konzerte und Bälle veranstalten, sondern auch Sänger und Sängerinnen ausbilden sollte. Die beiden feuerten sich gegenseitig an, setzten einen Entwurf auf den andern in einem atemlosen Crescendo:
Und wenn nur eine Handvoll zu Beginn –
Musiker wüßte ich genug –
Jaja, Violinisten gleich ein Dutzend –
Und Sie als Komponist –
Ich, wenn nötig, dann –
Und wissen Sie, Hoffmann, das Höchste wäre mir ein Konzerthaus –
Ein Saal, ein glänzender Saal –
Ja –
Ein Zentrum, Krumbiegel, ein Musikhaus –
Das fehlt Warschau noch –
Wir müßten also einen Verein gründen –
Wenn wir das nicht könnten, wer sonst?
Da sitzen wir an der Quelle –
Eben, eben –
Hören Sie, bester Krumbiegel?
Was?
Wie sich die Stimmen hier im Gasthaus bündeln zu einem grotesken Chor?
Und wir die Solisten –
Die nicht akzeptierten –
Sie tranken und planten, und irgendwann, gegen Abend, unterbrach sie ein atemloser Bote, ein Junge aus Hoffmanns Haus, der dem Herrn Regierungsrat mitzuteilen hatte: Ich soll Ihnen sagen, im Auftrag von Madame Hoffmann, und Herr Assessor Hitzig hat mich geschickt, ich soll Ihnen sagen, daß Sie ein Herr Vater geworden sind.
Hoffmann trank in einem Zug das Glas leer, überhörte die Gratulation Krumbiegels, sprang auf, drückte dem Jungen eine Münze in die Hand: Und kannst du mir sagen, ob Sohn oder Tochter?
Das konnte er nicht.
Womit er Hoffmann anspornte, hinter ihm herzusausen. Dem Wirt rief er noch zu, die Rechnung werde er morgen begleichen, doch von Krumbiegel bekam er zu hören, daß er ihn eingeladen habe – unter diesem Umstand natürlich sowieso!
Er überholte den kleinen, flinken Boten, triumphierte, der setzte ihm nach und hüpfte wieder vor ihm her. Das Spiel vergnügte ihn, er vergaß beinahe das Ziel des Laufs. Schließlich erreichte er taumelnd, doch vor dem Boten, die Haustür, wurde begrüßt von Eugenie Hitzig, die aus dem Fenster lehnte: Sie haben eine Tochter, Hoffmann!
Nun wußte es die ganze Gasse, die Gratulanten würden sich melden.
Ein Kind! Eine Tochter. Über ihren Namen mußte er nicht nachdenken. Die Wirtshausunterhaltung mit Krumbiegel legte ihn nahe.
Hitzig umarmte ihn im Treppenhaus, ein Kindchen, ein Seelchen, Hoffmann, und ich sage Ihnen, eine Stimme hat sie, geeignet für Koloraturen.
Das Kindchen plärrte und krähte.
Die Hebamme hielt es auf dem Arm ihm entgegen. Gratulation, Herr Regierungsrat.
Er beugte sich über Mischa, die vor Erschöpfung und Stolz glühte, strich ihr über die Stirn und fragte nach ihrem Befinden.
Sie sagte: Das Kindchen hat es mir nicht leichtgemacht.
Er sagte: Cäcilia.
Sie sagte: Aber schau sie dir doch wenigstens an. Und nach einer Pause, in der sie nach dem Namen suchte, den er schon gefunden hatte, fuhr sie fort: Unsere Cäcilia.
Seine Tochter! Ich will von einer Liebe schreiben, die der Leidenschaft zu Julia vorausgeht. Ein Arioso mit Zwischentönen, Strophen väterlicher Anbetung. Endlich eine neue Tonart und ein anderes Tempo – Andante.
In seinen Briefen suche ich nach wenigstens einem Satz, der mit Stolz dem Kind gewidmet ist. Es hätte seinen Alltag verändern können. Vermutlich aber hat er es kaum wahrgenommen, ist vor seinem Geschrei geflohen, hat es Mischa überlassen, die ihm in der neuen Rolle sowieso nicht ganz geheuer war, beansprucht von dem Kind. Mehr noch: Sie belästigte ihn mit diesem Wesen.
Hörst du sie atmen, Hoffmann? fragte sie ihn, wenn er nachts neben ihr lag und seine Wachträume zu steuern versuchte.
Hörst du sie? fragte er zurück.
Ich glaube, ja.
Bist du nicht sicher, Mischa, schau nach ihr.
Er hat Cäcilia nicht festgehalten, sage ich mir. Und erst, als sie ihn verlassen hatte, vernahm er die Stimme, die er ihr zugedacht hatte, Cäcilia, die Schutzheilige seiner Musik.
Mit zwei Jahren starb das Kind. Er war nicht dabei. Er hatte Frau und Tochter nach Posen gebracht und versuchte in Berlin Fuß zu fassen. Dort bekam er die Nachricht von Mischa. Weil nichts klappte, weil keiner seiner Einfälle Echo bekam und er in seinem Elend den Atem verlor, konnte er, freilich weiter um sich kreiselnd, nur für einen Augenblick trauern: »Sie fanden mich«, schreibt er, »bei Ihrem letzten Hiersein in einer etwas fatalen Stimmung – indessen müssen Sie diese dem äußeren Druck der Umstände zuschreiben – ich bin in einer Lage, über die ich selbst erschrecke, und die heutigen Nachrichten aus Posen sind nicht von der Art mich zu trösten – Meine kleine Cecilia ist gestorben und meine Frau ist dem Tode nahe!« Es ist ein einfacher Satz, mit dem er das verschwundene und wenig beachtete Wesen endlich erkannte, in die Arme nahm und für einen Augenblick an seine Brust drückte: »Meine kleine Cecilia«, um sie einen Halbsatz weiter schon wieder zu vergessen: »Am liebsten wünsche ich mir ein Unterkommen als Musik-Direktor bei irgendeinem Theater …«
Ich lese ihn, entlasse ihn wieder in die wirre Vorgeschichte zu einer Liebe, die Cäcilia ohnehin vergißt: sie war zwar als Ideal getauft worden, konnte aber nie eines sein.
Krumbiegel schaffte es in kürzester Zeit, genügend Mitglieder für die Musikalische Vergnügungsgesellschaft zu werben. Hoffmann zierte sich anfänglich, nahm nur selten an den wöchentlichen Treffen teil, fand den Enthusiasmus von Knochenköpfen lachhaft und wurde erst aktiv, wirbelte und warb, als der Oginskische Palast gemietet werden konnte, die Gesellschaft eine Bleibe hatte, mit Konzertsaal, Probe- und Unterrichtsräumen sowie zwei Lehrern für Solostimmen und Chor zu einem Institut avancierte.
Um seinen Dämonen nicht freien Lauf zu lassen, wie Hitzig bemerkte, ging Hoffmann morgens noch früher ins Büro, arbeitete sich mit manischer Akkuratesse durch die Akten, schrieb Kommentare und Gutachten und entließ sich, wie er Krumbiegel sagte, am frühen Nachmittag aus dem Dienst.
Er komponierte wieder, genauer, er komponierte weiter an seiner Es-Dur-Sinfonie, die er noch in Plock begonnen hatte, erinnerte sich im Adagio an Don Giovanni, diesen freiesten der Mozartschen Geister, den er in Gedanken nachspielte und in der Wirklichkeit mitunter ausprobierte. Die melodischen Einfälle wurden zu Gesten, warfen Schatten. Manchmal überwältigte ihn Don Giovannis Nähe, er sprang vom Klavier auf, hüpfte durchs Zimmer, zündete Kerzen an, stand, wurde steif, reckte sich und ließ die Glieder wieder beben. Nun konnte er singen: »Non l’avrei giammai creduto/Ma far quel che potrò.«
Mischa durfte dabei sein, mußte aber auf dem Diwan stillhalten – sie ärgerte ihn dennoch, wenn sie die Rotweinflasche versteckte. Morgen plagen dich wieder die Kopfschmerzen.
Meistens hielt er eine zweite Flasche in Reserve, hinterm Klavier oder zwischen den Büchern.
Mischa machte aus ihrer Abneigung gegen Don Giovanni kein Hehl. Er ist kein guter Mensch, fand sie, und sie konnte nicht begreifen, wieso Mozart eine solche Musik für ihn erfunden hat.
Womit sie Hoffmann nur bewies, daß sie die Liebe nicht verstand, nach der Don Giovanni sich vergeblich sehnte. Du hast keine Ahnung von der Liebe, sie ist wandelbar, vielgestaltig.
Aber ich liebe dich doch, pflegte sie dann zu beteuern, als wäre es der Refrain eines Liedes, und er ergänzte ihn schulterzuckend: Ich dich auch, Mischa, doch das ändert nichts daran, daß du sie nicht besitzt. Wenn überhaupt, besitzt sie dich, und wer weiß, ob auf Dauer.
Sobald er sang, dirigierte er ein unsichtbares Orchester. Er war sicher, daß dies bald in Wirklichkeit geschehen würde. Mischas Zweifeln fiel er sofort ins Wort: Du wirst es erleben!
Wie so oft, eilte er sich voraus. Die Zukunft schenkte ihm ein vollkommenes Musikhaus. Der Oginskische Palast könnte dem Musikalischen Verein genügen, aber mit einem Mal reizte eine größere Aufgabe: Der opulente Mniszecksche Palast war von einem Brand beschädigt worden, stand zum Verkauf. Dort erst, in dem großen, weitläufigen Bau mit dem riesigen Saal könnten sie der Stadt ein musikalisches Zentrum bieten, ein Musikschloß, ein Refugium der schönsten Stimmen und Instrumente.
Hoffmann kam nur noch, um zu schlafen, nach Hause. Morgens diente er wie gewohnt und pflichtbewußt der Regierung, die restliche Zeit widmete er seinem Traum. Er trat, von den Mitgliedern der Gesellschaft unterstützt, gleichsam als Bauherr auf. Er zeichnete die Pläne für den inneren Ausbau, leitete die Handwerker an, verwirrte und verärgerte sie durch Korrekturen und Retuschen.
Solange jedoch im Oginski-Palais Gesangstunden erteilt wurden, zog es ihn auch noch dorthin. Ich bin närrisch auf Stimmen, entschuldigte er seine unangekündigten Besuche bei den Gesangslehrern, die allerdings annahmen, daß Hoffmann weniger die Stimmen als die jungen Sängerinnen anzogen. Einen der beiden Lehrer, Monsieur Leydecke, der seinen Verdacht andeutete, versetzte Hoffmann in einen dauerhaften Schwindel:
Sie irren, mein Herr, wenn Sie mich einer derart platten Neigung für junge und schöne Damen verdächtigen, anfällig für ihre Reize, womöglich ein Wadenstreichler, ein Anbeter von langen und schlanken Hälschen, Sie irren sich, Monsieur, und ich bedaure Sie, schäme mich für Ihre allzu direkten Gedanken. Wobei er sich Leydecke mit kleinen, heftig aus den Knien gedrückten Schritten näherte, sich eng vor ihm aufstellte, mit seiner Nase die Nase des Angegriffenen touchierte, ihn an den Schultern faßte, vor sich her schob und auf einen Stuhl drückte: Es sind die Stimmen, weswegen Sie mich so häufig zu Gast haben, ihre Kraft, ihre Fähigkeit zu schwingen, ihr Leuchten, Stimmen, die sich von der Sängerin entfernen und in einem Echo wenden, ihre Entfaltung im Crescendo, ihre Biegsamkeit im Legato, Stimmen zwischen Dunkel und Hell, Stimmen – und nun hören Sie genau zu, Monsieur (er drehte vor Leydecke eine Pirouette) –, Stimmen, die ihren Körper haben, schmal oder üppig, die aus einem Grund kommen, aus einem Seelenloch gewissermaßen, die gefärbt sind von Erinnerungen, Erfahrungen und Wünschen, Stimmen, die ihr Wesen brauchen, mein Herr, denn ist Ihnen bei Ihren Lektionen noch nicht aufgefallen, daß die Sängerin sich singend verändert, schön und anziehend wird und zugleich schrecklich abweisend, daß sie Alcine oder Fiordiligi in sich aufnimmt, nicht nur deren erfundene Substanz als ein belebendes Elixier, nein, deren Existenz, deren Unvergleichbarkeit, eben weil die Musik Händels oder Mozarts sie erfüllt, verwandelt. Capito? Sie haben recht, ich bete diese jungen Damen an, erlaube mir sogar anzügliche Gedanken, die ich aber nie in ihrer Gegenwart äußern würde, denn ich liebe nicht Alexandra oder Hermine, ich liebe Zerline und Donna Anna, ich liebe ihre Liebe, ich bin ihnen verfallen, und meine Phantasie kennt keine Hemmungen, nein.
Was Leydecke ahnte und Hoffmann ihm auszureden versuchte, traf freilich zu: Die Stimmen erotisierten ihn, ein Sopran anders als ein Alt, sie verführten ihn, das singende Wesen in Besitz zu nehmen, den Körper der Stimme zu streicheln, ihn an sich zu pressen, atemlos zu werden aus Sehnsucht.
Leydecke gab nicht auf: Und warum stellen Sie Alexandra nach oder Mascha, der verwegenen Polin, wie Sie sie zu bezeichnen pflegen? Warum schenken Sie den jungen Damen Rosen und Konfekt, lesen ihnen Gedichte vor, produzieren sich am Klavier?
Auch dafür hatte Hoffmann seine Antwort: Stimmen steigern sich, wenn sie bewundert werden, Leydecke, sie brauchen die Liebe, den Applaus, und bei diesen beiden habe ich auch noch das Vergnügen, Unterschiede hören zu können, wozu auch Sie in der Lage wären, die Königsberger Stimmlage und die Warschauer, den preußischen Sopran, leuchtend und zugespitzt, den polnischen Alt, warm aus der Gurgel.
Leydecke erhob sich abrupt, drückte Hoffmann zur Seite und sagte ärgerlich: Das ist nichts als Einbildung, Herr Regierungsrat, und hat nichts mit Ausbildung zu tun. So, wie ich sie verstehe.
Hoffmann stellte tatsächlich der siebzehnjährigen Mascha nach, genoß ihre verlegene Abwehr. In den Konzerten hielt er nach ihr Ausschau, verschlang sie mit Blicken, und Mischa warf ihm vor, sich zum Gespött der Leute zu machen: Sie kennen dich doch alle, Hoffmann. Du benimmst dich, wie soll ich es anders ausdrücken, daneben.
Womit sie ihm ein Stichwort gab und er wieder spielen konnte: Du hast recht, Mischa, ich benehme mich daneben, ich stehe neben mir, das Entzücken hat mich aus mir ausgehebelt. Du solltest das Kind hören.
Er konnte sie nicht überreden.
Es genügt mir, dich von ihrer Stimme schwärmen zu hören. Sei nicht so geschmacklos, mich, wenn du in Gedanken abwesend bist, Mascha zu nennen.
Ist das nicht ein sonderbarer Zufall? Mascha, Mischa? Er legte seinen Kopf auf Mischas Schulter und verzehrte Mascha mit seinen Blicken: Sie wird eine mitreißende Dorabella sein, bestimmt und zugleich kapriziös.