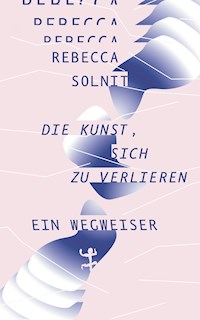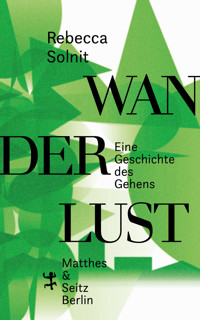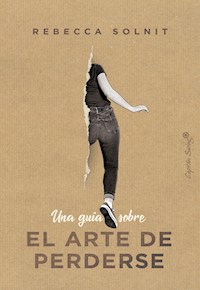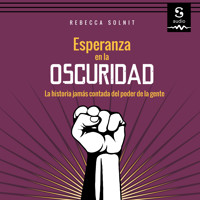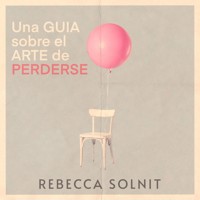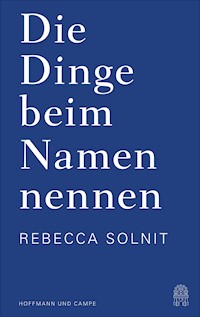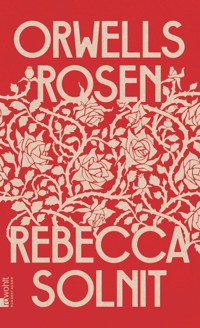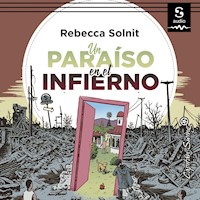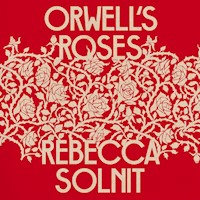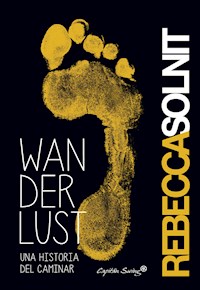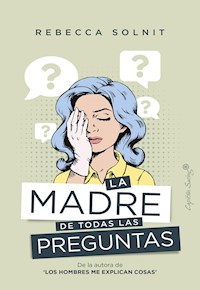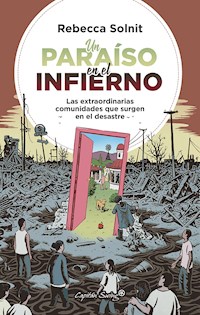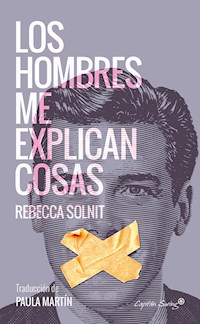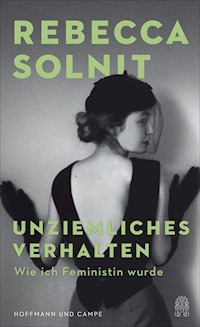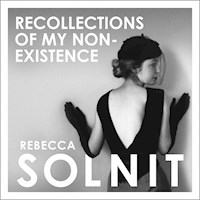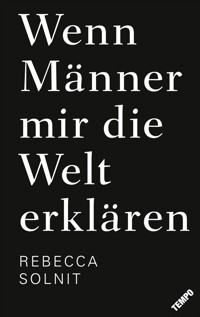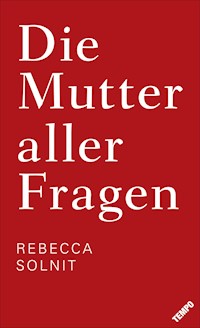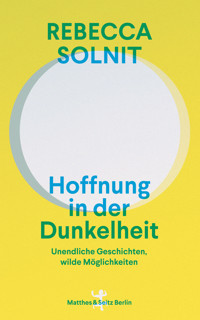
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was die Zukunft bringt, können wir nicht sagen – stets liegt das, was vor uns liegt, im Ungewissen, also in der Dunkelheit, weil Zukunft immer schon das war, was wir daraus gemacht haben. Dieses Machen, das Tun, das Engagement und der kleine und große Aktivismus stehen im Zentrum dieses Essays, den Rebecca Solnit bereits vor fast zwanzig Jahren geschrieben hat – und der damit einem spezifischen historischen Moment entspringt, in dem vieles möglich schien. Dass sich nicht alles davon eingelöst hat, ist dabei kein Zeichen des Scheiterns oder Versagens. Denn wenn uns die Geschichte etwas lehrt, argumentiert Solnit, dann dass bisher noch jede Form des kollektiven Engagements Früchte getragen hat – wenn vielleicht auch andere als die ursprünglich angestrebten. Es ist ihr prozessualer, schöpferischer und kreativer Politikbegriff, der Rebecca Solnits Essay gerade angesichts verhärteter Fronten wieder so ermutigend macht: weil es angesichts der komplexen Gegenwart mehr als einen Weg gibt, um durch unser Engagement die Zukunft zu gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hoffnung in der Dunkelheit
Rebecca Solnit
Hoffnungin der Dunkelheit
Unendliche Geschichten, wilde Möglichkeiten
Aus dem amerikanischen Englisch von Michael Mundhenk
Inhalt
Vorwort Gründe zur Hoffnung (2015)
Ein Blick ins Dunkel
Als wir verloren haben
Was wir gewonnen haben
Falsche Hoffnung, einfache Verzweiflung
Eine Geschichte im Schatten
Das neue Jahrtausend kommt: 9. November 1989
Das neue Jahrtausend kommt: 1. Januar 1994
Das neue Jahrtausend kommt: 30. November 1999
Das neue Jahrtausend kommt: 11. September 2001
Das neue Jahrtausend kommt: 15. Februar 2003
Die Veränderung unserer Vorstellung von Veränderung
Über die Indirektheit direkter Aktionen
Der Engel der alternativen Geschichte
Viagra für Karibus
Nichts wie raus aus dem Paradies
Über die tiefe Kluft hinweg
Nach der Ideologie oder: Veränderungen der Zeit
Das globale Lokale oder: Veränderungen des Ortes
Ein Traum, dreimal so groß wie Texas
Zweifel
Reise zum Mittelpunkt der Welt
Ein Blick zurück: Die außergewöhnlichen Leistungen gewöhnlicher Menschen (2009)
Alles fügt sich zusammen, während alles auseinanderfällt (2014)
Rückwärts und vorwärts Ein Nachwort
Eine terminologische Bemerkung
Dank
Literaturhinweise
Der Chronist, welcher die Ereignisse hererzählt,ohne große und kleine zu unterscheiden, trägt damit der Wahrheit Rechnung, daß nichts was sich jemalsereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist.
Walter Benjamin,
»Über den Begriff der Geschichte«
Wenn euch die Nachrichten nicht gefallen,dann geht raus und macht euch selber welche.
Abmoderation des Nachrichtensprechers Wes Nisker im Rundfunksender KSAN in den 1970er-Jahren
Vorwort Gründe zur Hoffnung (2015)
Deine Gegner wollen, dass du glaubst, alles sei hoffnungslos, du hättest keine Macht, es bestünde kein Handlungsbedarf, du könntest nicht gewinnen. Hoffnung ist eine Gabe, die du nicht hergeben musst, eine Kraft, die du nicht wegwerfen musst. Und obwohl Hoffnung eine Trotzreaktion sein kann, ist Trotz kein hinreichender Grund zum Hoffen. Doch es gibt gute Gründe.
Ich habe dieses Buch 2003 und Anfang 2004 als ein Plädoyer für die Hoffnung geschrieben. Was folgt, ist in gewisser Hinsicht ein Dokument seiner Zeit – es wurde gegen die enorme Verzweiflung geschrieben, die zu Beginn des Krieges im Irak herrschte, als die Bush-Administration auf dem Höhepunkt ihrer Macht war. Dieser Moment liegt lange zurück, doch Verzweiflung, Defätismus, Zynismus sowie die Geschichtsvergessenheit und die Annahmen, aus denen diese Einstellungen häufig erwachsen, haben sich nicht aufgelöst – nicht einmal, als sich absolut wilde, unvorstellbar fantastische Dinge ereigneten. Und zur Rechtfertigung dieser Haltungen ließe sich noch immer vieles vorbringen.
Mehr als ein Dutzend turbulente Jahre später glaube ich trotzdem, dass die Prämissen des Buches weiterhin gelten. Progressive, bürgernahe Graswurzelgruppierungen haben zahlreiche Siege errungen. Die kollektive Macht der Menschen ist weiterhin ein Katalysator für tiefgreifende Veränderungen. Und die Veränderungen, die wir erlebt haben, sind sowohl erfreulich als auch schrecklich. Die Welt von 2003 wurde hinweggefegt. Doch die Schäden, die sie angerichtet hat, klingen nach. Ihre Übereinkünfte und viele ihrer Ideologien haben allerdings Platz für neue gemacht – und darüber hinaus für eine grundlegende Veränderung dessen, wer wir sind, sowie der Art und Weise, wie wir uns selbst, die Welt und so viele Dinge in ihr vorstellen. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit, in der viele ungeahnt vitale Bewegungen entstanden sind, die nicht vorhersehbar waren. Gleichzeitig ist es eine albtraumhafte Zeit. Unser Engagement erfordert die Fähigkeit, beides erkennen zu können.
Im 21. Jahrhundert hat sich eine grauenhafte ökonomische Ungleichheit breitgemacht, möglicherweise aufgrund einer Geschichtsvergessenheit sowohl der Werktätigen, die eine Verschlechterung der Löhne, Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen tolerieren, als auch der Eliten, die nicht mehr wissen, dass sie einige dieser Dinge in der Hoffnung zugestanden hatten, dadurch eine Revolution vermeiden zu können. Der Aufstieg des Silicon Valley als ein globales Machtzentrum hat zahllose Arbeitsplätze eliminiert und automatisiert und so die ökonomische Ungleichheit verstärkt. Er hat neue Eliten und monströse Unternehmen entstehen lassen: von Amazon mit seinen Angriffen auf das Verlagswesen, auf Autorinnen und Autoren sowie auf Arbeitsbedingungen allgemein, bis hin zu Google, das versucht, in unzähligen Bereichen ein globales Informationsmonopol aufzubauen, und dabei eine erschreckende Macht anhäuft, die sich ableitet aus der Erstellung detailreicher Profile der allermeisten Menschen, die Computer nutzen. Die großen Tech-Konzerne haben Möglichkeiten zur Überwachung geschaffen und angewandt, die sich der Kreml und das FBI auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht hätten träumen lassen – in Zusammenarbeit mit der Regierung, die das Ganze regulieren sollte. Der Angriff auf bürgerliche Freiheiten, einschließlich des Rechts auf Privatsphäre, dauert weiterhin an, lange, nachdem die während des globalen Krieges gegen den Terror vorgebrachten Rechtfertigungen verblasst sind.
Schlimmer noch ist die Wirkung des Klimawandels, schneller, heftiger und verheerender als von der Wissenschaft vorhergesagt.
Hoffnung bedeutet nicht, diese Realitäten zu leugnen. Sie bedeutet, sich ihnen zu stellen und mit ihnen auseinanderzusetzen, indem man sich daran erinnert, was das 21. Jahrhundert sonst noch gebracht hat: die Bewegungen, Helden, Heldinnen und Bewusstseinsänderungen, die diese Dinge jetzt angehen. Unter ihnen: Occupy Wall Street; Black Lives Matter; Idle No More und die Dreamers, die den DREAM-Act unterstützen, ein Dekret zum Schutz von Migrantenkindern; die Bemühungen um die Gleichstellung aller Ehen; das Wiederaufleben der Frauenbewegung; Bewegungen für ökonomische Gerechtigkeit, die sich dem Thema Mindestlohn widmen (und ihn häufig angehoben bekommen) und gegen die Schuldknechtschaft und die Studienkredit-Abzocke kämpfen; sowie eine lebendige Klima- und Klimagerechtigkeitsbewegung – und die unzähligen Überschneidungen zwischen ihnen allen. Es war ein wirklich bemerkenswertes Jahrzehnt für den Aufbau von Bewegungen, für gesellschaftliche Veränderungen und für einen tiefgreifenden Wandel von Vorstellungen, Perspektiven und Strukturen für breite Teile der Bevölkerung (und natürlich auch für Backlashs gegen all diese Dinge).
Der Nutzen der Ungewissheit
Hoffnung in der Dunkelheit begann als ein Essay, den ich, keine sechs Wochen nachdem die Vereinigten Staaten ihren Krieg gegen den Irak eröffnet hatten, in einer Onlinezeitschrift veröffentlichte. Er ging sofort, wie man so schön sagt, viral – er fand weite Verbreitung per Mail, wurde in einer etablierten Zeitung abgedruckt, landete auf vielen Nachrichtenseiten im Netz, wurde von einigen alternativen Zeitungen raubkopiert und sogar von jemandem, dem er gefiel, ausgedruckt und per Hand verteilt. Es war mein erstes Abenteuer mit einer Veröffentlichung im Internet, aber auch das erste Mal, dass ich das Innenleben der Politik des Augenblicks, die Emotionen und Wahrnehmungen, die unseren politischen Standpunkten und Engagements zugrunde liegen, direkt ansprach. Verblüfft über den Hunger nach einer anderen Art des Erzählens darüber, wer und wo wir waren, beschloss ich, dieses damals schmale Buch zu schreiben. Nach seinem Erscheinen führte es ein aufregendes Leben in mehreren Sprachen, und ich verbrachte Jahre damit, öffentlich über Hoffnung und Aktivismus zu sprechen, über die historischen Fakten und die Möglichkeiten. Meine Argumente wurden dabei vielleicht geschliffener, präziser oder zumindest strapazierfähiger. Und es ist mir eine Freude, es zu überarbeiten und diese Einleitung, mehrere neue Kapitel am Ende sowie einige Anmerkungen hinzuzufügen. Hier also eine weitere Durchquerung dieser Landschaft.
Es ist wichtig zu sagen, was Hoffnung nicht ist: Sie ist nicht der Glaube, dass alles gut war, ist oder wird. Die Beweise unbeschreiblichen Leidens und unermesslicher Zerstörung sind allgegenwärtig. Bei der Hoffnung, die mich interessiert, geht es um breit gefasste Perspektiven mit ganz spezifischen Möglichkeiten, die uns zum Handeln einladen oder auffordern. Sie ist auch keine sonnige Alleswird-besser-Erzählung, kann jedoch ein Gegenstück zum Alles-wird-schlimmer-Narrativ bilden. Dieses Buch ist also ein Bericht über Komplexitäten und Ungewissheiten, mit Öffnungen. »Kritisches Denken ohne Hoffnung ist Zynismus, aber Hoffnung ohne kritisches Denken ist Naivität«, bemerkte die bulgarische Schriftstellerin Maria Popova einmal. Und Patrisse Cullors, eine Mitbegründerin von Black Lives Matter, beschrieb die Mission dieser Bewegung schon früh so: »Hoffnung und Inspiration für ein kollektives Handeln zu geben, um kollektive Macht aufzubauen und eine kollektive Transformation zu erreichen, verwurzelt in Trauer und Wut, aber ausgerichtet auf eine Vision und auf Träume.« Es ist eine Position, die anerkennt, dass Trauer und Wut nebeneinander existieren können.
Die enormen Errungenschaften im Bereich der Menschenrechte im letzten halben Jahrhundert – nicht nur das Erlangen von Rechten, sondern auch die Neudefinition von Race, Gender, Sexualität, Körperwissen, Spiritualität und der Idee des guten Lebens – florierten in einer Zeit beispielloser ökologischer Zerstörung und der Entwicklung ganz und gar neuer Formen der Ausbeutung. Aber es entstanden eben auch neue Formen des Widerstands, die ermöglicht wurden durch ein gelungenes Verständnis dieser Gleichzeitigkeiten, neue Kommunikations- und Organisierungsmöglichkeiten sowie überraschende Allianzen über Entfernungen und Unterschiede hinweg.
Hoffnung gründet auf der Annahme, dass wir nicht wissen, was geschehen wird, und dass in der Weite der Ungewissheit Raum zum Handeln ist. Wer Ungewissheit anerkennt, erkennt, dass wir in der Lage sein könnten, den Ausgang der Ereignisse zu beeinflussen – allein oder gemeinsam mit ein paar Dutzend oder mehreren Millionen anderen Menschen. Hoffnung ist eine Umarmung des Unbekannten, eine Alternative zur Gewissheit sowohl des Optimismus als auch des Pessimismus. Wer an Ersteren glaubt, denkt, dass alles ohne unser Zutun gut wird, wer an Letzteren glaubt, nimmt den entgegengesetzten Standpunkt ein. Und beide entschuldigen so ihr Nichthandeln. Hoffnung ist die Überzeugung, dass das, was wir tun, zählt, auch wenn wir nicht im Voraus wissen können, wie und wann es zählt, auf wen und auf was es sich vielleicht auswirkt. Möglicherweise wissen wir es sogar im Nachhinein nicht, aber zählen tut es trotzdem – die Geschichte ist voller Beispiele von Menschen, deren Einfluss nach ihrem Tod am größten war.
Es gibt bedeutende Bewegungen, die ihre Ziele verfehlten, und es gibt vergleichsweise kleine Gesten, die sich wie Pilze zu erfolgreichen Revolutionen auswuchsen. Die Selbstverbrennung des verarmten, von der Polizei schikanierten Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 in Tunesien war der Funke, der eine Revolution entzündete, erst in seiner Heimat und dann 2011 in ganz Nordafrika und anderen Teilen der arabischen Welt. Und obwohl der Bürgerkrieg in Syrien und die Konterrevolutionen nach dem erstaunlichen Aufstand in Ägypten wahrscheinlich das sind, woran sich die meisten erinnern, stürzte Tunesiens »Jasminrevolution« einen Diktator und führte 2014 zu friedlichen Wahlen in diesem Land. Was immer der Arabische Frühling noch war, er ist auch ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wie unvorhersehbar Veränderungen sind und wie stark die kollektive Macht von Menschen sein kann.
Die Entstehung des Arabischen Frühlings lässt sich aber auch anders erzählen: Das stille Organisieren, das vorher im Verborgenen stattfand, war grundlegend. Genauso wie die Comic-Biografie über Martin Luther King und den zivilen Ungehorsam, die ins Arabische übersetzt wurde und kurz vor dem Arabischen Frühling in Ägypten weite Verbreitung fand. Man kann das Ganze so erzählen, dass Kings Taktiken des zivilen Ungehorsams von Gandhis Taktiken inspiriert waren und Gandhi wiederum von Tolstoi und den radikalen Nichtkooperations- und Sabotageaktionen der britischen Suffragetten. So winden sich die Ideenfäden um die ganze Welt und durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Eine andere Abstammungslinie des Arabischen Frühlings führt zurück zum Hip-Hop, der afroamerikanischen Musik, die zu einem globalen Medium für Widerspruch und Empörung geworden ist; der tunesische Rapper El Général war, zusammen mit Bouazizi, ein Initiator des Aufstands, und auch andere Musiker spielten eine Rolle bei der Artikulation der Empörung und der Inspiration der vielen.
Wie Pilze: Nach einem Regen erscheinen sie wie aus dem Nichts an der Erdoberfläche. Viele wachsen aus dem Myzel heraus, einem ausgedehnten Wurzelgeflecht, das verborgen und weitgehend unbekannt bleibt. Was wir »Pilze« nennen, nennt die Mykologie »Fruchtkörper« dieses weniger sichtbaren Myzels. Aufstände und Revolutionen gelten oft als spontan, doch das Fundament dafür legen häufig weniger sichtbare langfristige Organisierungs- und Untergrundarbeit. Ein Wandel von Ideen und Werten ist auch das Ergebnis der Arbeit von Schriftstellerinnen, Aktivisten, Gelehrten, öffentlich auftretenden Intellektuellen sowie Menschen, die sich in den sozialen Medien engagieren. Das mag unbedeutend oder peripher erscheinen – bis veränderte Annahmen darüber, wer und was zählt, wer gehört und wem geglaubt werden soll, wer Rechte hat, zu ganz anderen Ergebnissen führen.
Aus Ideen, die anfangs als ungeheuerlich, lächerlich oder extrem gelten, werden allmählich Vorstellungen, an die man schon immer geglaubt zu haben meint. Wie diese Veränderung vonstattenging, bleibt nur selten im Gedächtnis, auch weil es an einen Mainstream erinnert, der beispielsweise auf eine fanatische Weise homophob oder rassistisch war, wie er es inzwischen nicht mehr ist; und es erinnert daran, dass die Kraft aus den Schatten und von den Rändern kommt, dass unsere Hoffnung eher in der Dunkelheit liegt und nicht mitten auf der Bühne im Rampenlicht. Unsere Hoffnung und häufig auch unsere Kraft.
Die Geschichten, die wir erzählen
Allein die Geschichte zu ändern reicht nicht aus, war aber oft grundlegend für echte Veränderungen. Eine Verletzung sichtbar und öffentlich zu machen ist häufig der erste Schritt zur Heilung, und politische Veränderungen folgen oft der Kultur – wenn das, was lange toleriert wurde, als intolerabel betrachtet wird, oder das, was übersehen wurde, sich zeigt. Mit anderen Worten, jeder Konflikt ist zum Teil ein Kampf um die Geschichte, die wir erzählen, beziehungsweise darum, wessen Geschichte erzählt wird.
Ein Sieg bedeutet nicht, dass jetzt alles für immer gut sein wird und wir deshalb bis ans Ende aller Tage einfach nur rumhängen können. Einige Aktivisten und Aktivistinnen befürchten, sobald wir einen Sieg verkünden, geben die Leute den Kampf auf. Ich hingegen habe eher die Befürchtung, dass die Leute aufgeben und nach Hause gehen oder gar nicht erst anfangen, wenn sie glauben, dass ein Sieg unmöglich sei, oder nicht erkennen, welche Siege bereits errungen wurden. Die Gleichstellung der Ehe bedeutet nicht das Ende der Homophobie, ist aber ein Grund zum Feiern. Ein Sieg ist ein Meilenstein, ein Beweis dafür, dass wir mitunter gewinnen, und eine Ermunterung weiterzumachen, nicht aufzuhören. Zumindest sollte er es sein.
Meine eigene Erkundung der Gründe für Hoffnung hat seit meiner Arbeit an Hoffnung in der Dunkelheit zwei große Bestärkungen erfahren. Eine resultierte aus der Erkenntnis, wie enorm groß die altruistischen und idealistischen Kräfte sind, die in der Welt bereits am Werk sind. Die meisten von uns würden, wenn man uns fragte, sagen, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, doch erhebliche Aspekte unseres Alltagslebens – unsere Interaktionen mit und unser Engagement für Familie, Freundschaften, Berufungen, Mitgliedschaften in sozialen, spirituellen und politischen Organisationen – sind im Kern nichtkapitalistisch oder sogar antikapitalistisch, voller Dinge, die wir umsonst tun, aus Liebe und aus Prinzip.
In gewisser Hinsicht ist der Kapitalismus eine anhaltende Katastrophe, die der Antikapitalismus lindern hilft, wie eine Mutter, die ihrem Kind ständig hinterherräumt (oder, um die Analogie noch etwas weiterzutreiben: die das Kind manchmal, durch Gesetze oder Proteste, diszipliniert, damit es sein Durcheinander selbst hinter sich aufräumt, oder manch ein Durcheinander von vornherein unterbindet – es mag in diesem Zusammenhang erwähnenswert sein, dass nichtkapitalistische Praktiken entschieden älter sind als die der freien Marktwirtschaft). Oft reden Aktivisten und Aktivistinnen so, als seien die Lösungen, die wir brauchen, noch gar nicht erfunden worden, als begännen wir bei null, wo das wahre Ziel doch oft ist, die Dynamik und Reichweite der bestehenden Alternativen zu verstärken. Das, wovon wir träumen, existiert bereits in der Welt.
Meine zweite Bestärkung resultierte aus meinen Recherchen über die Reaktionen von Menschen auf große urbane Katastrophen, von den verheerenden Erdbeben in San Francisco (1906) und Mexiko-Stadt (1995) über den sogenannten Blitz in London (1940/41) bis hin zum Hurrikan Katrina in New Orleans (2005). Ein Großteil der Reaktionen der Behörden auf eine Katastrophe – und die Logik der Bombardierung von Zivilisten – geht davon aus, dass die Zivilisation eine zerbrechliche Fassade ist, hinter der unsere wahre Natur liegt: monströs, egoistisch, chaotisch und gewalttätig oder aber kleinmütig, fragil und hilflos. Während der meisten Katastrophen sind die Menschen jedoch ruhig, findig, altruistisch und kreativ. Im Allgemeinen gelingt es den Bombardements der Zivilbevölkerung nicht, den Willen der Bevölkerung zu brechen, weshalb dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch noch eine reine Zeitverschwendung ist.
Was mich an den Reaktionen auf Katastrophenfälle überraschte, war nicht die Tugend, da Tugend häufig das Ergebnis von Beflissenheit und Pflichtbewusstsein ist, sondern die leidenschaftliche Freude, die in den Berichten von Menschen aufblitzte, die nur knapp überlebt hatten. Diese Leute, die alles verloren hatten, die zwischen Trümmern oder in Ruinen lebten, hatten bei ihrer gemeinsamen Arbeit mit anderen Überlebenden Handlungsmacht, Sinn, Gemeinschaft und Unmittelbarkeit gefunden. Die Zeugnisse eines ganzen Jahrhunderts, aus denen ich mir für mein Buch A Paradise Built in Hell von 2009 Anregungen holte, zeigten, wie sehr wir uns ein sinnvolles Engagement im Leben wünschen, eine Zugehörigkeit zur Zivilgesellschaft, und wie viele gesellschaftliche Anstrengungen unternommen werden, genau das zu untergraben und uns von diesem, unserem vollständigsten, kraftvollsten Selbst wegzulotsen. Doch wenn die Situation es verlangt, kehren die Menschen fast instinktiv zurück zu diesen Versionen ihrer selbst, diesen Formen der Selbstorganisierung. So ähnelt eine Katastrophe stark einer Revolution, zumindest was Disruptionen und Improvisationen angeht, neue Rollen und das beunruhigende oder berauschende Gefühl, dass jetzt alles möglich ist.
Das war eine gänzlich andere Auffassung der menschlichen Natur – und eine Offenbarung, dass es nämlich möglich ist, unsere Ideale nicht aus Beflissenheit zu verfolgen, sondern weil Freude aufkommt, wenn sie realisiert werden. Diese Freude ist selbst eine aufständische Kraft gegen die Trostlosigkeit, Tristesse und Isolation des Alltagslebens. Meine Recherchen waren, wie mir schlussendlich klar wurde, ein kleiner Teil eines riesigen Projekts, das sich über viele verschiedene Disziplinen hinweg – Psychologie, Ökonomie, Neurobiologie, Soziologie, Anthropologie, Politikwissenschaft – zum Ziel gesetzt hat, die menschliche Natur neu zu definieren, und zwar als gemeinschaftlicher, kooperativer und mitfühlender als gemeinhin angenommen. Diese Rettung unseres Rufes vor den Sozialdarwinistinnen und den Hobbesianern ist wichtig, nicht, um ein positives Selbstwertgefühl zu fördern, sondern um die radikalen Möglichkeiten zu erkennen, die sich auf einer alternativen Sicht der menschlichen Natur aufbauen lassen.
Die Früchte dieser Untersuchungen machten mich hoffnungsvoller. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Hoffnung nur ein Anfang ist – sie ist kein Ersatz für das Handeln, sondern lediglich dessen Grundlage. »Nicht alles, was man konfrontiert, lässt sich ändern, aber nichts lässt sich ändern, bis man es konfrontiert«, schrieb James Baldwin. Hoffnung bringt einen dorthin; Arbeit bringt einen durch. »Die Zukunft gehört denen, die sich heute auf sie vorbereiten«, erklärte Malcolm X. Und es gibt eine lange Geschichte dieser Arbeit, der Arbeit, die Welt zu verändern, eine lange Geschichte der Methoden, der Helden und Heldinnen, der Visionäre und der Siege – und natürlich der Fehlschläge. Doch es sind die Siege, die zählen, und sich an sie zu erinnern, zählt ebenfalls. Wie sagte Martin Luther King Jr.: »Wir müssen endliche Enttäuschungen hinnehmen, dürfen aber niemals die unendliche Hoffnung verlieren.«
Die Zweige sind Hoffnung, die Wurzeln Erinnerung
»Erinnerung erzeugt Hoffnung auf die gleiche Art und Weise, wie das Vergessen Verzweiflung erzeugt«, merkte der Theologe Walter Brueggemann an. Das ist eine außergewöhnliche Feststellung, die uns daran erinnert, dass, obwohl Hoffnung in die Zukunft gerichtet ist, die Gründe zur Hoffnung in den Dokumenten der Vergangenheit und den Erinnerungen an das Gestern zu finden sind. Wir können von einer Vergangenheit erzählen, die nichts als Niederlagen, Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten kannte, oder von einer Vergangenheit, die ein heute unwiderruflich verloren gegangenes wunderschönes goldenes Zeitalter war – oder aber wir erzählen eine vielschichtigere und genauere Geschichte, in der Platz ist für das Beste und das Schlimmste, für Gräueltaten und Befreiungen, für Trauer und Jubel. Eine der Komplexität der Vergangenheit und aller Mitwirkenden angemessene Erinnerung, eine Erinnerung, die unsere Stärke mit einschließt und die vorwärtsgerichtete Macht namens Hoffnung erzeugt.
Geschichtsvergessenheit führt auf vielfältige Weise zu Verzweiflung. Der Status quo hätte es gern, wenn du glaubtest, er sei unveränderbar, unabwendbar und unangreifbar, und das Fehlen einer Erinnerung an eine sich dynamisch verändernde Welt verstärkt diese Sichtweise. Mit anderen Worten, wenn du nicht weißt, wie sehr die Dinge sich verändert haben, siehst du auch nicht, dass sie sich verändern oder verändern können. Wer so denkt, erinnert sich nicht an Razzien in Schwulenkneipen, als Homosexualität illegal war; an Flüsse, die in Flammen aufgingen, als die unkontrollierte Verschmutzung in den 1960er-Jahren ihren Höhepunkt erreichte; oder daran, dass es noch vor wenigen Jahrzehnten weltweit siebzig Prozent mehr Seevögel gab, und vor den ökonomischen Verschiebungen während der Reagan-Revolution nur sehr, sehr wenige Wohnungslose in den Vereinigten Staaten. Wer so denkt, erkennt nicht, welche Kräfte des Wandels am Werk sind.
Einer der wesentlichen Aspekte einer Depression ist das Gefühl, dass man auf ewig in diesem Elend feststeckt, dass sich nichts ändern kann oder wird. Das ist es, was den Selbstmord so verführerisch macht als einzigen erkennbaren Ausweg aus dem Gefängnis der Gegenwart. Zur privaten Depression gibt es ein öffentliches Pendant: das Gefühl, das nicht das Individuum, sondern das Land oder die Gesellschaft feststeckt. Die Dinge wenden sich nicht immer zum Besseren, aber sie wenden sich, und wir können bei diesen Veränderungen eine Rolle spielen – sofern wir handeln. Genau da kommt die Hoffnung ins Spiel, wie auch die kollektive Erinnerung, die wir »Geschichte« nennen.
Die andere Entmutigung, die die Geschichtsvergessenheit mit sich bringt, ist ein Mangel an Beispielen für positive Veränderung, für die kollektive Macht der Menschen, Beweise dafür, dass wir es schaffen können und auch bereits geschafft haben. George Orwell schrieb: »Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft: Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.« Die Vergangenheit zu kontrollieren beginnt damit, sie zu kennen; die Geschichten, die wir uns darüber erzählen, wer wir waren und was wir taten, formen das, was wir schaffen können und tun werden. Und außerdem ist Verzweiflung oft verfrüht: Sie ist eine Form von Ungeduld, aber auch der Gewissheit.
Meine Lieblingsbemerkung über politischen Wandel stammt von einem hochrangigen Mitglied der Regierung des Vorsitzenden Mao Zedong, seinem Ministerpräsidenten Zhou Enlai, der, als er Anfang der 1970er-Jahre nach seiner Einschätzung der Französischen Revolution gefragt wurde, antwortete: »Zu früh, um das zu beurteilen.« Einige behaupten, er habe von den Aufständen von 1968 geredet, nicht vom Sturz der Monarchie 1789, doch selbst dann demonstrierte seine Reaktion eine großzügige und weitreichende Perspektive. Ein Gefühl dafür zu behalten, dass selbst ein paar Jahre später das Urteil darüber noch nicht gesprochen ist, heißt, mit mehr offener Ungewissheit zu leben, als die meisten heutzutage ertragen können.
Nachrichtenzyklen suggerieren gern, dass Veränderungen in kleinen, plötzlichen Schüben stattfinden – oder gar nicht. Während ich das schreibe, werden die Militärangehörigen, die aller Wahrscheinlichkeit nach den chilenischen Sänger und Politaktivisten Víctor Jara ermordet haben, angeklagt. Mehrere Jahrzehnte sind seither vergangen, und manche Geschichten brauchen noch viel länger, bis sie abgeschlossen sind. Der Kampf für das Frauenwahlrecht dauerte fast ein Dreivierteljahrhundert. Eine Zeit lang wurde gern das Scheitern des Feminismus verkündet, als müsste das Projekt, jahrtausendealte gesellschaftliche Normen zu kippen, seine endgültigen Siege in einigen wenigen Jahrzehnten erringen beziehungsweise als wäre es eingestellt worden. Aber der Feminismus fängt gerade erst an, und seine Erscheinungsformen sind in Bauerndörfern im Himalaya von Bedeutung, nicht nur in den Städten des globalen Nordens. Susan Griffin, eine große Autorin der Gegenwart, die auch im Feminismus der 1970er-Jahre eine wichtige Rolle spielte, sagte kürzlich: »Ich habe im Laufe meines Lebens genügend Veränderungen gesehen, um zu wissen, dass Verzweiflung nicht nur selbstzerstörerisch ist, sondern auch unrealistisch.«
Andere Veränderungen führen zu Siegen und werden dann vergessen. Jahrzehntelang befassten sich Radikale intensiv mit Osttimor, das zwischen 1975 und 2002 brutal von Indonesien besetzt gehalten wurde; das befreite Land ist keine Nachricht mehr wert. Es gewann seine Freiheit durch einen tapferen Kampf von innen heraus, aber auch mithilfe von engagierten Gruppen andernorts, durch die die Regierungen, die das indonesische Regime unterstützten, Druck und Beschämung ausgesetzt wurden. Aus diesen bemerkenswerten Demonstrationen kollektiver Macht und Solidaritätsbekundungen sowie dem letztendlichen Sieg ließe sich eine Menge lernen, doch der ganze Kampf scheint vergessen.
Jahrzehntelang förderte die Peabody Western Coal Corporation auf dem Land der Hopi und Navajo bei Black Mesa im Tagebau Kohle so, dass die Luft verunreinigt wurde und Unmengen von Wasser aus der Region abgepumpt wurden. Der Kampf gegen die Black-Mesa-Mine war ein totemistischer Kampf für indigene Souveränität und Umweltgerechtigkeit; 2005 wurde die Mine stillgelegt und war schon bald kein Gesprächsthema mehr. Auch hier hatte es hartnäckigen Aktivismus von innen heraus und gute Verbündete außerhalb gebraucht, langwierige Gerichtsverfahren sowie Beharrlichkeit.
Wir brauchen Litaneien, Rezitationen oder Denkmäler für diese Siege, damit sie im Bewusstsein aller als Meilensteine verankert werden. Allgemeiner gesprochen werden Veränderungen, beispielsweise der Rechtsstellung der Frau, leicht von Menschen übersehen, die sich nicht mehr daran erinnern, dass es noch vor wenigen Jahrzehnten keine Möglichkeiten gab, gegen Ausgrenzung vorzugehen, gegen Diskriminierung, gegen sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz, die meisten Arten der Vergewaltigung und andere Verbrechen gegen Frauen, da die Rechtsordnung nichts davon anerkannte oder auch nur zur Kenntnis nahm. Keine dieser Veränderungen war zwangsläufig – Menschen haben dafür gekämpft und sie durchgesetzt.
Menschen passen sich an, ohne die Veränderungen zu werten. Seit 2014 erzeugt Iowa achtundzwanzig Prozent seiner Elektrizität allein aus Windkraft, nicht weil irgendjemand in diesem konservativen Bundesstaat sämtlichen Unternehmen für fossile Brennstoffe das Ende in Aussicht gestellt oder jemanden oder etwas gestürzt hat, sondern weil es eine vernünftige und erschwingliche Option war. Dänemark gewann im Sommer 2015 hundertvierzig Prozent seines Strombedarfs aus Windkraftanlagen (und verkaufte den Überschuss an seine Nachbarländer). Schottland hat eine erneuerbare Energieerzeugung von fünfzig Prozent erreicht und visiert für 2020 hundert Prozent an. In den Vereinigten Staaten wurden 2014 dreißig Prozent mehr Solaranlagen installiert als im Jahr zuvor – allgemein werden erneuerbare Energien weltweit kostengünstiger, wobei sie mancherorts schon jetzt billiger sind als fossile Energieträger. Diese schrittweisen Veränderungen geschahen geräuschlos, und viele wissen gar nicht, dass sie begonnen, ja sogar explosionsartig zugenommen haben.
Wenn wir eine Lehre ziehen können – aus unserer heutigen Position wie auch aus unserer damaligen –, dann, dass das Unvorstellbare normal ist. Und dass der Weg vorwärts fast nie eine schnurgerade Linie ist, an der man entlangblicken kann, sondern ein verschlungener Pfad voller Überraschungen, Geschenke und Entmutigungen, auf den man sich nur vorbereiten kann, indem man seine blinden Flecke genauso wie seine Intuitionen akzeptiert. Howard Zinn schrieb 1988 in einer Welt, die inzwischen verloren scheint, bevor so viele politische Umwälzungen und technologischen Veränderungen eintraten: »Während sich dieses Jahrhundert, ein geschichtsträchtiges Jahrhundert, dem Ende zuneigt, sticht aus seiner Geschichte eins hervor, nämlich ihre absolute Unvorhersehbarkeit.« Er konnte nur darüber staunen, wie weit wir gekommen waren: von 1964, als der Nationale Parteitag der Demokraten es ablehnte, eine schwarze Delegation aus Mississippi offiziell anzuerkennen, bis zu Jesse Jacksons (weitgehend symbolischer) Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur 1984 zu einer Zeit, als die meisten Menschen sich sicher waren, dass sie niemals eine schwarze Familie im Weißen Haus erleben würden. In seinem Essay »The Optimism of Uncertainty« von 2004 führt Zinn diesen Gedanken näher aus: »Der Kampf für Gerechtigkeit darf niemals wegen der scheinbar überwältigenden Macht derer aufgegeben werden, die die Waffen und das Geld haben und in ihrer Entschlossenheit, beides zu behalten, unbesiegbar scheinen. Diese scheinbare Macht hat sich, immer und immer wieder, als verwundbar erwiesen […], verwundbar durch moralischen Eifer, Entschlossenheit, Einigkeit, Organisierung, Opferbereitschaft, Esprit, Einfallsreichtum, Courage, Geduld – ob von Schwarzen in Alabama und Südafrika, Bauern und Bäuerinnen in El Salvador, Nicaragua und Vietnam, oder Arbeitern, Arbeiterinnen und Intellektuellen in Polen, Ungarn und der Sowjetunion selbst.«
Menschen haben die Macht
Sozialer, kultureller oder politischer Wandel läuft nicht auf vorhersehbare Weise oder nach einem fest gefügten Zeitplan ab. Noch einen Monat vor dem Fall der Berliner Mauer rechnete kaum jemand damit, dass der Sowjetblock (dank vieler Faktoren, einschließlich der enormen Kraft der Zivilgesellschaft, gewaltfreier direkter Aktionen und hoffnungsvoller Organisierungsarbeit, die bis in die 1970er-Jahre zurückreichte) urplötzlich auseinanderfallen würde, genauso wenig, wie irgendjemand, inklusive der Beteiligten, die Auswirkungen voraussah, die der Arabische Frühling, Occupy Wall Street und eine Vielzahl anderer großer Aufstände nach sich ziehen würde. Wir wissen nicht, was geschehen wird oder wie oder wann, und genau diese Ungewissheit ist der Raum der Hoffnung.
Wer bezweifelt, dass diese Momente zählen, sollte Notiz davon nehmen, wie entsetzt die Obrigkeiten und Eliten sind, wenn sie losbrechen. Ihre Angst signalisiert, dass sie erkannt haben, dass die kollektive Macht der Menschen real genug ist, um Regime zu stürzen und den Gesellschaftsvertrag umzuschreiben. Was auch oft geschehen ist. Manchmal wissen deine Feinde, was deine Freunde nicht glauben können. Diejenigen, die diese Momente aufgrund ihrer Unvollkommenheiten, Beschränkungen oder Unvollständigkeit abtun, müssen sich intensiver damit befassen, welche Freude und Hoffnung in ihnen aufblitzt und welche echten Veränderungen sich aus ihnen ergeben haben, wenn auch nicht immer auf die offensichtlichste oder erkennbarste Weise.
Und außerdem hat alles seine Mängel, wenn man so will. Die Analogie, die mir am meisten geholfen hat, ist folgende: Während des Hurrikans Katrina retteten Hunderte von Bootsbesitzern Menschen – alleinerziehende Mütter, Kleinkinder, Großväter –, die auf Dachböden festsaßen, auf Dächern, in überschwemmten Sozialbauten, Krankenhäusern und Schulen. Niemand hat gesagt: »Ich kann nicht jeden retten, also ist das Ganze nutzlos, meine Bemühungen sind kümmerlich und wertlos« – doch das ist genau das, was die Leute oft bei abstrakteren Fragen sagen, selbst wenn dort Leben, Orte, Kulturen, Spezies oder Rechte auf dem Spiel stehen. Sie fuhren in Fischkuttern, Ruderbooten, Pirogen und Kleinbooten aller Art aufs Wasser, wobei manche sogar von so weit weg wie Texas anreisten und den Behörden aus dem Weg gingen, um in das Sperrgebiet hineinzukommen, während andere, selbst Geflüchtete, in der Stadt tätig wurden. Die Wagen mit den Bootsanhängern fuhren, einen Tag, nachdem die Dämme gebrochen waren, Stoßstange an Stoßstange – die gefeierte Cajun Navy – stadteinwärts. Keiner dieser Menschen sagte: »Ich kann sie nicht alle retten.« Alle sagten: »Ich kann jemanden retten, und dieser Einsatz ist so sinnvoll und wichtig, dass ich dafür mein Leben riskieren und mich den Behörden widersetzen werde.« Was sie auch taten. Natürlich ist es auch wichtig, für einen systemischen Wandel zu arbeiten – für die Art von Veränderung, die solche Katastrophen möglicherweise verhindern könnte, indem sie die klimatischen, infrastrukturellen, ökologischen und ökonomischen Ungerechtigkeiten angeht, die manche Menschen in New Orleans überhaupt erst diesen Gefahren ausgesetzt hatten.
Wandel geschieht selten auf direktem Weg, und das ist auch eine der Grundannahmen dieses Buches. Manchmal ist er so komplex wie die Chaostheorie und so langsam wie die Evolution. Selbst Dinge, die plötzlich zu passieren scheinen, speisen sich aus Wurzeln, die tief in der Vergangenheit liegen, oder aus lange ruhenden Samen. Der Selbstmord eines jungen Mannes löst einen Aufstand aus, der andere Aufstände inspiriert, doch der Vorfall selbst war nur ein Funke; der Grundstock für das Leuchtfeuer, das er entfachte, wurde von Aktivistennetzwerken gelegt, von Ideen über zivilen Ungehorsam und dem tiefen Wunsch nach Gerechtigkeit und Freiheit, der überall vorhanden ist.
Es ist wichtig, nicht nur zu fragen, was solche Momente langfristig bewirkt haben, sondern auch, was sie zu ihrer Blütezeit waren. Wenn sich Menschen in einer Welt wiederfinden, in der Hoffnungen verwirklicht werden, Freuden strahlend hell aufleuchten und Grenzen zwischen Einzelpersonen und Gruppen abgebaut werden – auch nur für eine Stunde, einen Tag oder mehrere Monate –, dann zählt das. Erinnerungen an Freude und Befreiung können zu einer Navigationshilfe werden, einer Identität, einem Geschenk.
Paul Goodman schrieb die berühmten Sätze: »Angenommen, Sie hätten die Revolution, von der Sie sprechen und träumen. Angenommen, Ihre Seite hätte gewonnen und Sie hätten die Art von Gesellschaft, die Sie wollten. Wie würden Sie persönlich in dieser Gesellschaft leben? Fangen Sie jetzt an, so zu leben!« Das ist ein Argument für winzige, temporäre Siege und für die Möglichkeit partieller Siege in Ermangelung oder angesichts der Unmöglichkeit von vollständigen Siegen. Ein vollständiger Sieg schien immer das säkulare Äquivalent des Paradieses zu sein: ein Ort, an dem alle Probleme gelöst sind und es nichts zu tun gibt – ein ziemlich langweiliger Ort. Die Absolutisten der alten Linken stellten sich den Sieg, wenn er dann kommt, als vollständig und dauerhaft vor, was praktisch dasselbe ist, als wenn man sagt, dass der Sieg unmöglich war und ist und niemals kommen wird. Dabei ist er sogar mehr als nur möglich. Er ist auf unzählige Weise Wirklichkeit geworden – es gab kleine Siege, große Siege und oft schrittweise Siege –, aber eben nicht so, wie es immer wieder beschrieben und erwartet worden war. Und so rutschen Siege unbemerkt durch. Fehlschläge werden leichter erkannt.
Und dann explodieren zuweilen die Möglichkeiten. In diesen Bruchmomenten gehören die Menschen plötzlich zu einem Wir, das es bis dahin nicht gegeben hat, jedenfalls nicht als eine Entität mit Handlungsmacht, Identität und Schlagkraft; plötzlich ergeben sich neue Möglichkeiten, oder der alte Traum von einer gerechten Gesellschaft leuchtet wieder auf – zumindest für einen kurzen Augenblick. Die Utopie ist das Ziel, aber häufig ist sie in den Moment selbst eingebettet, der nicht einfach zu erklären ist, da er gewöhnlich eine entbehrungsreiche Lebensweise, Gezänk und schließlich Desillusionierung und internen Streit mit sich bringt – aber auch eher ideelle Dinge: die Entdeckung persönlicher und kollektiver Macht, die Verwirklichung von Träumen, die Geburt von größeren Träumen, ein Gefühl der Verbundenheit, das ebenso emotional wie politisch ist, sowie Leben, die sich ändern und nicht in den alten Trott zurückfallen, selbst wenn der Glanz verblasst. Manchmal schlägt die Erde über diesem Moment zusammen, und er hat keine offensichtlichen Folgen; manchmal zerbröckeln Imperien und Ideologien fallen ab wie Fesseln. Nur weiß man es nicht vorher. Menschen in staatlichen Institutionen glauben aus tiefster Seele, dass sie die Macht haben, auf die es ankommt, obwohl die Macht, die wir ihnen erteilen, oft zurückgenommen werden kann; die Gewalt, über die Regierungen und Armeen verfügen, scheitert häufig, während gewaltfreie Kampagnen oft erfolgreich sind.
Ein Name für die Öffentlichkeit ist »der schlafende Riese«; wenn er erwacht, wenn wir erwachen, dann sind wir nicht mehr nur die Öffentlichkeit: Wir sind die Zivilgesellschaft, die Supermacht, deren gewaltfreie Mittel gelegentlich, für einen leuchtenden Augenblick, mächtiger als Gewalt sind, mächtiger als Regime und Armeen. Wir schreiben Geschichte mit unseren Füßen, unserer Präsenz, unserer kollektiven Stimme und Vision. Und trotzdem suggeriert die massenmediale Berichterstattung oft, dass öffentlicher Widerstand lächerlich sei, sinnlos oder kriminell, sofern er nicht weit weg stattfindet oder lange zurückliegt – und idealerweise beides. Das sind die Kräfte, die es vorziehen würden, wenn der Riese weiterschliefe.
Gemeinsam sind wir stark, und wir haben eine nur selten erzählte, nur selten erinnerte Geschichte von Siegen und Transformationen, die uns das Selbstvertrauen geben kann, dass wir die Welt tatsächlich verändern können, da wir es schon so oft getan haben. So, wie man beim Vorwärtsrudern zurückblickt, so ist das Erzählen dieser Geschichte mein Teil des Versuchs, uns dabei zu helfen, in Richtung Zukunft zu navigieren. Wir brauchen eine Litanei, einen Rosenkranz, eine Sutra, ein Mantra, einen Kriegsgesang von unseren Siegen. Die Vergangenheit liegt im Tageslicht und kann eine Fackel werden, die wir in die Nacht tragen können, die Nacht, die unsere Zukunft ist.