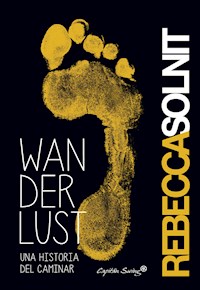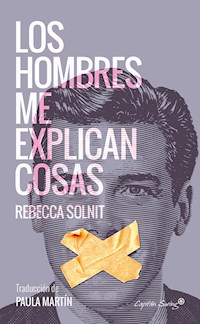9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tempo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Warum haben Sie keine Kinder?« Diese »Mutter aller Fragen« wird Rebecca Solnit hartnäckig von Journalisten gestellt, die sich mehr für ihren Bauch als für ihre Bücher interessieren. Warum gilt Mutterschaft noch immer als Schlüssel zur weiblichen Identität? Die Autorin findet die Antwort darauf in der Ideologie des Glücks und tritt dafür ein, lieber nach Sinn als nach Glück zu streben. Außerdem erklärt sie in ihren Essays, warum die Geschichte des Schweigens mit der Geschichte der Frauen untrennbar verknüpft ist, warum fünfjährige Jungen auf rosa Spielzeug lieber verzichten, und nennt 80 Bücher, die keine Frau lesen sollte. Sie schreibt über Männer, die Feministen und Männer, die Vergewaltiger sind, und setzt sich gegen jegliches Schubladendenken zur Wehr. Wenn Männer mir die Welt erklären sorgte weltweit für Furore – in ihren neuen Essays setzt Rebecca Solnit ebenso scharfsichtig wie humorvoll ihre Erkundung der heutigen Geschlechterverhältnisse fort. Ein wichtiges, Mut machendes Buch aus dezidiert feministischer Perspektive, über und für alle, die Geschlechteridentitäten infrage stellen und für eine freiere Welt eintreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Rebecca Solnit
Die Mutter aller Fragen
Aus dem amerikanischen Englisch von Kirsten Riesselmann
Mit Illustrationen von Paz de la Calzada
TEMPO
Hoffnungsfroh machen wir weiter
in Liebe zu allen Neulingen
und ihrem herrlichen Lärm:
Atlas
Ella und May
Isaac und Marti
Berkele
Brooke, Dylan und Solomon,
Daisy und Jake;
und ein Dankeschön an die Leser*innen
und alle, die so richtig Alarm schlagen
Einführung
Der längste und zugleich jüngste Essay in diesem Buch handelt vom Schweigen. Als ich angefangen habe, ihn zu schreiben, dachte ich noch, es ginge mir um die vielen verschiedenen Arten, wie Frauen zum Schweigen gebracht werden. Allerdings wurde mir schnell klar, dass auch die Art und Weise, mit der Männer zum Schweigen gebracht werden, untrennbar zu meinem Thema gehört, ja, dass jeder und jede in einem komplexen Geflecht unterschiedlichster Ausprägungen des Schweigens lebt, zu dem auch das gegenseitige Anschweigen gehört, das wir gemeinhin als »Gender-Rollen« bezeichnen. Dies hier ist ein feministisches Buch, aber keines, das nur mit der Erfahrungswelt von Frauen zu tun hat, sondern mit der von uns allen – von Männern, Frauen, Kindern und von Menschen, die Geschlechterbinarität und -grenzen infrage stellen.
In diesem Buch geht es genauso um Männer, die glühende Feministen sind, wie es um Männer geht, die Serienvergewaltiger sind, und es ist geschrieben in dem Wissen darum, dass solche Kategorien durchlässig sind und wir sie deswegen immer nur eingeschränkt benutzen dürfen. Dieses Buch beschäftigt sich mit den rasanten gesellschaftlichen Veränderungen, die eine wieder auflebende feministische Bewegung in Nordamerika und auf der ganzen Welt bewirkt. Diese Bewegung nimmt nicht nur Einfluss auf die Gesetzeslage, sondern verändert auch unser Verständnis davon, was Zustimmung, Macht, Rechte, Gender, Stimme und Repräsentation eigentlich sind. Es ist eine herrlich transformative Bewegung, die vor allem von jungen Leuten getragen wird: an den Universitäten, in den sozialen Medien und auf der Straße, und meine Bewunderung für diese furchtlose, sich von sämtlichen Anwürfen vollkommen unbeeindruckt zeigende neue Generation von Feminist*innen und Menschenrechtsaktivist*innen ist grenzenlos. Genauso groß allerdings ist auch meine Angst vor dem sich gegen sie richtenden Backlash, einem Backlash, der per se ein Beweis dafür ist, dass der Feminismus als Teil eines breiter angelegten Befreiungsprojekts eine Bedrohung darstellt für Patriarchat und Status quo.
Dieses Buch ist eine Rundreise zu Orten des Gemetzels, zugleich eine Feier der Befreiung und der Solidarität, der Einsicht und der Empathie und eine Überprüfung der Begriffe und Werkzeuge, mit denen wir uns all diesen Dingen vielleicht nähern können.
Die Mutter aller Fragen
2015
Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag über Virginia Woolf gehalten. Bei der anschließenden Diskussionsrunde schienen einige Leute sich vor allem für die Frage zu interessieren, ob Woolf nicht hätte Kinder haben sollen. Auf diese Frage antwortete ich pflichtschuldig, Woolf habe zu Beginn ihrer Ehe, als sie sah, wie viel Freude ihre Schwester Vanessa Bell an ihren Kindern hatte, ganz offensichtlich übers Kinderkriegen nachgedacht. Mit der Zeit aber habe sie es zunehmend für unklug gehalten, sich fortzupflanzen, was möglicherweise mit ihrer psychischen Labilität zu tun hatte. Vielleicht aber, so meine These, habe sie auch einfach Schriftstellerin sein und ihr Leben der Kunst widmen wollen, was sie schließlich mit außergewöhnlichem Erfolg getan habe. In meinem Vortrag hatte ich Woolf zustimmend zitiert: wie sie den »Engel im Haus« tötete, diese innere Stimme, die vielen Frauen befiehlt, aufopferungsvolle Dienerin des Haushalts und des männlichen Egos zu sein. Ich war doch etwas überrascht, dass mein Plädoyer für die Überwindung konventioneller Weiblichkeit nun gerade zu dieser Diskussion geführt hatte.
Ich hätte dem Publikum damals sagen sollen, dass es so ermüdend wie müßig sei, Woolfs Status in Fortpflanzungsdingen zu ergründen, und dass uns das wegführe von den großen Fragen, die ihr Werk eigentlich an uns stellt. (Ich glaube, ich sagte stattdessen irgendwann: »Ach, scheiß doch auf diesen Quatsch!«, was im Grunde dasselbe aussagte und die Diskussion abwürgte.) Schließlich schenken viele Menschen Babys das Licht der Welt, aber nur ein Mensch schenkte uns Zum Leuchtturm und Drei Guineen, und um Letzteres ging es bei unserer Diskussion über Woolf.
Diese Art von Fragen waren mir damals längst sattsam bekannt. Zehn Jahre zuvor, bei einem Gespräch, in dem es um ein Buch gehen sollte, das ich über Politik geschrieben hatte, beharrte der mich interviewende Brite darauf, nicht über die Erzeugnisse meines Geistes, sondern über die Frucht meiner Lenden beziehungsweise den Mangel daran zu reden. Auf der Bühne drangsalierte er mich mit der Frage, warum ich denn keine Kinder hätte. Keine meiner Antworten stellte ihn zufrieden. Er schien der Ansicht zu sein, dass ich Kinder haben müsse und dass es vollkommen unverständlich sei, warum ich keine hatte, weswegen wir eher darüber sprechen müssten, warum ich denn keine hätte, als über die Bücher, die ich ja immerhin hatte.
Als ich von der Bühne ging, lief mir die Pressesprecherin meines schottischen Verlags – schlank, Mitte zwanzig, pinkfarbene Ballerinas an den Füßen und hübscher Verlobungsring am Finger – mit wutverzerrtem Gesicht entgegen. »Das würde er einen Mann niemals fragen!« fauchte sie. Sie hatte recht. (Diesen Satz, nett als Frage getarnt, benutze ich jetzt immer, wenn ich einem dieser Fragensteller den Wind aus den Segeln nehmen will: »Würden Sie einem Mann diese Frage stellen?«) Solche Fragen scheinen aus der Wahrnehmung zu resultieren, dass es nicht »die Frauen« gibt, also die 51 Prozent der Menschheit, die in ihren Wünschen so vielfältig und in ihrem Begehren so geheimnisvoll sind wie die restlichen 49 Prozent auch, sondern nur »die Frau«. Und »die Frau« soll heiraten und sich vermehren, soll Männer rein- und Babys rauslassen wie ein Förderband der gesamten Spezies. In Wirklichkeit sind solche Fragen nichts als die Feststellung, dass wir, die wir uns gern als Individuen sehen und selbstbestimmt unserer Wege gehen, im Irrtum sind. Gehirne sind hochindividualisierte Phänomene, die unterschiedlichste Dinge hervorbringen: Gebärmüttern entspringt nur eine Art der Schöpfung.
Wie es der Zufall will, gibt es viele Gründe, warum ich keine Kinder habe: Ich bin gut in Sachen Verhütung; obwohl ich Kinder liebe und das Tantesein genieße, schätze ich auch das Alleinsein sehr; ich bin bei unglücklichen, wenig freundlichen Menschen aufgewachsen und wollte weder deren Art des Elternseins wiederholen noch jemanden in die Welt setzen, der mir ähnliche Gefühle entgegenbringt wie ich meinen Erzeugern; die Erde kann nicht noch mehr Erste-Welt-Menschen aushalten, und die Zukunft ist sehr unsicher; außerdem wollte ich schon immer wirklich gerne Bücher schreiben, was so, wie ich es bislang getan habe, ein einigermaßen zeitaufwendiger und nervenaufreibender Beruf ist. Meine Kinderlosigkeit ist nicht dogmatisch bedingt. Unter anderen Umständen hätte ich vielleicht welche bekommen, und es wäre mir gut damit gegangen – so gut, wie es mir mit meiner jetzigen Situation auch geht.
Manche Menschen wollen Kinder, können aber aus unterschiedlichen privaten Gründen – medizinischen, emotionalen, finanziellen oder beruflichen – keine bekommen. Andere wiederum wollen keine Kinder. Das geht niemanden etwas an. Nur, weil sich die Frage prinzipiell beantworten lässt, bedeutet das nicht, dass man dazu verpflichtet ist, sie zu beantworten beziehungsweise sie sich überhaupt stellen zu lassen. Die Frage meines britischen Gesprächspartners war ungehörig, weil sie impliziert, dass Frauen Kinder haben sollten und dass die reproduktiven Aktivitäten einer Frau selbstverständlich von öffentlichem Interesse sind. Grundsätzlich lag dieser Frage die Annahme zugrunde, dass es für eine Frau nur eine richtige Art zu leben gibt.
Aber wahrscheinlich ist sogar das noch zu optimistisch: Wenn man sich anschaut, wie kontinuierlich auch Mütter noch als unzulänglich dargestellt werden, ist es fraglich, ob es für Frauen überhaupt eine »richtige Art« gibt. Eine Mutter wird durchaus mal wie eine Verbrecherin behandelt, weil sie ihr Kind für fünf Minuten allein gelassen hat, obwohl der Kindsvater das schon seit mehreren Jahren tut. Einige Mütter haben mir erzählt, dass sie nach der Geburt ihrer Kinder wie einfältige, nicht Verstandesbegabte behandelt wurden, die mit Nichtachtung gestraft gehörten. Viele Frauen in meinem Bekanntenkreis haben zu hören bekommen, dass man sie im Beruf nicht für voll nehmen könne, weil sie ja doch irgendwann schwanger würden und gingen. Vielen beruflich erfolgreichen Müttern dagegen wird unterstellt, dass sie irgendwen vernachlässigen. Es gibt also schlicht keine gute Antwort auf die Frage, wie man als Frau zu sein hat. Vielleicht liegt die Kunst eher in der Art, wie wir die Frage zurückweisen.
Bislang haben wir über offene Fragen gesprochen. Dabei gibt es auch geschlossene Fragen, Fragen, auf die es, wenn es nach dem Fragenden ginge, nur eine einzige korrekte Antwort gibt. Es sind Fragen, die einen zurück in die Herde stoßen oder einen in die Hinterläufe zwicken, wenn man sich zu weit von der Herde wegbewegt, Fragen, die ihre Antworten schon in sich tragen und die ausschließlich auf Durchsetzung und Bestrafung abzielen. Eines meiner Lebensziele ist es, wahrhaft rabbinisch zu werden: jede geschlossene Frage mit einer offenen zu beantworten, die innere Autorität zu besitzen, um immer dann, wenn sich Eindringlinge nähern, eine gute Torwächterin zu sein und zumindest daran zu denken, »Warum fragen Sie mich das?« zurückzufragen. Das nämlich, so habe ich festgestellt, ist immer eine gute Antwort auf eine unfreundliche Frage, und geschlossene Fragen sind meistens unfreundlich. In dem Gespräch, das in ein Verhör über das Kinderkriegen ausartete, wurde ich jedoch überrumpelt (und hatte zudem einen schlimmen Jetlag), weswegen mir nur das Erstaunen darüber blieb, warum solch üble Fragen so berechenbar gestellt werden.
Ein Teil des Problems ist vielleicht, dass wir gelernt haben, von uns selbst das Falsche zu verlangen. Unser kulturelles Umfeld ist durchdrungen von einer Art Poppsychologie, die sich obsessiv um die Frage dreht: Bist du glücklich? Diese Frage stellen wir so reflexhaft, dass der Wunsch, ein Apotheker mit Zeitmaschine könnte einen lebenslangen Vorrat an Antidepressiva nach Bloomsbury liefern, damit eine unvergleichliche feministische Prosakünstlerin sich wieder im Leben zurechtfindet und viele Würfe Woolf-Babys hervorbringt, nur natürlich erscheint.
Fragen zum Thema Glücklichsein setzen üblicherweise voraus, dass wir wissen, wie ein glückliches Leben aussieht. Oft wird Glück als Ergebnis guter Organisation beschrieben: Wer sein Leben richtig aufstellt – Eheschließung, Nachwuchs, Eigentum, erotische Erfahrungen –, wird glücklich. Dabei würde eine Millisekunde Nachdenken reichen, um einzusehen, dass zahllose Menschen all das haben und trotzdem unglücklich sind.
Ständig bekommen wir Formeln in Einheitsgröße an die Hand, Formeln, die ganz oft ganz schmerzhaft nicht aufgehen. Trotzdem werden sie uns eingetrichtert. Wieder und immer wieder. Sie werden zu Gefängnissen und Strafen. Das Gefängnis der Vorstellungen lässt viele in die Falle eines Lebens tappen, das ordnungsgemäß von den richtigen Rezepten begleitet wird, aber trotzdem zutiefst unglücklich ist.
Möglicherweise ist das Problem ein literarisches: Wir sollen mit einem einzigen Handlungsstrang auskommen, der zu einem guten Leben führt, obwohl gar nicht wenige von denen, die eben diesem Handlungsstrang folgen, trotzdem ein schlechtes Leben haben. Wir tun so, als gäbe es genau einen guten Plot mit genau einem Happy End, während das Leben um uns herum doch in so vielfältigen Formen erblüht und wieder vergeht.
Sogar diejenigen, deren Leben nach der perfekten Version des bekannten Handlungsstrangs verläuft, werden nicht unbedingt glücklich. Was gar nicht notwendigerweise ein Drama ist. Ich kenne eine Frau, die siebzig Jahre lang glücklich verheiratet war. Sie hat ein langes, sinnerfülltes Leben nach ihren eigenen Maßstäben gelebt und wird von ihren Nachkommen geliebt und respektiert. Aber als glücklich würde ich sie trotzdem nicht bezeichnen. Ihr Mitgefühl für die Schwachen und ihre Sorge um die Zukunft haben ihr eine mutlose Weltsicht beschert.
Wer beschreiben will, was diese Frau anstelle von Glück im Leben gehabt hat, braucht eine präzisere Sprache. Möglicherweise gelten für jeden Menschen einfach sehr unterschiedliche Kriterien für ein gutes Leben: zu lieben und geliebt zu werden oder Befriedigung zu erfahren, geehrt zu werden, Sinn, Tiefe, Engagement oder Hoffnung zu erleben.
Als Schriftstellerin habe ich immer nach Wegen gesucht, um dem schwer Fassbaren und Übersehenen Gewicht zu geben, feine Nuancen und Schattierungen von Bedeutsamkeit zu beschreiben, das Leben in der Öffentlichkeit wie in der Einsamkeit gleichermaßen zu feiern und – so hat es John Berger formuliert – »eine andere Art zu erzählen« zu entdecken. Weswegen es auch so niederschmetternd ist, wenn man die immer gleichen alten Erzählweisen vorgesetzt bekommt.
Die »Verteidigung der Ehe«, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als die Verteidigung des alten hierarchischen Konstrukts, das die Ehe war, bevor Feminist*innen anfingen, sie zu reformieren, reklamieren betrüblicherweise nicht nur die Konservativen für sich. Der inbrünstige Glaube, der heterosexuelle Zwei-Eltern-Haushalt sei für Kinder etwas geradezu magisch Tolles, sitzt tief, und zwar in viel zu vielen Teilen dieser Gesellschaft. Das führt dazu, dass viele in unglücklichen Ehen verbleiben, was sich auf alle Beteiligten zerstörerisch auswirkt. Ich kenne Menschen, die lange gezögert haben, eine schreckliche Ehe zu beenden, weil eine Situation, die für einen oder sogar beide Elternteile unerträglich ist, sich angeblich auf Kinder segensreich auswirke. Sogar Frauen mit gewalttätigen Männern werden oft dazu genötigt, in einer Konstellation zu verharren, die schon für sich genommen so wundervoll zu sein hat, dass die Details nicht weiter ins Gewicht fallen. Form sticht Inhalt. Und trotzdem habe ich immer wieder erlebt, wie viel Freude eine Scheidung bereiten und welch vielfältige Formen eine glückliche Familie annehmen kann, angefangen bei alleinerziehendem Elternteil plus Kind bis hin zu unendlich unterschiedlichen Konstellationen von Patchwork-Familien.
Nachdem ich ein Buch über mich und meine Mutter geschrieben hatte, die einen brutalen, seinem Beruf ergebenen Mann geheiratet, vier Kinder bekommen und oft vor Zorn und Unglück geradezu gekocht hat, wurde ich von einer Interviewerin in einen Hinterhalt gelockt: Sie fragte mich, ob mein gewalttätiger Vater der Grund sei, warum es mir nicht gelungen sei, selbst einen Lebenspartner zu finden. Ihre Frage war voller erstaunlicher Annahmen darüber, was ich mit meinem Leben wohl vorgehabt hatte, und unterstrich das Recht, sich in dieses Leben einzumischen. Mein Buch Aus der nahen Ferne handelte, so dachte ich, indirekt von meinem langen Weg in ein wirklich schönes Leben. Gleichzeitig war es der Versuch, mir über die Wut meiner Mutter und deren Ursprung klarzuwerden, den ich unter anderem in ihrem Gefangensein in konventionellen weiblichen Rollen- und Erwartungsmustern verortete.
Ich habe getan, was ich mit meinem Leben tun wollte, und das, was ich tun wollte, entsprach nicht dem, was meine Mutter oder die Interviewerin sich vorgestellt hatte. Ich wollte Bücher schreiben, von großzügigen, intelligenten Menschen umgeben sein und tolle Abenteuer erleben. Männer – Romanzen, Affären und Langzeitbeziehungen – gehörten zu diesen Abenteuern genauso dazu wie ferne Wüsten, arktische Meere, Berggipfel, Aufstände und Katastrophen sowie die Erforschung von Ideen, Archiven, Schriften und anderen Biographien.
Die Rezepte für ein erfülltes Leben, die uns unsere Gesellschaft anbietet, verursachen offenbar eine ganze Menge Unglück, sowohl auf Seiten derer, die nicht in der Lage oder willens sind, diese Rezepte zu befolgen, und deswegen stigmatisiert werden, als auch auf Seiten derer, die brav nach Rezept leben, aber das Glück trotzdem nicht finden. Selbstverständlich gibt es Menschen mit einem Leben in Standardausführung, die sehr glücklich damit sind. Ich kenne einige davon, genauso wie ich eben auch sehr glückliche kinderlose und zölibatär lebende Mönche, Priester und Äbtissinnen, schwule Geschiedene und alles dazwischen kenne. Letzten Sommer wurde meine Freundin Emma von ihrem Vater zum Traualtar geführt, gefolgt von seinem Mann am Arm von Emmas Mutter. Alle vier, plus Emmas neuem Ehemann, stehen einander nahe, sie sind eine außergewöhnlich liebevolle Familie, die sich politisch für Gerechtigkeit einsetzt. Diesen Sommer war ich auf zwei Hochzeiten, bei beiden gab es keine Bräute, sondern jeweils zwei Bräutigame. Bei der ersten weinte der eine Bräutigam, weil ihm die meiste Zeit seines Lebens das Recht zu heiraten verwehrt worden war und er nicht geglaubt hatte, dass er seine eigene Hochzeit noch erleben würde.
Und trotzdem schwirren dieselben alten Fragen noch immer durch den Raum – auch wenn sie oft gar nicht wie Fragen daherkommen, sondern eher wie ein recht durchsetzungsstarkes Zwangssystem. In der traditionellen Weltanschauung ist Glück etwas essenziell Privates und Selbstbezogenes: Verstandesbegabte Menschen folgen ihrem Eigeninteresse, und wenn sie das mit Erfolg tun, sollten sie glücklich sein. Schon die Definition dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, ist eng, und Altruismus, Idealismus und öffentliches Leben (ausgenommen Ruhm, Status oder materieller Erfolg) haben nur wenig Platz auf der Agenda. Die Vorstellung, dass ein Leben primär nach Sinnhaftigkeit streben sollte, tritt nur selten auf den Plan. Die standardisierten Tätigkeiten werden nicht nur als per se sinnhaft erachtet, nein, man begreift sie als die einzigen sinnvollen Optionen.
Einer der Gründe, warum die Mutterschaft hartnäckig als Schlüssel zur weiblichen Identität gilt, ist der Glaube, dass sich nur über Kinder die eigene Liebesfähigkeit befriedigen lässt. Aber neben dem eigenen Nachwuchs kann man doch noch so vieles andere lieben, es gibt so viele Dinge, die Liebe benötigen, und so viel Arbeit, die in dieser Welt mit Liebe getan werden muss.
Etliche derer, die die Motive kinderloser Menschen infrage stellen – es heißt, sie seien egoistisch, weil sie die mit Elternschaft einhergehenden Opfer nicht bringen wollen –, nehmen andererseits nicht zur Kenntnis, dass Menschen, die ihre Kinder intensiv lieben, vielleicht weniger Liebe für den Rest der Welt übrighaben. Die Autorin und Hochschullehrerin Christina Lupton hat kürzlich über all die Dinge geschrieben, auf die sie verzichten musste, als die aufreibenden Aufgaben einer Mutter sie fest im Griff hatten, darunter:
»alle Arten, sich um die Welt zu kümmern, die nicht so leicht Bestätigung erfahren wie das Elternsein, aber fundamental notwendig sind, wenn Kinder gedeihen sollen. Damit meine ich das Schreiben und das Erfinden, die Politik und den Aktivismus, das Lesen und das Sprechen in der Öffentlichkeit, das Protestieren, Lehren und Filmemachen … Fast alle Dinge, die ich am meisten wertschätze und von denen ich mir am ehesten Verbesserungen für die Conditio humana verspreche, sind brutal inkompatibel mit der tatsächlichen sowie der imaginierten Arbeit, die Kinderbetreuung bedeutet.«
Als Edward Snowden vor einigen Jahren plötzlich die Bildfläche betrat, war ich fasziniert davon, wie viele Menschen unfähig waren, zu begreifen, warum sich da ein junger Mann nicht an das Glücksrezept hielt und ein gutes Gehalt, einen sicheren Job und ein Haus auf Hawaii drangab, um der meistgesuchte Flüchtige der Welt zu werden. Sie alle schienen davon auszugehen, dass Snowden ein eigennütziges Motiv haben müsse, wahrscheinlich nach Geld oder Aufmerksamkeit gierte – schließlich handeln doch alle Menschen egoistisch.
Während der ersten Kommentarwelle schrieb Jeffrey Toobin, Rechtsexperte des New Yorker, dass Snowden »ein grandioser Narzisst« sei, »der es verdient, im Gefängnis zu sitzen«. Ein weiterer strenger Kritiker verkündete: »Ich glaube, wir haben es bei Edward Snowden mit nichts als einem narzisstischen jungen Mann zu tun, der wild entschlossen ist, schlauer zu sein als der Rest der Welt.« Andere wiederum vertraten die Ansicht, Snowden enthülle Regierungsgeheimnisse der USA, weil er von einem feindlich gesinnten Land dafür bezahlt worden sei.
Snowden kam einem vor wie ein Mensch aus einem anderen Jahrhundert. In seiner ersten Kontaktaufnahme mit dem Journalisten Glenn Greenwald nannte er sich »Cincinnatus« – nach dem römischen Staatsmann, der für das Wohl seiner Gesellschaft eintrat, ohne sich davon einen Vorteil zu versprechen. Schon dieser Name war ein Hinweis darauf, dass Snowden seine Ideale und Handlungsmodelle weitab von den Standardformeln für Lebensglück ausgebildet hat. Andere Zeiten und Kulturen haben schon häufiger gänzlich andere Fragen formuliert als jene, die wir heute stellen: Was ist das Sinnvollste, was du mit deinem Leben anstellen kannst? Wie groß ist dein Beitrag zur Welt oder zur Gemeinschaft? Lebst du gemäß deinen Prinzipien? Was ist dein Vermächtnis? Wofür steht dein Leben? Vielleicht ist unsere Obsession mit dem Glück eine Art, uns all diese Fragen nicht stellen zu müssen, eine Möglichkeit zu ignorieren, wie großräumig unser Leben, wie wirkmächtig unsere Arbeit und wie weitreichend unsere Liebe sein kann.
Im Kern der Glücksfrage steht ein Paradoxon. Todd Kashdan, Psychologieprofessor an der George Mason University, hat vor einigen Jahren von Studien berichtet, die ergeben haben, dass Menschen, die es für wichtig halten, glücklich zu sein, häufiger Depressionen entwickeln als andere: »Das Leben rund um den Versuch zu organisieren, glücklich zu sein, und Glück zum Hauptlebensziel zu machen, verhindert es, tatsächlich glücklich zu werden.«
In England hatte ich dann doch noch meinen rabbinischen Augenblick. Als ich den Jetlag überwunden hatte, wurde ich noch mal auf einer Bühne interviewt, diesmal von einer Frau mit affektiert flötendem Akzent. »Sie sind also«, tirilierte sie, »von der Menschheit verletzt worden und daraufhin schutzsuchend aufs Land geflohen.« Was sie damit sagen wollte: Ich war ein ausnehmend klägliches Exemplar, das hier zur Schau gestellt wurde, eine Ausreißerin aus der Herde. Ich wandte mich ans Publikum: »Ist jemand von Ihnen schon mal von der gesamten Menschheit verletzt worden?« Man lachte mit mir. In diesem Augenblick wussten wir, dass wir alle unseren Hau hatten, alle gemeinsam in dieser Sache drinsteckten und dass es unser aller Aufgabe ist, das eigene Leiden zu thematisieren und gleichzeitig zu lernen, es anderen nicht zuzufügen. Genauso ist es mit der Liebe, die so vielfältige Erscheinungsformen hat und sich auf so viele Dinge richten kann. Viele Fragen im Leben sind es wert, gestellt zu werden. Aber vielleicht können wir uns, schlau wie wir sind, klarmachen, dass nicht jede Frage auch eine Antwort braucht.
1Das Schweigen wird gebrochen
Eine kurze Geschichte des Schweigens
»Was ich am meisten bereute, war mein Schweigen. Und es gibt so viele Schweigen zu brechen.«
Audre Lorde
I. Der Ozean rund um den Archipel
Schweigen ist Gold – so hieß es doch immer, als ich noch klein war. Später änderte sich alles. »Schweigen ist gleich Tod!« riefen die queeren Aktivist*innen auf den Straßen, als sie gegen Ignoranz und Unterdrückung rund um das Thema Aids kämpften. Das Schweigen ist der Ozean des Ungesagten, des Unsagbaren, Unterdrückten, Ausgelöschten und Ungehörten. Er umspült die versprengten Inseln, gebildet von jenen, denen es erlaubt ist, zu sprechen, von dem, was gesagt werden kann, und von jenen, die zuhören. Das Schweigen tritt aus vielen Gründen und in vielen verschiedenen Arten auf; jede*r hat sein oder ihr ganz persönliches Meer aus unausgesprochenen Wörtern.
Das Englische ist voll von Wörtern, deren Bedeutungen sich überlagern, aber in diesem Essay soll silence, das »Schweigen«, als etwas betrachtet werden, das Menschen auferlegt wird, wohingegen quiet, die »Stille«, etwas ist, das aktiv gesucht wird. Zwar ist die Ruhe eines stillen Ortes, die Beruhigung der Gedanken im stillen Rückzug von den Worten und der Betriebsamkeit akustisch das Gleiche wie das Schweigen der Einschüchterung oder der Repression. Psychisch und politisch sind das aber zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Was ungesagt bleibt, weil jemand Stille und Introspektion sucht, unterscheidet sich von dem, das nicht gesagt wird, weil es massive Drohungen oder viel zu hohe Hürden gibt. Es ist wie der Unterschied von Schwimmen und Ertrinken. Stille verhält sich zum Lärm wie Schweigen zur Kommunikation. Die Stille der Zuhörer*in macht dem Sprechen anderer Platz, und die Stille der Leser*in nimmt das auf einer Seite Geschriebene auf wie weißes Papier die Tinte.
»Wir sind wie Vulkane«, bemerkte Ursula K. Le Guin einmal. »Wenn wir Frauen unsere Erfahrungen als unsere Wahrheit verkaufen, als eine menschliche Wahrheit, ändern sich sämtliche Landkarten. Neue Berge entstehen.« Die neuen Stimmen brechen wie unterseeische Vulkane im offenen Meer aus, und neue Inseln entstehen – was eine gleichermaßen heftige wie erschütternde Angelegenheit ist. Die Welt verändert sich. Schweigen führt dazu, dass Menschen ohne Zuflucht leiden, dass Heuchelei und Lügen wachsen und gedeihen und Verbrechen ungestraft bleiben. Wenn unsere Stimme ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist, bedeutet das Stimmlos-gemacht-Werden die Entmenschlichung beziehungsweise die Exklusion von der eigenen Menschlichkeit. Und die Geschichte des Schweigens ist für die Geschichte der Frauen eine ganz zentrale.
Worte bringen uns zusammen, das Schweigen dagegen trennt uns und beraubt uns der Unterstützung, Solidarität oder auch schlicht der Gemeinschaft, die das Sprechen stiftet oder erzeugt. Manche Baumarten entwickeln ein unterirdisches Wurzelsystem, das die einzelnen Stämme miteinander verbindet und die Bäume zu einem so stabilen Ganzen verwebt, dass sie nicht mehr so schnell vom Wind umgeweht werden können. Geschichten und Unterhaltungen sind wie diese Wurzeln. Über ein ganzes Jahrhundert hinweg war die menschliche Reaktion auf Stress und Gefahr definiert als »Kampf oder Flucht«. In einer im Jahr 2000 durchgeführten Studie stellten mehrere Psycholog*innen an der University of California, Los Angeles, fest, dass die diesbezügliche Forschung größtenteils auf Testreihen an männlichen Ratten und Männern basierte. Die Untersuchung von Frauen brachte sie auf eine dritte, ebenfalls oft angewandte Möglichkeit, sich angesichts von Stress und Gefahr zu verhalten: sich solidarisch zusammenzuschließen, sich zu unterstützen, sich gegenseitig zu beraten. Die Studie stellte fest, dass »weibliche Verhaltensmuster stärker von Mustern des tend and befriend, des ›Kümmerns und Anfreundens‹, geprägt werden. Das Kümmern impliziert auch fürsorgliche Aktivitäten, darauf ausgelegt, sich selbst und die Nachkommen zu schützen – Nachkommen, die die Sicherheitslage verbessern und Notsituationen reduzieren. Beim Anfreunden geht es um das Aufbauen und Aufrechterhalten sozialer Netzwerke, die diesem Prozess förderlich sind«. Viel davon wird durch Sprechen bewerkstelligt, dadurch, dass man von seinen jeweiligen Zwangslagen erzählt, dass einem zugehört wird, dass man Mitgefühl und Verständnis heraushört aus der Reaktion der Menschen, um die man sich kümmert und mit denen man sich anfreundet. So etwas tun nicht nur Frauen. Vielleicht tun Frauen es routinierter. Auch ich komme genau auf diese Art mit den Dingen klar beziehungsweise lasse mir von meiner Community – jetzt, da ich eine habe – beim Klarkommen helfen.
Wer nicht in der Lage ist, die eigene Geschichte zu erzählen, führt ein trostloses Dasein. Manchmal ist das buchstäblich so, als wäre man lebendig begraben: wenn dir niemand zuhört, obwohl du sagst, dass dein Exmann versucht, dich umzubringen, wenn dir niemand glaubt, obwohl du sagst, du habest Schmerzen, wenn niemand deine Hilferufe hört oder du dich nicht mal traust, um Hilfe zu rufen, weil dir eingetrichtert worden ist, andere Menschen nicht mit deinen Hilferufen zu behelligen. Wenn man es für unangemessen hält, wenn du im Meeting den Mund aufmachst, wenn du nicht zugelassen wirst zu einer mit Macht ausgestatteten Institution, wenn du Kritik ausgesetzt bist, die unsachlich ist und deren Subtext besagt, dass Frauen weder anwesend sein noch überhaupt gehört werden sollten. Geschichten retten dir das Leben. Sie sind dein Leben. Wir sind unsere Geschichten. Geschichten, die beides sein können: Gefängnis und Stemmeisen, um das Gefängnistor aufzubrechen. Wir denken uns Geschichten aus, um uns selbst zu retten oder um uns und anderen eine Falle zu stellen, Geschichten, die unsere Stimmung aufhellen oder uns gegen die steinerne Mauer unserer Grenzen und Ängste schleudern. Befreiung ist in Teilen immer auch ein Erzählprozess: ein Prozess, der Geschichten aufknackt, Schweigen bricht, neue Geschichten erfindet. Ein freier Mensch erzählt die eigene Geschichte. Ein Mensch, der wertgeschätzt wird, lebt in einer Gesellschaft, in der ihre oder seine Geschichte einen Platz hat.
Gewalt gegen Frauen passiert oft als Gewalt gegen unsere Stimmen und unsere Geschichten. Sie ist die Zurückweisung unserer Stimmen – und dessen, was eine Stimme überhaupt bedeutet: das Recht auf Selbstbestimmung, auf Teilhabe, auf Zustimmung oder eine abweichende Meinung, das Recht darauf, zu leben und mitzumachen, zu interpretieren und zu erzählen. Ein Ehemann schlägt seine Frau, um sie zum Schweigen zu bringen; jemand, der sein Date oder seine Bekannte vergewaltigt, weigert sich, dem Nein seiner Opfer die Bedeutung zu lassen, die es hat: dass nämlich der Körper einer Frau unter die Gebietshoheit allein dieser Frau fällt. Die rape culture behauptet, die Aussage einer Frau sei wertlos und unglaubwürdig. Auch Abtreibungsgegner*innen wollen die Frauen in ihrer Selbstbestimmtheit mundtot machen. Und ein Mörder lässt Menschen für immer verstummen. All diese Fälle zeugen davon, dass ein Opfer keine Rechte und keinen Wert hat und nicht als gleichwertig gilt. Solche Stummstellungen finden auch in geringfügigerem Umfang statt: Menschen, die im Netz so lange drangsaliert und belästigt werden, bis sie schweigen, die ausgeschlossen werden von der Unterhaltung, die kleingemacht, gedemütigt und abgewiesen werden. Eine Stimme zu haben ist das Wichtigste. Zwar geht es bei den Menschenrechten nicht ausschließlich darum, aber es steht in ihrem Zentrum, weswegen man die Geschichte der (nicht existenten) Frauenrechte als eine Geschichte des Schweigens und des Brechens dieses Schweigens interpretieren kann.
Sprache, Worte und Stimme ändern die Dinge manchmal von Grund auf – immer dann, wenn sie zu Inklusion und Anerkennung führen, Entmenschlichung rückgängig machen und Rehumanisierung ins Werk setzen. Manchmal sind Sprache, Worte und Stimme nur die Voraussetzungen dafür, Regeln, Gesetze und Regime so zu verändern, dass sie Gerechtigkeit und Freiheit hervorbringen. Manchmal sind allein das Sprechenkönnen, Gehörtwerden und Glauben-geschenkt-Bekommen ausschlaggebend dafür, Teil einer Familie, einer Community, einer Gesellschaft zu werden. Manchmal lässt unsere Stimme Gemeinschaftliches auch entzweibrechen; manchmal wird das Gemeinschaftliche zum Gefängnis. Und wenn dann Worte die Unaussprechlichkeit durchbrechen, wird das, was vorher von einer Gesellschaft toleriert wurde, manchmal untragbar. Nicht davon Betroffene können die Auswirkungen von Diskriminierung, polizeilicher Brutalität oder häuslicher Gewalt oft nicht sehen oder fühlen: Geschichten jedoch machen das Problem greifbar und unausweichlich.
Mit »Stimme« meine ich nicht nur die tatsächliche Stimme – also den Klang, den Stimmbänder in den Ohren anderer erzeugen –, sondern die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen, zu partizipieren, sich selbst wahrzunehmen und als freier Mensch mit eigenen Rechten wahrgenommen zu werden. Was auch das Recht einschließt, nichts zu sagen – beispielsweise das Recht, nicht um eines Geständnisses willen gefoltert zu werden wie manche politische Gefangene. Oder das Recht, Fremden, die sich einem annähern, nicht per se zu Diensten zu sein, wie das einige Männer von jungen Frauen erwarten, wenn sie Aufmerksamkeit und Schmeichelei fordern und, wenn diese ausbleiben, zu Strafmaßnahmen greifen. Die auf das Konzept »Handlungsmacht« ausgeweitete Stimme schließt weite Bereiche von Macht und Machtlosigkeit in sich ein.1
Wer wurde nicht gehört? Der Ozean ist weit, und die Oberfläche eines Meeres lässt sich nicht kartieren. Wir wissen, wer in den vergangenen Jahrhunderten bei den offiziellen Themen meistens gehört wurde: derjenige, der gerade das Amt innehatte, der studiert hatte, der Armeen befehligte, der Richter oder Schöffe war, Bücher schrieb und ganze Reiche unter sich hatte. Wir wissen auch, dass sich diese Situation dank der zahllosen Revolutionen des 20. Jahrhunderts latent geändert hat – dank dem Aufbegehren gegen Kolonialismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und gegen das massenhaft von der Homophobie zwangsverordnete Stillschweigen und vieles mehr. Wir wissen, dass die Klassenunterschiede im Laufe des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten in gewissem Maße eingeebnet wurden und dann gen Ende durch Einkommensungleichheiten, das Wegbrechen sozialer Mobilität und das Erstarken einer neuen, extremen Elite wieder an Bedeutung gewonnen haben. Auch Armut bringt zum Schweigen.
Wer gehört wurde, wissen wir. Denn all jene sind gut kartierte Inseln. Der Rest ist das unkartierbare Meer der ungehörten und undokumentierten Menschheit. Im Laufe der Jahrhunderte sind viele gehört und geliebt worden, und auch wenn ihre Worte sich in dem Moment, in dem sie ausgesprochen wurden, in Luft auflösten, fanden sie trotzdem Halt in den Köpfen und leisteten ihren Beitrag zur Kultur, so als hätten sie sich zu nährstoffreicher Erde kompostiert. Aus solchen Worten kann Neues erwachsen. Andere aber wurden zum Schweigen gebracht, ausgeschlossen und missachtet. Die Erde besteht zu sieben Zehnteln aus Wasser. Das Verhältnis von Schweigen zu vernehmlicher Stimme ist deutlich unausgewogener. Wenn die Bibliotheken alle Geschichten enthalten, die jemals erzählt worden sind, dann gibt es auch Geisterbibliotheken mit all den Geschichten, die nie erzählt worden sind. Und die Geister sind den echten Büchern zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegen. Sogar jene, die vernehmbar gewesen sind, haben dieses Privileg oft nur durch strategisches Schweigen an anderer Stelle erwirkt oder durch die Unfähigkeit, gewisse Stimmen zu hören – inklusive der eigenen.
Im Kampf um die Freiheit ging es immer auch darum, Bedingungen zu schaffen, die denen, die vormals zum Schweigen gebracht wurden, zu Sprache und Gehörtwerden verhelfen.
Eine Engländerin hat mir neulich erzählt, in Großbritannien gebe es eine wachsende Gefängnispopulation von alten Männern, weil zahllose Opfer, denen vorher niemand zuhören wollte, endlich von ihrem sexuellen Missbrauch erzählen. Der berüchtigtste Fall in Großbritannien ist der des BBC-Showmoderators Jimmy Savile, der zum Ritter geschlagen, mit Lob überschüttet und zum Prominenten gemacht wurde – und dann starb, bevor mehr als 450 Menschen, mehrheitlich junge Frauen, aber auch Jungen und erwachsene Frauen, ihre Klage wegen sexueller Nötigung gegen ihn einreichten. 450 Menschen, die vorher nicht angehört wurden – vielleicht, weil sie glaubten, kein Recht zu haben, sich zu äußern, Protest einzulegen oder überhaupt für voll genommen zu werden. Oder weil sie einfach wussten, dass sie dieses Recht tatsächlich nicht hatten, dass sie schlicht die Stimmlosen waren.
John Lydon, bei den Sex Pistols bekannt als Johnny Rotten, sagte 1978 in einem BBC-Interview über Savile: »Ich wette, der hängt in all diesen schäbigen Geschichten drin, die man so hört, über die man aber nicht sprechen darf. Mir sind da so ein paar Gerüchte zu Ohren gekommen. Und ich wette, dass nichts davon je ans Tageslicht kommen wird.« Lydons Worte wurden erst 2013 öffentlich gemacht, als die BBC endlich das ungekürzte Interview freigab. In dieser Zeit kamen auch andere Geschichten heraus, Geschichten über Pädophilenringe, in die auch prominente britische Politiker verwickelt waren. Viele der betreffenden Verbrechen waren vor langer Zeit geschehen. Manche davon führten nachgewiesenermaßen zum Tod einiger Opfer, noch im Kindesalter. Skandale um Personen des öffentlichen Lebens sind nationale oder sogar internationale Versionen jener Dramen, die auch auf niedriger lokaler Ebene ablaufen, wenn es darum geht, wessen Geschichte die Oberhand gewinnt. Oft ist das abhängig davon, in welche Richtung sich der Wind der öffentlichen Meinung dreht – schließlich lösen Skandale eine Menge Gespräche und Auseinandersetzungen aus. Manchmal legen solche Fälle den Grundstein dafür, dass auch andere nach vorne treten und von ihrem Leid und anderen Tätern erzählen. In jüngster Zeit hat sich daraus ein Prozess entwickelt, bei dem in den sozialen Medien kollektive Tribunale eingerichtet und massenhaft Zeugenaussagen getätigt werden sowie Betroffene sich gegenseitig unterstützen, was man durchaus als eine Variante des oben skizzierten »Kümmerns und Anfreundens« interpretieren kann.