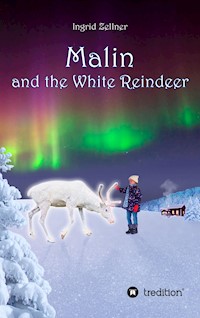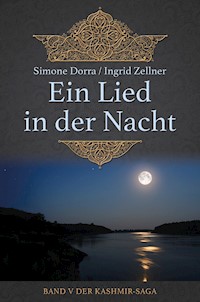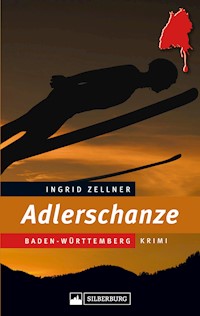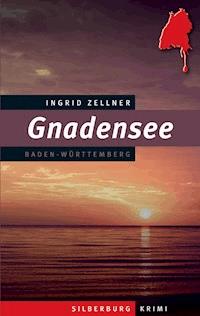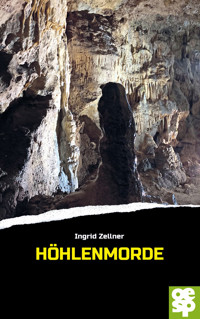
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel + Spörer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In der Wimsener Höhle treibt am frühen Morgen eine übel zugerichtete männliche Leiche im Wasser. Kommissar Surendra Sinha und seine Kollegin Leonie Lexer von der Kripo Reutlingen haben kaum richtig mit den Ermittlungen begonnen, als ihnen bereits ein zweiter Höhlenmord gemeldet wird: Diesmal liegt der Tote in der Nebelhöhle. Bei ihren Nachforschungen entdecken Surendra und Leonie, dass die beiden Mordopfer sich gekannt haben: Vor zwanzig Jahren haben sie in der Schule zusammen mit einem weiteren Freund als das “Räuberhöhlen-Trio” zahlreiche Mitschüler gemobbt und terrorisiert. Hat womöglich eines ihrer damaligen Opfer nun einen verspäteten Rachefeldzug gestartet? Als in der Bärenhöhle eine dritte Leiche gefunden wird, spitzt sich die Lage zu …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Ingrid Zellner
wurde 1962 in Dachau geboren. Sie studierte in München Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Geschichte (1988 Magisterexamen). Von 1990 bis 1994 war sie als Dramaturgin am Stadttheater Hildesheim engagiert, von 1996 bis 2008 in derselben Funktion an der Bayerischen Staatsoper München. Heute ist sie vor allem als Übersetzerin (Schwedisch) und als Autorin tätig. Sie veröffentlichte Romane, Krimis, ein Kinderbuch, Kurzgeschichten, CD-Booklet-Texte, Artikel und Theaterstücke. Daneben ist sie Regisseurin und Schauspielerin; große Erfolge u. a. als Dorfrichter Adam in Kleists Der zerbrochne Krug. Sie ist Backing Vocalist für die Punk-Rock-Band Garden Gang und leitete sechs Jahre lang ein Jugendtheater-Ensemble. Derzeit lebt sie in Gomadingen auf der Schwäbischen Alb und spielt im Ensemble des Naturtheaters Hayingen. Ihre bevorzugten Reiseziele sind die Länder Skandinaviens, die Arktis und Indien.
Titel
Ingrid Zellner
Höhlenmorde
Kriminalroman
Oertel+Spörer
Impressum
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen.Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden.Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel + Spörer Verlags-GmbH + Co. KG 2025 Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen Alle Rechte vorbehaltenTitelbild: Ingrid ZellnerGestaltung: PMP Agentur für Kommunikation, ReutlingenLektorat: Bernd WeilerKorrektorat: Sabine Tochtermann Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-96555-202-9
Besuchen Sie unsere Homepage und informieren Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:www.oertel-spoerer.de
Die Wohnungstür fällt ins Schloss. Er presst das Ohr dagegen und hört die hallenden Schritte draußen im Treppenhaus. Stumm zählt er die Sekunden. Er weiß genau, wie lange es dauert, bis sie unten angekommen ist und das Haus verlässt. Seine Nasenflügel beben vor Erregung. Gleich ist es so weit. Fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig … da. Da ist es, das vertraute, ferne Geräusch der sich schließenden Haustür zwei Etagen tiefer. Sie ist fort. Er ist allein.
Allein und voll unbändiger Vorfreude.
Noch immer kann er es kaum fassen: Er hat den Fernseher ganz für sich, und das heute Abend, wo im Estádio da Luz in Lissabon das Endspiel der Fußball-EM stattfindet. Und er darf bis zum Schluss aufbleiben, obwohl am nächsten Tag Montag ist und er wieder in die Schule muss. Seine Mama hat es ihm erlaubt. Ausnahmsweise, mein Schatz, hat sie gesagt, bevor sie zu ihrer Nachtschicht aufgebrochen ist, und ihm sogar Limo und Salzbrezeln bereitgestellt. Seine Schwester übernachtet heute bei einer Freundin. Sie mag keinen Fußball.
Es ist einfach perfekt.
Gut, nicht ganz. Wirklich perfekt wäre es, wenn Deutschland im Endspiel wäre. So wie damals, als er sechs war und Oliver Bierhoff in Wembley mit dem Golden Goal gegen Tschechien Deutschland zum Europameister gemacht hat. Wie Papa und er über dieses Tor gejubelt haben, ist eine der frühesten Erinnerungen in seinem Leben. Und zugleich auch die letzte an seinen Papa. Einen Tag danach hat ein Auto ihn überfahren. Seitdem sind seine Mama, seine Schwester und er allein.
Und die Deutschen haben seitdem auch nichts mehr gerissen. Beim vorigen Mal sind sie als amtierende Europameister in der Vorrunde mit nur einem einzigen Tor als Gruppenletzter rausgeflogen. Diesmal haben sie es immerhin auf zwei Tore gebracht, aber für die Finalrunde hat es wieder nicht gereicht. Deshalb spielen nun Portugal und Griechenland um den Titel. Ausgerechnet Griechenland. Wobei, die haben immerhin einen deutschen Trainer. Da könnte er doch ersatzweise denen die Daumen drücken. Andererseits hat Portugal Cristiano Ronaldo. Als er den Fernseher einschaltet, ist er immer noch unschlüssig, zu wem er an diesem Abend halten wird.
Und dann, gerade als die Mannschaften in das Stadion kommen, klingelt im Flur das Telefon.
Natürlich geht er sofort ran. Es könnte ja seine Mutter sein, oder seine Schwester.
Aber die Stimme, die ihm antwortet, ist männlich. Und er kennt sie.
»Wir haben deine Schwester«, sagt die Stimme. »Wenn du nicht willst, dass wir heute Nacht unseren Spaß mit ihr haben, dann komm zu uns und lös sie aus. Und komm nicht auf die Idee, deine Mama oder die Bullen zu rufen.«
Im Moment kommt er auf überhaupt keine Idee. Er ist wie gelähmt. Seine Schwester. Bei denen.
»Hallo? Bist du taub, du Opfer?«
»Nein.« Seine Stimme ist nicht mehr als ein heiseres Flüstern. »Womit?«
»Womit was?«
»Womit soll ich sie auslösen?«
Ein höhnisches Lachen am anderen Ende der Leitung. »Na, mit dir natürlich. Das heißt – wenn du noch ein paar Fressalien mitbringst, haben wir auch nichts dagegen. Vielleicht sind wir dann ja sogar etwas netter zu dir.«
Er denkt an die Salzbrezeln im Wohnzimmer und an den Kühlschrank in der Küche.
»Ja … ja, mach ich«, stottert er hilflos.
»Gut. Komm zum Spielplatz in Traifelberg, wir warten da auf dich. Und wie gesagt: Keine Bullen! Sonst passiert deinem hübschen Schwesterchen was.«
»Nein!«, entfährt es ihm verzweifelt. »Nein – bitte, bitte nicht!«
»Hör auf zu heulen und mach dich auf die Socken!«, erwidert die Stimme barsch. Dann ertönt ein leises Klicken, das ihm meldet, dass das Gespräch beendet ist.
Er steht da wie angewurzelt. Aus dem Wohnzimmer hört er die Töne einer Hymne. Die griechische. Vielleicht auch die portugiesische. Er hat keine Ahnung.
Wir haben deine Schwester …
Die verstörenden Bilder, die in seinem Kopf auftauchen, reißen ihn aus seiner Erstarrung. Er stürzt ins Wohnzimmer, schaltet den Fernseher aus und schnappt sich die Salzbrezeltüte. Dann rennt er in die Küche. Im Kühlschrank findet er Saitenwürste, ein Stück Käse und sogar eine Packung Schokoriegel. Er stopft alles in seinen Schulrucksack. Das muss reichen. Lieber Gott, lass es reichen.
Wenig später sitzt er auf seinem Fahrrad und tritt in die Pedale. Bis nach Traifelberg braucht er zehn Minuten. Zum Glück ist es draußen noch immer sommerlich hell. Der Spielplatz liegt trotzdem öde und verlassen da, als er ihn erreicht. Klar. Er ist losgefahren, als das Endspiel angepfiffen worden ist, also muss es jetzt etwa neun Uhr abends sein. Da schaukeln hier keine kleinen Kinder mehr.
Er steigt ab und lässt sein Fahrrad achtlos ins Gras fallen.
»Hallo?«, ruft er zaghaft. »Wo seid ihr?«
Zu spät hört er das leise, knackende Geräusch hinter ihm. Eine Hand wird ihm auf den Mund gepresst und erstickt seinen Angstschrei. Gleichzeitig werden ihm die Augen verbunden. »Keinen Mucks!«, zischt eine Stimme neben seinem Ohr, dann wird die Hand vor seinem Mund durch einen Knebel ersetzt. Starke Hände halten ihn an beiden Armen fest. Sein erster Impuls, sich zur Wehr zu setzen, ist schnell wieder erloschen. Er hat keine Chance. Sie sind zu dritt. Er weiß es.
»Komm mit!«
Blind stolpert er in dem festen Haltegriff seiner Gegner vorwärts. Darf er hoffen, dass jemand mitbekommt, wie er hier entführt wird? Kaum. Der Spielplatz liegt ganz am Rand der kleinen Wohnsiedlung, hinter der die Honauer Steige ohne Vorwarnung jäh hinab ins Tal führt, und die wenigen Menschen, die in Hörweite leben, sitzen jetzt vermutlich alle vor dem Fernseher.
Es dauert eine gefühlte Ewigkeit und wahrscheinlich doch nur wenige Minuten, bis er das knarzende Geräusch einer Tür hört und in einen Raum gestoßen wird, in dem es nach morschem Holz und Zigarettenrauch riecht. Er wird auf einen Stuhl niedergedrückt und festgebunden. Aus der Angst, die seit dem Telefonat pausenlos Adrenalin in seine Adern pumpt, wird jetzt schiere Panik. Was haben die mit ihm vor?
»Willkommen in unserer Räuberhöhle«, sagt die Stimme, die er auch am Telefon gehört hat. »Ich sag’s dir gleich, es hat gar keinen Sinn, zu schreien. Hier hört dich keiner.«
Der Knebel wird ihm aus dem Mund genommen. Er schnappt ein paarmal keuchend nach Luft und wartet darauf, dass ihm auch die Augenbinde abgenommen wird. Aber nichts geschieht.
»Wo ist meine Schwester?«, stößt er hervor.
Als Antwort bekommt er nur ein lautes, dreistimmiges Gelächter.
»Was habt ihr mit ihr gemacht?«, schreit er wild und windet sich in seinen Fesseln. »Sweetie! Sweetie, wo bist du? Sag doch was!«
»Der ist tatsächlich drauf reingefallen«, prustet eine raue Stimme. »So ein Blödmann!«
»Deine dumme Schwester ist nicht hier«, sagt die Anführerstimme. »Das war eine Falle, du Opfer! Wärst du sonst freiwillig hier angetanzt?«
»Noch dazu mit lauter milden Gaben!« Die dritte Stimme ist die hellste von allen. »Schaut mal hier – sogar Schokolade hat er dabei!«
»Braver Junge. Hey, das sind ja die mit den Sammelbildern! Cool.« Das Rascheln einer aufgerissenen Schokoladenverpackung. »Och Mist, den Lukas Podolski hab ich doch schon zweimal – braucht den einer von euch?«
»Nö, kannste wegschmeißen.«
»Apropos Fußball – wieso schaltet hier eigentlich keiner das Radio ein?«
»Scheiße, voll vergessen!«
Ein leises Klickgeräusch. Ein Rauschen, dann eine blecherne Kommentatorenstimme, die etwas von nach wie vor Null zu Null verkündet.
»War ja abzusehen«, sagt die Anführerstimme mürrisch. »Die Rehhagel-Jungs mauern sowieso, und die Portugiesen spielen bestimmt auch mit angezogener Handbremse, nachdem sie im Eröffnungsspiel gegen die Griechen so auf die Schnauze gefallen sind. Dieses Finale geht mir voll am Arsch vorbei.«
»Dafür interessiert dich heute ein ganz anderer Arsch, nicht wahr?«
»Worauf du einen lassen kannst.«
Ein eisiger Schauer schießt durch seinen Körper, sein Herz trommelt verzweifelt gegen den Brustkorb. Die Fesseln machen ihn bewegungsunfähig, die Augenbinde blind. Er ist seinen Peinigern hilflos ausgeliefert. Wie schon so oft. Aber noch nie hat er dabei eine derartige Todesangst empfunden wie jetzt.
»Also dann zu uns, du Opfer. Du weißt, warum du hier bist?«
Er schüttelt unsicher den Kopf. Im nächsten Moment sitzt eine schallende Ohrfeige auf seiner linken Backe. Unwillkürlich schreit er auf – vor Schmerz, aber vor allem auch vor Schreck, schließlich hat er den Schlag nicht kommen sehen.
»Verarsch uns nicht! Du weißt ganz genau, was los ist. Du bist zum Direx gelaufen und hast ihm gesteckt, dass wir dem Dominik das Handy und die Kohle abgenommen haben.«
Das hat er nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber während er noch überlegt, wie er ihnen das klarmachen soll, brennt bereits die zweite Backpfeife auf seiner Wange.
»Du hast gepetzt und uns in die Scheiße geritten. Hast du im Ernst geglaubt, wir nehmen das einfach so hin?«
Die dritte Ohrfeige. Im Hintergrund moderiert die blecherne Sportreporterstimme unablässig vor einer lauten Geräuschkulisse weiter.
»Aber da bist du schiefgewickelt. Und jetzt zeigen wir dir, was wir mit Petzen und Verrätern machen.«
Noch mehr Ohrfeigen. Tritte gegen die Schienbeine. Ein Schlag auf den Hinterkopf, sodass er sich auf die Zunge beißt. Ein warmer, kupfriger Geschmack erfüllt seinen Mund. Blut. Instinktiv spuckt er es aus.
»He Leute – habt ihr das gesehen? Der Wichser hat mich angespuckt!«
»Der hat seine Lektion offenbar noch nicht begriffen. Legt ihn über!«
Seine Fesseln werden gelöst, aber noch ehe er die Gelegenheit zu einem Fluchtversuch nutzen kann, wird er von starken Händen bäuchlings auf die Sitzfläche des Stuhles gelegt und erneut festgebunden. Blankes Entsetzen steigt in ihm hoch wie ein würgender Brechreiz, als ihm aufgeht, was ihn jetzt erwartet.
»Bitte!«, fleht er. »Ich hab euch nicht beim Rektor verpfiffen! Das muss jemand anderes gemacht haben, aber ich war das nicht!«
»Halt’s Maul! Nicht hinterher feige werden! Los, Leute – Strafe muss sein!«
Etwas Flaches, Hartes landet mit Wucht auf seinem Gesäß. Er brüllt auf vor Schmerz. Der zweite Schlag folgt sofort, dann der dritte, dann der vierte. Es muss ein Tischtennisschläger sein, denkt er, während das Publikum im Radio weiter johlt und der Kommentator irgendetwas von Halbzeitpause sagt. Seine Peiniger machen keine Pause. Sie schlagen weiter auf ihn ein, mittlerweile zur Abwechslung auch mit einem Stock und mit einem Gürtel. Er schreit bei jedem Schlag demonstrativ laut auf. Denn mitten zwischen all den Schmerzen und der entsetzlichen Erniedrigung glimmt noch ein letztes Fünkchen Hoffnung, dass ihn vielleicht doch noch jemand hört und der Qual ein Ende bereitet.
Ein Fünkchen, das irgendwann langsam und traurig erlischt.
Und dann hören sie plötzlich auf. Er hört sie keuchend schnaufen. Seine Augen brennen von den vielen Tränen, die keinen Weg aus der groben Augenbinde heraus gefunden haben. Sein wundgeschlagenes Hinterteil glüht wie Feuer. Lieber Gott, lass es vorbei sein, betet er inständig. Lass mich nach Hause. Bitte.
»Ich brauch jetzt unbedingt ’ne Fluppe.«
»Hast du für mich auch eine?«
»Wenn’s sein muss. Und du?«
»Noch nicht. Ich bin mehr für die Zigarette hinterher.«
Also ist es noch nicht vorbei. Verzweifelt bäumt er sich auf. Die Fesseln schneiden ihn schmerzhaft ins Fleisch. Jemand packt ihn an den Haaren.
»Übrigens, dass das klar ist: Wenn du uns noch einmal verpetzt – wenn du irgendjemandem auch nur ein Sterbenswort von dem hier erzählst – dann nehmen wir uns deine Schwester doch noch vor. Und das willst du doch nicht, oder?«
Er zieht den Rotz hoch und nickt gehorsam. Was soll er sonst tun. Sein Widerstand ist gebrochen, spätestens jetzt, wo sie ernsthaft damit drohen, seiner geliebten Schwester etwas anzutun.
Die zweite Halbzeit im Radio hat inzwischen begonnen. Die Luft ist geschwängert von beißendem Zigarettenrauch. Er ist in der Hölle. Kein Zweifel. Die Hölle – das sind die anderen. Er kann sich nicht mehr erinnern, wo er diesen Satz gelesen hat. Aber er weiß jetzt, dass er stimmt.
»So, Leute – auf zum großen Finale. Darauf freu ich mich schon die ganze Zeit.«
Jemand zieht ihm die Hosen herunter. Die Shorts mitsamt der Unterhose. Seine Eingeweide verkrampfen sich. Sie wollen ihn also noch mehr prügeln. Und noch mehr demütigen.
Zwei Hände massieren seine nackten Hinterbacken. Er zieht scharf die Luft ein vor Schmerz.
»Wow – warm wie zwei frische Brötchen. Da wird mir ja gleich noch heißer!«
»Sag mal, Freddie … willst du das echt machen?«
»Klar, ich wollte schon immer mal wissen, wie das ist. Und dieses Opfer weiß danach noch besser, was seiner Schwester blüht, wenn er nicht die Klappe hält.«
Er merkt, wie sich alles in ihm zusammenzieht. Er weiß nicht, was jetzt mit ihm passiert, und weiß es zugleich mit fürchterlicher Gewissheit. Dann spürt er den ersten grauenvollen Schmerz in seinem Hintern. Er schreit auf. Hinter ihm johlen zwei Stimmen, starten laute Anfeuerungsrufe. Im Radio johlt das Publikum in Lissabon. Er weint laut und hemmungslos, während sich ein Stoß nach dem anderen in ihn hinein rammt, bis sein Gehirn durchdreht und seine Welt auseinanderfließt wie geschmolzenes Wachs.
Mitten in diesem Inferno hört er von irgendwoher ein lautes »Tooooooor!«.
Angelos Charisteas hat die Griechen in Führung geschossen.
1
Max Holzschuh warf einen Blick aus dem Küchenfenster und schnalzte zufrieden mit der Zunge. Die ganze Nacht hindurch hatte es geregnet, aber nun waren die schweren Wolken weitergezogen, und im Osten machte sich die Sonne auf den Weg in einen sanftblauen Himmel. Es versprach ein schöner Maitag zu werden. Gut fürs Geschäft.
Er löffelte den Rest seiner reichlichen Portion Rührei mit Speck direkt aus der gusseisernen Pfanne. Danach schenkte er sich eine Tasse Kaffee ein und überflog die Titelseite des Reutlinger General-Anzeigers. Genauer studieren würde er die Zeitung, wenn er am Abend von seiner Arbeit nach Hause kam – bei einer Flasche Bier und einem herzhaften Vesper. Das war seine tägliche Routine, jahraus, jahrein. Außer in den Wintermonaten, wenn er seinem Job nicht nachgehen konnte. Wegen der Fledermäuse.
Im Radio lief »Hey Jude«, und er ertappte sich dabei, dass er die Melodie leise mitpfiff. Das waren noch richtige Songs gewesen damals, mit solchen Hits war er aufgewachsen. Siebenundsechzig war er heute und hatte damit eigentlich bereits die Altersgrenze für die Regelaltersrente erreicht. Wahrscheinlich wäre er auch auf der Stelle in Rente gegangen, hätte er immer noch den alten, stumpfsinnigen Bürojob gehabt, mit dem er jahrelang seine liebe Frau Heidrun und seine drei Kinder solide versorgt hatte. Aber die Zeiten waren vorbei, die Kinder hatten das heimische Nest längst allesamt verlassen, und seine jetzige Arbeit machte ihm noch immer so viel Spaß, dass er keine Sekunde lang daran dachte, das Ruder aus der Hand zu legen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn sein Arbeitsplatz war seit gut zehn Jahren der Besucherkahn in der Wimsener Höhle.
Es war Heidrun gewesen, die ihn damals ermutigt hatte, sich seinen Jugendtraum zu erfüllen. Mit zwölf hatte er mit seinen Eltern einen Ausflug zu der einzigen mit einem Boot befahrbaren Schauhöhle Deutschlands machen dürfen, und auch wenn man als Besucher nur gerade mal siebzig Meter weit in die Höhle hineinrudern konnte und dabei ständig den Kopf einziehen musste, um nicht gegen irgendeinen kantigen Felsen zu stoßen, so war er dennoch fasziniert gewesen von der geheimnisvollen Atmosphäre, dem kristallklaren Wasser und den spannenden Geschichten, die der Fährmann während der Fahrt zu erzählen wusste. Oft war er danach wiedergekommen, erst allein, dann mit Heidrun, dann mit den Kindern – und immer wieder hatte er sich dabei vorgestellt, selbst der Mann zu sein, der den Besuchern diese mystische Welt erklärte, die ihn einfach niemals losließ. Er hatte alles über die Wimsener Höhle gelesen, was ihm in die Finger kam, und sich mit regelmäßigen langen Wanderungen in der Umgebung fit gehalten. Aber erst, als auch der letzte seiner drei Sprösslinge von zu Hause ausgezogen war und er nur noch seine Frau und sich selbst versorgen musste, hatte er erstmals gewagt, Heidrun von seiner heimlichen Sehnsucht zu erzählen. Und zu seiner Überraschung hatte sie ihn nicht ausgelacht, sondern ganz gelassen gesagt: »Probier’s doch einfach mal!«
Mit dieser Ermutigung im Rücken hatte er eine Bewerbung losgeschickt – und nur wenig später konnte er tatsächlich seinen Bürojob kündigen und seine neue Stelle als Fährmann in der Wimsener Höhle antreten. In dem ersten Boot, das er allein und selbstständig durch die Felsgänge in die große Grotte dirigierte, hatte zwischen den anderen Passagieren auch Heidrun gesessen, mit einem glücklichen Lächeln und feucht schimmernden Augen. Es sollte das einzige Mal bleiben, dass er seine Frau in die Höhle rudern durfte. Kurz darauf erlitt sie aus heiterem Himmel einen schweren Herzinfarkt und ließ ihn als fassungslosen, trauernden Witwer zurück. Knapp zehn Jahre war das jetzt her.
Wahrscheinlich dachte er auch deswegen noch nicht daran, in Rente zu gehen. Was sollte er denn den ganzen Tag lang allein zu Hause? Abgesehen davon machte ihm seine Arbeit nach wie vor Freude, und er wurde es niemals müde, den Besuchern während der Kahnfahrt auf unterhaltsame Art die Geschichte des historischen Anwesens Wimsen und die Entstehung, Geologie und Erforschung seiner geliebten Höhle näherzubringen. Nicht zu vergessen natürlich den Wimsener Höhlenstollen. Wenn er auf die Stelle in der Grotte zeigte, wo eine auf der Schwäbischen Alb ansässige Bäckerei jedes Jahr im Herbst über zweitausendfünfhundert Butterstollen für mehrere Wochen auf flachen Kähnen einlagerte, sodass sie dank der konstant kühlen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit wunderbar aromatisch und zart wurden, erhob sich unweigerlich ein fasziniertes »Ahhhhh!« unter seinen Passagieren. Und wenn er dann noch jenen Bäckermeister zitierte, der einstens auf die Frage, ob diese Form der Lagerung denn nicht Diebe anlocke, seelenruhig geantwortet hatte: »Der, der da noischwemmt in dem kalta Wass’r, der hot sich oin Stolla g’scheid verdent und kaa’nen gern hau«, kassierte er jedes Mal einen Extra-Lacher, der im Idealfall am Ende auch noch das Trinkgeld ein wenig in die Höhe trieb.
Unwillkürlich schmunzelte er, während er seine Kaffeetasse austrank. Dann faltete er die Zeitung zusammen und legte sie beiseite. Keine sonderlich spannenden Schlagzeilen heute. In der Weltgeschichte mochte gerade der Teufel los sein, aber hier auf der beschaulichen Alb hatte man zum Glück noch überwiegend seine Ruhe.
Er packte seine Vesperbrote und eine Thermosflasche mit Kaffee ein und machte sich auf den Weg. Eigentlich hätte er sich ruhig noch Zeit lassen können – bis zur Wimsener Höhle brauchte er von Hayingen aus mit dem Wagen nur wenige Minuten, und das erste Besucherboot würde erst um zehn Uhr ablegen. Aber bevor ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fiel, fuhr er lieber frühzeitig zu seinem Arbeitsplatz, um in Ruhe alles für den Tag vorzubereiten, vielleicht noch einen gemütlichen Spaziergang zu machen und den einen oder anderen Schwatz mit seinen Kollegen zu halten.
Die Sonne schien, und die Morgenluft war frisch und kühl, als er seinen Wagen auf dem Parkplatz abstellte und zur Höhle hinunterging. Der Kiosk war noch geschlossen, die Bootsanlegestelle menschenleer. Er liebte diese herrliche Ruhe, bevor das Gewimmel des Tages einsetzte. In dieser Zeit gehörte die Höhle ganz und gar ihm.
Sein Blick glitt über das Boot hinweg – und erfasste plötzlich einen seltsamen dunklen Schatten in dem klaren Wasser. Hatte hier etwa jemand einen Müllsack entsorgt? Das wäre ja wohl ein Frevel sondergleichen! Er trat ganz an den Rand des Stegs heran, kniff die Augen ein paarmal zusammen – und dann begriff er, was dort im Wasser trieb.
Das war kein Müllsack. Das war noch viel, viel schlimmer.
Es dauerte mehrere Sekunden, bis er sich von dem ersten Schock erholt hatte und sein Smartphone aus der Hosentasche fingerte, um die 110 zu wählen.
Dabei dachte er an die Zeitung, die zu Hause auf seinem Küchentisch lag.
Morgen würde es darin mit Sicherheit zumindest eine spannende Schlagzeile geben.
2
Surendra Sinha stand am Fenster seines kleinen Appartements in Gomadingen und schaute zu dem dicht bewaldeten Sternberg hinüber. Es war der erste Sonntag im Mai, und die Bäume hatten endlich damit begonnen, ihre leuchtend grünen Blätterkleider anzulegen. Weiter unten im Land hatte der Frühling längst Einzug gehalten, hier oben auf der Schwäbischen Alb dauerte das immer etwas länger.
Das hatte jedenfalls Helga daadi ihm gesagt, vor zwei Wochen, als er ihr bei einer Tasse Kaffee erzählt hatte, wie es unten in Reutlingen bereits überall knospte und grünte. Wir sind hier auf achthundert Metern Höhe, da muss der Frühling eben erst mal mühsam hochklettern, hatte sie erklärt und mit einem heiteren Augenzwinkern hinzugefügt: Leonie sagt immer, dass sie deshalb den Frühling jedes Jahr gleich zweimal genießen kann – erst bei ihr zu Hause in Reutlingen und danach bei mir, wenn sie mich besucht.
Surendra lächelte in sich hinein. Helga daadi. Aus einem Impuls heraus hatte er seine Vermieterin vor einiger Zeit das erste Mal so genannt und dafür natürlich erst einmal einen völlig verständnislosen Blick von ihr kassiert. Woraufhin er ihr erklärt hatte, dass man auf Hindi Großmütter so nannte: daadi väterlicherseits, naani mütterlicherseits. Sie hatte das ungemein spannend gefunden, so wie eigentlich alles, was seine indischen Wurzeln in seinem Alltag widerspiegelte – ob das nun die kleine goldene Skulptur des elefantenköpfigen Hindu-Gottes Ganesha war, vor der er regelmäßig Räucherstäbchen anzündete und betete, die alten Hindi-Filmsongs, die er so liebte, oder die Kostproben seiner indischen Küche, die er ihr gelegentlich vorbeibrachte. Ihre Augen leuchteten jedes Mal auf, wenn er zwischendurch statt seiner üblichen Jeans und T-Shirts Kurta und Churidars trug, und sie strahlte wie ein Kind, wenn er sie auf traditionelle Weise mit vor der Brust gefalteten Händen, geneigtem Kopf und einem »Namaste!« begrüßte. Mit dem »Herrn Sinha« hatte sie sowieso bereits wenige Wochen, nachdem er die kleine Dachwohnung in ihrem Haus bezogen hatte, Schluss gemacht: Sie nannte ihn Surendra (»das ist so ein schöner Name!«), und mittlerweile duzten sie sich sogar.
Manchmal konnte er noch immer nicht begreifen, was für ein Glück er gehabt hatte. Noch vor gut einem Jahr hatte er planlos und ohne jede Perspektive in der Luft gehangen, nachdem er aus mehreren Gründen seinen alten Beruf als Kriminalkommissar aufgegeben hatte. Er hatte bereits ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, Deutschland zu verlassen und nach Indien zu übersiedeln, in die Heimat seiner Eltern, die vor zweiundvierzig Jahren kurz vor seiner Geburt aus dem Punjab nach Stuttgart emigriert waren. Dann jedoch hatte Frank Hasemann, sein Ex-Vorgesetzter und bester Freund, ihm einen Undercover-Job für die Kripo Reutlingen vermittelt, der ihn nach Hayingen und in das dortige Naturtheater geführt hatte. Und seitdem hatte sich sein Leben um hundertachtzig Grad gedreht. Er hatte seine Freude am Ermitteln wiedergefunden, er hatte neue, sympathische Kollegen kennengelernt, und vor allem hatte er sich derart in die Schwäbische Alb verliebt, dass er kurzerhand beschlossen hatte, sich hier niederzulassen.
Ein Domizil war schnell gefunden: Die Reutlinger Kriminalkommissarin Leonie Lexer hatte ihm die kleine Dachwohnung im Haus ihrer Großmutter Helga Lexer vermittelt. Die alte Dame war Ende siebzig, klein und nicht mehr gut zu Fuß, aber voller Lebensfreude und mit hellwachen Augen in einem Gesicht voller Runzeln, die von einem langen, arbeitsreichen Leben erzählten. Seit dem Tod ihres Mannes lebte sie allein in ihrem gemütlich eingerichteten Haus. Eine Nachbarin und ihre Enkelin Leonie halfen ihr, wenn sie zum Einkaufen oder zum Arzt musste, aber ansonsten kam sie im Alltag nach wie vor bestens zurecht. Sie sieht aus wie eine zerbrechliche Porzellanpuppe, aber sie ist alles andere als eine hilflose alte Oma, hatte Leonie Surendra hinter vorgehaltener Hand zugeraunt. Ich bin überzeugt, sie hätte keine Skrupel, einem Rowdy, der ihr ans Leder will, ihren Gehstock über den Schädel zu ziehen. Trotzdem bin ich ehrlich gesagt froh, dass sie jetzt nicht mehr ganz allein in dem Haus herumsitzt. Und sie auch, wenn du mich fragst. Sie schwärmt wie ein Teenager von ihrem ›großen, bildschönen Chauffeur und Leibwächter‹.
Surendra schüttelte leicht amüsiert den Kopf, während er zu der Küchenzeile in seinem Wohn-Schlafzimmer ging, um sich einen Masala-Chai zu machen. Dass er hochgewachsen war, ließ sich nicht bestreiten, und dass er gelegentlich als Chauffeur für Helga daadi fungierte, war ebenfalls eine Tatsache. Aber »bildschön«? Nun ja, so etwas war bekanntlich Geschmackssache, und auf seine deutschen Landsleute mochte er mit seiner bronzefarbenen Haut, den braunen Augen und den dunklen, fast schwarzen Haaren samt gepflegtem Fünftagebart zumindest exotisch wirken. Vielleicht sogar tatsächlich gutaussehend, auch wenn er sich, anders als sein Freund Frank, niemals zu dem kühnen Vergleich mit dem indischen Filmstar Arjun Rampal versteigen würde. Obwohl er diesem Schauspieler in der Tat ein bisschen ähnlich sah. Zugegeben.
Egal. Letzten Endes war sein indisches Aussehen Segen und Fluch zugleich. Für die einen mochte es ihn »bildschön« machen. Für die anderen machte es ihn zum »Ausländer«, den man mobben, beleidigen und je nach Lust und Laune auch zusammenschlagen durfte. Hatte er alles schon erlebt.
Ein Schatten flog über sein Gesicht, während er ein paar Kardamomkapseln, Pfefferkörner, Nelken und eine Zimtstange in seinen Mörser gab und ausgiebig mit dem Stößel zu bearbeiten begann. Wie immer taten der intensive Duft der Gewürze und diese Arbeit ihm gut, und er bemühte sich, nicht mehr an diverse unerfreuliche Begegnungen mit rechtsextrem gesinnten oder einfach nur dummen Zeitgenossen zu denken. Seit er Anfang September, also vor acht Monaten hier eingezogen war, hatte er diesbezüglich ohnehin seine Ruhe gehabt. Zumindest bis jetzt. Ganesha sei Dank.
Er röstete die feingemörserte Masala-Mischung in einem heißen Topf an, goss Wasser darüber und ließ das Ganze aufkochen. Dann fügte er losen Schwarztee, Milch, Zucker und ein paar Ingwerscheiben hinzu. Nun musste der Chai nur noch ein paar Minuten sanft vor sich hin köcheln, dann konnte er ihn abseihen und genießen.
Laute, schwungvolle Musik zerriss plötzlich die friedliche Stille. Das Smartphone, das Surendra auf dem Tisch abgelegt hatte, spielte den alten indischen Filmsong »Choli Ke Peeche«, und das bedeutete, dass seine Mutter Zenobia Sinha ihn aus Indien anrief. Er hatte die legendäre Tanznummer, zu der einst die schöne Madhuri Dixit auf der Filmleinwand die Hüften geschwungen hatte, als Klingelton speziell für seine Mutter eingespeichert – damit er vorgewarnt war, wenn sie sich bei ihm meldete. Zwar war ihr jahrelang hingebungsvoll gepflegter Eifer, ihm eine (am besten von ihr selbst ausgesuchte) Ehefrau zu verpassen, inzwischen glücklicherweise etwas abgeflaut, aber aufgegeben hatte sie den Traum von einer guten Schwiegertochter und einem Stall voller Enkelkinder keineswegs, und bei jedem Telefonat musste er damit rechnen, dass dieses Thema unweigerlich mindestens einmal aufs Tapet kam.
»Namaste, maaji«, meldete er sich wohlerzogen.
»Namaste, mein Junge!« Man konnte Zenobia Sinhas freudestrahlendes Gesicht förmlich hören. »Ich muss doch unbedingt mal wieder hören, wie es dir geht da droben in diesen kalten, finsteren Bergen!«
Surendra segnete die Tatsache, dass maaji seine verdrehten Augen und sein amüsiertes Schmunzeln nicht sehen konnte. Sie war – abgesehen von einem Besuch auf der Burg Hohenzollern – nie auf der Schwäbischen Alb gewesen, aber irgendwo hatte sie einmal den Spruch gehört, dass dort »immer ein rauer Wind weht«. Und seitdem war sie offenbar der festen Überzeugung, dass es ihren einzigen Sprössling in eine unwirtliche Bergwelt verschlagen hatte, wo er nun unter harter Mühsal um sein Überleben kämpfen musste.
»Alles bestens, maaji«, versicherte er. »Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, und es geht mir nach wie vor sehr gut hier.«
»Wirklich?«
»Wirklich.«
»Du würdest es mir doch sagen, wenn etwas nicht in Ordnung wäre?« Es klang in seinen Ohren mehr misstrauisch als besorgt. »Du könntest jederzeit zu uns kommen, das weißt du.«
Natürlich wusste er das. Nach dem Tod seines Vaters Praveer Sinha hatte seine Mutter ihre Zelte in Deutschland abgebrochen, war zurück in den Punjab gezogen und lebte nun zusammen mit ihren Schwestern und deren Familien in einem großen Haus in Amritsar. Er war dort schon einige Male zu Besuch gewesen, zuletzt Ende des vergangenen Jahres anlässlich des Diwali-Festes, und er hatte sich stets ehrlich willkommen gefühlt. Aber auf Dauer dort zu leben konnte er sich nicht vorstellen. Sollte er irgendwann tatsächlich nach Indien übersiedeln, dann definitiv nur in ein eigenes Domizil und auch gar nicht zwangsläufig nach Amritsar.
Aktuell stand so etwas jedoch überhaupt nicht auf seiner Agenda. Und das musste er jetzt möglichst glaubhaft rüberbringen, damit maaji das Thema zumindest für diesmal freiwillig abhakte.
»Lieb von dir, maaji«, erwiderte er. »Aber du musst dir wirklich keine Gedanken machen. Ich habe hier eine hübsche kleine Wohnung, eine nette Vermieterin und meine Arbeit. Mir fehlt nichts.«
Dass die letzten drei Wörter ein böser Fehler waren, merkte er leider erst, als es bereits zu spät war.
»Das denkst du!«, trumpfte Zenobia Sinha auf und reicherte ihren Tonfall mit einer Überdosis indignierter Entrüstung an. »Natürlich fehlt dir etwas, du glaubst es mir nur noch immer nicht! Wenn du eine gute Ehefrau an deiner Seite hättest, wäre alles viel leichter für dich! Sie würde für dich sorgen, dich bekochen, dir Wärme geben – dann würde dir auch dieses schreckliche raue Albklima nichts mehr ausmachen! Gibt es denn wirklich keine nette Kollegin da in Reutlingen, oder was ist mit diesem Dorf, in dem du wohnst, dieses Goma … Goma …«
»Gomadingen«, half Surendra höflich aus.
»Ja, sag ich doch – was ist mit den Mädchen dort, sind die etwa alle schon vergeben?«
Es war mehr als verlockend, auf diese Frage einfach lakonisch mit »Ja« zu antworten. Aber da maaji ihm das sowieso nicht abgekauft hätte, verkniff Surendra sich diesen Scherz und stellte mit einem innerlichen Seufzer fest, dass er doch besser bei dem Thema Eventuelle Übersiedlung nach Indien geblieben wäre.
»Du kennst mich doch, maaji«, versuchte er es auf die friedfertige Art. »Ich sehe das nun mal anders als du, ich muss nicht unbedingt verheiratet sein. Sollte ich eines Tages die Richtige finden – okay, dann können wir gerne darüber reden, aber …«
»Aber wie willst du sie finden, wenn du gar nicht nach ihr suchst?«, schoss Zenobia Sinha herausfordernd dazwischen.
»Wer sagt dir, dass ich nicht suche?«, verteidigte sich Surendra lahm.
»Na hör mal!«, kam es prompt und überlegen von seiner Mutter. »Wenn du wirklich suchen würdest, dann hättest du bei meinen Vorschlägen nicht jedes Mal so ein Theater gemacht! So viele schöne Mädchen hab ich dir gezeigt, Raveena und Deepika haben auch immer wieder Fotos aus Indien geschickt – Raveena sammelt nach wie vor, ich hab einen ganzen Stapel hier herumliegen! Aber das wird wohl nichts mehr in diesem Leben. Du suchst nicht, du lässt dich auch nicht suchen, und ich werde niemals daadi werden! Isst du wenigstens ordentlich, beta?«
»Lieber Himmel!«, stieß Surendra hervor, unendlich dankbar für dieses Stichwort. »Ich hab noch immer meinen Chai auf dem Herd! Ich geh ihn schnell abseihen, maaji – aber red ruhig weiter, ich mach den Lautsprecher an und hör dir zu!«
Er hörte noch ein belehrendes »Siehst du, das Chaikochen würde deine Frau auch für dich erledigen …«, bevor er das Smartphone auf der Arbeitsplatte ablegte und dem Rest des mütterlichen Vortrags nur noch mit halbem Ohr lauschte, während er den duftenden Gewürztee betont langsam durch ein Sieb in eine Thermosflasche goss. Als er schließlich den Deckel zuschraubte, war Zenobia Sinha bei den Mahlzeiten angekommen, die er täglich unbedingt zu sich nehmen sollte, wenn er nicht noch dünner werden wollte als ohnehin schon. Er hielt sich für einen Moment das mahnende Gegenbeispiel vor Augen, nämlich Zenobia selbst, die so kugelrund wie klein war, und beschloss, ihre empfohlenen Tagesrationen um mindestens die Hälfte zu reduzieren.
»Alles klar, maaji«, sagte er, nachdem er das Smartphone wieder in die Hand genommen hatte. »Mach dir keine Sorgen, ich werde nicht verhungern, schließlich habe ich das Kochen bei dir gelernt. Und jetzt hören wir besser auf, sonst wird es zu teuer.«
»Kommst du bald mal wieder?«
»Sobald meine Arbeit mir Zeit dafür lässt.«
»Pass auf dich auf, beta. Und liebe Grüße von der ganzen Familie!«
»Danke, Gruß zurück. Namaste!«
Er seufzte erleichtert, als er das Gespräch endlich beenden konnte. Er liebte seine Mutter aufrichtig, aber ihre mütterliche Fürsorge war manchmal wirklich erdrückend. Er war zweiundvierzig, Himmel noch mal – für maaji würde er jedoch wohl immer der kleine Junge bleiben, den man umsorgen und vor allem verheiraten musste.
Aber offenbar hatten die Götter ihn nicht zum Ehemann geschaffen. Ein einziges Mal hatte er sich wirklich verliebt, fünf Jahre war das jetzt her – er hatte sich sogar bereits heimlich mit der schönen, liebenswerten Vidya verlobt, doch nur wenige Stunden später war sie brutal vergewaltigt und ermordet worden. Danach hatte er nur noch zwei weitere Versuche gewagt. Die eine Beziehung endete, weil er sich mit seiner Partnerin schlichtweg auseinandergelebt hatte, und die andere, weil die lebenslustige junge Frau sich als Serienmörderin entpuppte, die um ein Haar auch ihn ins Jenseits befördert hätte.
Nein, mit den Frauen hatte er kein Glück. Und wenn er ehrlich war: mit seiner Arbeit derzeit auch nicht wirklich. Zwar hatte er sich mit Leonies Vorschlag, auf Privatermittler umzusatteln, nach anfänglichem Zögern angefreundet, und da sie einen Familienanwalt namens Justus Michaelis in Bad Urach kannte, der gerade auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter war, schien ein entsprechender Job sogar in Reichweite zu sein. Doch als er sich bei besagtem Anwalt meldete, musste er erfahren, dass die Stelle wenige Tage zuvor vergeben worden war. Tut mir sehr leid, hatte Justus Michaelis am Telefon gesagt, grüßen Sie bitte Leonie, ja? – Selbstverständlich, hatte Surendra gemurmelt und bitter enttäuscht aufgelegt.
Zum Glück war er finanziell unabhängig. Seine Mutter hatte vor ihrer Rückkehr nach Indien ihr Haus in Waiblingen-Neustadt auf ihn überschrieben, und da er nicht vorhatte, dort einzuziehen, hatte er es kurzerhand für gutes Geld verkauft. Für sehr gutes Geld, um exakt zu sein. Selbst wenn er noch jahrelang arbeitslos bleiben sollte, würde er sich zumindest wegen der Miete und dem täglichen Brot keine Sorgen zu machen brauchen.
Also hatte er seinen neuen Lebensabschnitt auf der Alb erst mal ohne Job begonnen und den ganzen Herbst genutzt, um seine neue Heimat zu erkunden und immer besser kennenzulernen. Weihnachten hatte er bei Frank Hasemann in Hechingen verbracht. Und dann hatte ihn kurz nach dem Jahreswechsel ein Anruf von der Kripo Reutlingen erreicht: Kriminalhauptkommissarin Dorothea Kaiser, genannt die »Kaiserin«, mit der er während seiner Undercover-Mission in Hayingen sehr gut zusammengearbeitet hatte, berichtete – und Surendra hätte schwören können, dass sie dabei unverhohlen vor sich hin grinste –, dass ihr Kollege Kriminaloberkommissar Jakob Kratz (den sie beide nicht ohne Grund »die Kratzbürste« nannten) sich im Skiurlaub über Silvester eine Knieverletzung und einen komplizierten Trümmerbruch im rechten Bein zugezogen hatte und voraussichtlich ein halbes Jahr lang ausfallen würde. Konnte Surendra sich vorstellen, für ihn einzuspringen, bis der Mann wieder einsatzfähig war?