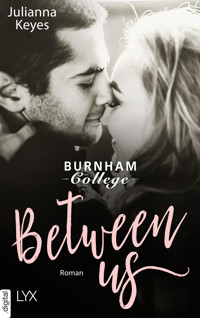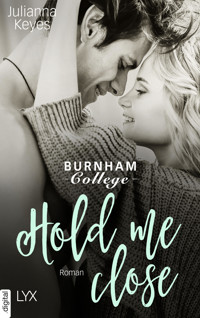
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Burnham Reihe
- Sprache: Deutsch
"Vermutlich habe ich immer gewusst, dass ich das einzige Mädchen, für das ich je so empfinden würde, schon längst kennengelernt hatte."
Kellan McVey ist der bekannteste Sportler und Frauenheld am Burnham College. Obwohl er sich vor weiblichen Bewunderinnen kaum retten kann, ist es noch keiner gelungen, ihn für mehr als ein paar Nächte zu interessieren. Seine letzte längere Beziehung hatte er mit Andrea Walsh. Andi, die viele Jahre lang seine beste Freundin war, und dann einen Sommer lang so viel mehr. Andi, die ihm das Herz gebrochen hat und Andi, die auf einmal auch Studentin am Burnham College ist.
Während die beiden sich ständig zu begegnen scheinen, fallen Kellan all die Gründe wieder ein, weshalb er sauer auf Andi ist - aber auch die Gründe, weshalb er sich in sie verliebt hat ...
"Hold me Close hat mir so viel Lesevergnügen bereitet. Ich konnte nicht genug davon kriegen." BookCatPin
Band 2 der Burnham-College-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmung12345678910111213141516171819Danksagung Die AutorinDie Romane von Julianna Keyes bei LYXLeseprobeImpressumJULIANNA KEYES
Hold me close
Roman
Ins Deutsche übertragen von Michael Krug
Zu diesem Buch
»Vermutlich habe ich immer gewusst, dass ich das einzige Mädchen, für das ich je so empfinden würde, schon längst kennengelernt hatte.«
Kellan McVey ist der bekannteste Sportler und Frauenheld am Burnham College. Obwohl er sich vor weiblichen Bewunderinnen kaum retten kann, ist es noch keiner gelungen, ihn für mehr als ein paar Nächte zu interessieren. Seine letzte längere Beziehung hatte er mit Andrea Walsh. Andi, die viele Jahre lang seine beste Freundin war, und dann einen Sommer lang so viel mehr. Andi, die ihm das Herz gebrochen hat und Andi, die auf einmal auch Studentin am Burnham College ist. Während die beiden sich ständig zu begegnen scheinen, fallen Kellan all die Gründe wieder ein, weshalb er sauer auf Andi ist – aber auch die Gründe, weshalb er sich in sie verliebt hat …
Between us war mein erster – sehr nervöser – Vorstoß ins Selbstverlegertum, und ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich erwarten sollte. Es war mein fünftes Buch und erwies sich als mein erfolgreichstes, das überwältigend wundervolle und ermutigende Reaktionen und Rückmeldungen erhielt. E-Mails, Tweets, Rezensionen, Mitteilungen … jedes kleine bisschen war inspirierend und motivierend, wie ich es vorher nie wirklich erlebt hatte.
Als ich mit Hold me close anfing, entschied ich mich, ein Protokoll zu führen, das ich #WednesdayWIPReport nannte, um über meine Fortschritte beim Schreiben zu informieren und auch, um auf Linie zu bleiben. Falls ihr es mitverfolgt habt (es wurde zuerst auf Facebook gepostet und ist jetzt auf meiner Website), wisst ihr, dass dieses Buch nicht einfach gewesen ist, aber das Festhalten meiner Sünden und Erfolge beim Schreiben hat mich weiterrackern lassen. Wann immer mich das Gefühl beschleichen wollte, es wäre vergebliche Liebesmüh, haben mich eure Kommentare und eure Unterstützung davon überzeugt, dass dem nicht so ist. Jedes Mal, wenn ich besonders davon überzeugt war, dieses Buch würde nie fertig werden, habe ich eine Nachricht erhalten, die mir nicht nur gezeigt hat, dass ich es beenden sollte, sondern auch, dass es danach tatsächlich jemand lesen will. Und das ist das Freundlichste, was man einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller sagen kann.
Scheint perfekt zu passen, dass ein Buch, in dem es darum geht, wie wichtig es ist, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen (nachdem man sich über sie klar geworden ist), von euch angeschoben wurde, indem ihr mir eure Gefühle der Liebe und Unterstützung mitgeteilt habt. Dieses Buch ist in so vieler Hinsicht meine Antwort darauf, ein acht Monate umfassendes Dankeschön an meine Leserinnen und Leser, Blogger, Freunde und Familie, also an alle, durch die sich das Schreiben noch lohnender anfühlt.
Dieses Buch ist euch gewidmet. Danke für eure Worte.
1
Ich hasse Andrea Walsh und werd’s immer tun. AUF EWIG!!!
Ich fahre mit dem Daumen über die Buchstaben, die in die Tür der Herrentoilette im Freibad von Avilla geritzt sind. Ich habe sie vor Jahren in einem jugendlichen Wutanfall ins Holz geschnitzt, nachdem Andi in der Spielhalle meinen Rekord bei Donkey Kong gebrochen und als Benutzernamen AndiWRegiertKellIstEinLoser eingegeben hatte. Wahrscheinlich habe ich um die hundert Dollar in Vierteldollarmünzen beim Versuch vergeudet, den Thron zurückzuerobern, und bin nie auch nur nah dran gewesen.
Nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, wage ich mich zurück in die sengende Wüstenhitze und nähere mich der Imbissbude. Mitte August herrscht in Südkalifornien eine drückende Schwüle, und die Hälfte der spärlichen Bevölkerung von Avilla hat sich ins einzige Freibad gepfercht, sucht verzweifelt nach Abkühlung. Ich warte in der Schlange. Durch die Sonnenbrille beobachte ich, wie Andi in der Nähe der Bademeisterstation auf der anderen Seite des Pools auf und ab läuft. Sie wirkt wie eine grimmige Wächterin und scheint die Horde der nachmittäglichen Badegäste warnen zu wollen: Es soll bloß niemand wagen, unter ihrer Aufsicht zu ertrinken.
Ich bleibe unter der Markise der Imbissbude stehen und betrachte das begrenzte Angebot an Limos, Tafelwasser und Eiscreme. Nach den früheren Flirtversuchen von Madison, der Kassiererin, zu urteilen, ist auch sie im Angebot.
»Hi, Kellan.«
»Hey, Madison. Noch ein Wasser, bitte.«
Sie fischt eine Flasche aus der Kühltruhe und reicht sie mir mit einer unnötigen Serviette. Schon vorher hat sie mir eine Serviette gegeben, auf die sie in runden Buchstaben ihren Namen über ihre Telefonnummer geschrieben hat. Madison ist süß, achtzehn und gelangweilt. Vor drei Jahren ist es mir genauso gegangen, und während ich ihre nicht allzu subtile Einladung noch letzten Sommer angenommen hätte, lächle ich heute nur höflich.
»Danke.« Ich bezahle und werfe mein Wechselgeld in den kleinen Plastikbecher für Trinkgeld.
»Danke dir.«
Ich kehre zum Schwimmbecken zurück, sammle meine Sachen ein, schlüpfe in ein T-Shirt und setze meine Baseballmütze auf, bevor ich nachsehe, wie spät es ist. Zwei Minuten vor fünf. Laut dem am Zaun befestigten Zeitplan sollten die Bademeister jetzt Schichtwechsel haben, also sollte Andi eigentlich gleich zusammenpacken.
Ich beobachte, wie sie sich hinhockt und einem weinenden Kind ein Pflaster auf einen Finger klebt. Ihre Augen sind hinter einer dunklen Sonnenbrille verborgen, das lange blonde Haar hat sie zu demselben nachlässigen Dutt zusammengebunden, den sie schon damals in der Junior High trug. Die Standarduniform des Aufsichtspersonals im Freibad – roter Badeanzug, weiße Shorts und Flipflops – zeigt deutlich, dass Andi so groß und schlank wie immer ist.
Nachdem sie das Kind verarztet hat, schickt sie es seiner Wege, und als sie sich aufrichtet, sichtet sie mich endlich in der Menschenmenge. Ich bin seit einer halben Stunde hier und frage mich, ob sie Notiz von mir nehmen oder weiterhin so tun wird, als wäre ich gestorben. Ihr Mund erstarrt zu einem überraschten O, ihre dunklen Augenbrauen sind hochgezogen. Langsam hebe ich eine Hand zum Gruß. Es ist zwei Jahre her, seit wir zuletzt ein Wort gewechselt haben, doch bevor ich herausfinden kann, ob sich das heute ändern wird, tritt ein weiteres Kind an sie heran, und sie wendet sich ab.
Ich rede mir ein, dass ich nicht enttäuscht bin, dass es nichts zu bedeuten hat. Andi und ich sind beste Freunde und Todfeinde gewesen, seit wir uns in der Vorschule kennengelernt haben. Und wenngleich ich mir vorgemacht habe, ich hätte kein Problem damit, wie frostig wir auseinandergegangen sind, lässt der Umstand, dass ich noch keine vierundzwanzig Stunden in Avilla bin und schon nach ihr suche, auf etwas anderes schließen. Zumindest darauf, dass die zwei Jahre, in denen ich mir einreden wollte, es ginge mir gut, vergebliche Liebesmüh waren.
Ich nehme meinen Kram und trete den Weg zum Parkplatz an. Der Asphalt ist so heiß, dass ich es sogar durch die Schuhsohlen spüre. Am Fahrradständer bleibe ich stehen, trinke mein Wasser und frage mich, ob Andi immer noch so viel mit dem Rad fährt wie früher. Sie war das einzige Mädchen in unserer Gruppe schmuddeliger, waghalsiger Jungs. Mit den Fahrrädern waren wir die Herrscher unserer Straße, und obwohl wir unzählige Male versucht haben, sie abzuschütteln, hat sie immer mitgehalten. Letztlich haben wir es aufgegeben, und sie wurde eine von uns. Dann wurden wir zu alt für die Fahrräder, widmeten uns Sport und dummen Mutproben, und immer war Andi dabei, stur, kämpferisch, unerbittlich. Meine unmittelbare Nachbarin und beste Freundin. Und dann, in jenem letzten Sommer … mehr als das.
Das Klatschen von Flipflops auf Asphalt unterbricht eine Erinnerung, die ich mir nicht leisten kann, noch einmal zu durchleben. Und als ich mich umdrehe, sehe ich, wie sich Andi nähert. Sie trägt jetzt ein blaues Tanktop über dem Badeanzug und eine Segeltuchtasche über der Schulter. Die Augen liegen immer noch hinter der Sonnenbrille verborgen. Andi wirkt zwar nicht begeistert, sie sieht aber auch nicht so aus, als würde sie mich schlagen wollen. Was ich als Fortschritt betrachte.
Sie bleibt bei einem Fahrrad am Ende der Reihe stehen, nah genug, dass mir ein Hauch von Sonnencreme und Chlor in die Nase steigt.
»Hi«, grüße ich.
»Hi«, gibt sie zurück, während sie am Schloss hantiert. »Wusste gar nicht, dass du zu Hause bist.«
»Bin erst gestern Nacht angekommen.«
»Für wie lange?«
»Nur ein paar Tage.«
Ich bin nach dem Abschluss an der Highschool mit einem Crosslauf-Stipendium ans Burnham College gegangen, eine der ältesten Schulen des Landes, und ich bin seit mittlerweile zwei Jahren dort. Ohne Stipendium für das hohe Schulgeld konnte Andi nicht mit, ganz gleich, wie sehr sie es wollte und wie sehr sie es verdient gehabt hätte. Statt sich an einem örtlichen College einzuschreiben, hat sie sich dafür entschieden, zwei Jobs anzunehmen und Geld für die Schule ihrer Wahl zu sparen. Sie spart noch immer.
»Tja, dann willkommen zurück«, meint sie schließlich. Sie legt die Hand auf den schwarzen Ledersattel des Fahrrads und zuckt zurück, weil er so heiß ist; dann willigt sie wortlos ein, mit mir zu Fuß zu gehen und ihr Fahrrad zu schieben. Avilla ist eine ruhige Wüstenortschaft. Die Häuser halten sich alle an ein erkennbares Muster aus Weiß, Blau und Gelb mit Tonziegeldächern und Xeriscape-Gärten, die wenig Wasser brauchen. Bei dieser Hitze haben sich alle Bewohner, die nicht am Pool sind, drinnen verschanzt, wo die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen.
»Wie stehen die Dinge?«, erkundige ich mich einen Häuserblock später.
»Gut.«
Ich beobachte sie aus dem Augenwinkel. Als Teenager hat Andi jede Sportart ausgeübt, in die sie reinkommen konnte, und sie war in allem, was sie ausprobiert hat, hervorragend. Sie ist durch und durch ein Wildfang – kein Make-up, keine Kleider, kein Firlefanz. Sommersprossen sprenkeln ihre Wangenknochen, doch davon abgesehen finden sich weder Schminke noch irgendwelche Makel auf ihrer Haut. Ihre dichten Brauen lassen sie entweder nachdenklich oder mörderisch aussehen, je nach Stimmung.
»Hör auf mich anzustarren«, brummelt sie, wischt sich eine verirrte Strähne aus dem Gesicht und klemmt sie hinters Ohr.
»Tu ich gar nicht«, lüge ich.
Sie will gerade antworten, als ich im Gras etwas sichte und mich bücke, um es aufzuheben. »Nicht schlecht. Zwanzig Mäuse.«
Ich muss Andi nicht ansehen, um zu wissen, dass sie die Augen verdreht. Sie hat mir schon immer vorgeworfen, nie für irgendetwas arbeiten zu müssen, und das ist nicht ganz falsch. Obwohl es in letzter Zeit auch nicht mehr ganz richtig ist.
»Komm mit«, fordere ich sie auf. Dass sie bis jetzt noch nicht davongerannt ist, betrachte ich als gutes Zeichen. »Ich lad dich zum Essen ein. Magst du immer noch Chili-Fritten?«
Es folgt ein kurzes Zögern, als sie überlegt, mir eine Abfuhr zu erteilen, und ich ignoriere, wie sehr mich das trifft. Wir sind vielleicht nicht im Guten auseinandergegangen – obwohl ich keine Ahnung habe, was ich falsch gemacht haben könnte. Aber vor dieser schmerzlichen Trennung waren wir Sommer-Sex-Freunde. Schon klar, nicht die coolste Bezeichnung, nur hat sich Andi geweigert, es mit mir zu tun, wenn ich uns Lover nenne. Was mir, um ehrlich zu sein, ohnehin nicht gelungen wäre, ohne eine Miene zu verziehen.
»Kriegst auch ein Getränk«, füge ich hinzu, als ich sehe, wie sich eine Schweißperle den Weg über ihre Schläfe bahnt. »Ich hab die Spendierhosen an.«
Ihre Mundwinkel verziehen sich leicht nach oben, und mich durchströmt etwas, das sich verdächtig nach Erleichterung anfühlt. »Na schön«, willigt sie ein. »Wenn auch ein Getränk drin ist.«
»Ein kleines Glas Wasser«, bestätige ich.
Jetzt lacht sie. Ihr Lächeln ist breit genug, um den Zahn zu entblößen, den sie sich angeschlagen hat, als sie elf war. Avilla hatte nicht genug Spielerinnen für ein Mädchenteam, deshalb hat Andi Baseball bei den Jungs mitgespielt. Sie war als Centerfielder ein Star, und an jenem Tag hat sie den Ball wegen der Sonne aus den Augen verloren und geradewegs in den Mund bekommen. Der Zahn war ihr völlig egal, sie hat sich nur geärgert, dass ihr ein Fehler passiert war, der erste und einzige der Saison.
Gerade laufen wir an jenem Baseballfeld vorbei. Auf der anderen Straßenseite befindet sich die Grundschule, deren Spielplatz in der Sonne schimmert. Dort haben wir uns am ersten Vorschultag kennengelernt. Ich kam gerade die Rutsche runter, sie war schon unten und trug das gleiche Superhelden-T-Shirt wie ich. Wenn man fünf Jahre alt ist und einen die Freunde dabei erwischen, dass man das Gleiche trägt wie ein Mädchen, dann merkt man sich das. Und zieht das T-Shirt nie wieder an.
Wir biegen in Avillas Haupteinkaufsstraße ein und steuern auf einen Laden zu, der aus wenig mehr als einem verbeulten, silbernen Wohnwagenanhänger mit abmontierten Rädern besteht. Franks Frittenbude ist ein beliebter Treffpunkt. Auf der Hälfte des Parkplatzes stehen alte, mit blauen Plastikplanen bedeckte Picknicktische, die ganzjährig mit Weihnachtslichterketten beleuchtet werden. Im Augenblick trotzen nur wenige Menschen der Hitze. Andi sucht sich einen Tisch in der Ecke aus, während ich unsere Bestellung aufgebe.
Ich nehme ihr gegenüber Platz. Die raue Textur der Holzbank presst sich gegen die Rückseiten meiner Oberschenkel. Andi hängt ihre Tasche an den Lenker ihres Fahrrads und schiebt sich die Sonnenbrille auf den Kopf hoch. Endlich kann ich ihr Gesicht ganz sehen. Dieselben ernsten, braunen Augen, dieselbe kantige Kieferpartie und dieselben vollen Lippen, von denen ich mir eingeredet habe, es würde mich nicht jucken, ob ich sie je wiedersehe.
Weil wir als Nachbarn aufgewachsen sind, habe ich Andi tagtäglich getroffen, und sie war immer einfach nur Andi für mich. Ich habe nie wirklich überlegt, ob sie hübsch ist oder nicht – nicht mal, als die Jungs in unserer Gruppe angefangen haben, darüber zu diskutieren. Nicht mal, als ich sie gebeten habe, mit mir Sex zu haben, damit ich nicht als Jungfrau ans College muss. Nicht mal, als sie eingewilligt hat.
Ich war in jungen Jahren immer beliebt, aber mit dem Laufen habe ich erst in der zehnten Klasse ernsthaft begonnen. Dadurch verschwand der letzte Babyspeck, das Sixpack kam hervor, und die Mädchen fingen an, es zu bemerken. Ich hatte Dates, aber dabei wurde nur unbeholfen rumgefummelt – schlabberige Küsse in der hintersten Reihe von Avillas einzigem Kino, ein bisschen Grapschen auf den Vordersitzen eines geliehenen Autos. Nur dank der Übungszeit mit Andi konnte ich mein altes Ich hinter mir lassen, als ich am Burnham College ankam, und wurde zu dem Typ, der ich sein sollte, dachte ich jedenfalls – populär, sorglos, immer für Spaß zu haben. Und ich hatte eine Menge Spaß. Vielleicht zu oft.
Als könnte Andi meine Gedanken lesen, fragt sie: »Wie ist das Leben in Oregon?«
»Gut«, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Vor jenem Sex-Sommer hätte ich ihr die Wahrheit gesagt. Jetzt nicht mehr.
Ich lehne mich zurück, als Frank mit zwei Körbchen voll Chili-Fritten und eiskalten Limo-Dosen an unseren Tisch kommt.
»Oh, tut mir leid«, sage ich und greife mir Andis Dose. »Das sollte ein kleines Wasser sein.«
Andi lacht und schnappt sich die Dose aus meiner Hand. »Beachte ihn gar nicht«, meint sie zu Frank und reißt die Dose auf. »So mache ich es.«
Frank versteht die Anspielung nicht. Er lässt uns ein paar Servietten da und kehrt zum Anhänger zurück. Ich muss an Madisons Servietten in meiner Tasche denken und fühle mich schuldig. Eingesteckt habe ich sie nur, weil sie nicht sehen sollte, wie ich sie wegwerfe – nicht, weil ich vorhabe, sie anzurufen. Trotzdem fühlt es sich jetzt falsch an.
»Gern geschehen«, sage ich, als Andi trinkt.
Sie grinst und wischt sich mit dem Handgelenk den Mund ab. »Oh, vielen herzlichen Dank, Kellan.«
»Jederzeit wieder.« Ich esse eine Fritte. »Oder eigentlich: nur dieses eine Mal. Du hast echt keine guten Manieren.«
Sie rülpst ungeniert. »Habe ich nicht?«
Mir fällt kein einziges Mädchen am Burnham College ein, das je vor mir gerülpst hat. »Könntest dich ruhig entschuldigen.«
Ihr Mundwinkel zuckt. »Wo bist du den ganzen Sommer gewesen?«
»Washington. Hab dort zusammen mit einem Kumpel und seiner Freundin geholfen, Häuser zu bauen.«
»Klingt nach Spaß.«
Ich zögere. »So hat es für mich auch geklungen.«
»Und war’s das nicht?« Sie faltet eine extralange Fritte in der Mitte und steckt sie sich in den Mund.
»Na ja, Häuser zu bauen ist offensichtlich was Gutes. Man hilft anderen, ist selbstlos, blablabla.«
»Du bist ein wahrer Menschenfreund.«
»Ich weiß. Aber im Ernst: Crosbie klebt dermaßen an seiner Freundin, dass es sich anfühlt, als würd’s mich überhaupt nicht geben. Versteh mich nicht falsch – ich freu mich ja für ihn. Aber wir sind zu jung für so was Ernstes.«
Etwas blitzt in Andis Augen auf und verschwindet genauso schnell wieder. Ich tue so, als würde ich es nicht bemerken, aber ich kann mir nicht selbst etwas vormachen. Alle im Ort wissen, dass Andi in mich verliebt gewesen ist, solange wir zurückdenken können, und ich bin der Einzige, der vorgibt, keine Ahnung davon zu haben. Wie meine drei älteren Brüder wollte ich immer nur weg von hier, und sich in irgendjemanden zu verlieben – in Andi – würde das unheimlich erschweren. Vielleicht sogar unmöglich machen. Als ich an jenem ersten Tag von der Vorschule nach Hause kam, das peinliche T-Shirt im Rucksack versteckt, meinten meine Brüder, die Mädchen würden mir schon jetzt die Kleider vom Leib reißen. Und mein Dad hat mich davor gewarnt, mich zu verlieben. Seinen Rat habe ich immer beherzigt. Irgendwann möchte ich mich schon auf jemanden einlassen, aber nicht gerade jetzt.
»Apropos Liebe«, bastle ich eine ungeschickte Überleitung. »Wie geht’s deinem Freund?« Letzten Sommer war ich für eine Woche zu Hause und habe Andi mehrmals mit irgendeinem Kerl im Ort gesehen. Sie hat natürlich so getan, als würde sie mich nicht bemerken, und ich hab so getan, als würde es mir nichts ausmachen.
»Ich habe keinen Freund.«
»Ich hab dich letztes Jahr mit jemandem gesehen. Er hatte Khakihosen an. Jedes Mal.«
Ihr Mund zuckt. »Oh. Todd. Wir haben uns getrennt.«
»Wann?«
»Vor einem Monat.«
»Warum?«
»Weil mir mein Herz verraten hat, dass du zurückkommen würdest, Kellan. Und da bist du auch schon. Meine Träume sind wahr geworden.« Bisher sind wir mit ihren Gefühlen immer ausschließlich auf diese Weise umgegangen – als wären sie ein Witz. So ist es einfacher, auch wenn es die einzige Lüge ist, die es je zwischen uns gegeben hat.
»Tja, eindeutig.«
Sie zuckt mit einer Schulter. »Es hat nicht funktioniert. Er hat viel Khaki getragen, und ich …« Mitten im Satz verstummt sie und starrt über meine Schulter hinweg etwas an. Ich begehe den Fehler, mich umzudrehen: Madison und eine Freundin nähern sich. Sie tragen winzige Bikinis unter Netz-Tanktops und Jeansshorts, so kurz, dass man sie kaum als vorhanden bezeichnen kann. Wenn ich zurück in Burnham bin, werde ich wieder begeistert sein, junge Frauen wie sie zu sehen. Aber heute will ich nur mit Andi reden.
»Hi, Kellan«, grüßt mich Madison und lässt sich rittlings neben mir nieder, während sich ihre Freundin ans andere Ende der Bank kauert.
»Oh, hi«, gebe ich zurück und überlege bereits, wie ich sie höflich abschütteln kann.
Mir gegenüber am Tisch isst Andi ihre letzte Fritte, trinkt die Limo aus und steht auf. »Ich muss zur Arbeit«, verkündet sie, wirft sich die Tasche über die Schulter und steigt aufs Fahrrad. »Wir sehen uns.«
»Du musst doch nicht …«
»Doch«, fällt sie mir ins Wort. »Muss ich. Viel Spaß.«
Ich will ihr sagen, dass es schön war, sie zu sehen, aber sie ist schon weg.
* * *
Das Haus meiner Eltern ist eines der schönsten in einer sehr gepflegten Straße. Zweigeschossig, blaue Verkleidung und Tonziegel. Die ums Überleben kämpfenden Rosenbüsche meiner Mutter säumen die Eingangsstufen. Als ich in die Einfahrt einbiege, sehe ich meinen Dad auf der Veranda sitzen. Ich fühle mich ausgelaugt von der Hitze und von der Anstrengung, die überaus hartnäckige Madison abzuwimmeln. Eine dritte Serviette hat sich zu den ersten zwei in meiner Tasche gesellt. Ich habe trotzdem nicht vor, sie anzurufen. Wegen eines bedauerlichen Zwischenfalls vergangenen Herbst habe ich eine mentale Blockade, wenn es um Sex geht. Deshalb hatte ich seit acht Monaten und vier Tagen keinen mehr.
Neben den Füßen meines Vaters steht ein mit Wasser gefüllter Metalleimer, in dem zwei Bierdosen treiben. Ich fische mir die drei verbliebenen Reste von Eiswürfeln aus dem Eimer und stecke sie mir in den Mund, bevor ich mich ihm gegenüber auf einen freien Stuhl plumpsen lasse. Meine älteren Brüder kommen mit ihren blonden Haaren und braunen Augen nach meiner Mutter, aber ich habe das lockige, dunkle Haar, die blauen Augen und die Grübchen meines Vaters abgekriegt.
»Wie war’s im Schwimmbad?«, erkundigt er sich und klappt seinen Laptop zu. Er klappt immer seinen Laptop zu, wenn sich jemand zu ihm gesellt, während er zu schreiben versucht. Seit er Du bist dumm, und weißt du auch, warum? veröffentlicht hat, einen Ratgeber für, nun ja, Idioten, reißen die Forderungen nach einem Folgebuch nicht ab. Nur hat er es bis heute noch nicht fertiggeschrieben. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Das Teil ist in neunzehn Sprachen und siebenundzwanzig Ländern erschienen und hatte bislang sechs Auflagen. Im örtlichen Buchladen steht es immer noch an prominenter Stelle in der Auslage, und mein Dad achtet stets darauf, dass dort signierte Exemplare vorrätig sind.
»Viel los«, antworte ich mit dem Mund voller Eis. »Heiß.«
»Wie geht’s Andrea?« Er nennt sie immer beim vollen Namen, den er An-dre-ia ausspricht, womit wir sie immer aufgezogen haben, als hätte sie sich selbst einen ausgefallenen Namen ausgesucht.
»Gut.«
»Hast du mit ihr geredet?«
Meine Eltern wissen nicht, was zwischen Andi und mir in jenem Sommer gelaufen ist, nur, dass Andi an dem Tag, an dem ich abgereist bin, nicht gekommen ist, um sich zu verabschieden. Das war ein mächtiger, herzzerreißender Wink mit dem Zaunpfahl und zugleich der ultimative Schlag ins Gesicht. »Sie konnte der Verlockung von Chili-Fritten nicht widerstehen.«
»Tja, wer könnte das schon?«
Inzwischen ist das Eis geschmolzen, und ich wische mir Schweiß von der Schläfe. »Ist Ma drinnen?«
»Ja«, antwortet mein Vater und klappt den Laptop wieder auf.
Ich kicke die Schuhe von den Füßen, gehe rein und seufze selig über die kühle, klimatisierte Luft. »Ma?«
»Küche!«, ruft sie.
Ich finde sie an der Arbeitsfläche vor, wo sie auf eine Packung mit ganzen Shrimps samt Köpfen starrt, als hätte sie den Kadaver eines Aliens vor sich. Sie putzt sich jeden Tag heraus, auch ohne besonderen Anlass. Heute trägt sie ein grünes Sommerkleid und die blonden Haare in einem französischen Zopf. Ich wurde acht Jahre nach meinem nächstälteren Bruder geboren. Wenn meine Mutter also bei irgendetwas im Haus Hilfe wollte, haben die anderen sich jedes Mal aus dem Staub gemacht, und es blieb an mir hängen. Damals habe ich mich bitterlich darüber beschwert, dass ich kochen, putzen und meiner Mutter beim Auftragen von Make-up helfen musste. Allerdings haben sich diese Fähigkeiten als durchaus praktisch erwiesen. Na ja, zumindest manche davon. »Ich hab deinen Vater gebeten, Shrimps zu besorgen«, sagt sie und knabbert an einem manikürten Fingernagel. »Und damit ist er nach Hause gekommen.«
»Das sind Shrimps.«
»Das sind acht kleine Meeresungeheuer.«
»Lass mich das Rezept sehen.«
Sie schiebt mir einen aus dem Internet ausgedruckten Zettel zu, den ich rasch überfliege. Gegrillte Shrimps mit einem Salat als Beilage.
»Also, den Salat kann ich machen …«, meint sie und verstummt, als sie die Krabben beäugt. »Aber die Dinger haben Köpfe. Und Augen. Und Füße. Und … sind das Haare?«
Ich stupse sie beiseite. »Weißt du was? Ich kümmere mich um die Shrimps, du übernimmst den Salat.«
Ich greife gerade nach einem Geschirrtuch, als mein Handy in der Tasche summt und eine neue Nachricht ankündigt. Ich ziehe das Smartphone heraus, wische über das Display und verziehe das Gesicht, als ich das Bild einer Handfläche erblicke, aus der ein Nagel hervorragt. Es folgt eine weitere Nachricht. Helfende Hand, steht da, begleitet von einem Kackhaufen-Emoji. Von Crosbie, meinem besten Freund.
Grinsend schreibe ich zurück: Ist das eine Illusion?
Crosbie steht auf Zauberei, und ich versuche, ihn bei diesem Hobby moralisch zu unterstützen, so wie er das auch bei mir getan hat. Was letzten Herbst passiert ist, bezeichne ich als den »Zwischenfall«, aber in Wahrheit hatte ich Tripper. Das war die erschreckendste und demütigendste Diagnose meines Lebens. Es gab buchstäblich eine Sexliste von Frauen, die ich durchgehen musste, um die infizierte Partnerin ausfindig zu machen, und Crosbie hat mir die ganze Zeit dabei geholfen. Ein Medikament und eine ausgedehnte Enthaltsamkeitsphase haben die Symptome beseitigt, aber die Auswirkungen klingen immer noch nach. Ich habe mir eine Vertuschungsgeschichte einfallen lassen und mir Zeit genommen, um mir über einiges klar zu werden. Anfangs dachte ich, sobald es mir besser ginge, würde ich zu meinem wilden Partyleben zurückkehren. Aber irgendetwas hat sich verändert. Ich habe versucht, mich auf flüchtige Affären einzulassen, habe versucht, es zu genießen. Konnte ich aber nicht. Seither täusche ich es nur noch vor.
»Kell?« Die Stimme meiner Mutter unterbricht meinen selbstmitleidigen Gedankengang.
»Entschuldige. Hast du was gesagt?«
»Ich habe dich bloß gefragt, ob du die Shrimps dann auch mal putzt oder lieber noch ein bisschen streicheln willst.«
Ich schaue nach unten und stelle fest, dass ich skurrilerweise tatsächlich einen Shrimp streichle. »Äh … ich putze sie.«
»Ja, wenn du so freundlich wärst. Und um das gleich klarzustellen, der da gehört dir. Leg ihn dir beiseite.«
* * *
Am Donnerstagabend bin ich in meinem Zimmer und sehe mir gerade ein Baseballspiel an, als in Andis Zimmer nebenan das Licht angeht. Es ist kurz nach neun, und meine Mannschaft, die Giants, liegen im sechsten Inning sieben Punkte zurück. Ich schalte den Fernseher stumm und trage mir auf, langsam bis fünfzig zu zählen, damit es nicht so wirkt, als hätte ich auf sie gewartet. Erst dann beuge ich mich aus dem Fenster. In unserer Straße stehen die Häuser jeweils nur ungefähr einen Meter auseinander, was wir als Teenager schrecklich und zugleich herrlich gefunden haben.
»Andi«, flüstere ich, als wären wir noch zwölf und in Gefahr, Hausarrest zu bekommen, weil wir plaudern, statt zu schlafen.
Ihre Vorhänge sind zugezogen, aber dahinter erkenne ich einen undeutlichen Schemen, der sich nähert. Gleich darauf erscheint Andi. Sie trägt noch die dunkle Hose und die Bluse von ihrem Job im Restaurant. »Hi«, grüßt sie mich und knöpft die Bluse auf. Darunter kommt ein schlichtes weißes Tanktop zum Vorschein. Die Bluse fällt zu Boden, und Andi greift nach oben, zieht Klammern aus dem Haar, das sie in einem ordentlichen Dutt am Hinterkopf fixiert hat. Erinnert mich an die Fototage in der Schule. Damals musste sie ihrer Mutter jedes Mal versprechen, die Haare zumindest so lange ordentlich zu lassen, bis die Aufnahme im Kasten war, danach durfte sie sie wieder zerzausen, so sehr sie wollte.
»Die Giants verlieren gerade«, sage ich, weil ich weiß, dass sie sich darüber freuen wird.
»Die Giants sind scheiße«, teilt sie mir mit.
Ihr Haar ergießt sich über ihre Schultern. Der Anblick verursacht einen vorübergehenden Kurzschluss in meinem Hirn und lässt mich meinen genialen Konter vergessen: »Ne, du bist scheiße.«
Andi ist eingefleischter Fan der Oakland Athletics. Das Letzte, was wir zusammen gemacht haben, bevor sie aufgehört hat, mit mir zu reden, war der Besuch eines Spiels in San Francisco, die Giants gegen die Athletics. Wir konnten mit der älteren Schwester eines Freundes mitfahren und hatten zu dritt eine tolle Zeit. Zumindest dachte ich das. Die Giants haben vier zu zwei gewonnen, aber während wir uns bei der Hinfahrt im Seitenspiegel immer wieder verstohlene, sehnsüchtige Blicke zugeworfen haben, hat Andi auf der Heimfahrt mit versteinerter Miene auf dem Rücksitz gesessen und kein Wort von sich gegeben. Damals wusste ich es noch nicht, aber es sollte zwei Jahre dauern, bis sie wieder mit mir redete, und ich brachte nie den Mumm auf, sie zu fragen, warum. Ich floh lieber nach Burnham, statt mich hier mit meinen Problemen auseinanderzusetzen.
»Geh noch nicht schlafen«, sage ich, als sie gähnt.
Sie wischt sich über die Augen. »Warum nicht? Ich bin müde.«
»Weil ich morgen abreise. Lass uns ein bisschen abhängen. Lass uns zum Grim fahren.«
Ihre dunklen Augenbrauen heben sich. »Grim Mountain?«
»Ja. Komm schon. Ich fahre.«
»Ist ein Getränk drin?«
»Wenn das dafür nötig ist.«
Drei Minuten später sitze ich in meinem Auto hinter dem Steuer und beobachte, wie Andi aus ihrem Haus kommt. Die schwarze Hose hat sie gegen ausgewaschene Jeans mit einem Riss am Knie getauscht, aber das Tanktop hat sie anbehalten. Ihre Silhouette zeichnet sich groß und schlaksig im Licht der Veranda ab.
Ich beuge mich hinüber, um die Tür zu öffnen, und sie lässt sich auf den Beifahrersitz plumpsen. Ihre Beine stoßen gegen das Sechserpack fruchtiger Longdrink-Mixgetränke mit wenig Alkohol, das ich aus dem Kühlschrank geklaut und im Fußraum verstaut habe. »Was ist das?«, fragt sie, fasst nach unten in die Dunkelheit und beäugt mit zusammengekniffenen Augen die Flasche, die sie hervorholt.
»Die Bestechung für dich.« Obwohl sich Andi unseren Trinkversuchen als Teenager angeschlossen hat, war sie nie ausdauernd genug, um Gefallen an Bier, Wein oder härterem Alkohol zu finden oder eine größere Verträglichkeit zu entwickeln.
»Pineapple Passion Twist«, liest sie vom Etikett ab. »Gute Wahl.«
»Bringt einen unter Garantie zum Kotzen.«
Um diese Zeit liegen die Straßen von Avilla dunkel und still da. Warme Wüstenluft weht durch die offenen Fenster herein, als ich auf den Grim zusteuere, einen großen Tafelberg direkt am Rand unserer Ortschaft. Wegen seiner steilen Hänge ist er bei Kletterern beliebt. Wir sind als Teenager gern hinaufgewandert und haben Kiesel über die Felskante geworfen. Für jeden direkten Treffer gab es Punkte.
Weder während der Fahrt noch während des fünfundvierzigminütigen Marsches nach oben wechseln wir viele Worte. Der Anstieg ist steil, und so durchtrainiert ich sein mag, verhindert das nicht das intensive Brennen in meinen Oberschenkeln. Den Weg beleuchten wir uns mit den Taschenlampen-Apps unserer Smartphones. Eine lange Weile bleiben das Klirren der Flaschen in ihrer tragbaren Kartonverpackung, das Knirschen unserer Schuhsohlen auf dem felsigen Untergrund und unsere schwere Atmung die einzigen Geräusche.
»Wow«, sagt Andi, als wir oben ankommen. Mit den Händen an den Hüften entfernt sie sich von mir. Das Mondlicht funkelt in ihrem Haar. »Das habe ich lange nicht mehr gemacht.«
»Ist steiler, als ich’s in Erinnerung habe.« Ich zupfe mir das verschwitzte T-Shirt von der Brust, nehme mir eine der Flaschen und drehe den Verschluss auf. »Willst du was trinken?«
»Ja.«
Ich reiche ihr die Flasche, nehme mir eine andere, stelle den Karton mit den restlichen auf den Boden und setze mich daneben. Der felsige Untergrund ist noch warm von der Hitze des Tages, aber die leichte Brise kühlt den Schweiß in meinem Genick. Ich trinke einen großen Schluck Pineapple Passion Twist und verziehe angewidert das Gesicht. »Igitt.«
Andi lacht, als sie sich auf der anderen Seite der Flaschen niederlässt. »Köstlich.«
Ich sehe sie an. Im Licht ihres Handy-Displays liest sie das Etikett auf der Flasche. »Interessant?«
Ihr Mundwinkel zuckt. »Wir sind in Avilla. Hier ist alles interessant.«
»Wie war die Arbeit?«
»Okay. Wie war dein letzter Tag zu Hause?«
»Langweilig. Wie immer.«
»Bestimmt freust du dich darauf, abzureisen.«
Ich öffne den Mund, um zu sagen, was von mir erwartet wird. Dass ich mich tatsächlich freue. Dass ich schon ganz aufgeregt bin. Dass ich’s kaum erwarten kann. Und all das stimmt auch. Na ja, zumindest ungefähr zur Hälfte. Ich freue mich darauf, meine Freunde wiederzusehen. Ich mag den Campus. Mir gefällt die Atmosphäre. Nur irgendwie habe ich mir dort einen Ruf aufgebaut und bin mir nicht sicher, ob ich ihm weiterhin gerecht werden kann.
»Was ist?«, fragt mich Andi und beobachtet mich, während sie trinkt.
»Ich hatte Tripper«, sprudelt es aus mir hervor.
Ihre Augenbrauen schießen vor Überraschung über mein Geständnis hoch zur Stirn. Vielleicht auch nur, weil es so unverhofft gekommen ist. Jedenfalls verschluckt sie sich an ihrem Getränk und hustet in die Armbeuge. Sofort fängt meine Haut vor Verlegenheit und Peinlichkeit an zu kribbeln an. Was keinen Sinn ergibt, denn die Diagnose habe ich letzten Oktober bekommen. Die Sache ist längst ausgestanden, und auf der Suche nach der infizierten Partnerin musste ich so einigen Leuten davon erzählen. Und in dem Fall ist es nur … es ist nur Andi.
»Äh …«, sagt sie schließlich und wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Okay …«
»Ich meine, inzwischen geht’s mir längst wieder gut«, füge ich hastig hinzu. »Das war letzten Herbst. Ist wieder alles in Ordnung.«
Sie legt die Stirn in Falten. »Also … gut?«
»Aber du weißt doch noch, dass ich am College das Leben, na ja, richtig auskosten wollte, oder?«
»Ja.«
»Und dass du mir geholfen hast, mich darauf vorzubereiten, ja?« Über unsere Sexvergangenheit zu reden, fühlt sich an, als würde ich mich mit den Zehen über den Rand des Abgrunds wagen.
Aber sie erwidert nur: »Ich erinnere mich daran.«
»Tja, ich … hab das Leben ausgekostet, falls du verstehst, was ich meine.«
»Selbst die Flasche hier versteht, was du meinst«, sagt sie und zeigt darauf. »Versuchst du gerade, mir durch die Blume zu sagen, dass du am College Sex mit anderen Mädchen hattest? Das dachte ich mir schon. Ist irgendwie schräg, mir davon zu erzählen.«
»Du hattest Sex mit dem Khaki-Kerl«, höre ich mich sagen und wünsche mir sofort, ich könnte die Worte zurücknehmen. Selbstverständlich kann Andi schlafen, mit wem auch immer sie will, obwohl ich es mir lieber nicht vorstellen mag.
Sie geht nicht auf meinen Kommentar ein. »Kellan«, sagt sie stattdessen und leert die Flasche, als müsste sie sich stärken. »Was zum Teufel ist los?«
Ich trinke ebenfalls aus. »Keine Ahnung«, murmle ich und fahre mir mit der Hand übers Gesicht. Meine Handfläche ist feucht vom Kondenswasser der Flasche. »Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle.«
»Ich auch nicht.«
»Es ist nur … Als ich nach Burnham gegangen bin, wollte ich alles verändern. Mein ganzes Leben. Ich wollte, dass es besser wird.« Ich tue so, als würde ich nicht bemerken, wie sie leicht zusammenzuckt, vermutlich wegen der Andeutung zwischen den Zeilen, dass es davor irgendwie nicht gut gewesen ist.
»M-hm.«
»Und mein erstes Jahr war verdammt noch mal spitze. Also echt mega.«
»Okay …«
»Und letztes Jahr wollte ich es genauso halten wie im ersten Jahr. Dann hab ich diese Diagnose bekommen, und es war, als wäre ich abrupt auf die Bremse gestiegen.«
In Burnham gibt es die beinah schon sagenumwobene und sehr geschmacklose Tradition, an der Toilettenwand im Gebäude des Studentenwerks über die Sexgeschichten der Athleten der Schule Buch zu führen. Wenn man bekannt genug ist, dass sich andere dafür interessieren, was für ein Liebesleben man führt, dann befindet man sich wahrscheinlich an jener Wand. Und auf mich trifft das zu. Tatsächlich war ich sogar eine Weile lang überaus stolz darauf. Bis ich jene umfangreiche Liste heranziehen musste, um herauszufinden, von wem ich mir die Krankheit geholt haben könnte. Da machte mich das plötzlich nicht mehr so stolz.
Ich murmle Andi etwas in der Art zu, und sie kratzt sich verwirrt am Kopf. »Und bis du herausgefunden hast, von wem du’s hattest, hast du festgestellt, dass du’s schon an jemand anderen weitergegeben hattest?«
»Was? Nein. Niemand sonst hatte es, nur diese eine Frau.«
»Und dann … ist sie gestorben?«
»Was? Nein!«
»Dann verstehe ich das Problem nicht, Kellan. Ich meine, klar, es war bestimmt peinlich und unangenehm. Und offensichtlich werde ich es dir dein Leben lang vorhalten. Aber es klingt, als hättest du ein paar Anrufe getätigt und verantwortungsbewusst gehandelt.«
Und da dämmert es mir. Jeder in Burnham weiß, dass auf der Liste dreiundsechzig Namen gestanden haben. Dreiundsechzig junge Frauen, mit denen ich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums etwas hatte. An einige davon konnte ich mich erinnern, an viele andere nicht.
»Was ist los?«, hakt Andi nach und mustert mich eindringlich.
»Es waren nicht nur ein paar«, murmle ich.
Andi nimmt sich eine weitere Flasche und hält sie mir hin, damit ich den Verschluss für sie öffne. Sie braucht immer einen Flaschenöffner, sogar für die Schraubverschlüsse. »Das fühlt sich allmählich wie das schleppendste Geständnis der Welt an. Wie viele waren es denn? Offensichtlich willst du es ja beichten. Acht? Neun?« Sie verzieht das Gesicht. »Zweistellig?« Sie lässt den Mund übertrieben aufklappen. »Dreistellig?«
Da muss ich lächeln. »Nein, doch nicht dreistellig, du Vollpfosten.«
Als sie zurücklächelt, löst sich etwas in mir. Ich war im Begriff, eine Dummheit zu begehen und Andi etwas zu sagen, das sie nicht zu wissen braucht. Etwas, das ihr, das mir, das uns nur wehtun würde. Es ist zu lange her, dass wir uns so unterhalten haben. Und ich habe zu lange so getan, als wäre mir egal, dass sie damals nicht mal aus dem Fenster geschaut hat, als ich mein Auto beladen und zum Abschied meinen Eltern und Nachbarn zugewinkt habe. Aber nicht ihr. Nicht dem einen Menschen, den ich hätte sehen müssen.
Die dumme Zahl, um die wir gerade herumreden, bedeutet nichts, könnte aber alles verändern.
»Ich würde nichts ändern wollen«, höre ich mich sagen. Etwas in ihrem Gesichtsausdruck verändert sich, etwas, das ich nicht richtig interpretieren kann. »Ich meine, was das College betrifft«, präzisiere ich rasch.
»Natürlich.«
Ich räuspere mich, greife nach einer weiteren Flasche, und wir stoßen klirrend miteinander an. »Darauf, dass alles so bleibt, wie es ist«, sage ich.
Eine lange Weile starrt Andi die Stelle der Flaschenhälse an, an der sie sich berühren. Sie nimmt die Unterlippe zwischen die Zähne, und etwas tief in mir zieht sich auf eine Weise zusammen, wie ich es viel zu lange nicht mehr gespürt habe.
Aber es wird vergehen. Ich breche morgen auf, und ich habe ja gerade verkündet, dass ich nichts verändern will. Ich kann nicht wieder anfangen, über unseren letzten gemeinsamen Sommer nachzudenken. Abgesehen davon bin ich mir zu neunundneunzig Prozent sicher, dass sie mich ohnehin zurückweisen würde, wenn ich sie fragen würde, ob wir noch ein letztes Mal »üben« könnten. Obwohl mein bestes Stück auf einmal voll dafür ist, es zu versuchen.
»Darauf, dass alles bleibt, wie es ist«, wiederholt Andi meinen Trinkspruch, hebt den Kopf und sieht mich an. Ihre Haut schimmert blass im Mondlicht, ihre Augen sind dunkel und unergründlich.
Schweigend trinken wir und beobachten, wie sich der Himmel weiter mit Sternen füllt, während unten im Ort die Lichter nacheinander ausgehen, bis nur noch wenige verbleiben. Als wir alle Longdrinks getrunken haben und es keinen Grund mehr zum Verweilen gibt, treten wir den Marsch hinunter auf etwas wackeligen Beinen an und fahren nach Hause. Nachdem ich vor dem Haus meiner Eltern geparkt habe, steigen wir aus und bleiben am Fuß der Einfahrt stehen. Der Wind hat ein wenig zugenommen und weht einzelne blonde Haarsträhnen um Andis Kopf, so dass es aussieht wie ein schimmernder Heiligenschein.
»Wahrscheinlich bin ich schon bei der Arbeit, wenn du aufwachst«, sagt sie. »Ich fange früh an.«
»Oh. Okay.«
Sie tritt von einem Fuß auf den anderen und zupft abwesend am Saum ihres Oberteils. Dann beugt sie sich steif vor und umarmt mich. Ihr schlanker Körper fühlt sich warm an meinem an. Die Berührung fällt entschieden zu kurz aus. Unsere Mütter haben uns in einem Sommer gezwungen, uns gegenseitig zu umarmen, als wir einen Streit hatten und mit Stöcken aufeinander losgegangen sind. Diese Umarmung fühlt sich stark wie jene damals an, nur ohne Aufpasserinnen. Andi tritt einen Schritt zurück und räuspert sich. »Tja, beim letzten Mal habe ich mich nicht verabschiedet, also diesmal … Leb wohl.«
Jahrelang hat mich eine seltsame Traurigkeit wegen jenes verpassten Abschieds begleitet. Was sich so ähnlich angefühlt hat, als würde man sich etwas auf eine bestimmte Art und Weise ausmalen, doch am Ende läuft es anders ab. Jetzt jedoch weiß ich, dass ich nur diese eigenartige Zugeschnürtheit meiner Kehle und ein peinliches Brennen in der Brust verpasst habe. Ich würde immer noch gern erfahren, warum sie sich beim letzten Mal nicht verabschiedet hat und was ich bei jenem Baseballspiel so falsch gemacht habe, dass sich damals alles verändert hat. Warum ich mit einem halb gebrochenen Herzen zum College abreisen musste – und der wilden Entschlossenheit, es mit Alkohol, Partys und dreiundsechzig namenlosen Gesichtern zu kitten. Aber ich frage nicht. Ich will den wackeligen Frieden nicht gefährden, den wir irgendwie zustande gebracht haben. Ich will Andis Gesicht genau so in Erinnerung behalten, wie es jetzt ist, angespannt und ein bisschen stoisch. Das Mädchen, das sich geweigert hat, auch nur eine Träne zu vergießen, als ich ihr vor gefühlt tausend Jahren als Teil eines Blutschwurs mit einem Steakmesser in den Finger gestochen habe. Das Mädchen, das hinter dem Schuppen im Garten die blutige Fingerspitze an meiner gerieben und gelobt hat: »Freunde für immer, bis einer von uns stirbt.«
Ich ringe mir ein Lächeln ab, als wäre alles bestens. Als wäre das für uns beide ein Abschluss, ein dringend benötigtes Gefühl, für das ich nie einen Namen hatte. Und als ich die Worte ausspreche, die ich letztes Mal nicht sagen konnte, wird mir klar, dass ich es nicht tun will, obwohl ich keine andere Wahl habe. »Leb wohl, Andi.«
2
Als ich zum ersten Mal über die Grenze nach Oregon gefahren bin, habe ich die Fenster runtergelassen und gebrüllt: »Hier bin ich, Mädels!« Diesmal nicke ich dem Hinweisschild an der Bundesstaatengrenze nur zu, ernst und würdevoll wie ein Erwachsener. Kellan 2.0.
Das klärende Gespräch zwischen Andi und mir hat mir eine merkwürdige Gefühlslage zwischen Leichtigkeit und Schwere beschert, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich dachte, ich würde erleichtert darüber sein, die Tür zu dieser Episode meines Lebens zu schließen. Stattdessen ist mir immer noch danach zumute, anzuklopfen und herauszufinden, ob jemand öffnet.
Mein Telefon summt. Ein weiterer Fortschrittsbericht von Crosbie. Nora und er sind gestern nach Burnham zurückgekehrt, und Crosbie ist ins McKinley-Haus auf dem Campus gezogen. Er meint, nach zwei Jahren Dauerparty in einem Verbindungshaus habe er sich noch nie so alt und weise gefühlt. Er hat bereits neun überforderten Studienanfängern sein Ohr geliehen und ihnen weitergeholfen, und er hat einen verirrten, nackten Badmintonspieler aus der Mensa geholt.
Dieses Jahr wohne ich allein – keine Mitbewohner, keine Ablenkungen. Letztes Jahr habe ich abseits des Campus gewohnt, und sowohl meine Zensuren als auch meine Ergebnisse beim Laufen haben sich dermaßen verbessert, dass meine Eltern einverstanden sind, weiterhin die Miete zu übernehmen, solange es so bleibt. Außerdem geht das Buch meines Vaters in Russland in die siebte Auflage, deshalb haben sie ein bisschen zusätzliches Geld zur Verfügung.
Als ich in Burnham eintreffe, fühlt es sich wieder richtig an, dort zu sein. Das College gehört zu den ältesten Schulen des Landes, mit allem, was dazugehört: weitläufige, verwinkelte Ziegelsteingebäude, hoch aufragende Bäume und großflächige grüne Rasen. Gepflegte Reihenhäuser säumen das Gelände, und die vertraute rote Fassade und die grüne Tür meiner Wohneinheit sind ein willkommener Anblick. Trotz meines schmerzenden Rückens und meiner verkrampften Beine lächle ich, als ich aus dem Auto steige. Eigentlich will ich nur mein Gepäck in der Wohnung abladen, die Flipflops gegen Sportschuhe austauschen und ein paar Freudenrunden um den Campus laufen.
Als ich damals zum ersten Mal in Burnham eingetroffen bin, hat es sich wie ein Traum angefühlt. Als hätte man dort alles perfekt angeordnet, um mir eine College-Erfahrung zu bieten, wie man sie aus Filmen kennt. Es lag allein an mir, die Vergangenheit zu vergessen und in die Zukunft zu blicken. Also habe ich genau das getan. Ich habe mich ausgetobt, habe gefeiert, habe Freundschaften geschlossen, Mädchen kennengelernt, habe alles in vollen Zügen genossen. Vielleicht zu sehr. Wenn man plötzlich auf die Konsequenzen seiner Handlungen aufmerksam gemacht wird, kommen einem dumme Entscheidungen umso dümmer vor. Daher bin ich nach Jahren unbekümmerter Dummheit bereit, ein klein wenig klüger zu werden.
Der Besitzer meines Hauses hat die Wohnung während der Ferien an einen Sommerstudenten vermietet, der nur ein Zimmer gebraucht hat. Gegen eine Gebühr hat er ein Schloss an meiner Schlafzimmertür angebracht und mich mein Zeug dort einlagern lassen. Nun hole ich die Schlüssel aus dem Briefkasten, öffne die Tür und trete ein. Die Wohnung ist warm und stickig und mein.
Trautes Heim, Glück allein.
Bis sich ein starker Unterarm um meinen Hals legt und eine Stimme raunt: »Rück deine Kohle raus, Arschloch.«
Ich ramme den Ellbogen nach hinten, weiß jedoch, dass es nutzlos ist. Crosbie ist gebaut wie ein Panzer, deshalb tut mir anschließend nur mein Arm weh.
Gleich darauf umarmt er mich zur Begrüßung. »Alter!«, ruft er, als er mich loslässt. »Ich bin so verdammt froh, dich zu sehen. Wenn ich mir noch einen Grünschnabel anhören muss, der mit irgendwelchem Zeug versetzte Limo hochkotzt, spring ich aus dem Fenster. Ich komm mir steinalt vor. Mindestens wie dreißig.«
Beim Gedanken daran, so alt zu sein, läuft mir ein Schauder über den Rücken. »Kids«, meine ich abfällig – obwohl wir uns fast jede Nacht genauso aufgeführt haben, bis er Nora kennengelernt hat.
Ich schleppe meine Reisetasche in die winzige Diele und stelle sie ab, dann gehen wir zurück zum Auto, holen den Rest meines Zeugs und tragen es die Treppe hoch, bevor ich einen prüfenden Blick durch meine Wohnung wandern lasse. Sie ist sauber und leer. Sonnenlicht strömt durch das vordere Fenster auf die Parkettböden und die kahlen weißen Wände. Wohnzimmer, Küche, zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Nicht extravagant, aber es fühlt sich nach einem Zuhause an.
»Geht’s dir gut?«, fragt Crosbie. »Freust du dich, zurück zu sein?«
Ich stehe mitten im Raum und umklammere meine Reisetasche, als könnte ich mich nicht entscheiden, ob ich bleiben oder gehen soll. »Klar«, lüge ich. Da ich immer noch die Schlüssel in der Hand habe, halte ich sie hoch. »Ich überlege bloß, welcher fürs Schlafzimmer ist.« An dem Bund befinden sich ein Schlüssel für den Briefkasten und Reserveschlüssel für einen Mitbewohner, also ist die Ausrede nicht ganz so weit hergeholt.
»Gibt nur einen Weg, das rauszufinden.« Er nimmt mir den Schlüsselbund ab und öffnet im dritten Anlauf die Tür. Wir zucken zusammen, als uns der durchdringende Mief eines lange nicht gelüfteten Zimmers entgegenweht.
»Pfui Teufel«, brumme ich und wedle mit einer Hand vor dem Gesicht. Soweit ich es beurteilen kann, befinden sich in dem Raum nur Möbel … und vielleicht eine tote Katze.
»Sollen wir damit wie Erwachsene umgehen?«, fragt Crosbie. »Oder tun wir so, als wär nichts, und gehen ein Bier trinken?«
Seufzend denke ich an meinen Entschluss, eine bessere Version meiner selbst zu werden. »Wahrscheinlich sollten wir uns drum kümmern.«
»Ja.«
Ich stelle die Tasche ab. Keiner von uns beiden rührt sich. »Nach einem Bier?«
»Voll okay für mich.« Als wir rausgehen, zieht er sein Smartphone aus der Tasche und tippt darauf herum.
Ich kenne die Antwort zwar bereits, trotzdem frage ich: »Wem schreibst du?«
»Nora. Ich gebe ihr nur Bescheid, dass wir im Marvin’s sein werden, falls sie vorbeikommen will, wenn ihre Schicht zu Ende ist.«
Marvin’s ist eine Kneipe an der Hauptstraße der kleinen Innenstadt von Burnham, ungefähr zwanzig Minuten zu Fuß vom Campus. Nora arbeitet in einem Café in der Nähe, und letztes Jahr hat sich Crosbie unzählige Ausreden dafür einfallen lassen, dort »vorbeizuschauen«. Die Anzeichen für eine Verliebtheit waren alle vorhanden, ich war damals bloß zu sehr mit meinem eigenen Leben beschäftigt, um sie zu bemerken.
»Wann macht sie Feierabend?«
»Um sechs.«
Ich schaue auf die Armbanduhr. Es ist fast vier, also haben wir rund zwei Stunden, bevor ich mir wieder das Liebesgeturtel der beiden ansehen muss. Ich freue mich ja für sie, aber ein Sommer auf engstem Raum mit ihnen war wirklich mehr als genug.
Wir überqueren eine der Rasenflächen des Campus und kommen an einer Gruppe hübscher Studentinnen vorbei, die auf Badetüchern im Gras liegen und das warme Wetter nutzen. Ich verdränge das Bild von Andi in ihrem roten Badeanzug und winke den Mädchen zu, die prompt zurückwinken.
»Hi, Kellan!«, ruft eines von ihnen.
»Hi!« Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber sie trägt einen hellblauen Bikini und sieht heiß aus.
»Hi, Crosbie«, ruft eine andere.
Ich würde gern stehen bleiben und plaudern, aber Crosbie wird nicht mal langsamer, sondern marschiert einfach weiter wie ein Ausbilder beim Militär. »Wir können nicht mal mit ihnen reden?«
»Du bist grade mal eine halbe Stunde hier«, gibt er zurück. »Du kannst schon noch eine Stunde durchhalten, ohne jemanden aufzureißen.«
»Aber die sind so hübsch.«
Er lacht. »Schätze, ich hab mir umsonst Sorgen um dich gemacht.«
»Wovon redest du?«
»Von Washington, wo du niemanden abgeschleppt hast.«
»He, ich muss ja nicht jede abschleppen.«
Er wirft mir einen skeptischen Blick zu, und ich ergänze meine Äußerung. »Nicht mehr«, stelle ich klar. »Du hast Kellan 2.0 vor dir. Kein Verzicht auf Spaß, aber nie mehr Tripper.«
»An dem Untertitel solltest du vielleicht noch arbeiten, aber wenn du auf Spaß aus bist: Im McKinley-Haus steigt heut Abend eine Party. Kellan 2.0 kann ja vorbeikommen und mir helfen, junge Geister dazu zu inspirieren, verantwortungsbewusst zu trinken.«
»Trinkst du denn verantwortungsbewusst?«
Er späht über die Schulter. »Wieso? Ist Nora in der Nähe? Natürlich tu ich das.«
»Du stehst voll unterm Pantoffel, Cros.«
Ist ihm offensichtlich völlig schnuppe. »Es gibt Schlimmeres, als auf eine Frau zu stehen, die umgekehrt auf einen steht.«
Ich lache über ihn, aber aus irgendeinem Grund denke ich an Andi.
* * *
Am nächsten Morgen weckt mich die Sonne.
Obwohl ich in Burnham bin und gestern Nacht aus war, bin ich stocknüchtern und sehr allein. Kellan 2.0 braucht vielleicht noch etwas Nachjustierung.
Im Wohnzimmer finde ich Crosbie ausgestreckt auf der Couch, ein Fuß auf dem Boden, beide Arme über dem Kopf. Nach der Kneipe haben wir die McKinley-Party sausen lassen, sind hierher zurückgekommen, haben meine Wohnung eingerichtet und Videospiele gezockt. Nicht der Freitagabend, den ich im Sinn hatte, aber es kommen ja noch genügend andere.
Ich gehe um die Arbeitsfläche in der Küche herum und stecke zwei Scheiben Brot in den Toaster. Ich habe den Sommer über einen Karton mit lang haltbaren Lebensmitteln in meinem Zimmer gelassen und bin nur mit dem Notwendigsten eingetroffen. Nun öffne ich ein Glas Erdnussbutter und schäle eine Banane, während ich warte.
Als der Toast herausspringt, schnaubt Crosbie und dreht sich auf der Couch herum, wacht aber nicht vollständig auf. »Raus aus den Federn!«, rufe ich, beschmiere die beiden Toasts mit einer großen Portion Erdnussbutter und verteile die in Scheiben geschnittene Banane darüber.
»Verpiss dich«, brummelt Crosbie. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich mit mir redet oder noch träumt.
»Komm schon«, sage ich und werfe die Bananenschale in seine Richtung. Platschend landet sie auf seinem Bauch.
Er tastet herum, bis er auf die Schale stößt. »Du nervst«, murrt er und reibt sich die Augen. Ich bin nicht gekränkt. Im ersten Jahr waren wir Zimmergenossen, und er war schon immer ein Morgenmuffel. »Wie spät ist es? Die Sonne ist ja noch nicht mal aufgegangen.«
»Tut sie gerade. Und weißt du, was das heißt?« Ich wedle mit einer Scheibe Toast vor meinem Gesicht herum. »Zeit fürs Frühstück!«
»Ich würd lieber schlafen.«
»Ich wette, Nora macht dir kein Frühstück.«
»Nora weiß, wie wichtig es ist, auszuschlafen.« Obwohl er nörgelt, kommt er herüber, holt sich seinen Toast und schenkt sich ein Glas Wasser ein, das Einzige, was ich als Getränk im Angebot habe.
Ich bücke mich, ergreife einen Fuß und hebe ihn an, um den Oberschenkelmuskel zu dehnen. »Lass uns laufen gehen. Ich brauch Bewegung.«
»Gehen wir doch in zwei Stunden laufen.«
»Was sagt der Coach immer? ›Tu’s einfach!‹«
»Das ist ein Werbespruch von Nike. Der Coach sagt immer: ›McVey, hör auf zu flirten und lauf.‹«
»Na ja, nah dran.«
Dreißig Minuten später haben wir gegessen, uns die Zähne geputzt und uns gedehnt. Ich leihe Crosbie ein Paar Shorts, und wir brechen auf.
Am Montag ist Labor Day, was bedeutet, dass dieses Wochenende die meisten Studenten einziehen werden. Offiziell haben die Wohnheime schon vor fünf Tagen ihre Pforten geöffnet, damit sich die Neuankömmlinge einfinden und besinnungslos saufen können, trotzdem geht es auf dem Campus noch ziemlich ruhig zu. Allerdings ist es auch deshalb ruhig, weil wir sechs Uhr dreißig an einem Samstagmorgen haben, was jedoch nur Crosbie stört.
Schweigend laufen wir und genießen die kühle Morgenluft. Der klare Himmel und die grelle Sonne versprechen einen weiteren heißen Tag. Burnhams Laufwege winden sich durch den umliegenden alten Wald. Wir kommen an dessen Ostseite vorbei, passieren mehrere Wohnheime, darunter das McKinley, einen hoch aufragenden Betonblock, der mehr wie ein Knast als wie ein Studentenwohnheim anmutet.
»Welches Zimmer ist deines?«, frage ich.
Er zeigt mit dem Finger auf die uns am nächsten gelegene Seite. »Das da. Das mit dem offenen Fenster.«
Die Fenster stehen überall offen, aber ich nicke, als würde ich es sehen. »Cool.«
»Die unteren zehn Stockwerke sind gemischt, die oberen sechs abwechselnd von Mädchen und Jungs belegt. Unnötig zu erwähnen, dass ich im sechzehnten Stock bin.«
»Anordnung von Nora?«
»Unmissverständlich.«
»Warum seid ihr zwei nicht zusammengezogen?«
Er läuft im Kreis um mich herum. »Zu früh.«
»Den Sommer über hatte ich den Eindruck, dass es euch gefallen hat, euch eine Wohnung zu teilen.«
»Weil Nora eine sehr umgängliche Frau ist.«
»Aber?«
»Gibt kein Aber. Ich weiß, du denkst, in einer Beziehung müsste man seine Hoffnungen und Träume aufgeben, aber das bildest du dir bloß ein.«
»Das hat nichts mit Hoffnungen und Träumen zu tun«, lüge ich. »Was, wenn du was verpasst? Was, wenn die beste Erfahrung deines Lebens irgendwo da draußen wartet und du bei Nora festsitzt?«
Er zeigt sich nicht gekränkt über die Andeutung, Nora könnte eine lebenslängliche Strafe sein. »Ich habe Erfahrungen gemacht. Ich habe einiges durchprobiert. Dann habe ich gefunden, wonach ich gesucht hab. Besser spät als nie.«
»Besser spät als zu früh«, korrigiere ich ihn.
Er grinst. »Wirst schon sehen. Eines Tages lernst du eine Frau kennen, die dir Feuer unterm Hintern macht und dich dazu bringt, das auch noch zu mögen. Und dann werde ich zur Stelle sein, um zu sagen: Ich hab’s dir ja gesagt.«
»Pah.« Ich schnaube spöttisch. »Niemals.«
* * *
Im Posteingang meines Burnham-Kontos warten neunundvierzig ungelesene E-Mails, als ich es später am Nachmittag aufrufe. Für die meisten Angelegenheiten benutze ich ein persönliches Konto. Mein College-Konto meide ich aus einem einzigen, schrecklichen Grund, so gut es geht: Bertrand.
Bertrand ist ein aufgepumpter ehemaliger Ringer, der Studienberater geworden ist – und mein schlimmster Albtraum. Wir liegen schon im Clinch miteinander, seit ich in Burnham aufgenommen wurde und man ihn dazu eingeteilt hat, mir beim Auswählen der Kurse zu helfen, die zu einer Entscheidung für mein Hauptfach führen sollten. Obwohl ich jedem erzähle, mein Hauptfach wäre Soziologie, habe ich mich bislang nicht festgelegt und absolviere Kurse des allgemeinen Lehrplans. Bei unserem ersten Treffen hat mir Bertrand erklärt, sich nicht zu entscheiden wäre eine Zeitverschwendung und unnötig teuer. Ich habe ihm damals für seinen Rat gedankt und weiche ihm seither aus.
Alle neunundvierzig Nachrichten sind von Bertrand. Die ältesten datieren ungefähr drei Wochen zurück. Dreißig lösche ich, ohne sie auch nur zu lesen, den Rest überfliege ich, angefangen bei der ältesten E-Mail. Die Quintessenz ist immer dieselbe.
2. August:Hoffe, du hattest einen tollen Sommer. Lass uns über deine Kursauswahl reden.
8. August: Hab gesehen, dass du deine Kurse ausgewählt hast – bitte ruf an, damit wir darüber reden können.
11. August: Du kannst dich nicht in Deutsch 201 eintragen, wenn du Deutsch 101 nicht bestanden hast.
12. August: Kellan – hast du Deutsch 101 überhaupt besucht? Ruf mich an.
15. August:Kellan, hab mir die Freiheit genommen, Deutsch 201 aus deinem Stundenplan zu streichen. Ruf mich an, dann suchen wir einen geeigneten Ersatz.
20. August: Kellan, wenn du mich nicht anrufst, such ich einen Kurs für dich aus.
23. August: Kellan, letzte Warnung.
Dann eine Mitteilung vom College selbst.
28. August: Hiermit wird bestätigt, dass Sie für den folgenden Kurs eingeschrieben sind: Einführung Hotelmanagement.
Mit zusammengekniffenen Augen betrachte ich den Bildschirm. Was um alles in der Welt soll das?
Ich melde mich auf der Burnham-Website an und navigiere zu meinem Stundenplan. Und tatsächlich, da steht es. Aber nicht lang. Ich klicke auf das Auswahlfeld neben dem Kurs und wähle »Stornieren«.
Es tut uns leid, erhalte ich eine Meldung in roter Schrift in einem Dialogfeld. Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Studienberater.
Nach einem gemurmelten Fluch scrolle ich zum unteren Rand der Seite und klicke auf die Kontaktschaltfläche für das Studiendekanat. Ich habe zwei Jahre Übung darin, Bertrand zu umschiffen – ich weiß, was ich tue. In einer kurzen Mitteilung entschuldige ich mich für den Irrtum mit Deutsch 201 und ersuche darum, für Deutsch 101 eingetragen zu werden. Problem gelöst.
Als ich später am Abend im Marvin’s eintreffe, habe ich Bertrand schon wieder völlig vergessen. Das Lokal ist gerammelt voll mit Erstsemestern in peinlichen Outfits, mit bemalten Gesichtern und lächerlichen Frisuren. Jedes Programm hat seine eigenen Ersti-Betreuer. Sie sind dafür zuständig, die Frischlinge in den ersten zwei Wochen des Studienjahrs an die Hand zu nehmen. Sie helfen den Studenten, die Schule kennenzulernen, das Städtchen und die schnellsten Möglichkeiten, sich zu betrinken. Die Erstsemester sind zu jung, um in der Kneipe zu trinken, also sind sie mit Vorräten eingetroffen, und im Augenblick tanzen ungefähr vierzig Kids mit Clownsperücken und in Tutus den Macarena vor einem halb enthusiastischen Publikum.
»Noch mal!«, tönt es durch den Raum, als der Song endet.
Mürrische Klagen gehen prompt in den Eröffnungsnoten des Songs unter. Durchlauf Nummer fünfzehn, wenn ich richtig mitgezählt habe.
»Tod durch Macarena«, merkt Nora an, die das Geschehen mit einem verträumten Lächeln beobachtet. »Ist also doch möglich.« Als ich sie letztes Jahr kennengelernt habe, hat sie Strickwesten und flache Schuhe getragen und sich redlich bemüht, die fleißige junge Studentin im zweiten Studienjahr zu mimen. Sie ist klein, besitzt dichtes, lockiges Haar, und obwohl sie die Strickwesten aussortiert hat, sind ihre Zensuren unverändert gut geblieben. Sie strahlt auch das dementsprechende Selbstvertrauen aus.
»Warum helft ihr eigentlich nicht bei der Folter des Aufnahmerituals mit?«, fragt Marcela.
»Das ist keine Folter, es ist ein Test«, wird sie von Crosbie korrigiert.
»Ach ja? Was wird denn getestet?«
»Der … Mumm«, sagt er schließlich.
Wir lachen. Das Ritual testet vielleicht die Schmerztoleranz, die Demütigungsgrenze und die Alkoholverträglichkeit, aber damit hat es sich auch schon.
»Warum hast dich nicht bei einer Studentinnenverbindung beworben?«, frage ich Marcela.
Sie und Nora sehen sich an und brechen in schallendes Gelächter aus. »Welcher Teil hiervon gehört in eine Studentinnenverbindung?«, kontert sie und deutet von Kopf bis Fuß auf sich. Marcela Lopes ist Noras Mitbewohnerin und meine ehemalige Fake-Freundin. Sie bevorzugt gebleichtes Haar und roten Lippenstift. Heute Abend trägt sie dazu ein violettes rückenfreies Kleid mit Nackenträger und flauschige schwarze Stiefeletten. Dass sie flauschig sind, weiß ich, weil sie immer wieder gegen mein Bein stoßen und mich kitzeln, wenn sie sich bewegt.
»Verbindungsmädchen sind heiß.«
»Du hältst alle Mädchen für heiß.«
Bevor ich sie aufklären kann, dass Kellan 2.0 anspruchsvoller als Kellan 1.0 sein wird, endet der Song, und eine betrunkene Studentin ergreift das Mikrofon auf der Karaoke-Bühne. Ich kenne sie von einigen Verbindungspartys – sie ist Kapitänin des Volleyballteams, und ihre schlanke Gestalt erinnert mich an Andi. Ich schüttle den nostalgischen Anflug ab. Kellan 2.0 lebt in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Crosbie wollte heute Abend mein Wingman sein. Aber bisher habe ich alle verfügbaren Frauen abgelehnt, auf die er mich hingewiesen hat. Ich hänge nur am Tisch ab, mit meinem besten Freund und zwei Frauen, die tabu sind. Möglichkeiten habe ich reichlich gesehen, aber keine, die mich vom Hocker … Heilige Scheiße! Ich setze mich aufrechter hin.
»… Ententanz«, sagt die Volleyball-Kapitänin gerade. »Und als Hilfestellung geben wir ihnen jede Menge Federn!«
Das Publikum gerät aus dem Häuschen, als sich ungefähr ein Dutzend junger Frauen auf die winzige Bühne drängt. Jede trägt etwas, das nach einem mit einer gefühlten Million Federn bedeckten Bodysuit aussieht. Die Palette der ergänzenden Accessoires reicht von Federboas über Cowboyhüte und glitzernde Stripperinnenschuhe bis hin zu Karnevalsperlen. Drei der Mädchen wirken begeistert darüber, hier zu sein, die anderen gedemütigt. Daran erinnere ich mich noch vom vergangenen Jahr: Das Volleyballteam lässt die neuen Rekrutinnen überall auf dem Campus auf Befehl den Ententanz aufführen. Sobald die vertraute, fröhliche Melodie ertönt, flattern sie gehorsam – wenn auch kläglich – mit den angewinkelten Armen, wackeln mit dem Hintern und bemühen sich bestmöglich, unsichtbar zu werden.
Aber kein Bemühen kann etwas an der Tatsache ändern, dass sich inmitten der Gruppe gefiederter Studentinnen eine große, straffe Gestalt mit einem vertrauten blonden Dutt und dunklen Brauen befindet. Ihre ernsten Mundwinkel krümmen sich gerade vor Konzentration nach unten, als sie versucht, mit dem zunehmend schnelleren Takt mitzuhalten und gleichzeitig auf glitzernden roten High Heels zu balancieren.
Ich kneife die Augen zusammen, beuge mich auf dem Sitz vor und kann nicht glauben, dass ich sehe, was ich mir einbilde zu sehen.
»Echt jetzt, Alter«, flüstert Crosbie. »Hühner? Als ich gesagt hab, ich würde für dich den Wingman geben, hätt ich nicht gedacht, dass du es so wörtlich nimmst.«